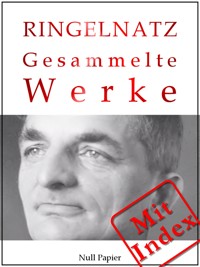Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Enthält folgende Novellen: Die wilde Miß vom Ohio Das Gute Zwieback hat sich amüsiert Auf der Straße ohne Häuser Vergebens Sie steht doch still Gepolsterte Kutscher und Rettiche Durch das Schlüsselloch eines Lebens Der tätowierte Apion Das - mit dem "blinden Passagier" Das Grau und das Rot Phantasie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Jeder lebt's
Joachim Ringelnatz
Inhalt:
Joachim Ringelnatz – Biografie & Bibliografie
Ein Jeder lebt's
Die wilde Miß vom Ohio
Das Gute
Zwieback hat sich amüsiert
Auf der Straße ohne Häuser
Vergebens
Sie steht doch still
Gepolsterte Kutscher und Rettiche
Durch das Schlüsselloch eines Lebens
Der tätowierte Apion
Das – mit dem »blinden Passagier«
Das Grau und das Rot
Phantasie
Ein Jeder lebt's, Joachim Ringelnatz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849619190
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Joachim Ringelnatz – Biografie & Bibliografie
Deutscher Humorist und Schriftsteller, geb. am 7. August 1883 in Wurzen, verstorben am 17. November 1934 in Berlin. Sohn eines Zeichners und Schriftstellers. Nach vielen Problemen in der Schule und einem Verweis vom Königlichen Staatsgymnasium in Leipzig bricht er 1901 die Schule ganz ab und beginnt als Schiffsjunge zur See zu fahren. Dazwischen hält er sich mit immer anderen Gelegenheitsarbeiten über Wasser und beendet sogar eine kaufmännische Lehre. 1906 zieht es ihn nach München, wo er in die Künstlerszene eintaucht und beginnt, seine schriftstellerischen Arbeiten zu veröffentlichen. Als der Erste Weltkrieg ausbricht zieht es R. wieder auf See und er heuert bei der Kriegsmarine an. Nach dem Krieg arbeitet er als Archivar in Berlin und sein großer kommerzieller Erfolg bricht an. Er absolviert unzählige Auftritte in ganz Deutschland, wird aber 1933 von den Nationalsozialisten mit einem Auftrittsverbot belegt. Seine finanzielle Situation rutscht schnell ins Bodenlose und bei seinem Tod ist er völlig verarmt. Er stirbt an einer Lungenentzündung.
Wichtige Werke:
1909: Simplicissimus-Künstler-Kneipe und Kathi Kobus1910: Gedichte1910: Kleine Wesen1910: Was Topf und Pfann’ erzählen kann. Ein lustiges Märchen1912: Die Schnupftabaksdose. Stumpfsinn in Versen und Bildern1913: Ein jeder lebt’s. Novellen1917: H.M.S.D.1920: Joachim Ringelnatzens Turngedichte1920: Kuttel Daddeldu oder das schlüpfrige Leid1921: Die gebatikte Schusterpastete1921: Der lehrreiche, erstaunliche und gespassige Zirkus Schnipsel! Entdeckt von Joachim Ringelnatz1921: Mannimmond, eine einaktige Groteske1921: Bühnenstar und Mondhumor. Einaktige Groteske1922: Taschenkrümel1922: Die Woge. Marine-Kriegsgeschichten1922: Weitab von Lappland1922: Janmaate. Topplastige Lieder1922: Fahrensleute1923: Vorstadt-Bordell1923: Kuttel Daddeldu erzählt seinen Kindern das Märchen vom Rotkäppchen und zeichnet ihnen sogar was dazu1924: …liner Roma…1924: Nervosipopel. Elf Angelegenheiten1927: Reisebriefe eines Artisten1927: Doktors engagieren. Operette in drei Akten1928: Allerdings. Gedichte1928: Einige Gedichte von Joachim Ringelnatz1929: Flugzeuggedanken1931: Joachim Ringelnatz. Auslese aus seinen Gedichten und seiner Prosa1932: Gedichte dreier Jahre1932: Die Flasche. Eine Seemannsballade1932: Briefe aus dem Himmel. Kammerspiel in drei Akten1933: 103 Gedichte1934: Gedichte, Gedichte von Einstmals und HeuteEin Jeder lebt's
Die wilde Miß vom Ohio
Ich rede von einem jener gott- und menschenverlassenen Eisenbahnpunkte, wo normale Fremde den Verstand verlieren, wenn sie nicht Schlafvirtuosen sind oder ein dichterisches Verständnis für die Poesie der Öde haben. –
Als ich die Tür zur Wartehalle klinkte, flehte ich irgendeine überirdische Macht an, mich nicht in eine Gesellschaft zu lancieren, die über Bierqualitäten, Zufälle im Lotteriespiele oder innere Politik polemisierte.
Es war jedoch nur ein einziger Gast anwesend, eine stattliche Baron-Offizier-Lebemannerscheinung, die mir gleich durch eine kurze Kopfbewegung zu verstehen gab, daß ich mich zu den unsichtbaren Geistern zählen dürfe. Das war ganz nach meinem Sinn, und ich drückte mich selbst in den entferntesten Winkel, gleichfalls ein deutliches Noli me tangere in meine Züge legend.
Der Herr »Ober« bemühte sich, meine schlechte Stimmung auf den nervösesten Punkt zu schrauben, durch allerhand Schikanen, die ich in vier Humoresken und einer Tragödie zu verwenden gedenke. Dann allmählich schlief er am Zeitungsständer ein. Und nun war es still in der leeren Halle. Nur ein melancholischer Landregen nässelte an den Fensterscheiben.
Der Baronartige starrte regungslos auf eine Flasche Burgunder. Ich hatte das Gefühl, daß ich ohne seine Gegenwart ein stimmungsvolles Gedicht verfassen könnte. Die Hände vor die Augen pressend, um ihn nicht mehr zu sehen, gewahrte ich durch die Fingerspalten, daß er energische und eigentlich mehr zielbewußte als blasierte Gesichtslinien hatte, daß eine breite Narbe an seiner Schläfe nicht übel wirkte und daß er einen pompösen, exotischen Ring trug.
Die Einsamkeit ist die Treppe zum Gedankenkeller. Sie ist selbstverständlich wertlos für denjenigen, der unten nichts auf Lager hat. Wer aber sein Fäßchen oder gar Fässer, Tonnen dort liegen weiß – meistens die, welche oben nur wenig verzapfen – dem fällt es nicht schwer, die Stunden in dieser erfrischend kühlen Tiefe totzuschlagen.
Auch ich wollte mein Fläschchen Spiritus heraufholen, um damit den eingeborenen Zeltinger zu veredeln, den mir das Bahnhofsrestaurant zu Kriegspreisen aufgetischt hatte.
Der Baron war wirklich im Grunde ein recht sympathischer Mann. Er schien ebenfalls trübseliger Laune zu sein und saß noch immer wie ich über sein Glas gebeugt – Zigarrenrauch und Asche studierend.
Da öffnete sich die Türe. Ein älterer, wettergebräunter Dritter im Jagdkostüm blieb auf der Schwelle stehen.
Der Baron bemerkte ihm sofort durch eine kurze Kopfbewegung, daß er sich zu den unsichtbaren Geistern zählen dürfe, und ich legte ein deutliches Noli me tangere in meine Züge. Der Jäger aber bediente sich einer noch überlegeneren Sprache. Er sah sich weder nach dem Baron noch nach mir um, sondern placierte sich mit geometrischer Geschicklichkeit so, daß er uns beiden gleichzeitig den Rücken zudrehte. Die schikanöse Einleitung des Kellners kürzte er dadurch ab, daß er ihn sehr bald mit Kamel anredete.
Ich fühlte mein Dichtermilieu durch einen struppigen Bart, verwegen rollende Augen und eine lokomotivierende Meerschaumpfeife erheblich gestört.
Erst als der wilde Mann mit einem Glas heißer Milch gestillt war und das dienstbare Kamel seine Journal-Ecke wieder eingenommen, trat der status quo ein. Dieses Verhältnis nahm mit der Zeit einen ganz friedlichen Charakter an. Es war, als hätten wir ein stilles Abkommen getroffen, einander rücksichtsvoll zu ignorieren.
Der Ofen begann wie in einer Anwandlung von Mitleid geheimnisvoll zu knistern. In tiefes Sinnen versunken, rührten wir uns nicht. Nur wenn der Kellner seine Beinstellung wechselte, hoben sich für einen Moment drei müde Häupter. Dann war alles tot.
An was denkt man in solcher Situation wohl? – – –
Das wird immer individuell sein. Ich z.B. dachte – – ach nein, das ist ganz gleichgültig.
Jedenfalls wurde die Ruhe plötzlich unterbrochen. Es war die seltsame Melodie eines mir unbekannten Liedes, halblaut durch die Zähne gesummt. Ich warf dem Jäger einen vorwurfsvollen Blick zu und beobachtete dann, wie der Baron sich verhielt.
Er hatte gleich mir den Kopf erhoben und außerdem eine Zeitung ergriffen, aber ich bemerkte, daß er hinter derselben neugierig den Jäger fixierte. Gleich darauf legte er das Blatt beiseite, leerte sein Glas mit einem nervösen Schluck, trommelte mit den Fingern auf das Tischtuch und stimmte leise pfeifend in das Lied, dasselbe Lied ein.
Nun sah auch der wilde Mann auf und schwieg. Der Baron schwieg gleichfalls. Es kam mir vor, als sei ein kleines Vorpostengefecht beendet.
Plötzlich erhob sich der Burgunderherr, trat mit ungezwungen vornehmer Haltung an den Jäger heran und sagte: »Mein Herr, erlauben Sie mir die Frage: Waren Sie je am Ohio?«
»Ja«, erwiderte der andere erstaunt.
»Und Sie kennen die wilde Miß vom Ohio?«
»The wild Miß? – – –« Etwas wie ein wehmütig-glückliches Lächeln fuhr über das harte Jägergesicht. Er hielt dem Frager seine kräftige Rechte hin, und dann gab's einen Handschlag, den ich im Leben nicht wieder vergessen werde. Und nun rückten die beiden zusammen, und der Kellner wurde aus seinem Presseschlummer gejagt, um Sekt und Zigarren zu bringen, und dann begannen die beiden zu fragen und zu erzählen, und dazwischen stießen sie so feurig die Gläser zusammen, daß der Kellner jedesmal zusammenfuhr.
Ich verstand kein Wort weiter von dem, was da besprochen wurde, aber ich glaubte den Inhalt zu erraten, und das Herz ward mir dabei weit, als sei ich berauscht.
Es mußte eine köstliche, interessante Erzählung sein – aus dem Leben dieser Männer, und das Lied, woran sich beide erkannt hatten, sowie die wilde Miß vom Ohio mußten irgendeine romantische Rolle darin spielen. Leidenschaftliche, gefährlichschöne, vielleicht teilweise sehr traurige Erlebnisse.
Ich sah ein einsames Licht aus dem nachtdunklen Ufergebüsch des Ohio blinken. Die wilde Miß stand vor mir, eine herrliche, heißblütige Kreolin mit tief schwarzen, verführerischen Augen, und ich wob einen spannenden und ergreifenden Roman um sie. – –
Die Augen der Erzähler leuchteten begeistert, ihr Sekt schäumte, und der Zigarrenrauch umlagerte sie, wie Nebelwolken, den kühlen, schwarzen Fluten des Ohio entstiegen. Ich aber saß einsam in meiner Ecke und spürte eine so gewaltige Sehnsucht danach, auch Anteil an diesen bewegten Erinnerungen zu haben und hinzugehen, um zu sagen: Meine Herren, auch ich kenne das Lied, den Ohio und die wilde Miß. Darf ich mich zu euch setzen?
Glückliche, beneidenswerte Weltmenschen! –
Noch nie hatte ich ein Alleinsein so bitter empfunden wie in dieser Stunde. Ich faßte den Entschluß, mir auch ohne Belege als Zuhörer einen Platz bei den beiden zu erbitten.
Da pfiff etwas. Ein Zischen – ein Rollen – der Zug lief ein – –
Ich habe weder den Jäger noch den Baron wiedergesehen. Die Geschichte der wilden Miß vom Ohio habe ich nie erfahren, aber wenn ich mich ihres Titels erinnere, habe ich eine häßliche, drückende Empfindung.
Es ist das Gefühl des Unbefriedigtseins. Etwa wie wenn man während einer spannenden Lektüre nach der weggelegten Zigarre greift und plötzlich merkt, daß diese auf unerklärliche Weise abhanden gekommen – –
Nein, es ist ein ganz anderes, viel tieferes, trüberes Gefühl.
Das Gute
Am Bahnhof ließen die Gassenbuben endlich von der Zigeunerin ab. Aber Iwan Georgewitsch warf ihr noch eine Handvoll tauschweren, schmutzigen Schnee nach, der sie an der Hüfte traf und den dünnen, blauen Kattunrock mit widerlichen Flecken durchtränkte.
Der dienstschlafende Polizist, welcher die Szene beobachtet hatte, barg sich tiefer in den Morgenschatten eines Torbogens und beschwichtigte sein russisches Gewissen, indem er behaglich brummte: »Ach, das macht der alten Krähe nichts!«
Diese Bemerkung schien gar nicht unpassend, denn der Rock der Zigeunerin war in der Tat schon übel zugerichtet, und wenn sie ihn übermäßig hoch raffte, so geschah es wohl nur, um schneller ausschreiten zu können, nicht um ihn zu schonen. Außerdem: Wie sie gebeugt, auf dürren Beinen dahinstelzte – langschrittig, um ihren Verfolgern zu entkommen, vorsichtig, damit ihre großen, nur mit dürftigem Schuhwerk bekleideten Füße nicht allzutief in Schnee und Schlamm versänken – so sah sie wirklich einem riesigen Vogel ähnlich, zumal sie den linken, gebogenen Arm, woran ein Hausierkorb hing, im Gehen flügelartig bewegte.
Garstige Flüche und Verwünschungen murmelte sie vor sich hin, gegen die Niedertracht der Menschen, gegen Letten, Russen, gegen alle Livländer und besonders gegen jene Schulbengels, die sie ihrer Meinung nach gern und mitleidslos erwürgt hätte. O, sich rächen zu dürfen!
Sie fühlte und hörte, wie das Wasser in den Schuhen bei jedem Schritt patschte, empfand auf einmal, daß ihre Sohlen eiskalt von Nässe waren, und verwischte dabei mit unsauberen Fingern die Schweißtropfen auf der Stirn. Sie berechnete, daß sie seit vierundzwanzig Stunden keinen Schlaf genossen hatte, dachte an vielerlei Ärgernisse, Enttäuschungen, die ihr in dieser Zeit begegnet waren, auch daran, daß ihr eigener törichter Übermut solches verschuldet hatte. Dann spürte sie, wie sich irgendein Band ihrer Unterkleidung löste, und ihre Hände, die den Rock und ein wollenes, vielfarbiges Kopftuch hielten, krallten sich so krampfhaft zu Fäusten, daß sie zitterten, daß der Korb am Arm mitzitterte. Ja, als sie, die Stufen zur Bahnhofshalle hinanhastend, auf den Saum ihres Unterrocks trat, so daß dieser hörbar zerriß, blieb sie einen Moment mit zusammengepreßten Augen stehen, um zwei Tränen loszuwerden, die sich nicht unterdrücken ließen. O, sich rächen zu dürfen! Übrigens: An wem?
Obwohl noch eine halbe Stunde bis zum Abgang der Strandbahn verblieb, war die Halle schon von Wartenden belebt, vornehmlich Arbeitsleuten, die in hohen, schweren Stiefeln auf den triefenden Steinfliesen hin und her trotteten und deren Schritte an den kahlen Wänden des gewölbten Saales knapp widerhallten.
Auf der einzigen Bank und neben derselben am Boden kauerten Frauen, und am Schanktisch wankte in kläglicher Betrunkenheit ein Soldat, der von Zeit zu Zeit sein Inneres und sein Äußeres mit Wodka begoß. Auch waren unter der Menge einige besser gekleidete Damen und Herren. Sie mochten die Nacht durchzecht, durchtanzt haben, von Bällen oder Maskeraden heimkehren; das war ihnen nach Anzug und Gebaren unschwer anzumerken, und jener Tag gehörte zum Februar, da man im westlichen Rußland dem Fasching ebenso opferte als in Deutschland.
Die meisten dieser Leute befanden sich in Gedanken schon oder noch im Bett und verhielten sich still und ernst. In ihren Blicken, die von der Uhr durch die Halle wieder zurück zur Uhr kreisten, in ihren Bewegungen prägte sich jene selbstsüchtige Strenge aufgezwungener und gewohnter Geduld aus.
Die Hausiererin schob sich in das dichteste Gewühl. Gleichzeitig schlang sie das breite Kopftuch eng zusammen, daß nur wenig von ihrem braunen Gesicht, dem einfach gescheitelten, tiefschwarzen Haar unbedeckt blieb. In gebückter Haltung, den Kopf zur Brust gesenkt, vermeinte sie sich hinter einer Gruppe breitrückiger Gestalten verbergen zu können; aber das gelang nicht. Denn die Nächsten wichen vor ihr zurück; andere umringten und betrachteten sie mit neugieriger Verachtung, wie man ein wildes, abscheuliches Tier beguckt. Sie musterten dreist oder verstohlen ihren Korb, ihre Schuhe, ihre jämmerliche Physiognomie, lachten, spotteten erst verhalten, bald offener. Besonders Frauen vergnügten sich unverhohlen, als ein dicker plattnasiger Lette sich tölpelhaft zum Spaßmacher aufwarf, indem er das Leinentuch von des Weibes Korb wegzog; wobei allerdings ein komisches Durcheinander von Apfelsinen, Schuhbürsten, Kinderspielzeug, Taschenkämmen, Zwirnrollen und anderlei Sachen zum Vorschein kam. Daraufhin steuerte sich der berauschte Soldat hinzu und begann eine längere Ansprache, mit schluckenden, teils russischen, teils lettischen Worten, welche das allgemeine Ergötzen erhöhten, zumal er sie durch gewagt vertrauliche Gesten unterstützte. Das Weib hatte Mühe, sich der Aufdringlichen zu erwehren. Vorübergehende stießen sie achtlos, sogar absichtlich an. Die Uhr ward vergessen; man unterhielt sich nur noch gespannt mit dem Anblick der fremden Gestalt. Was sie wohl anfangen würde?
Die sagte nichts; sie durfte ja nicht; es hätte nur mehr peinliches Aufsehen erregt. Sie ertrug. »Hexe!« »Wahrsagerin!« rief man ihr zu, und junge Leute bestürmten sie, ihnen die Karten auszulegen; auch wollten sie ihr etwas von dem drolligen Kram abkaufen. Die Braune schüttelte nur wortkarg und abwehrend den Kopf. Doch in ihren Augen funkelte unsäglicher Haß. Sie mußte dulden, – weil sie ein Weib und eine Zigeunerin war. Das wußte sie, wie sie auch qualvoll erkannte, daß sie einem rohen, unverständigen Pöbel auf der Bühne der Langeweile ein Schauspiel gab. Man vergalt ihr mit kaum erträglichem Hohn, mit plumpen Schikanen. Bis das Rasseln eines Schlüsselbundes die Peiniger hinweg zum Schalter trieb. Der Plattnasige hielt es davonrennend noch für lustig, in den Korb mit den Apfelsinen zu spucken.
Das Fahrgeld – zwanzig. O Gott, es reichte nicht: es fehlten zwei Kopeken. Fiebernd durchhakten die knochigen Finger den Inhalt des Korbes zur Belustigung vieler Gaffer. Ein Polizist schaute mißtrauisch zu. Sie sah – vielmehr empfand es nur, und eisige Angst griff in die Schläge ihres Herzens.
Er wird mich anhalten, ausforschen, bangte sie und wühlte noch rascher, noch aufgeregter in dem krausen Tand herum. Ich habe das Geld verloren. Ach, daß mich alles treffen muß! – O allmächtiger Vater im Himmel, du kannst das ansehen! Gott, du bist schlecht, du bist – nein, Gott, du bist gut. Sei barmherzig, bitte, bitte! Hilf, daß –
Und sie entdeckte die zwei Kopeken. Keuchend langte sie vor dem Schiebefenster an, forderte zaghaft ein Billett. Der Beamte schimpfte: Ob sie das Maul nicht aufreißen könnte.
Sie hörte nichts. Indem sie zum Perron jagte, rannte sie gegen eine Säule und stieß sich das Handgelenk blutig.
Der Zug war, wie allmorgendlich, auch diesmal im Nu überfüllt. Zumal in den Wagen letzter Klasse herrschte bald ein arges Gedränge, grobes Schelten und Streiten um die Plätze, dazu heiße üble Luft. Diejenigen Fahrgäste, welche sich eine Sitzgelegenheit erhascht, förmlich erkämpft hatten, gaben deutlich zu verstehen, daß sie das Errungene unter jeder Bedingung behaupten würden. Die anderen beruhigten sich erst, als der Zug stampfend, zischend ins Rollen kam, und unter ihnen befand sich auch die Frau mit dem bunten Tuch. An einem eisernen Träger lehnte sie, kaute auf ihren Lippen und schickte bittere Blicke nach allen Seiten. Es versteht sich von selbst, daß sie ununterbrochen von ihrer Umgebung angestarrt wurde, verständnislos, anstandslos, voll Abscheu. Da saß eine Gesellschaft von Nachtschwärmern, welche vor dem Ernst des trüben Morgens ernüchtert und verstummt waren, nun aber allmählich wieder in ausgelassenere Stimmung kamen und ungeniert über die Zigeunerin zu witzeln begannen.
Der entging kein Wort. Daß dieses Witzeln sowie das jeweils folgende Gelächter so geistlos, niedrig waren, das steigerte ihre Wut zum äußersten. Wahrhaftig – so seltsam es klingen mag – der Zigeunerin war eine sehr zarte Empfindlichkeit, ein feines Verständnis eigen. Sie erriet auch verschwiegene Gedanken bei den übrigen Passagieren: Vor dieser diebischen Landstreicherin, die sich selten wäscht und gewiß Ungeziefer an sich trägt, muß man auf der Hut sein. Wie, wo und wovon mag sie leben? Ob sie zaubern kann? Halbschuhe trägt sie im Winter, seidene Strümpfe mit großen Löchern darin! Wenn sie wüßte, wie lächerlich sich ihre zerfetzten Flitter ausnehmen!
Derartige Bemerkungen verletzten die Fremde ebenso, als wären sie ausgesprochen. Einige Muskeln des dunklen Gesichtes gerieten in flackernde Spannung, bemühten sich, Ideen und Gefühle zurückzuzwängen, die wirr und stickig gemengt aus jenem Schädel, jener Brust herausschwollen,
Ein weißhaariger Bahnarbeiter schielte beklommen nach der neben ihm stehenden rätselhaften Frau, zuckte bei jeder Berührung mit ihr erschrocken zusammen und schlug dann jedesmal heimlich ein Kreuz.
Der einzige, der unbefangen und ohne jede Feindseligkeit sie anschaute, war ein blasser, hagerer Mann, ein Maler, welcher Freude an ihrer künstlerischen Erscheinung hatte. Gewiß, sie ist schmutzig, erklärte er für sich, wird nicht mehr jung sein, aber hat sie nicht sinnvolle, geradezu edle Züge? Wie seltenartig, wie hoheitsvoll wirken die blauen Augen auf dem ruhigen braunen Grund unter dem tiefblauen Haar und dieses brennende Scharlachrot auf dem Tuch!
Die Zigeunerin selbst stellte sich vor (und ein halbes Lächeln kam und schwand ihr), daß der hagere Mann ein Künstler wäre, der Gefallen an ihr und den leuchtenden Farben ihrer Kleider fände. Denn sie kannte ihre Vorzüge recht wohl, hatte dieselben oft, noch am jüngst verflossenen Tage, rühmen hören.
Niemand schien indes die Anstregung zu bemerken, mit der sie sich äußerlich beherrschte, niemand zu gewahren, was jetzt in ihr vorging.
Nach und nach legte sich dieser innere Kampf, schlief ein in dem erschöpften Körper, welcher sich kaum noch aufrecht zu halten vermochte. Ein Ausdruck milder Ergebenheit, versöhnlicher Müdigkeit lagerte sich in ihre Linien. An jeder Haltestelle der Eisenbahn hatte sie gehofft, daß jemand aussteigen, einen Sitz hinterlassen würde. Es ereignete sich auch zweimal; doch nahmen ihr andere Fahrgäste, klotzige, eilfertige Männer, die leeren Plätze vorweg.
Ohne Bitterkeit trat sie zurück, wartete, litt, schloß für Sekunden die Lider, reckte sich – im Begriff einzuschlafen – mit mehr Wollen als Können wieder zurecht, verträumte sich an den fernen Schlägen einer Turmuhr.