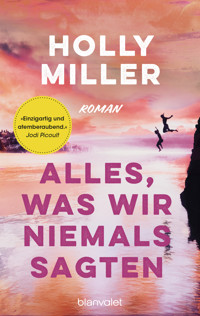10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Würdest du dich für die große Liebe entscheiden, wenn du wüsstest, wie sie endet?
Seit seiner Kindheit lebt Joel als Einzelgänger, der niemanden in sein Herz lässt. Nicht weil er das will – sondern weil er muss. Denn Joel hat Träume. Träume, die ihm die Zukunft der Personen zeigen, die er liebt. Oft weiß er schon Tage, Monate oder sogar Jahre im Voraus, was den Menschen um ihn herum passieren wird. Doch erzählen kann er es niemandem.
Callie träumt schon immer von den schönsten Orten dieser Welt, doch nach dem Tod ihrer besten Freundin lebt die junge Frau zurückgezogen und nimmt an den aufregenden Momenten des Lebens stets nur als stille Beobachterin teil. Das alles soll sich verändern, als sie Joel trifft und sich die beiden unsterblich ineinander verlieben.
Bis Joel von Callies Zukunft träumt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Seit seiner Kindheit lebt Joel als Einzelgänger, der niemanden in sein Herz lässt. Nicht weil er das will – sondern weil er muss. Denn Joel hat Träume. Träume, die ihm die Zukunft der Personen zeigen, die er liebt. Oft weiß er schon Tage, Monate oder sogar Jahre im Voraus, was den Menschen um ihn herum passieren wird. Doch erzählen kann er es niemandem.
Callie träumt schon immer von den schönsten Orten dieser Welt, doch nach dem Tod ihrer besten Freundin lebt die junge Frau zurückgezogen und nimmt an den aufregenden Momenten des Lebens stets nur als stille Beobachterin teil. Das alles soll sich verändern, als sie Joel trifft und sich die beiden unsterblich ineinander verlieben.
Bis Joel von Callies Zukunft träumt …
Autorin
Holly Miller ist im englischen Bedfordshire geboren und aufgewachsen. Nach ihrem Studium arbeitet sie unter anderem als Marketingleiterin, Redakteurin und Werbetexterin, ihre wahre Leidenschaft galt aber schon immer dem Schreiben von Geschichten. Die Autorin lebt mit ihrem Partner und ihrem Hund in Norfolk. »Ein letzter erster Augenblick« ist ihr erster Roman.
Weitere Informationen unter: www.hollymillerauthor.comwww.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Holly Miller
EinletzterersterAugenblick
ROMAN
Deutsch von Astrid Finke
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Sight of You« bei Hodder & Stoughton, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Holly Miller
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Daniela Bühl
Covergestaltung: © FAVORITBUERO, München
Covermotiv: © Shutterstock.com (mamita; KatarinaF; Aristarh)
DN · Herstellung: sam
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-25892-4V002
www.blanvalet.de
PROLOG
1
Callie
Joel, es tut mir so leid. Dich so wiederzusehen … Warum bin ich nur in den Zug eingestiegen? Ich hätte auf den nächsten warten sollen. Es wäre egal gewesen. Meine Haltestelle habe ich sowieso verpasst, und wir kamen zu spät zur Hochzeit.
Weil ich den ganzen Weg nach London nur an dich denken konnte, daran, was auf dem Zettel stehen könnte, den du mir gegeben hast. Als ich ihn dann endlich auseinanderfaltete, starrte ich so lange darauf, dass ich schon an Blackfriars vorbei war, bis ich den Kopf wieder hob.
Es gab auch ein Meer von Dingen, die ich dir sagen wollte, musste. Aber ich hatte einfach einen Aussetzer, als ich dich sah. Vielleicht war es die Angst, zu viel zu sagen.
Aber was, wenn es das heute war, Joel? Was, wenn heute das letzte Mal war, dass ich dein Gesicht sehe, deine Stimme höre?
Die Zeit rast, und ich weiß ja, was kommt.
Ich wünschte, ich wäre geblieben. Nur noch ein paar Minuten. Es tut mir so leid.
TEIL EINS
2
Joel
Es ist ein Uhr nachts, und ich stehe mit bloßem Oberkörper an meinem Wohnzimmerfenster. Der Himmel ist klar und mit Sternen übersät, der Mond eine Murmel.
Jeden Moment wird mein Nachbar Steve die Wohnung über mir verlassen. Mit seinem wütend in der Babyschale zappelnden Töchterchen wird er zu seinem Auto gehen. Er fährt Poppy mitten in der Nacht durch die Gegend, versucht, sie durch das Brummen der Reifen und seine Playlist von Bauernhoftierlauten zu besänftigen.
Da ist er. Die schläfrig schleppenden Schritte auf der Treppe, Poppys Quengeln. Sein typisches Malträtieren unserer Haustür. Ich sehe ihn auf den Wagen zugehen, aufschließen, zögern. Er ist verwirrt, merkt, dass etwas nicht stimmt. Aber sein Gehirn hinkt noch hinterher.
Dann begreift er. Flucht, greift sich an den Kopf. Dreht ungläubig zwei Runden um das Auto.
Sorry, Steve, ja, alle vier Reifen. Eindeutig aufgestochen. Heute Nacht fährst du nirgendwohin.
Ein paar Sekunden lang ist er eine Statue, im Neonlicht der Straßenlaterne. Dann veranlasst ihn etwas, direkt in die Fensterscheibe zu sehen, durch die ich ihn beobachte.
Ich behalte die Nerven. Solange ich mich nicht rühre, muss es für ihn praktisch unmöglich sein, mich zu entdecken. Meine Jalousien sind geschlossen, die Wohnung still und dunkel wie eine Reptilienhöhle. Er kann nicht wissen, dass ich das Auge an eine einzelne Lamelle gedrückt habe. Dass ich alles verfolge.
Einen Moment lang verschmelzen unsere Blicke, dann wendet er sich ab und schüttelt den Kopf, während Poppy der Straße ein gut getimtes Brüllen spendiert.
Im Haus gegenüber geht ein Licht an. Ein heller Kegel trifft auf das dunkle Pflaster, eine genervte Stimme ertönt: »Ach, komm schon!«
Steve hebt die Hand und macht kehrt. Ich höre die beiden auf der Treppe, Poppy energisch heulend. Steve ist an unregelmäßige Zeiten gewöhnt, aber Hayley versucht bestimmt, zu schlafen. Sie hat erst vor Kurzem ihre Stelle in einer renommierten Londoner Kanzlei wieder angetreten, was bedeutet, dass sie sich nicht leisten kann, in Meetings einzunicken.
Trotzdem. Meine Aufgabe für heute ist erledigt. Ich streiche sie aus dem Notizbuch, setze mich aufs Sofa und öffne die Jalousielamellen, damit ich die Sterne betrachten kann.
Ich belohne mich mit einem Glas Whisky, denn das gönne ich mir bei besonderen Gelegenheiten. Dann mache ich einen doppelten daraus und trinke ihn zügig.
Zwanzig Minuten später bin ich bettreif. Ich bin auf eine ganz spezielle Form von Schlaf aus, und was ich heute Nacht getan habe, müsste mir dazu verhelfen.
»Er ist ja so heiß«, sagt meine über achtzigjährige Nachbarin Iris, als ich ein paar Stunden später bei ihr auftauche, um ihren gelben Labrador Rufus abzuholen.
Es ist noch keine acht Uhr, was möglicherweise erklärt, warum ich keinen Schimmer habe, von wem sie spricht. Ihr Nachbar Bill, der fast jeden Morgen mit dem neuesten Klatsch und Tratsch oder einem komischen Flugblättchen bei ihr vorbeischaut? Der Postbote, der uns gerade durchs Fenster fröhlich zugewinkt hat?
Postboten. Immer entweder albern gut gelaunt oder restlos griesgrämig. Nie ein Mittelweg.
»Zurzeit schläft er auf den Küchenfliesen, damit er es kühler hat.«
Ach natürlich. Sie meint den Hund. Das passiert mir häufiger, als mir lieb ist: zu erschöpft für eine simple Unterhaltung mit jemandem zu sein, der mindestens doppelt so alt wie ich ist. »Gute Idee.« Ich lächle. »Vielleicht probiere ich das auch mal aus.«
Sie wirft mir einen strengen Blick zu. »Damit werden Sie die Damen wohl kaum für sich einnehmen, oder?«
Ah genau, die Damen. Wer war das noch mal? Iris ist offenbar überzeugt, dass sie bei mir Schlange stehen, unbedingt ihr Leben auf Pause schalten möchten, um sich mit einem Kerl wie mir abzugeben.
»Wird ihm das auch nicht zu viel?« Sie deutet auf Rufus. »Da draußen in der Hitze?«
Ich war mal Tierarzt. Jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, Iris fühlt sich durch meine Qualifikation beruhigt.
»Heute ist es kühler«, versichere ich ihr. Sie hat Recht damit, dass es in letzter Zeit warm war, es ist ja auch erst September. »Und wir gehen runter zum Bootsteich, eine Runde planschen.«
Sie grinst. »Sie auch?«
Ich schüttle den Kopf. »Ich ziehe es vor, die öffentliche Ordnung erst nach Feierabend zu stören. Das macht es aufregender.«
Sie strahlt, als wären meine lahmen Witze das Highlight ihres Tages. »Wir haben so ein Glück, dass wir Sie haben, stimmt’s, Rufus?«
Man muss dazusagen, dass Iris selbst ziemlich toll ist. Sie trägt Ohrringe in Obstform und hat ein Premium-Abo bei Spotify.
Ich bücke mich, um Rufus anzuleinen, während er sich erhebt. »Er ist immer noch zu schwer, Iris. Das macht es für ihn nicht leichter bei der Hitze. Wie läuft es mit seiner Diät?«
Sie zuckt die Achseln. »Er riecht Käse aus hundert Metern Entfernung, Joel. Was soll ich sagen?«
Ich seufze. Seit fast acht Jahren halte ich Iris jetzt schon Vorträge über Rufus’ Ernährung. »Was hatten wir abgemacht? Ich gehe mit ihm spazieren, Sie kümmern sich um den Rest.«
»Ja, ja, ich weiß, ich weiß.« Sie scheucht uns mit dem Gehstock aus dem Wohnzimmer. »Aber ich kann seinem Blick einfach nicht widerstehen.«
Als ich im Park ankomme, habe ich insgesamt drei Hunde im Schlepptau. (Neben Rufus führe ich noch zwei andere für ehemalige Kunden aus, die nicht mehr so mobil sind. Es gibt noch einen vierten, eine Dogge namens Bruno. Aber der ist sozial inkompatibel und extrem kräftig, deshalb gehe ich mit ihm erst nach Einbruch der Dunkelheit Gassi.)
Obwohl die Luft über Nacht frischer geworden ist, halte ich mein Versprechen mit dem Bootsteich. Ich lasse die Hunde von der Leine, und meine Stimmung hebt sich, als sie wie Pferde ins Wasser galoppieren.
Ich atme durch. Rede mir zum wiederholten Male gut zu, dass ich letzte Nacht das Richtige getan habe.
Es musste sein. Denn die Sache ist die: Fast schon mein gesamtes Leben habe ich prophetische Träume. Klare, lebensechte Visionen, die mich aus dem Schlaf reißen. Sie zeigen mir, was passieren wird, Tage, Wochen, Jahre später. Und die Betroffenen sind immer Menschen, die ich liebe.
Die Träume kommen ungefähr einmal die Woche, das Verhältnis von gut zu schlecht zu neutral ist einigermaßen ausgewogen. Aber die düsteren Vorahnungen sind es, die ich am meisten fürchte: die Unfälle und Krankheiten, Schmerz und Unglück. Sie sind der Grund dafür, dass ich unentwegt nervös bin, immer in höchster Alarmbereitschaft. Dass ich mich ständig frage, wann ich zum nächsten Mal den Lauf des Schicksals umlenken, überstürzt in jemandes wohlbedachte Pläne eingreifen muss.
Oder, schlimmer noch, ein Leben retten.
Vom Ufer des Sees aus beobachte ich meine vierbeinigen Schützlinge, grüße ein Grüppchen Hundebesitzer aus wohlweislich weiter Ferne. Sie treffen sich meistens morgens an der Brücke, winken mich zu sich, falls ich den Fehler begehe, Augenkontakt herzustellen. Ich halte Abstand, seit sie anfingen, Tipps über guten Schlaf auszutauschen, und ihr Gespräch sich Hausmitteln und Therapien, Tabletten und Gewohnheiten zuwandte. (Ich verabschiedete mich höflich und verschwand. Seitdem bleibe ich für mich.)
Das Ganze betraf mich zu stark. Denn in meinem Streben nach einer traumlosen Nacht habe ich alles ausprobiert. Ernährungsumstellung, Meditation, Suggestion. Lavendel und weißes Rauschen. Milchgetränke. Schlaftabletten mit Nebenwirkungen, ätherische Öle. Ein Sportprogramm, das so krass war, dass ich mich zwischendurch übergeben musste. Mit Mitte zwanzig regelmäßig extreme Alkoholphasen in der irrigen Annahme, ich könnte meinen Schlafzyklus verändern. Aber Jahre des Experimentierens bewiesen, dass mein Zyklus unumstößlich ist. Und nichts konnte daran jemals rütteln.
Dennoch, schlichte Mathematik besagt, dass weniger Schlaf gleich weniger Träume ist. Deshalb bleibe ich dieser Tage bis in die frühen Morgenstunden auf, unterstützt vom Fernseher und einem ziemlich heftigen Koffeinkonsum. Danach gestatte ich mir ein kurzes, konzentriertes Ausruhen. Ich habe meinen Kopf darauf trainiert, damit zu rechnen, nach nur wenigen Stunden aus dem Schlaf geschreckt zu werden.
Weshalb ich auch jetzt dringend Kaffee brauche. Also pfeife ich die Hunde aus dem Wasser und laufe über den Pfad am Fluss entlang zurück. Auf der Straße rechts von mir kommt das richtige Leben allmählich in Gang. Berufsverkehr, Fahrradfahrer, Fußgänger auf dem Weg zur Arbeit, Lieferwagen. Ein Orchester, das seine Instrumente für einen ganz gewöhnlichen Wochentag stimmt.
Es ruft in mir eine eigenartige Sehnsucht nach Normalität hervor. Im Augenblick habe ich nicht viele geistige Kapazitäten für Erwerbsarbeit, Freundschaften oder Gesundheit frei. Wegen der Sorgen und des Schlafmangels bin ich ständig kaputt, fahrig, zerstreut.
Damit mich die ganze Sache nicht ins Grab bringt, halte ich mich an einige nicht übermäßig strenge Regeln: täglich körperliche Bewegung, nicht zu viel Alkohol, keine Liebe.
Nur zwei Menschen habe ich in meinem Leben die Wahrheit gestanden. Und beim zweiten schwor ich mir, dass es das letzte Mal war. Weshalb ich auch Steve nicht erzählen kann, dass ich gestern Nacht auf eine schlimme Vorahnung in Bezug auf Poppy reagiert habe: mein Patenkind, das ich so liebe wie meine eigenen Nichten. Ich sah alles vor mir, den erschöpften Steve, der mit Poppy auf dem Rücksitz an der Kreuzung zu bremsen vergisst; seinen Wagen, der mit fünfzig Stundenkilometern gegen einen Laternenmast prallt. Nach dem Unfall musste das Baby aus dem Auto geschnitten werden.
Also ergriff ich die nötigen Maßnahmen. Womit ich mir diesen doppelten Whisky verdient hatte, wenn ich das mal so sagen darf.
Ich leine die Hunde wieder an und gehe nach Hause. Steve muss ich aus dem Weg gehen, zumindest ein Weilchen. Je länger ich den Kopf einziehen kann, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er mich mit dem gestrigen Vorfall in Verbindung bringt.
Sobald ich die Hunde abgegeben habe, werde ich mir ein Café suchen, um mich zu verkriechen, denke ich. Ein Plätzchen, wo ich still in einer Ecke meinen Kaffee trinken kann, anonym und unbeobachtet.
3
Callie
»Du kannst mir nicht erzählen, dass dir das noch nie passiert ist.« Dot und ich wischen nach Ladenschluss die Tische im Café ab und spekulieren über den Gast, der vorhin, ohne zu zahlen, gegangen ist. Das ist mein Lieblingsteil der Arbeit – durchatmen und den Tag Revue passieren lassen, den Raum wieder zum Glänzen bringen. Die Septemberluft draußen ist warm und zart wie Pfirsichhaut.
»Vielleicht war es wirklich keine Absicht«, sage ich.
Dot streicht sich durch die wasserstoffblonden Haare. »Mal ernsthaft. Wie lange arbeitest du schon hier?«
»Achtzehn Monate.« Je öfter ich es sage, desto unglaublicher klingt es.
»Achtzehn Monate, und du hattest noch keinen einzigen Zechpreller.« Dot schüttelt den Kopf. »Offenbar hast du das richtige Gesicht.«
»Er hat es bestimmt nur vergessen. Ich glaube, Murphy hat ihn abgelenkt.«
Murphy ist mein Hund, ein schwarz-brauner Mischling. Na ja, mehr oder weniger meiner. Jedenfalls führt er das Traumleben eines Café-Hunds, denn es mangelt hier nie an Leuten, die ihn streicheln und ihm heimlich Leckerbissen zustecken.
Dot schnaubt. »Das Einzige, was der vergessen hat, ist sein Geld.«
Ich habe ihn noch nie gesehen. Andererseits hatte ich viele unserer heutigen Gäste vorher noch nie gesehen. Normalerweise fängt morgens das Konkurrenz-Café oben am Hügel die meiste Kundschaft in Eversford ab, der Kleinstadt, in der ich mein ganzes Leben verbracht habe. Aber das hatte heute ohne Vorwarnung zu, deshalb strömten die ganzen Bürogänger wortlos bei uns herein, mit ihren Nadelstreifen und ihrem Aftershave und ihren blank polierten Schuhen.
Dieser Gast war allerdings anders. Offen gestanden wäre es mir ein bisschen peinlich, Dot gegenüber zuzugeben, wie stark er mir aufgefallen ist. Er kann nicht auf dem Weg in irgendein Büro gewesen sein, denn seine dunklen Haare waren ungekämmt, und er wirkte unheimlich erschöpft, als hätte er eine harte Nacht hinter sich. Zuerst machte er beim Bestellen einen abwesenden Eindruck, aber als er mir endlich den Blick zuwandte, ließ er ihn unverwandt auf mir liegen.
Wir wechselten nicht mehr als ein paar Worte, aber ich weiß noch, dass er in den Pausen zwischen seinem fieberhaften Schreiben eine stumme Verbindung zu Murphy herstellte.
»Ich könnte mir vorstellen, dass er Schriftsteller ist. Er hatte ein Notizbuch dabei.«
Dot drückt ihren Widerspruch durch die Nase aus. »Schon klar, ein armer Poet. Typisch, sogar Diebstahl musst du romantisieren.«
»Mag ja sein, aber wenn es nach dir ginge, würde bei uns eins dieser Schilder wie an Tankstellen hängen. Wer nicht zahlen kann …«
»Hervorragende Idee.«
»Das war nicht als Vorschlag gemeint.«
»Vielleicht niete ich ihn beim nächsten Mal mit meinem besten Roundhouse-Kick um.«
Ich bezweifle nicht, dass der effektiv wäre. Dot hat vor Kurzem mit dem Kickboxen angefangen und betreibt es mit einer Energie, um die ich sie beneide. Sie macht jeden Hype mit, stürmt wie ein aus dem Käfig gelassenes Geschöpf durchs Leben. Im Gegensatz dazu glaubt sie, ich würde vor der Welt zurückschrecken, mich in die halbdunklen Ecken verkriechen, im hellen Licht blinzeln. Wahrscheinlich hat sie Recht.
»Kein Kung-Fu bei den Gästen«, sage ich. »Café-Vorschrift.«
»Es gibt ja sowieso kein nächstes Mal. Ich hab mir sein Gesicht gemerkt. Wenn ich ihn irgendwo in der Stadt sehe, verlange ich einen Zehner von ihm.«
»Er hatte nur einen Espresso.«
Sie zuckt die Achseln. »Das ist eben unsere Gebühr für Kaffee-Flucht.«
Grinsend gehe ich an ihr vorbei ins Büro, um die Bestellung für die morgige Lieferung auszudrucken. Ich bin erst eine Minute weg, da höre ich Dot rufen: »Wir haben geschlossen! Kommen Sie morgen wieder!«
Als ich den Kopf durch den Türrahmen stecke, erkenne ich die Gestalt vor der Scheibe. Und Murphy offenbar auch, denn er schnüffelt erwartungsfroh an den Scharnieren.
»Das ist er.« In meinem Magen kribbelt es leicht. Groß und schlank, graues T-Shirt, dunkle Jeans. Haut, die auf einen im Freien verbrachten Sommer schließen lässt. »Der Mann, der zu zahlen vergessen hat.«
»Ach.«
»Eins-a-Spürnase, Sherlock.«
Mit einem Grunzen öffnet Dot den Riegel und dreht den Schlüssel herum, zieht die Tür nur einen Spalt auf. Ich höre nicht, was er sagt, nehme aber an, dass er seine Rechnung begleichen möchte, da sie jetzt die Kette aushakt und ihn hereinlässt. Murphy schlittert rückwärts, schwanzwedelnd, mit tanzenden Pfoten.
»Ich hab vorhin gar nicht bezahlt«, sagt er mit entwaffnender Zerknirschtheit. »Aus Versehen. Hier.« Er gibt Dot einen Zwanziger, rubbelt sich durch die Haare, wirft mir einen Seitenblick zu. Seine Augen sind groß, dunkel wie feuchte Erde.
»Ich hole Ihnen Ihr Wechselgeld«, sage ich.
»Nein, das stimmt so. Danke. Entschuldigung.«
»Dann nehmen Sie doch was mit. Noch einen Kaffee, ein Stück Kuchen? Als Dankeschön, weil Sie so ehrlich waren.« Abgesehen von allem anderen scheint irgendetwas an seinem Auftreten um Nettigkeit zu flehen.
Es ist noch ein Rest Drømmekage da, ein saftiger dänischer Rührkuchen mit karamellisierten Kokosflocken, zu Deutsch Traumkuchen. Ich packe ein Stück ein und strecke ihm die Schachtel entgegen.
Er zögert kurz, reibt sich unsicher über die Stoppeln am Kinn. Dann nimmt er die Schachtel, und seine Fingerspitzen stupsen dabei meine an. »Danke.« Mit gesenktem Kopf geht er, und ein warmer Hauch samtiger Luft weht durch die Tür herein.
»Tja«, meint Dot. »Der war ja mal wortkarg.«
»Ich glaube, mit dem Kuchen hab ich ihn aus dem Konzept gebracht.«
»Was sollte das denn überhaupt? Noch einen Kaffee?«, äfft sie mich nach. »Ein Stück Drømmekage?«
Ich kann mir gerade noch verkneifen, rot zu werden. »Wenigstens ist er freiwillig zurückgekommen. Was beweist, dass du schrecklich zynisch bist.«
»Wohl kaum. Bei dem Riesenstück Kuchen hast du trotzdem kaum Gewinn gemacht.«
»Darum geht es nicht.«
Dot zieht eine Microblading-Augenbraue hoch. »Das sieht unser Chef möglicherweise anders. Oder zumindest sein Buchhalter.«
»Nein, Ben würde dir sagen, dass du mehr Vertrauen in die Menschheit haben musst. Du weißt schon, anderen eine Chance geben und so.«
»Also, was hast du heute sonst noch vor?« Mit belustigt funkelnden Augen geht Dot ins Büro, um ihre Jacke zu holen. »Für den guten Zweck draußen schlafen? Spontan eine Suppenküche einrichten?«
»Sehr witzig. Vielleicht gehe ich noch mal bei Ben vorbei, sehen, wie es ihm so geht.«
Darauf entgegnet Dot nichts. Sie findet, dass ich mich zu sehr von den Sorgen um Ben belasten lasse, zu viel meinen Erinnerungen nachhänge.
»Und du?«
Sie taucht wieder auf, die Sonnenbrille in die Haare geschoben. »Wasserski.«
Ich muss lächeln. Klar, was sonst?
»Komm doch mit.«
»Nein, ich bin von Natur aus tollpatschig.«
»Na und? Wasser ist weich.«
»Ach nein, ich geh besser …«
Sie sieht mich durchdringend an. »Du weißt, was ich denke, Cal.«
»Ja.«
»Schon bei Tinder angemeldet?«
»Nein.« Bitte nicht drängeln.
»Ich kann dich auch mit jemandem verkuppeln.«
»Ich weiß.« Dot kann alles. »Viel Spaß heute Abend.«
»Das würde ich dir ja auch wünschen, aber …« Sie zwinkert liebevoll. »Bis morgen.« Und in einer Abschiedswolke Gucci Bloom rauscht sie ab.
Als sie weg ist, schalte ich die Lampen eine nach der anderen aus und setze mich wie immer noch kurz ans Fenster, um den schwachen Duft nach Brot und Kaffeebohnen einzuatmen. Aus Reflex hole ich das Handy aus der Tasche, scrolle zu Grace’ Nummer und wähle.
Nein, das geht so nicht weiter. Schluss jetzt.
Ich lege auf und schalte den Bildschirm wieder aus. Sie anzurufen ist eine Angewohnheit, die ich in letzter Zeit abzulegen versuche, aber ihren Namen auf meinem Handy zu lesen, gibt mir immer Auftrieb wie ein heller Sonnenstrahl an einem schuttgrauen Tag.
Als ich schließlich den Blick durchs Fenster richte, begegnet er unerwartet den aufmerksamen, torfdunklen Augen des Notizbuch-Manns von vorher. Nach dem ersten Schreck verziehe ich den Mund zu einem Lächeln, aber ich bin zu langsam – er sieht auf den Boden und verwandelt sich in einen Schatten, der zügig in das weiche Abendlicht verschwindet.
Die Kuchenschachtel hat er nicht mehr in der Hand. Entweder hat er ihn schon gegessen oder in den erstbesten Mülleimer geworfen.
4
Joel
Mit einem Ruck wache ich um zwei Uhr nachts auf. Ich stehe leise auf und nehme mir mein Notizbuch, um sie nicht zu stören.
Das warme Wetter der letzten Woche ist vorbei und die Wohnung ein bisschen kalt. Ich ziehe mir einen Kapuzenpulli und eine Jogginghose an und gehe in die Küche.
Dort setze ich mich an die Frühstückstheke und schreibe alles auf.
Mein jüngerer Bruder Doug wird jedenfalls begeistert sein. Ich habe geträumt, dass seine Tochter Bella mit zehn Jahren ein Sportstipendium an der örtlichen Privatschule erhält. Als eine der besten Schwimmerinnen im ganzen Landkreis wird sie offenbar jedes Wochenende säckeweise Medaillen gewinnen. Seltsam, wie sich manches entwickelt. Doug bekam als Kind in unserem Schwimmbad Hausverbot, nachdem er eine Arschbombe zu viel gemacht und dem Bademeister den Stinkefinger gezeigt hatte.
Noch ist Bella keine drei. Aber Doug ist der Ansicht, dass man Potenzial nicht früh genug fördern kann. Den vierjährigen Buddy schickt er schon zum Tennis, und bei Britain’s Got Talent holt er sich Tipps für ehrgeizige Eltern.
Wobei mein Traum andererseits bestätigt, dass es sich auszahlen wird. Ich mache mir eine Notiz, ihm gegenüber möglichst bald Schwimmvereine in unserer Gegend zu erwähnen, und unterstreiche sie dreimal.
»Joel?«
Melissa beobachtet mich aus dem Türrahmen, reglos wie eine Spionin.
»Schlecht geträumt?«
Ich schüttle den Kopf, sage ihr, dass der Traum gut war.
Melissa trägt ein T-Shirt von mir und wird es wahrscheinlich auch mit nach Hause nehmen. Sie glaubt, so was wäre süß. Ich hingegen finde es unschön, ein Inventar von meinem eigenen Kleiderschrank erstellen zu müssen.
Jetzt kommt sie zu mir, hüpft auf einen Hocker. Schlägt die nackten Beine übereinander, fährt sich durch die dunkelblonde Mähne. »Kam ich drin vor?« Sie zwinkert auf eine Art, die gleichzeitig neckisch und unverschämt ist.
Offen gestanden wäre das unmöglich, möchte ich sagen, lasse es aber. Sie weiß nicht, was für eine Art Träume ich habe, und so wird es auch bleiben.
Seit mittlerweile fast drei Jahren treffen Melissa und ich uns ungefähr einmal im Monat, normalerweise ohne viel Kontakt dazwischen. Steve hat sich schon öfter, als mir lieb ist, mit ihr unterhalten, als glaubte er, es würde sich lohnen, sie kennenzulernen. Selbst Melissa findet die Vorstellung amüsant und passt ihn im Flur ab, nur um mich zu provozieren.
Ich werfe einen Seitenblick auf die Küchenuhr. Unterdrücke ein Gähnen. »Es ist mitten in der Nacht. Geh doch wieder ins Bett.«
»Nee.« Sie seufzt träge, zupft an einem Fingernagel. »Jetzt bin ich wach. Da kann ich genauso gut mit dir aufbleiben.«
»Wann musst du ins Büro?« Sie arbeitet in der Presseabteilung der Londoner Geschäftsstelle eines afrikanischen Bergbauunternehmens. Ihre Schichten fangen häufig schon um sechs Uhr an.
»Zu früh.« Sie verdreht missmutig die Augen. »Ich melde mich krank.«
Eigentlich hatte ich gleich morgens einen Hundespaziergang mit meinem Freund Kieran geplant und wollte danach in dem Café frühstücken. Ich war jetzt schon mehrmals dort nach dem peinlichen Auftritt letzte Woche, als ich zu zahlen vergaß.
Anfangs, muss ich zugeben, empfand ich eine Art moralische Verpflichtung dazu. Aber inzwischen liegt es mehr an dem Hund und dem großartigen Kaffee. Und dem freundlichen Empfang, obwohl ich bei meinem ersten Besuch nicht gerade ein vorbildlicher Gast war.
»Ehrlich gesagt habe ich schon was vor.« Sofort zieht sich mein Magen vor schlechtem Gewissen zusammen.
Sie legt den Kopf schief. »Charmant, charmant. Weißt du, ich kapiere immer noch nicht, warum du single bist.«
»Du bist doch auch single«, gebe ich zurück, wie jedes Mal.
»Schon. Aber ich bin es freiwillig.«
Das ist eine von Melissas Theorien. Dass ich unbedingt eine Beziehung möchte, kaum erwarten kann, jemandes fester Freund zu sein. Bevor wir uns kennenlernten, war ich fünf Jahre allein, ein Umstand, an dem sie sich ergötzt wie eine Katze an einer Maus. Manchmal schimpft sie mich sogar, ich würde zu sehr klammern, wenn ich ihr nach einem Monat Funkstille eine Nachricht schreibe, ob sie Lust auf Pizzaflitzer hat.
Aber sie irrt sich. Ich war von Anfang an offen mit ihr, habe sie gefragt, ob es für sie okay ist, die Sache mit uns unverbindlich zu halten. Sie lachte und sagte Ja. Meinte sogar, ich sei ganz schön eingebildet.
»Weißt du, eines Tages schlage ich dein Notizbuch auf, während du schläfst, und lese mir genau durch, was du da reinschreibst.«
Ich lache auf und senke den Blick, traue mich nicht, darauf zu antworten.
»Könnte ich es an die Zeitung verkaufen?«
Vielleicht ja: Es steht alles drin. Ein Traum pro Woche seit achtundzwanzig Jahren, und seit ich zweiundzwanzig bin, mache ich mir Aufzeichnungen.
Ich notiere alles, falls ich handeln muss. Aber von Zeit zu Zeit muss ich zusehen, wie ein schlimmer Traum seinen Verlauf nimmt. Wenn sie nicht so ernst sind oder ich keine Möglichkeit zum Eingreifen sehe, unternehme ich nichts. Keins von beidem ist ideal für einen Mann von meinem Gemüt.
Dennoch. Wie Diamanten im Staub glitzern schönere Träume zwischen den schlechten. Beförderungen, Schwangerschaften, kleine Glücksfälle. Und dann gibt es die öden, über das Alltägliche des Lebens. Haarschnitte und Supermärkte, Hausarbeit und Schulaufgaben. Dann sehe ich zum Beispiel, was Doug zum Abendessen hat (Innereien, echt jetzt?). Oder ich erfahre, ob Dad auf Platz eins in der örtlichen Badminton-Liga aufsteigt oder meine Nichte ihren Turnbeutel vergisst.
Die relevanten Daten und Uhrzeiten sind in meinem Kopf präsent, wann immer ich aufwache. Sie sind dort verankert wie mein eigener Geburtstag oder Weihnachten.
Ich achte auf alles, selbst das Harmlose. Halte es in meinem Notizbuch fest. Falls sich irgendwo ein Muster, ein Hinweis versteckt. Etwas, das zu übersehen ich mir nicht erlauben kann.
Jetzt schiele ich nach dem Heft auf der Arbeitsfläche. Bereite mich innerlich darauf vor, dass Melissa es mir wegzunehmen versucht. Sie merkt es sofort und lächelt süßlich, fordert mich auf, mich locker zu machen.
»Möchtest du einen Kaffee?«, frage ich, um das Funkeln in ihren Augen zu dämpfen. Gleichzeitig tut es mir ein wenig leid. Trotz ihres selbstbewussten Auftretens hätte sie sicher nichts dagegen, wenigstens einmal herzukommen und ihre vollen acht Stunden zu bekommen wie ein normaler Mensch.
»Weißt du, bei deinem vielen Geld könntest du dir doch wohl eine anständige Maschine leisten. Niemand trinkt heute noch Instantkaffee.«
Aus dem Nichts schiebt sich ein Bild des Cafés vor mein geistiges Auge. Von Callie, die mir meine Tasse hinstellt, und von dem Blick aufs Kopfsteinpflaster von meinem Platz am Fenster aus. Das beunruhigt mich leicht, und ich verdränge es, löffle Pulver in zwei Becher. »Welches viele Geld?«
»Wie du immer tust, als wärst du arm, toll. Früher warst du Tierarzt, und jetzt arbeitest du nicht.«
Das stimmt nur zum Teil. Ja, ich habe Ersparnisse. Aber nur weil ich rechtzeitig erkannte, dass mein Job auf dem Spiel stand. Und das Geld wird nicht ewig reichen.
»Zucker?«, frage ich, um sie vom Thema abzulenken.
»Ich bin süß genug.«
»Darüber kann man streiten.«
Darauf lässt sie sich nicht ein. »Also, machst du’s?«
»Was?«
»Dir eine richtige Kaffeemaschine kaufen.«
Ich verschränke die Arme und drehe mich zu ihr um. »Für das eine Mal im Monat, wenn du herkommst?«
Wieder zwinkert sie. »Weißt du, wenn du mal anfangen würdest, mich anständig zu behandeln, bestünde vielleicht die Chance, dass sich aus uns was entwickelt.«
Ich erwidere das Zwinkern und klopfe mit dem Löffel an den Becher. »Dann also Instant.«
Meinen ersten prophetischen Traum hatte ich mit gerade mal sieben Jahren, als ich mit meinem Cousin Luke so eng befreundet war, wie man nur sein kann. Unsere Geburtstage lagen nur drei Tage auseinander, und wir verbrachten jede freie Minute zusammen. Computerspiele, Fahrradfahrten, mit den Hunden durch die Gegend ziehen.
Eines Nachts träumte ich, dass Luke, als er die übliche Abkürzung über den Spielplatz zur Schule nahm, aus dem Nichts von einem schwarzen Hund angegriffen wurde. Ich wachte um drei Uhr auf, gerade als der Hund sein Gebiss um Lukes Gesicht klammerte. Wie eine Migräne pochte in meinem Kopf das Datum, an dem es passieren sollte.
Mir blieben nur Stunden, um es aufzuhalten.
Bei einem nicht angerührten Frühstück erzählte ich meiner Mutter alles, flehte sie an, Dads Schwester anzurufen, Lukes Mutter. Sie weigerte sich ganz ruhig, versicherte mir, es sei nur ein böser Traum gewesen. Versprach mir, dass Luke vor der Schule auf mich warten würde, gesund und munter.
Aber Luke wartete nicht gesund und munter vor der Schule. Also rannte ich zu ihm nach Hause, so schnell, dass ich Blut in der Kehle schmeckte. Ein Mann, den ich nicht kannte, öffnete die Tür. Er ist im Krankenhaus, teilte er mir schroff mit. Wurde heute Morgen auf dem Spielplatz von einem Hund gebissen.
Am Abend rief meine Mutter meine Tante an und erfuhr von ihr alle Einzelheiten. Ein schwarzer Hund hatte Luke auf dem Weg zur Schule angefallen. Er brauchte plastische Chirurgie am Gesicht, linkem Arm und Hals. Er hatte Glück, noch am Leben zu sein.
Nachdem sie aufgelegt hatte, setzte meine Mutter sich mit mir im Wohnzimmer aufs Sofa. Dad war noch nicht zu Hause. Ich kann mich noch an den Duft der Hühnersuppe erinnern, die sie mir gekocht hatte. Das seltsam tröstliche Geräusch meiner oben streitenden Geschwister.
»Das war nur ein Zufall, Joel«, sagte Mum immer wieder. (Heute frage ich mich, ob sie sich selbst zu überzeugen versuchte.) »Verstehst du? So was kommt vor.«
Damals arbeitete meine Mutter in Dads Buchhaltungsfirma. Sie verdiente ihr Geld wie er, mit logischem Denken, Überprüfung von Fakten. Und Fakt war, Menschen konnten nicht hellsehen.
»Aber ich wusste, dass es passiert«, schluchzte ich verzweifelt. »Ich hätte es aufhalten können.«
»Ich weiß, dass es für dich so scheint, Joel«, flüsterte sie. »Aber es war nur ein Zufall. Das darfst du nicht vergessen.«
Wir erzählten es niemandem. Dad hätte es als Wahnvorstellung abgetan, und meine Geschwister waren noch zu klein, um zu verstehen oder sich auch nur darum zu kümmern. Das bleibt einfach unter uns, sagte Mum. Und so war es dann.
Selbst heute noch kennt der Rest meiner Familie die Wahrheit nicht. Sie glauben, ich wäre überängstlich und paranoid. Dass meine wirren Warnungen und manischen Einmischungen unbewältigter Trauer um Mum entspringen. Doug findet, ich sollte Pillen dagegen nehmen, weil Doug glaubt, es gäbe für alles Pillen. (Spoiler: Gibt es nicht.)
Ahnt meine Schwester Tamsin, dass mehr dahintersteckt? Möglich. Aber ich bleibe absichtlich vage, und sie fragt nicht nach.
Ich kann nicht behaupten, dass ich noch nie versucht gewesen wäre, ihnen alles zu erzählen. Aber wenn ich den Drang dazu verspüre, muss ich nur an das eine Mal zurückdenken, als ich so naiv war, mich an einen Fachmann zu wenden. Der Hohn in seinem Blick und der spöttisch verzogene Mund reichten, um mir zu schwören, mich nie wieder jemandem anzuvertrauen.
5
Callie
An einem Freitagabend Mitte September bekomme ich einen typisch frustrierenden Anruf von meinem Hausverwalter.
»Leider schlechte Nachrichten, Miss Cooper.«
Ich runzle die Stirn, erinnere Ian daran, dass er mich gern Callie nennen darf – im Laufe der Jahre hatten wir genug miteinander zu tun.
Langsam wiederholt er meinen Vornamen, als schriebe er ihn zum allerersten Mal auf. »Na gut. Also, Mr. Wright hat uns gerade mitgeteilt, dass er seine Immobilie verkauft.«
»Welche Immobilie? Was?«
»Ihre Wohnung. Zweiundneunzig B. Nein, Moment, C.«
»Schon gut, ich kenne meine Adresse. Sie wollen mich wirklich rausschmeißen?«
»Sagen wir lieber, wir kündigen Ihnen das Mietverhältnis. Sie haben einen Monat.«
»Aber warum? Warum verkaufen?«
»Nicht mehr rentabel.«
»Ich bin ein Mensch. Ich bin rentabel. Ich zahle Miete.«
»Regen Sie sich bitte nicht auf.«
»Glauben Sie, der Käufer will auch vermieten? Vielleicht freut er sich, wenn er sich nicht extra neue Mieter suchen muss?«
»Oh nein. Er will die Wohnung definitiv leer. Er muss sie aufhübschen.«
»Gut zu wissen. Nur dass ich nicht weiß, wohin.«
»Sie leben doch nicht von Sozialhilfe, oder?«
»Nein, aber …«
»Momentan gibt es reichlich Angebote. Ich maile Ihnen ein paar.«
Die Wohnung gekündigt zu bekommen, stelle ich fest, ist unfassbar deprimierend. »Toller Start ins Wochenende, Ian.« Ich frage mich, ob er all seine Kündigungstelefonate freitagabends führt.
»Ja? Kein Problem.«
»Nein, das war … Bitte«, sage ich verzweifelt, »könnten Sie mir was mit einem richtigen Garten suchen?« Meine Wohnung liegt im obersten Stock, deshalb habe ich zu unserem Garten keinen Zugang, aber selbst wenn, wäre es, wie sich auf einen Schrottplatz zu setzen. Er ist fast vollständig asphaltiert und steht voll mit Müll – rostige Sonnenliegen, eine kaputte Wäschespinne, eine Sammlung von vergammelten Küchenstühlen und drei nicht mehr benutzte Schubkarren. Ungepflegt stört mich nicht, ein Hauch von Chaos ist so viel besser als ein steriler Musterhausgarten, aber dieser hier ist ein ständiges Tetanusrisiko.
Ian gluckst. »Budget immer noch das gleiche?«
»Wenn überhaupt, dann niedriger.«
»Witzig. Ach, und, Callie, ich gehe mal davon aus, dass Sie das mit den Bienen geregelt haben?«
»Bienen?«, frage ich unschuldig.
Ian zögert. Ich höre ihn hektisch mit dem Zeigefinger klopfen. »Na ja, da war doch so was. Die sind unter dem Sims neben Ihrem Wohnzimmerfenster ein- und ausgeflogen.«
Das stimmt. Ich glaube, das Paar von nebenan hat das gemeldet. Als Ian mich deshalb anrief, habe ich ihn damit abgewimmelt, dass ich einen Freund hätte, der mir helfen könne. Es überrascht mich gar nicht, dass er jetzt erst auf die Idee kommt, nachzufragen, Monate später.
Ich wollte so gern das fröhliche kleine Heim beschützen, das die Bienen sich dort bauten. Sie richteten keinen Schaden an – im Gegensatz zu ihren Denunzianten, die wenige Tage nach dem Einzug schon ihren Garten zugepflastert und sämtliches Gras durch Kunstrasen ersetzt hatten.
»Klar doch«, sage ich munter. »Alles wieder im Lot.«
»Wunderbar. Wir wollen ja nicht, dass sie dort Winterschlaf halten.«
Ich grinse. Das Nest ist mit Sicherheit jetzt leer, die Bienen längst weg. »Um genau zu sein, halten Bienen keinen …«
»Wie bitte?«
»Ach nichts.«
Als ich aufgelegt habe, haue ich mit dem Kopf an die Sofalehne. Im Alter von vierunddreißig obdachlos. Na, wenn das mal keine Ausrede für einen Litereimer Eis ist.
Im Nachbargarten wuchs ein Weißdorn, bevor die Nachbarn ihn ausrissen, um Platz für diesen Pseudoparkplatz zu machen. Er stand zu dem Zeitpunkt in voller Blüte. Die durch die Luft fliegenden Dolden, als sie den Baum in den gemieteten Container warfen, riefen mir windige Frühlingstage aus meiner Kindheit ins Gedächtnis, an denen ich ausgelassen durch das Konfetti der Natur rannte, angefeuert von meinem Vater.
Sie erinnerten mich außerdem an den Weißdorn, den ich von meinem Schreibtisch bei dem Dosenhersteller sehen konnte, bei dem ich früher arbeitete. Ich liebte ihn, dieses einsame Zeichen von Leben auf der Betonfläche des Gewerbegebiets. Vielleicht hatte ihn ein Vogel gepflanzt oder jemand, dem so verzweifelt zumute war wie mir damals. Jahrelang beobachtete ich ihn im Verlauf der Jahreszeiten, bestaunte die Blütenknospen im Frühling, das üppig grüne Laub im Sommer und die rote Pracht des Herbstes. Ich liebte ihn sogar im Winter, empfand die Geometrie seiner kahlen Äste als genauso schön wie eine Skulptur in einer Galerie.
In jeder Mittagspause ging ich hin, manchmal nur, um die Rinde zu berühren oder in die Krone hinaufzusehen. An wärmeren Tagen aß ich mein Sandwich darunter, auf der Kante der Begrenzung hockend. In meinem dritten Sommer dort hatte jemand offenbar Mitleid mit mir bekommen und eine alte Holzbank dort abgestellt.
Doch zu Beginn meines sechsten Sommers bei der Firma wurde der Baum gefällt und stattdessen ein Raucherunterstand gebaut. Es fiel mir schwer, zu erklären, warum es mir so wehtat, dort, wo vorher Blätter und Zweige gewesen waren, einen Haufen grauer Gesichter zu sehen, die unter dieser Plexiglaskuppel ausdruckslos ins Leere starrten.
Jetzt sehe ich aus dem Fenster auf die Stelle, an der früher der Weißdorn stand. Wahrscheinlich sollte ich mich an den Computer setzen und mit der Suche nach einer neuen Bleibe beginnen. Komisch, wie leicht es für einen Menschen ist, einen anderen Menschen zu entwurzeln, wenn er am wenigsten damit rechnet.
6
Joel
Ich bin unten am Fluss und denke darüber nach, was vorhin passiert ist. Oder nicht passiert ist. Schwer zu sagen.
Es war seltsam, als Callie mir im Café meinen doppelten Espresso brachte. Unsere Blicke trafen sich, mir strich eine Hitze über die Haut, und ich hatte Mühe, die Augen von ihr zu lösen.
Iris mit braunen Pünktchen darin, wie Sonnenlicht auf Sand. Lange, unkomplizierte Haare in der Farbe von Kastanien. Ein Teint wie blasseste Vanille. Und ein hinreißendes Lächeln, das unmöglich mir gelten konnte.
Aber offenbar mir galt.
Callie deutete mit dem Kopf auf Murphy, der an meinem Knie lehnte und sich genüsslich am Kopf kraulen ließ. »Ich hoffe, er nervt dich nicht.«
Während meiner inzwischen fast täglichen Besuche im Café im Laufe der letzten Woche habe ich ein ziemlich enges Verhältnis zu ihrem Hund aufgebaut. »Der hier? Aber nein. Wir haben eine Abmachung.«
»Nämlich?«
»Er leistet mir Gesellschaft, und ich werfe ihm Kuchenkrümel hin, wenn du nicht aufpasst.«
»Möchtest du welchen?« Ein freundliches Lächeln. »Wir haben gerade ein frisches Blech Traumkuchen reingekriegt.«
»Was bitte?«
»Den Drømmekage. Das ist Dänisch für ›Traumkuchen‹.«
Ich fand den Namen grauenhaft. Aber seien wir mal ehrlich, dieser Kuchen ist das kulinarische Äquivalent zu Crack. »Ja, gern, danke.«
Sie kam fast sofort zurück und stellte einen Teller mit einem überdimensionierten Stück vor mir ab. »Guten Appetit.«
Wieder trafen sich unsere Blicke. Wieder konnte ich mich nicht abwenden. »Danke.«
Sie blieb noch stehen. Nestelte an ihrer Kette. Sie war rotgold und zart, eine Schwalbe im Flug. »Und, viel zu tun? Bist du auf dem Weg zur Arbeit?«
Zum ersten Mal seit Langem störte es mich, das nicht mit Ja beantworten zu können. Absolut nichts Interessantes über mich zu erzählen zu haben. Ich weiß nicht mal genau, warum ich das wollte. Sie hatte einfach so etwas an sich. Wie sie sich bewegte, das Leuchten ihres Lächelns. Dieses Lachen, voll und süß wie der Duft des Frühlings.
Reiß dich zusammen, Joel.
»Ich hab da so eine Theorie über dich«, sagte sie daraufhin.
Kurz dachte ich an Melissa, die schon genug Theorien über mich entwickelt hat, um eine zentnerschwere, inhaltlose Doktorarbeit zu schreiben.
»Ich glaube, du bist Schriftsteller.« Callie zeigte auf mein Notizbuch.
Wieder hatte ich das Bedürfnis, sie zu beeindrucken. Sie irgendwie zu faszinieren, etwas Gewinnendes zu sagen. Wenig überraschend versagte ich. »Nur unzusammenhängendes Gefasel, fürchte ich.«
Sie wirkte nicht allzu enttäuscht. »Und was machst du …«
Plötzlich rief hinter uns ein Gast nach ihr. Als ich mich umdrehte, flitzte Dot von Tisch zu Tisch und lächelte entschuldigend.
Callie lächelte. Legte den Kopf schief Richtung Theke. »Tja, ich muss wohl mal wieder.«
Er war seltsam, der Drang, die Hand nach ihr auszustrecken, als sie ging. Sie sanft zu mir zurückzuziehen, mich wieder von ihrer Gegenwart wärmen zu lassen.
Vor langer Zeit habe ich mir antrainiert, mich nicht mit flüchtiger Anziehung aufzuhalten. Aber das hier ging viel tiefer, ein Gefühl, das ich seit Jahren nicht hatte. Als hätte sie einen Teil von mir zum Leben erweckt, den ich dachte ein für alle Mal begraben zu haben.
Bald danach ging ich. Widerstand dem Reflex, mich auf dem Weg nach draußen zu ihr umzusehen.
»Joel! Hey, Joel!«
Ich bin noch damit beschäftigt, die Begegnung mit Callie aus meinem Kopf zu verdrängen, als ich merke, dass ich gerufen werde. Normalerweise ist das nicht die beste Art, meine Aufmerksamkeit zu erregen, aber ich erkenne die Stimme. Es ist Steve, und er verfolgt mich.
Seit ich ihm letzte Woche die Reifen zerstochen habe, gehe ich ihm aus dem Weg. Jetzt allerdings holen mich meine Schandtaten offenbar buchstäblich ein.
Ich hätte gute Lust, zum See zu sprinten und mit meinem kleinen Hunderudel eine Flucht per Tretboot zu versuchen. Dann fällt mir allerdings ein, dass Steve definitiv schneller ist als ich und mich zu Boden ringen könnte, und zwar innerhalb von ungefähr zehn Sekunden.
Steve ist Personal Trainer, er veranstaltet widerwärtige Outdoor-Sportkurse für Menschen mit masochistischen Neigungen. Er muss gerade einen abgehalten haben, denn er trinkt schwitzend einen riesigen Protein-Shake. In Jogginghose, Turnschuhen und einem Shirt, das aussieht wie auf seinen Körper gesprüht, trabt er hinter mir her.
»Hallo, Meute«, sagte er zu meinen drei Hunden.
Er wirkt entspannt. Das könnten natürlich auch noch die Endorphine sein. Ich gehe zielstrebig weiter, bleibe auf der Hut. Wenn er mich auf seine Reifen anspricht, werde ich alles abstreiten.
»Wie läuft’s, Kumpel?«
Oder ich sage einfach gar nichts.
Steve kommt direkt auf den Punkt, denn so ist er. »Joel, ich weiß, dass du das mit meinen Reifen letzte Woche warst.« Seine Stimme ist leise, aber fest, als wäre ich ein Kind, das er beim Zigarettenklauen erwischt hat. »Ich hab rumgefragt, Rodney hat für mich die Aufnahmen seiner Überwachungskamera überprüft. Ist alles drauf.«
Aha, Rodney. Die Augen unserer Straße. Eine Ein-Mann-Bürgerwehr. Ich hätte wissen müssen, dass er mein Untergang sein wird. Die Hinweise häufen sich seit Monaten, seit er sich einen Breitbandanschluss besorgt hat, um der Polizei seine Videos schicken zu können.
Selbstvorwürfe plagen mich. Ich möchte etwas sagen, weiß aber nicht, was. Also stecke ich nur meine Hände noch tiefer in die Taschen und laufe weiter.
»Weißt du«, sagte Steve, »hinterher hast du den Kopf an den Radkasten gelehnt. Du hattest ein schlechtes Gewissen, stimmt’s?«
Natürlich hatte ich das, alle guten Gründe mal beiseite. Denn seit so vielen Jahren jetzt ist Steve für mich mehr wie ein Bruder als ein Freund.
»Ich weiß, dass du das eigentlich nicht wolltest. Also sag mir einfach, warum.«
Schon der bloße Gedanke an dieses Gespräch fühlt sich an, wie an einer Felskante zu stehen. Rasender Herzschlag, kribbelnde Haut, Worte, die in meinem Mund zu Sägespänen vertrocknen.
»Ich musste es Hayley erzählen«, sagt Steve, als ich ihn nicht aufkläre.
Das überrascht mich nicht: Die beiden funktionieren als Paar. Erzählen sich alles, verheimlichen nichts.
»Sie ist nicht begeistert. Besser gesagt ist sie stinksauer. Sie versteht einfach nicht, was zum Henker du dir dabei gedacht hast. Ich meine, ich hatte Poppy dabei …«
»Die Reifen waren total platt. Du hättest unmöglich wegfahren können, selbst wenn du es probiert hättest.«
Jetzt fasst Steve mich am Arm und bleibt stehen. Der Griff ist so kräftig, dass er mich ziemlich hilflos macht: Ich bin gezwungen, ihm in die Augen zu sehen.
»Poppy ist dein Patenkind, Joel. Das Mindeste, was du tun kannst, ist, mir zu sagen, warum.«
»Es war nicht … Ich verspreche dir, dass ich einen guten Grund hatte.«
Er wartet darauf, ihn zu hören.
»Tut mir leid, ich kann es nicht erklären. Aber es war nicht böswillig.«
Seufzend lässt er mich los. »Hör mal, Joel, das Ganze bestätigt irgendwie, worüber Hayley und ich schon seit einer Weile nachdenken. Jetzt mit Poppy brauchen wir sowieso mehr Platz, deshalb sollte ich dir sagen: Wir tun es. Wir ziehen aus.«
Ein Seufzen des Bedauerns. »Schade.« Er muss das unbedingt wissen. »Das finde ich ehrlich schade.«
»Wahrscheinlich verkaufen wir nicht. Zumindest nicht sofort, wir vermieten erst mal. Der Kredit ist fast abgezahlt, also …« Er stockt, sieht mich an, als hätte er etwas wirklich Anstößiges gesagt. »Das habe ich gerade in meinem Hinterkopf gehört. Was für ein Mittelschichtsarschloch.«
Steve und Hayley waren schlau, haben unserem Vermieter ihre Wohnung abgekauft, als die Preise noch gemäßigt waren. »Überhaupt nicht. Ihr arbeitet viel. Behaltet die Wohnung auf jeden Fall.«
Er nickt langsam. »Ich wünschte, du könntest mir sagen, was los ist. Ich mache mir Sorgen um dich.«
»Alles unter Kontrolle.«
»Joel. Ich glaube, dass ich dir vielleicht helfen könnte. Hab ich dir schon mal erzählt …«
»Sorry«, sage ich hastig. »Ich muss los. Diese Hunde führen sich nicht selbst Gassi.«
Und wie sie das würden, selbstverständlich. Aber im Moment sind sie die einzige Ausrede, die mir einfällt.
Ich lebe schon immer in Eversford, bin seit fast zehn Jahren Steves und Hayleys kauziger Nachbar.
Anfangs, als sie frisch eingezogen waren, mied ich sie. Aber Steve aus dem Weg zu gehen, ist nicht so leicht. Er ist selbstständig, was bedeutet, dass er Zeit hat für Dinge, wie meine Mülltonnen rauszustellen und Päckchen anzunehmen und sich unseren Vermieter wegen des gewaltigen Risses in unserer Mauer vorzuknöpfen. Also wurden wir von Nachbarn zu Freunden.
Vicky, meine damalige Freundin, bemühte sich um die neue Bekanntschaft. Andauernd machte sie mit Hayley Verabredungen für uns vier aus: Sundowner im Garten, Grillen an Feiertagen, Geburtstagsfeiern in der Stadt. Sie schlug vor, das Guy-Fawkes-Feuerwerk im Park anzusehen und sich an Halloween mit Rum, abgedunkelten Fenstern und Horrorfilmen vor Süßigkeiten sammelnden Kindern zu verstecken.
Vicky verließ mich an ihrem Geburtstag, nach drei Jahren Beziehung. Legte mir eine Liste vor, die sie geschrieben hatte, eine kurze Spalte mit Pros gegenüber einer endlos langen mit Kontras. Meine emotionale Distanz stand ganz oben, nicht weniger wichtig allerdings waren meine allgemeine Asozialität und ständige Nervosität. Meine mangelnde Bereitschaft, mich auch mal einen Abend lang gehen zu lassen, meine scheinbaren Schlafstörungen. Das Notizbuch, in das sie nie einen Blick werfen durfte, tauchte ebenso auf der Liste auf wie meine permanente geistige Abwesenheit.
Nichts davon war mir neu, und nichts davon war unfair. Vicky verdiente viel mehr als eine so lauwarme Beziehung, wie ich sie ihr zu bieten hatte.
Es war natürlich auch nicht förderlich, dass ich ihr das Träumen verheimlichte. Aber Vicky erinnerte mich immer ein wenig an Doug, in der Hinsicht, dass sie nicht gerade berühmt für ihr Einfühlungsvermögen war. Obwohl es vieles gab, was ich an ihr bewunderte (Ehrgeiz, Sinn für Humor, innerer Antrieb), war sie auch ein Mensch, der nur die Achseln gezuckt hätte, wenn er einen Hasen überfuhr.
Als sie ging, trank ich mehrere Monate lang heftig. Das hatte ich vorher schon probiert, in meinen letzten beiden Jahren an der Uni, nachdem ich gelesen hatte, dass Alkohol den Schlaf massiv störte. Ich wusste also, dass das keine Lösung war, nicht dauerhaft. Dass es nicht wirklich funktionieren konnte. Aber ich muss mir wohl eingeredet haben, dass es dieses Mal anders wäre.
War es nicht, deshalb hörte ich wieder auf. Gerade noch rechtzeitig wahrscheinlich, denn ich gewöhnte mich schon langsam an die gefährliche Wärme der Abhängigkeit. Und die Vorstellung, mich damit auch noch befassen zu müssen, war ungefähr so attraktiv für mich, wie den Ärmelkanal zu durchschwimmen oder Streit in meinem örtlichen Karateklub zu suchen.
In den Jahren nach Vicky wurde mein Verhältnis zu Steve und Hayley noch enger. Es war fast, als schlängen sie ihre Arme um meinen Schmerz. Und als Poppy auf die Welt kam, dachten sie vermutlich, dass es mir tatsächlich guttäte, ihr Patenonkel zu werden.
Bei der Taufe hielt ich Poppy stolz für ein Foto auf dem Arm. Sie war wie ein zappelnder Welpe, warm und bezaubernd. Ich betrachtete ihr Gesichtchen, spürte, wie kostbar dieses Leben war, empfand überwältigende Liebe.
Wütend auf mich selbst gab ich sie zurück. Betrank mich, zerbrach zwei Weingläser. Musste früh mit dem Taxi nach Hause geschickt werden.
Das war es. Seitdem ist unser Verhältnis angespannt.
7
Callie
Gegen Ende des Monats schlägt Ben vor, in den Pub zu gehen, wo ein Freund eines Freundes seinen Geburtstag feiert. Ich bin nach der Arbeit fast zu müde, möchte Ben aber nicht enttäuschen. Seine Fortschritte sind immer noch so zaghaft, als erwachte er nach einem besonders bitteren Frost aus dem Winterschlaf.
Joel war einer der letzten Gäste heute, und als er die Tür hinter sich schloss, überlegte ich eine hektische halbe Sekunde lang, ob ich ihm nicht nachrennen und ihn einladen sollte mitzukommen. Momentan ist er das mit Abstand Beste an der Arbeit im Café – er kann mich mit einem bloßen Lächeln umwerfen, mich mit dem flüchtigsten Blick ganz kopflos machen. Ich merke, dass ich jeden Tag auf ihn warte, grüble, wie ich ihn zum Lachen bringen könnte.
Dann ließ ich es doch lieber sein, weil ich ziemlich sicher bin, das würde eine Grenze überschreiten. Der arme Mann sollte einfach in Frieden seinen Kaffee trinken dürfen, ohne von dahergelaufenen Baristas mit Vorschlägen für seine Abendgestaltung belästigt zu werden. Außerdem ist jemand, der so nett ist, garantiert in festen Händen, auch wenn er, wie Dot festgestellt hat, immer allein hier ist.
Eigentlich, ermahne ich mich, kennen wir uns kaum, gerade mal gut genug für ein Lächeln und eine kurze Bemerkung, wie Sterne aus Begleitgalaxien, die einander über den unendlichen Himmel hinweg zuzwinkern.
Da es zum Glück noch warm genug zum Draußensitzen ist, findet die Geburtstagsfeier im Biergarten statt. Ich entdecke meine Freundin Esther mit ihrem Mann Gavin, neben einigen Leuten, die wir alle etwas besser kannten, als Grace noch lebte. Wäre sie jetzt hier, würde sie einen nach dem anderen abklappern, und ihr tiefes, rollendes Lachen wäre wie der Takt einer vertrauten, geliebten Melodie.
Einen Moment lang horche ich danach. Denn, also – nur für alle Fälle.
Ich rutsche neben Esther auf die Bank, Murphy macht es sich zu meinen Füßen bequem. Von der Pergola über uns hängt Jelängerjelieber wie ein Wasserfall herab, Büschel von cremeweißen Blüten zwischen dem leuchtenden Grün. »Wo ist Ben?«
»Wurde in der Arbeit aufgehalten. Ich glaube, er ist nicht so gut drauf.«
»Sehr schlimm?«
»Na ja, immerhin kommt er. Also nur mittelschlimm, schätze ich mal.« Esther, in einem ärmellosen buttergelben Oberteil, schiebt mir ein Pint Cider vor die Nase.
Esther, Grace und ich lernten uns an unserem ersten Schultag kennen. Von Anfang an hielt ich mich gern in ihrem Schatten, bewunderte ihren Wagemut, ohne es je mit ihnen aufnehmen zu können. Sie waren sich einig in ihrer Freimütigkeit, deretwegen sie häufig aus dem Unterricht geworfen wurden und die sich Jahre später in wildem Gebrüll bei Polit-Talkshows im Fernsehen manifestierte, in Debatten über meinen Kopf hinweg über Regierungspolitik und Klimawandel und feministische Theorie. Die beiden putschten sich gegenseitig auf, lebhaft und leidenschaftlich. Und dann wurde Grace plötzlich und gewaltsam von uns genommen, und Esther musste allein für all ihre Prinzipien, ihre glühendsten Überzeugungen weiterkämpfen.
Grace kam vor achtzehn Monaten ums Leben, durch einen betrunkenen Taxifahrer. Er kam von der Straße ab, und Grace starb auf dem Bürgersteig, auf dem sie unterwegs war.
Es sei ganz schnell gegangen, wurde uns gesagt. Sie habe bestimmt nicht gelitten.
Während wir jetzt auf Ben warten, wendet sich das Gespräch der Arbeit zu. »Ich hab mich heute mal an deinem Traumjob versucht, Cal«, sagt Gavin zu mir und nippt an seinem Bier.
Leicht verdutzt sehe ich ihn an. »Wie meinst du das?«
Gavin ist Architekt, und jedes Jahr leisten er und seine Kollegen ehrenamtliche Arbeit für einen guten Zweck. Er erzählt mir, dass er heute acht Stunden lang mit Habitatmanagement in Waterfen beschäftigt war, unserem örtlichen Naturschutzgebiet, meinem persönlichen Paradies.
»Du kannst dir ja vorstellen, wie das ablief.« Esther zwinkert. Sie arbeitet viele Stunden für wenig Gehalt bei einem Wohlfahrtsverband. »Acht Stunden Plackerei im Freien für Bürohengste.«
Während ich den Jelängerjelieberduft einatme, stelle ich mir einen Tag zwischen mäandernden Hecken und wilden Wäldchen vor, goldbraunem Röhricht, aufgefädelt an einem kühlen Fluss. Ich arbeite manchmal auch ehrenamtlich in Waterfen, schreibe vierteljährliche Berichte, nichts Großes, Brutvogelerhebungen, Habitat-Monitoring, aber das macht nichts. Es befriedigt meine Sehnsucht nach einem unverbauten Horizont, nach nicht von Menschen zertrampelter Erde, nicht von künstlichen Gegenständen getrübter Luft.
Ich lächle Gavin an. »Klingt ja interessant.«
Er zieht eine selbstironische Grimasse. »So kann man es auch formulieren. Ich hab immer gedacht, ich sei fit. Außerdem, Holzstapel umzuschichten, die fünf Mal so hoch wie ich sind, und Zaunpfosten durch die Gegend zu schleifen und irgendwelches Kraut auszurupfen, bis mir fast der Rücken bricht, ist nicht meine Vorstellung von Spaß.«
Ich bemerke die Kratzer an seinen Armen. In den Haaren ist auch noch ein Rest Natur zu erkennen. »Jakobskraut?«
»Was?«
»Habt ihr das ausgerissen?«
»Kann schon sein«, brummelt er finster und trinkt einen Schluck Bier. »Es war die Hölle.«
»Klingt für mich wie das Paradies.«
»Tja, die Leiterin meinte, sie schreiben bald eine Assistenzstelle aus. Da wäre dein Ökologiestudium besser genutzt als mit Kellnern. Wie wäre es, wenn du dich …«
Im selben Moment, als Esther ihn mit einem Husten zum Schweigen bringt, spüre ich ein Zucken im Inneren wie das Erwachen einer schlafenden Kreatur.
»Wie wäre es, wenn du dich was?« Ben lässt sich mit seiner Rugbyspielerstatur neben mir auf die Bank fallen, Bierglas in der Hand, den Blick erwartungsvoll auf unsere Gesichter gerichtet. Er verkörpert genau das Ende eines Arbeitstags – Ärmel hochgekrempelt, Haare zerzaust, Augen außer Dienst.
»Nichts«, sage ich hastig. In den letzten Tropfen des leeren Glases rechts von mir strampelt sich hilflos ein Marienkäfer ab. Ich schiebe einen Finger hinein, führe eine Rettungsaktion durch. Er flattert weg.
»In Waterfen wird eine Stelle frei«, sagt Gavin. »Du weißt schon, das Naturschutzgebiet, wo man sich ehrenamtlich quälen lassen kann? Offenbar ist das Callies Traumberuf, deshalb …« Er verstummt abrupt und sieht Esther böse an, seine übliche Art zu protestieren, wenn sie ihn gegen das Schienbein getreten hat.
Ben, der gerade noch Murphy die Ohren gekrault hat, richtet sich auf. »Ich dachte, du liebst das Café.«
Seine Verblüffung versetzt mir einen Stich. »Das stimmt ja auch«, versichere ich und ignoriere dabei Bens hochgezogene Augenbraue. »Keine Sorge, ich bleibe.«
Seine Miene wandelt sich zu Erleichterung, und ich weiß, was das heißt, nämlich dass es Grace viel bedeuten würde, ihr Café bei mir in guten Händen zu wissen. Nach ihrem Tod meine Anstellung zu kündigen, um es zu führen, schien so naheliegend, fast eine logische Konsequenz. Ben ging in seinem Marketingjob auf, während ich bei der Farbdosenfirma versauerte. Ich war schon elf Jahre dort, elf Jahre Terminplanung für meine Chefin, Kaffeekochen, Telefon. An sich hatte es nur eine Überbrückung nach der Uni sein sollen, schnelles Geld für die Miete, aber nach drei Monaten bekam ich eine feste Stelle, und noch mal zehn Jahre später wurde mir zum Arbeitsjubiläum gratuliert, was Grace grenzenlos amüsierte. »Zehn Jahre einer einzelnen Frau treu«, neckte sie mich, als ich mit der Sektflasche bei ihr auftauchte, die ich geschenkt bekommen hatte. »Das ist wie eine komische kleine Ehe.«
Ein Jahr später starb sie.
Bald darauf adoptierte ich Murphy. Er war eigentlich Grace’ Hund gewesen, außerdem waren bei Ben im Büro keine Hunde erlaubt, im Café dafür viel Tierliebe im Angebot.
Ein Café zu besitzen, war Grace’ erste dauerhafte Beschäftigung seit dem Studium, und selbst das fing aus einer Laune heraus an. Von einem Erbe kaufte sie spontan einen alten Kinderkleidungsladen, zu unserer aller Überraschung. In den Jahren davor war sie durch die Welt gereist und hatte unterwegs gearbeitet, als Kellnerin, Telefonverkäuferin, kostümierte Prospektverteilerin. Ab und zu rief sie mich aus einem fernen Land an, ergötzte mich mit ihren neuesten Abenteuern und Katastrophen, und ich legte hinterher neugierig und neidisch auf. Dann gab ich mich kurz Tagträumen hin, selbst in einen Flieger zu steigen, den Dopaminschub zu spüren, wenn ich endlich meinem eigenen winzigen Fleckchen Erde entfloh.
Ich fragte mich oft, wie es wäre, einfach so loszufahren. Es zog mich an Orte endloser Wildnis, weiter Horizonte, schwindelerregender Panoramen. In der Schule hatten wir einmal Südamerika behandelt, und seitdem schmachtete ich nach einem speziellen Naturpark im Norden Chiles. Unsere Erdkundelehrerin war zwei Jahre vorher dort gewesen, und am Ende der Stunde hatten wir alle das Gefühl, wir hätten sie begleitet. An jenem Abend erzählte ich meinem Vater von ihren Abenteuern und fragte, ob wir in den nächsten Sommerferien nach Chile fahren durften. Er lachte und meinte, da müssten wir meine Mutter fragen, was ich sofort als ein Nein begriff. Wahrscheinlich hatte er Recht damit, dass kein vernünftiger Mensch sich auf eine solche Bitte einer Zehnjährigen einlassen würde.
Also bereiste ich den Altiplano stattdessen in meinem Kopf, sah mir stundenlang Bilder von schneebedeckten Vulkanen und weitläufigen Landschaften an, träumte nachts von Alpakas und Lamas, Falken und Flamingos. Sie wurde zu meinem Fluchtort, wenn ich einen brauchte, diese Ecke Chiles, die durch meine Vorstellungskraft zum Märchen geworden war.
Ich hatte mir fest vorgenommen, eines Tages hinzufahren. Aber nach der Uni hatte ich kaum noch Ersparnisse, und ich war nicht so sicher, ob ich für Grace’ legendären Unterwegs-jobben-Ansatz geeignet war. Irgendwie war der Zeitpunkt nie ganz der richtige, ich suchte entweder gerade eine Stelle oder sparte oder arbeitete viel oder hatte einen Freund. Und so glitten mir die Jahre durch die Finger, und Chile blieb ein ferner Traum.
Ich weiß, dass es auf Ben immer den Eindruck machte, als wäre das Café ein willkommener Ausweg aus einem Job gewesen, der mich zu Tode langweilte. Eigentlich jedoch erinnert er mich nur daran, dass Kaffeekochen nicht meine Leidenschaft ist. Ich wohne immer noch in der Stadt, in der ich geboren bin, und die Welt dort draußen pulsiert vor Möglichkeiten, während sie sich dreht, dreht, dreht.
8
Joel
Ich laufe absichtlich aus Versehen an der Tierarztpraxis vorbei, in der ich früher gearbeitet habe. Das mache ich mindestens einmal pro Woche. Warum, kann ich auch nicht sagen.
Vielleicht tue ich, als wäre ich noch dort beschäftigt, als hätte sich nichts verändert, und ich könnte einfach durch die Schwingtür treten. Alison am Empfang begrüßen, auf dem Weg in mein Behandlungszimmer kurz mit Kieran plaudern.
Ich entdecke ihn auf dem Parkplatz. Er lehnt neben der Hintertür an der Mauer und verschnauft.
Ich überquere die Straße. Hebe eine Hand, als er mich sieht.
»Hallo.« Er richtet sich halb auf. »Wie geht’s?«
»Gut, danke.« Ich nicke bekräftigend, obwohl wir beide wissen, dass es nicht stimmt. »Und dir?«
»Brauchte nur kurz frische Luft.«
Als ich mich neben ihn an die Mauer stelle, schiele ich nach seinem dunkelblauen Kittel. Es ist genau der gleiche, den ich zu Hause habe. Der gleiche, den ich früher mit Stolz getragen habe.
Wir recken unsere Gesichter der Septembersonne entgegen. »Schlimmer Tag?«, frage ich.
»Nicht so toll. Erinnerst du dich an Jet Mansfield?«
»Klar.« Der taube Border Collie mit seiner zauberhaften uralten Besitzerin Annie. Sie hat Jet kurz nach dem Tod ihres Mannes zu sich genommen. Die beiden lieben einander abgöttisch.
»Vor sechs Monaten hab ich ihm die Vorderpfote amputiert. Sarkom.«
Ich sehe ihn an und rate. »Und jetzt ist es zurück?«
»Musste es Annie gerade beibringen.«
»Wie hat sie es aufgenommen?«
»Erwartungsgemäß.«
»Was will sie machen?«
»Zum Glück ist sie mit mir einer Meinung.«
Maximale Schmerzlinderung, denke ich, und ein bequemes Bett.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch länger als einen Monat hat.«
Ich stelle mir vor, wie Annie Jet nach Hause bringt. Sie wird so tun, als wäre alles ganz normal. Ihm Futter in den Napf schütten und dabei versuchen, nicht zu weinen. »Wie geht’s dir damit?«
»Na ja.« Kieran lächelt matt und sieht mich an. »Ist ganz nett, wieder mit dir hier zu stehen. Wie in den guten alten Zeiten.«
Kieran weiß nichts von meinen Träumen: Ich hatte immer Angst, dass er mich für mental nicht stabil hält, mich bemitleidet. Insgeheim froh ist, dass ich gegangen bin.
Da er mein Freund und ehemaliger Chef ist, bedeutet Kierans Respekt mir sehr viel. Das ist ein Grund, warum ich gekündigt habe, warum ich gesprungen bin, bevor ich gestoßen wurde.
Ich lächle gezwungen. »Ja.«
»Lust auf einen Job?«
Ich lächle weiter, schüttle aber den Kopf. »Zu viel los gerade.«
»Genau. Du kommst mir vor wie jemand mit echt vollem Terminkalender. Du warst nur zufällig in der Gegend, oder?«
»Ja.« Ich stoße mich von der Wand ab, räuspere mich. »Apropos, ich muss jetzt mal weiter.«