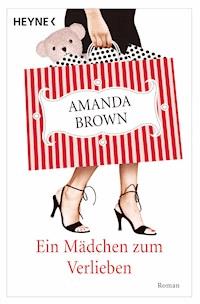
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei überzeugte Singles und ein kleines Mädchen …
Eine beinharte Karrierefrau und ein wohlhabender Lebemann, der stets auf Partys oder Golfplätzen zu finden ist. Doch die beiden Singles haben etwas gemein: Sie sind die Pateneltern der kleinen Emily, deren Eltern bei einem Flugzeugunglück umkamen. Von da an steht ihr Leben auf dem Kopf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Amanda Brown
Ein Mädchen zum Verlieben
Roman
Aus dem Amerikanischen von Usch Pilz
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Das Buch
Sie hat mit allem gerechnet, nur damit nicht. Die selbstbewusste Karrierefrau Becca Reinhart, gewappnet mit der Financial Times und ausgestattet mit einer geschäftsmännischen Spürnase, ist in ihrem Buisness unschlagbar. Sie ist mit allen Wassern gewaschen und lässt sich von niemandem dreinreden, erst recht nicht von Männern. Doch jetzt muss sie sich auf ein ganz unbekanntes Terrain wagen: Sie wird die neue Mutter ihrer vierjährigen Patentochter Emily, deren Eltern bei einem Flugzeugunglück ums Leben kommen. Und als ob die neue Mutterrolle nicht schon genug wäre, gibt es da auch noch den Patenonkel der Kleinen, Edward Kirkland. Auch für ihn ist das Vaterdasein eine neue Erfahrung, steckt in dem smarten Mittdreißiger doch selbst noch ein kleiner Schuljunge, der unter der Aufsicht seiner Mutter steht, die ihren Edward möglichst schnell verheiraten möchte.
Zwei eingefleischte Singles und eine quirlige Vierjährige – ein heiteres Erziehungschaos bricht aus und amüsante Sinneswandlungen sind garantiert.
Die Autorin
Amanda Brown, geboren in Paradise Valley in Arizona, ist eigentlich noch Jurastudentin an der Stanford Law School, doch ihr durchschlagender Bucherfolg hat sie davon überzeugt, Schriftstellerin zu werden. Ihr Erstlingswerk »Natürlich Blond« (»Legally Blonde«) wurde sofort verfilmt, und das Ergebnis war eine Nominierung für den Golden Globe im Jahr 2001. Auch ihr neues Buch, »Ein Mädchen zum Verlieben«, soll mit der Oscar-Gewinnerin Hillary Swank als Hauptdarstellerin verfilmt werden. Amanda Brown, verheiratet und Mutter einer dreijährigen Tochter, pendelt zwischen Los Angeles und San Francisco. Sie arbeitet bereits an einem dritten Roman.
HEYNE ALLGEMEINE REIHE Band-Nr. 01/14005
Die Originalausgabe FAMLY TRUST erschien 2003 bei Dutton, a member of Penguin Group (USA) Inc.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Redaktion: lüra – Klemt & Mues GbR
Deutsche Erstausgabe 07/2004 Copyright © 2003 by Amanda Brown Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2004 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung des Originalumschlags von Tamaque Perry Gesetzt aus der Minion Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
eISBN: 978-3-641-19001-9
http://www.heyne.de
www.randomhouse.de
Für meinen Liebling, der mich zum Lachen bringt, für meine Mutter, die immer an mich geglaubt hat, für meinen Mann, ohne den alles nicht möglich geworden wäre, und – nicht zu vergessen – für meine Katzen Gomez und Underdog.
Mein besonderer Dank gilt Jim Hornstein, Hillary Bibcoff, Nancy Nigrosh, Michelle Forrest, Daniel Greenberg und Laurie Chittenden.
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Becca Reinharts lebhafte Augen funkelten, während sie sich auf die Stimme konzentrierte, die aus dem Headset schallte. Dann schüttelte sie so heftig den Kopf, dass ihr offenes schwarzes Haar die Schultern streifte. Ihre Antwort war unerbittlich: Nein.
Becca lehnte am Schreibtisch und stützte sich mit ihren schlanken Armen an der Kante ab. Ihr Blick wanderte über die üppig grünen, noch immer von Tau benetzten Baumkronen vor ihrem Bürofenster. Dann atmete sie tief durch, rückte das Headset zurecht und begann, mit raschen Schritten auf und ab zu gehen.
In den Rand des türkischen Teppichs war ein deutlich sichtbarer Pfad gewetzt – das Resultat unzähliger intensiver Telefonate. Das zarte Muster aus Scharlachrot, Gold und Kobaltblau, das einstmals die Kante des handgeknüpften Prachtstücks geziert hatte, war im Laufe der Jahre unter Beccas unermüdlichen Schritten zerschlissen. Vielleicht hätte sie den kostbaren Teppich nie in ihr Büro legen sollen, denn sie hatte ihn nicht nur ruiniert, vielleicht passte er gar nicht in ihre Welt. Für Zartheit war in Beccas hektischem, ganz auf Erfolg und Geschäfte ausgerichteten Leben kein Platz.
»Nein! Kommt überhaupt nicht in Frage!«, beharrte Becca, grinste dabei jedoch amüsiert. »Ich bin dem Kerl schließlich schon mal begegnet. Dem ist jede Art von Anstand fremd. Nicht einmal Abby Joseph Cohen würde dem ein Geschäft anbieten – und das will was heißen!«
Becca blieb vor dem ledernen Schreibtischstuhl mit den Messingbeschlägen stehen, der ihr vorwiegend als Ablage für eingehende Unterlagen und Faxe diente. Wer sie kannte, vermochte das Ende ihrer Wanderung als sicheres Zeichen zu deuten, dass sie die gegenwärtige Diskussion oder den gerade anstehenden Deal zum Abschluss zu bringen gedachte. Wenn sie für jeden Anwalt, mit dem ihre Mutter sie verkuppeln wollte, fünf Cents bekäme, hätte sie sich zur Ruhe setzen können.
»Vergiss es!«, sagte Becca jetzt fest. »Der Typ wäre eine glatte Fehlinvestition.« Sie warf einen Blick in ihren aufgeschlagenen Terminkalender. »Ich habe sowieso keine Zeit. Nächste Woche bin ich bis einschließlich Samstag in Hongkong.«
Zwar standen Beccas Füße inzwischen still, doch nun setzten sich ihre Hände in Bewegung. Ohne es recht zu merken, malte sie kleine Muster in das Samstagsfeld des Kalenders.
»Ich weiß, dass das ein Feiertag ist, Mom«, sagte sie und seufzte.
Wieder wanderten ihre Augen zum Fenster. Der Blick auf den Central Park, Manhattans großes, starkes Herz, war einer der großen Pluspunkte ihres Büros, das auf der West 57th Street lag. Zwischen dem Stahl und Beton der Stadt wirkte der Park wie eine grüne Insel. Mit ruhiger Stimme sprach Becca weiter.
»Ich habe einen Termin beim Finanzminister, Mom. Was hätte ich denn tun sollen? Absagen?«
Sie betrachtete die auf dem Schreibtisch verteilten Schriftstücke. Ein Blick auf den Computerbildschirm sagte ihr, dass inzwischen Dutzende neuer E-Mails eingegangen waren. Jede einzelne davon fiel in die Kategorie ›dringend‹.
»Schon gut, Mom. Ich versuche es«, versprach sie.
Als Philippe, Beccas kleiner flinker Sekretär, den Kopf zur Tür hereinsteckte, winkte sie ihn näher. Philippes Haar, das bis vor kurzem noch nachtschwarz gewesen war, zierten nun graue Strähnchen. Der Effekt war ein Salz-und-Pfeffer-Look, für dessen Beseitigung andere Leute ein kleines Vermögen ausgaben. Mit einer einladenden Handbewegung forderte Becca Philippe auf, sich auf die Couch zu setzen.
Philippe erwiderte ihr Lächeln, lehnte sich auf dem Sofa zurück und wartete. Er begann, in der neuesten Ausgabe von The Economist zu blättern, dem einzigen Lesematerial, das auf Beccas Couchtisch auslag.
Heute war der dritte September, aber man hätte meinen können, es sei erst Juni. Die Luft war feucht und stickig, und über der Stadt hing eine dichte Dunstglocke. Die Sonne sah aus wie eine überreife Frucht und ließ erahnen, dass der Sommer noch weitere drei Wochen lang Hof halten würde.
Philippe betrachtete Becca voller Zuneigung. Sie hatte ihre rastlose Wanderung wieder aufgenommen und lachte in das Mundstück des Headsets. Als er Becca vor fünf Jahren kennen gelernt hatte, war ihre Ruhelosigkeit für ihn zuerst schwer zu ertragen gewesen. Doch inzwischen schätzte Philippe Beccas Intensität – ja, er vermisste ihre Rastlosigkeit regelrecht, wenn Becca einmal für ein paar Tage auf Geschäftsreise war. Diese Frau war ein unglaublich faszinierendes Wesen.
Besprechungen, Redeauftritte, Konferenzen und die üblichen Verhandlungen, die größeren Abschlüssen vorausgingen, füllten Beccas Tage bis zur letzten Minute aus. Den ganzen Sommer über war keine Woche vergangen, in der sie nicht mindestens eine Geschäftsreise unternommen hatte. Doch das alles schien sie nicht sonderlich zu belasten. Im Gegenteil, die Hektik und die vielen Reisen schienen ihrem lebhaften Charakter entgegenzukommen. An manchen Tagen nahm Philippe seine Chefin nur als verwischten Schatten wahr, der im Eilschritt – einen polternden, hüpfenden Pullman-Koffer im Schlepptau – an seinem Schreibtisch vorbeihuschte und währenddessen versuchte, schnell noch ein Telefonat zu beenden, bevor ihr Headset im Aufzug die Verbindung verlor.
Becca hatte Klasse. Das war eine Tatsache, die sich in den Gesichtern ihrer Klienten und derer, die es gern werden wollten, widerspiegelte, wenn sie sich in ihrem Büro die Klinke in die Hand gaben. Nach einem Termin mit Becca war jede nervöse Anspannung aus den Mienen ihrer Gesprächspartner gewichen. Beccas Kompetenz und ihre Verlässlichkeit wirkten beruhigend auf die Firmenvertreter. Es kam aber auch vor, dass Philippe sich angestrengt an irgendwelchen Unterlagen in der untersten Schreibtischschublade zu schaffen machte, um nicht in die harten oder verzweifelten Augen derer sehen zu müssen, die auf der verbissenen Jagd nach Kapital an Beccas eisernen Grundsätzen gescheitert waren.
Philippe wunderte sich gelegentlich darüber, dass eine Normalsterbliche die Strapazen der vielen Reisen, der pausenlosen Sitzungen und Besprechungen überhaupt schadlos überstehen konnte. Becca wechselte jedoch mühelos zwischen sämtlichen Zeitzonen hin und her und führte täglich Krisengespräche mit Topmanagern von Firmen, deren Zukunft auf der Kippe stand. Dem Drängen und Bitten ihrer Klienten begegnete sie mit Integrität und – wenn nötig – mit Härte. Manchmal fragte sich Philippe, was Becca wohl ohne ihren anstrengenden Berufsalltag täte. Würde sie sämtliche Achttausender des Himalaja erstürmen? Oder beim härtesten Marathon mitlaufen? Fest stand, dass Becca sich nur mit Dingen beschäftigte, die ihr die Möglichkeit gaben, herausragende Resultate zu erreichen.
Lächelnd betrachtete Philippe den Koffer an der Tür. Becca hatte stets mehrere gepackte Koffer bereitstehen, jeweils für unterschiedliche klimatische Gegebenheiten. Um die Übersicht zu behalten, bestückte sie ihr Reisegepäck mit Etiketten. Der in Messing gefasste Anhänger, der an dem Louis-Vuitton-Rollkoffer baumelte, trug die Aufschrift LONDON; HERBST.
Philippe kannte Beccas engen Terminplan sehr genau. Sie würde kaum Gelegenheit haben, sich an die sechsstündige Zeitverschiebung zu gewöhnen, bevor sie eine Verhandlung leiten musste, in der es um ein Übernahmeangebot für Machovia ging, eine Firma aus dem Davis Capital Portfolio. Becca galt als wichtigste private Investorin von Machovia. Eigentlich hatte die Firma nicht zum Verkauf gestanden, doch dann war ein ebenso unerwartetes wie verlockendes Angebot auf den Tisch gekommen.
Becca würde sich – je nach Verkehrslage – in einem Firmenwagen zum Teterboro Airport in New Jersey chauffieren lassen oder mit dem Hubschrauber dorthin fliegen. Von New Jersey aus ging es mit einem Jet von Davis Capital weiter nach Heathrow, wo sie um zehn Uhr morgens, Londoner Zeit, ankommen sollte. Die meisten Geschäftsreisenden legten Wert auf einen mindestens dreitägigen Aufenthalt, bevor sie wieder ins Flugzeug stiegen. Doch Becca plante, inklusive aller Flüge und Termine, binnen drei Tagen wieder in ihrem Büro in New York erreichbar zu sein.
Sie konnte inzwischen auf eine rasante Karriere in der harten Finanzwelt zurückblicken. Ihren kometenhaften Aufstieg verdankte sie vor allem dem Vertrauen, das Dick Davis in sie gesetzt hatte. Vor fünf Jahren war er mit dem Angebot an sie herangetreten, als Partnerin bei Davis Capital einzusteigen. Damals hatte sie gerade die Technologieabteilung bei Morgan Stanley geleitet. Sie war eine junge, ehrgeizige Analystin gewesen, die sich durch ihre gründliche Arbeit und die Nervenstärke, Risiken einzugehen, bereits einen Ruf gemacht hatte. Selbst als an allen Börsen die wilde Zeit des Bullen zu Ende ging und der Markt schon längst das schwerfälligere Wesen des Bären angenommen hatte, war es ihr noch gelungen, überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen.
Dick Davis hatte vor beinahe zwanzig Jahren die Firma Bear Sterns verlassen, um gemeinsam mit ein paar Geschäftsfreunden eine Finanzierungsgesellschaft zu gründen – Davis Capital. Als Grundkapital hatte er das Vermögen seiner Frau in die Firma eingebracht. Mrs Davis war die Alleinerbin der Standard Oil-Anteile ihres Großvaters. Inzwischen steckten über elf Milliarden Dollar von Davis Capital in Firmen ganz unterschiedlicher Branchen.
Becca wusste genau, was sie Dick Davis verdankte. Er hatte ihr mit dem Angebot, als Partnerin in die Firma einzusteigen, die Tür zu den höchsten Etagen der Finanzwelt geöffnet. Und das zu einer Zeit, als sie in den Augen vieler seiner Geschäftspartner fast noch ein Kind gewesen war. Mit gerade einmal 26 Jahren hatte sie ihren ersten Deal für Davis Capital gemacht. Dicks Vertrauen in Becca war vom ersten Augenblick an unerschütterlich gewesen, und sie hatte ihn nicht enttäuscht.
Wenn in der Branche von Davis Capital gesprochen wurde, fiel unweigerlich Becca Reinharts Name. Mit 31 Jahren war sie noch immer die jüngste Teilhaberin der Firma, gleichzeitig aber auch diejenige mit den höchsten Provisionen. Ihr Portfolio umfasste beinahe 40 Prozent des investierten Firmenkapitals, und sie zeichnete für über die Hälfte der Gewinne verantwortlich.
Wie sich Becca bei Davis Capital eingeführt hatte, gehörte inzwischen zu den immer wieder gern erzählten Legenden der Branche. Unmittelbar nachdem sie Dicks Angebot angenommen hatte, rief sie Philippe, Dicks damaligen Sekretär, an und fragte ihn nach seinem Gehalt. Dann machte sie Philippe ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Becca war bewusst, wie wichtig es war, einen Assistenten zu haben, der sich in der Branche auskannte, und sie war zu dem Schluss gekommen, dass nur der Sekretär ihres Chefs alle erforderlichen Qualifikationen mitbrachte.
»Hat mir einfach meinen besten Mann ausgespannt«, sagte Dick jedesmal lachend, wenn die Rede auf Beccas Husarenstück kam. »Ohne mit der Wimper zu zucken!« Die Geschichte machte bald in der gesamten Wall Street die Runde. Dick war klug genug gewesen, Becca gewähren zu lassen. Er hegte keinerlei Zweifel daran, dass Beccas grenzenloses Selbstvertrauen der Firma letztlich zum Vorteil gereichen würde. Mit einem weisen Lächeln hatte er Philippe damals aufgefordert, seinen angestammten Platz zu räumen und in Beccas Büro umzuziehen.
Philippe war über diese Veränderung nicht unglücklich gewesen, denn auf diese Weise entkam er Dicks gebieterischer Gattin. Mit seiner neuen Chefin kam er nach einer kleinen Eingewöhnungsphase sehr gut zurecht. Ihr genügte es vollauf, dass er schnell reden, schnell tippen und Termine minutengenau auf drei Monate im Voraus planen konnte. Philippe kümmerte sich um Beccas Terminkalender, erledigte alle Reisevorbereitungen, sortierte die Faxe sowie die Post und hielt alle wichtigen Dokumente sicher unter Verschluss. Becca beschäftigte bald einen weiteren Assistenten, der nur Telefonanrufe entgegennahm, und vergab Rechercheaufträge an einen Stab von Analysten. Zusätzlich nahm sie die Dienste eines Leseservices in Anspruch, der ihr regelmäßig aktuelle Zusammenfassungen sämtlicher wirtschaftlich relevanter Pressemeldungen lieferte.
Doch Becca tat sich schwer damit, wirklich wichtige Aufgaben zu delegieren. Sie hätte ein Team von 50 oder mehr Mitarbeitern beschäftigen können, aber die Firmen, die sie betreute, umklammerte sie wie ein Schraubstock. Sie ließ es sich nicht nehmen, alles selbst zu erledigen – und zu überwachen. Nur in Bezug auf die Organisation ihrer zahllosen Geschäftsreisen hatte sie inzwischen gelernt, Philippe voll und ganz zu vertrauen.
Nun eilte sie zu ihm und ließ sich neben ihn auf die Couch fallen.
»Hast du meine Nachricht bekommen?«, fragte sie. Während sie sprach warf sie einen Blick auf die Uhr, die die Zeit an der Ostküste anzeigte. 11 Uhr 30. Doch erst als sie ihre dunklen, ausdrucksvollen Augen auf Philippe richtete, antwortete er ihr.
»Natürlich. Alles schon so gut wie erledigt.«
In der vergeblichen Hoffnung, Beccas Aufmerksamkeit für einen Augenblick auf sein verändertes Äußeres lenken zu können, strich sich Philippe durchs Haar. Er war stolz auf seine mutige Entscheidung für die neue Farbe. Sein Lebensgefährte Alexander, der in der Upper East Side einen der augenblicklich angesagtesten Friseursalons von Manhattan betrieb, hatte tagelang an dem richtigen Silberton für das Grau an den Schläfen gearbeitet.
Becca dachte laut nach. »Bis Dienstag bin ich in London. Um halb sieben morgens lande ich wieder in New York. Um acht ist die Besprechung bei Wasserstein. Ich schaffe es also dazwischen nicht mehr hierher ins Büro.«
Philippe strich erneut mit den Fingern durch seine Haarpracht. »Ich weiß, Becca, ich weiß. Ich habe die Termine ja selbst eingetragen. Ich werde mit allem bereitstehen, was du brauchst. Du weißt doch, es ist mein höchstes Glück, wenn ich für dich die Kammerzofe spielen darf. Dafür opfere ich sogar meine kärgliche Freizeit.«
»Freizeit? Wie buchstabiert man das?«, gab sie lachend zurück.
Becca stand auf und fischte den Schlüssel ihres Schließfachs im John-F.-Kennedy-Flughafen aus der Schreibtischschublade und versicherte sich, dass sie ihn nicht mit dem Schlüssel für La Guardia verwechselte. Dann schrieb sie Philippe die aktuelle Zahlenkombination für den elektronisch gesicherten Aktensafe auf, in dem sie die wichtigsten Unterlagen aller Firmen, die sie betreute, verwahrte. Sie begann Philippe zu erklären, wo er die Wassersteinordner finden würde, doch er machte nur eine ungeduldige Handbewegung.
»Ich habe die Unterlagen doch selbst abgelegt. Ich weiß, wo sie sind«, versicherte er seiner Chefin. Dabei wühlte er verzweifelt mit beiden Händen in seinem Salz-und-Pfeffer-Haar. Becca konnte die ungeheure Veränderung doch nicht einfach übersehen! Doch Beccas Blick war bereits wieder über ihn hinweggeglitten und auf die Kaffeemaschine gerichtet, zu der sie nun hinüberging.
Philippe verlor langsam die Geduld. Er bemühte sich, Beccas Desinteresse nicht persönlich zu nehmen, denn er erinnerte sich noch gut an den denkwürdigen Augenblick, in dem Becca Dick Davis gefragt hatte, seit wann er denn eine Brille trüge. Das war vor ein paar Monaten gewesen, als sie bis spät in der Nacht in Dicks Büro an dem Celex Deal gefeilt hatten.
»Seit 1992«, hatte Dick zu Beccas grenzenloser Verwunderung geantwortet. Er lachte heute noch darüber.
Philippe lehnte den Milchkaffee, den Becca ihm nun anbot, dankend ab. Die monströse, fest in der Wand installierte Kaffeemaschine mit ihren an die 30 silbernen Knöpfen bot eine endlose Auswahl an Kaffeezubereitungen. Für sich selbst drückte Becca gleich fünfmal auf den Espressoknopf. Dann stellte sie einen großen Becher unter die Ausgussöffnung der Maschine.
In diesem Moment war es um Philippes Beherrschung endgültig geschehen. »Nun sag doch endlich was zu meinen Haaren, Becca!«, flehte er.
Sofort wandte sie sich zu ihm um. »Philippe«, sagte sie mit einem breiten Lächeln, »es sieht großartig aus!«
»Die Old Economy ist wieder im Kommen«, erklärte er eifrig und kam eilig zu ihr herüber. »Alexander sagt, die Leute laufen ihm deswegen beinahe die Türen ein. Alle wollen plötzlich graue Schläfen und graue Koteletten. Das ist die neue Ernsthaftigkeit. Seriosität ist wieder gefragt.«
Becca stellte ihren Kaffee zum Abkühlen in den Kühlschrank. So konnte sie ihn später schneller trinken.
»Schön, schön«, sagte sie. »Die Frage ist nur – wie machen wir diesen Trend zu Geld?«
Eine Minute später schloss sie die Tür hinter Philippe und nahm den Anruf an, der gerade zu ihr durchgestellt wurde. Es gelang ihr, gleichzeitig David Sheffer zu begrüßen und dabei in ihre Laufhosen zu schlüpfen. Sie hatte sich fest vorgenommen, heute ein paar Minuten für das Training herauszuschlagen. Das Laufen war für Viertel nach zwölf in den Kalender eingetragen, und sie pflegte ihren Terminplan eisern einzuhalten.
Sheffer leitete die Kreditabteilung der Europäischen Investmentbank. Becca kannte ihn noch aus der Zeit, in der er bei Morgan Stanley für europäische Stammaktien zuständig gewesen war. Sie gestattete sich eine Bemerkung über die für einen Anruf aus Luxemburg recht ungewöhnliche Uhrzeit. Doch Sheffer antwortete, er sei gerade wieder einmal in New York. Er bat sie, sich einen deutschen Papierhersteller genauer anzusehen, dessen Finanzierung die EIB nicht übernehmen wollte, weil Sheffers Familie in größerem Stil an der Firma beteiligt war. Becca versprach, sich in der kommenden Woche mit der Geschäftsleitung der deutschen Firma zu treffen. Sie hoffte, bis dahin einen qualifizierten Dolmetscher auftreiben zu können. Bei Sheffer bedankte sie sich im Voraus für die Informationen, die er ihr in den nächsten Tagen zukommen lassen wollte. Dann wies sie Philippe per E-Mail an, ihre Termine so umzulegen, dass sie am kommenden Donnerstag für ein Gespräch mit den Deutschen eine halbe Stunde Zeit hatte.
Becca zog mit geübten Handgriffen ihren Sport-BH und ein T-Shirt an, ohne dabei das Headset abzunehmen. Ihre Augen wanderten währenddessen durchs Büro. Überall lagen Stapel von Papieren, die noch durchgearbeitet werden mussten, bevor sie in London aus dem Flugzeug stieg. E-Mails und Faxe gingen im Sekundentakt ein, und ihr Terminplan kam schon durcheinander, wenn sie mit jemandem, den sie zufällig im Flur traf, ein paar freundliche Worte wechselte. Neben der Kaffeemaschine sammelten sich leere Becher zwischen ausgetrunkenen Evian-Flaschen. Die gebrauchten Tassen verschwanden in unregelmäßigen Abständen und wurden durch saubere ersetzt.
Becca warf einen Blick auf die Tüte mit den Bagels, die noch unberührt auf dem Couchtisch lag. Jeden Morgen ließ sie sich eine frische Auswahl direkt ins Büro liefern, um der durchaus vorhandenen Gefahr des Hungertods zu entrinnen. Sie steckte auch immer einen Bagel in ihre Handtasche, denn es kam vor, dass sie auf der Jagd nach einem Taxi den Bürgersteig entlangrannte und plötzlich das Gefühl hatte, dass sich alles um sie herum drehte.
Mit einem weiteren Blick auf die Uhr ging sie zum Laufband hinüber und stellte den Regler auf ›laufen/bergauf‹. Dabei murmelte sie ein paar abschließende Bemerkungen in das Mundstück des Headsets und hoffte, dass Sheffer den Wink mit dem Zaunpfahl verstand und sich verabschiedete. Stattdessen rückte er nun mit dem wahren Grund für seinen Anruf heraus. Er wollte, dass sich Becca im Laufe der Woche mit einem seiner Neffen zum Abendessen traf.
Sie stellte den Regler auf die schnellste Joggingstufe. Nicht noch ein Neffe!
Becca gab sich die größte Mühe, weiterhin höflich zuzuhören, da die Sache mit dem deutschen Papierhersteller durchaus interessant werden konnte. Sheffers Versuche, sie mit einem seiner zahllosen Verwandten zu verkuppeln, wurden allerdings langsam unerträglich. Man hätte glauben können, sie trüge ein Schild auf dem Rücken, auf dem stand: VERZWEIFELTES MÄDCHEN, NOCH ZU HABEN! BITTE HEIRATE MICH! Becca arbeitete sich mit noch mehr Energie als sonst durch ihr Trainingsprogramm. Ihr Unmut über David Sheffers erneuten Vorstoß stachelte sie an.
»Er ist gerade 34 geworden«, erklärte Sheffer fast schon entschuldigend. »Anwalt bei Simpson Thatcher, gute Praxis, hervorragende Aussichten. War noch nie verheiratet.«
»Nimm es mir nicht übel, David«, antwortete Becca schließlich gerade heraus und bereits etwas atemlos. »Aber das Geschäft mit den Deutschen interessiert mich weitaus mehr als eine Verabredung mit deinem Neffen. Ich lasse dich wissen, was ich von der Firma halte, sobald ich sie mir angesehen habe.« Damit beendete sie das Gespräch und lief die nächsten paar Minuten so schnell ihre Füße sie trugen.
Becca verstand nicht, warum gestandenen Geschäftsleuten, mit denen sie solide professionelle Beziehungen pflegte, so viel daran lag, sie unter die Haube zu bringen. Schließlich fragte sie ja auch keinen von ihnen nach seinen eigenen Heiratsaussichten und verkniff sich jeden Kommentar zu den Ehen oder Affären ihrer Geschäftspartner. Diese hingegen schienen es geradezu für ihre Pflicht zu halten, sich in Beccas Privatangelegenheiten einzumischen. Wussten die Leute denn nicht, wie beschäftigt sie war?
Seit ihrem 31. Geburtstag im vergangenen Jahr war es noch schlimmer geworden. Selbst ihre Mutter, die eigentlich von allen Illusionen über die Segnungen der Ehe hätte geheilt sein müssen, bedrängte sie pausenlos, einem netten Jungen wie Gary Yahkzen doch wenigstens eine Chance zu geben. Oder war Urologe etwa kein anständiger Beruf?
Im Gegensatz zu ihrer Mutter schienen Ehen ihrem Vater recht gut zu bekommen. Immerhin war er bereits zum zweiten Mal verheiratet. Noch immer wurde Becca wütend, wenn sie daran dachte, unter welchen Umständen er ihre Mutter verlassen hatte. Damals, kurz nach der Diagnose, hatte sich ihre Mutter einer – zum Glück erfolgreichen – Krebsbehandlung unterzogen. Und ihrem Mann war in dieser Situation nichts Besseres eingefallen, als eine Affäre mit einer Krankenschwester aus der Chemoabteilung zu beginnen und diese Frau später sogar zu heiraten. Diesen Verrat würde Becca ihm nie verzeihen.
Als er ihre Mutter verlassen hatte, war Becca gerade zehn Jahre alt gewesen. Für sie war er seither so gut wie tot. Sie weigerte sich, auch nur von ihm zu sprechen. Beccas Mutter Arlene war es zum Glück gelungen, die Lücke zu füllen, die er hinterlassen hatte. Sie war Becca eine großartige Mutter gewesen und heute ihre engste Vertraute.
Becca versuchte, so oft es nur ging, freitags zum Shabbes Dinner zu ihrer Mutter nach Brooklyn zu fahren. Zurzeit schaffte sie das aber nur alle vier bis acht Wochen einmal. Das tat dem guten Verhältnis zu Arlene jedoch keinen Abbruch. Die beiden Frauen vertrauten auf die Kraft der Liebe, die sie fest miteinander verband, und griffen oft und gern zum Telefon.
Finanziell war Beccas Mutter weitgehend von ihrer Tochter abhängig, sah man einmal von einer schlecht bezahlten Teilzeitstelle im Gemeindezentrum ab. Dort arbeitete Arlene inzwischen nicht mehr wegen des kargen Lohns, sondern weil sie die Geborgenheit in ihrer Religionsgemeinschaft schätzte. In letzter Zeit drehten sich die Gespräche im Zentrum allerdings zunehmend um die Enkelkinder der älteren Gemeindemitglieder. Hätte Becca einen Nachmittag lang Arlenes Freundinnen bei einer solchen Unterhaltung belauschen können, wäre ihr wohl aufgegangen, warum ihre Mutter sie neuerdings zum Heiraten drängte.
Becca spürte, wie sich ihre Wadenmuskulatur durch das Laufen auf dem Band dehnte. Die sportliche Betätigung war für sie unabdingbar, denn so konnte sie innere Spannungen abbauen, bevor sie sich mit Klienten traf. Es war wichtig für Becca, auf ihre Kunden stets ruhig und besonnen zu wirken. Das fiel ihr leichter, wenn sie vor einer Besprechung ihre überschüssige Energie auf dem Laufband loswurde.
Wieder einmal liefen ihre Füße und ihre Gedanken um die Wette. Im Geist ging sie noch einmal die Rede durch, die sie auf der Kapitalmärkte-Konferenz in der nächsten Woche halten wollte.
Mit einem Blick auf die Uhr schaltete Becca das Laufband schließlich ab. Zum Umziehen blieb keine Zeit, also behielt sie ihre Sportsachen an. Sie zog einen Hosenanzug von Armani aus dem Kleiderschrank, rollte ihn sorgsam zu einer festen Wurst zusammen und steckte ihn in ihre geräumige Handtasche. Hinzu kamen Schuhe, Strumpfhosen und eine Garnitur Unterwäsche, die mit ihren Spitzenbesätzen so feminin und sexy war, dass die anderen Besprechungsteilnehmer bei ihrem Anblick sicher nicht schlecht gestaunt hätten. Becca wollte sich in der VIP-Lounge des Flughafens duschen und umziehen.
Eine Sekunde lang schielte sie in den kleinen Spiegel an der Wand neben der Bürotür und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Sie sah nicht, wie das Sonnenlicht die natürlichen Rottöne in ihrem dunklen, glänzenden Schopf akzentuierte. Ein wenig Lippenstift noch, und es konnte losgehen.
»Becca – deine Mutter ist am Telefon«, meldete sich Philippes Stimme über die Sprechanlage.
Das war ungewöhnlich. Ihre Mutter rief sie nie ohne bestimmten Grund zweimal hintereinander an. Becca seufzte. Sie war in Eile.
»Mom?«, fragte sie in ihr Headset und blätterte dabei die Memos in ihrer Eingangsbox durch.
»Schatz, ich hab mir Gedanken gemacht.« Becca stutzte. Man hätte meinen können, ihre Mutter knüpfe an etwas zuvor Besprochenes an. Aber vielleicht war das ja auch so, und Becca konnte sich nur gerade nicht daran erinnern. Sie tauschten ständig Klatschgeschichten, aber auch wichtige Gedanken und Informationen aus. Doch worauf spielte ihre Mutter an?
»Mom – was gibt’s denn?«
»Ich möchte wirklich nicht neugierig sein …«
»Bist du aber.«
»Okay, ich gebe es zu. Hör mal, du hast vorhin irgendwie sonderbar geklungen. Hast du etwas auf dem Herzen?«
Nur der Blick einer Mutter – oder vielleicht auch nur Arlene Reinharts Blick – konnte geradewegs durch die Maske aus Entschlossenheit und Selbstbewusstsein in Beccas Seele dringen.
»Na ja, eigentlich ist es nur eine Kleinigkeit. Der Eigentümer der Londoner Firma hält nicht viel von Frauen im Finanzmetier. Außerdem weiß er nicht, wie alt ich bin.«
»Du meinst wohl, wie jung.«
»So könnte man es auch sagen.«
»Nun hör mir mal zu, Becca Reinhart. Vergiss bloß nie, wer du bist! Du stammst aus der Reinhart-Linie. Und wenn du dich jemals unsicher fühlst, dann denk daran!«
»Das sagst du immer.«
»Es wirkt ja auch jedes Mal.«
Beccas dunkle Augen funkelten amüsiert. »Ja, du hast Recht, Mom …«
»Okay. Und glaubst du, du könntest mich von unterwegs mal anrufen?«
Grrr. Beccas Mutter war eine wunderbare Frau, aber davon abgesehen beherrschte sie – wie alle Mütter – diverse mehr oder weniger subtile emotionale Erpressungsmethoden.
»Ich liebe dich, Mom.«
Nachdem Becca ihrer Mutter durch ihr Headset noch einen Kuss zugeworfen hatte, stürzte sie in Richtung Aufzug davon. Philippe hätte schwören können, dass ihre Füße, die noch immer in den Diesel-Laufschuhen steckten, dabei kein einziges Mal den Boden berührten.
Becca eilte an Sam Wattenbergs Büro vorbei. Die Tür stand offen.
»Becca!«, rief Sam und sprang auf. Becca hastete jedoch weiter. Sam folgte ihr notgedrungen.
»Tut mir Leid, Sam. Um 15 Uhr habe ich am Flughafen eine Besprechung und um 18 Uhr geht mein Flug!«, rief sie ihm über die Schulter zu.
»Und ich gebe in zehn Minuten eine Pressekonferenz. Wie sieht es aus? Welche Teile der Welt stehen deiner Meinung nach im Augenblick am wirtschaftlichen Abgrund?«
Becca seufzte und diktierte Sam im Telegrammstil ein paar ihrer neueren Prognosen. Währenddessen steuerte sie weiter auf den Fahrstuhl zu.
»Venezuela, Peru und Kolumbien: stürzen dieses Jahr wahrscheinlich ab. Russland: alles wie gehabt – Rezession, mal mehr, mal weniger. Ägypten: bestenfalls ein Wackelkandidat. Die Tschechische Republik: langsam aber sicher auf dem Weg nach unten. Japan: könnte die Kurve noch kriegen. Ich tippe aber eher auf Absturz. Argentinien: siehe Peru. Und nun muss ich wirklich los, Sam!«
Als die Fahrstuhltür sich schon schloss, warf Becca Philippe noch schnell eine Kusshand zu. Dann war sie allein. Sie atmete tief durch und lächelte zufrieden. Vorsichtshalber sah sie noch einmal nach, ob Palmtop, Mobiltelefon, Ticketbestätigung und Geldbeutel in ihrer Tasche verstaut waren.
Der Gedanke an die Besprechung in London ließ ihr Herz schneller schlagen. Der Bieter mochte ein sexistischer Betonkopf sein, doch das Angebot der Briten konnte sich sehen lassen und würde wahrscheinlich angenommen werden. Becca hatte vor, sich dafür auszusprechen. Sie glaubte, auch die meisten anderen Investoren mit ins Boot holen zu können. Mit der Firma Machovia hatte sie von Anfang an aufs richtige Pferd gesetzt. Die Geschäfte hatten sich bestens entwickelt. Wenn nun noch der Verkauf an die Briten über die Bühne ging, hatten sich die Investitionen mehr als gelohnt. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit würde man sie sogar für einen Posten im Aufsichtsrat der zukünftigen Holding vorschlagen.
Becca freute sich auf die Maniküre, die sie sich während des Fluges nach London gönnen wollte. Auf den meisten Langstreckenflügen betreute eine vielseitig begabte Wellness-Spezialistin die Mitarbeiter von Davis Capital. Als sich die Türen des Aufzuges zur Lobby hin öffneten, fühlte sich Becca beschwingt und siegessicher. Der Wagen von Davis, der sie zum Flugplatz bringen sollte, stand schon bereit. Sie wollte unterwegs noch schnell bei den amerikanischen Anteilseignern von Machovia anrufen und in Erfahrung bringen, wie sie abstimmen werden. Sicher hatten die meisten von ihnen bereits ihre Vertreter zur Stimmabgabe bevollmächtigt. Sie konnte die Absichten der Herrschaften auch gleich in das Verhandlungsprotokoll aufnehmen lassen. Wen sollte sie zuerst anrufen? Wer hielt die meisten Anteile? Beccas Gedanken rasten. So wenig Zeit, und noch so viel zu tun!
Den scharfen Stich in ihrem Herzen und die leise Trauer, die ihm folgte, bemerkte sie kaum. Erst viel später sollte sie wieder daran denken. Becca Reinhart atmete tief durch. Sie liebte ihren hektischen Beruf.
Zweites Kapitel
Edward Kirkland legte das Rasierzeug weg, klopfte sich mit den Fingerspitzen üppige Mengen von Eau de Toilette auf die Wangen und eilte dann vom Raquet Club über die Park Avenue zum Büro der Kirkland-Stiftung. Wenn er es schaffte, die lästige Schreibtischarbeit innerhalb einer Stunde zu erledigen, ließ sich für den Nachmittag vielleicht noch einmal ein Squash-Match arrangieren.
Ein ganzer Stapel von unbeantworteten Einladungen türmte sich in der edlen Kiste aus Kirschbaumholz, die auf dem handgefertigten Mahagonischreibtisch in Edwards Büro stand. Eine Tiffany-Tischlampe warf verschiedenfarbige Lichtflecken auf die Umschläge. Sie schimmerten in sanften Blau-, Violett- und Grüntönen. Weitere Briefe warteten in einem ordentlichen Stapel auf der ledernen Schreibunterlage gleich neben dem Montblanc-Schreibset in dem Ständer aus Messing. Ein kleiner, längst nicht mehr aktueller Globus ragte nur wenig über die Berge von ungelesenen Einladungsschreiben hinaus. Edward wusste nicht mehr, wie er zu dieser Miniaturweltkugel gekommen war. Wahrscheinlich hatte der Globus, wie so viele andere Gegenstände in diesem Büro, einst das Arbeitszimmer seines Vaters geziert.
Für gewöhnlich herrschte Ordnung, wenn nicht gar gähnende Leere auf Edwards Schreibtisch, denn er hatte wenig zu tun.
Edward kehrte der Arbeit, die an diesem Vormittag auf ihn wartete, erst einmal den Rücken zu und sah zum Fenster hinaus. Sein Blick wanderte zur anderen Straßenseite, wo eine frische Brise die Fahne des Raquet Clubs in der hellen Septembersonne flattern ließ.
Alice Carter, Edwards Privatsekretärin, war unbemerkt eingetreten. Sie streckte demonstrativ die Nase vor und schnüffelte amüsiert.
»Haben Sie in Aftershave gebadet?«
Sie begrüßte Edward mit einem warmen Strahlen in ihren hellbraunen Augen. Wie üblich zog sie sich den ledernen Sessel, der vor seinem Schreibtisch stand, neben den Schreibtischstuhl. Dabei achtete sie darauf, den Perserteppich mit den kräftigen Rot- und Violetttönen, der den gemütlichen Raum ein wenig dunkel machte, nicht über Gebühr zu strapazieren. Schließlich nahm sie Platz.
»Setz dich, Edward, setz dich«, sagte sie. »Am Montag ist schon Labor Day, und für das verlängerte Wochenende liegt einiges an.«
Edward grinste. »Labor Day! Das heißt, der Union Club öffnet am Sonntag den hauseigenen Weinkeller.«
Alice zeigte stumm auf die zahllosen Briefe. Edwards Freude schwand.
»Sag nicht, ich habe für Sonntag irgendwelche anderen Verpflichtungen.«
»Davon würde ich an deiner Stelle ausgehen«, antwortete Alice trocken.
»Hoffentlich sind wenigstens keine sterbenslangweiligen Benefizkonzerte dabei.«
Die Teilnahme an derlei Veranstaltungen ließ sich vor allem dann nicht vermeiden, wenn ›die Familie‹ den jeweiligen guten Zweck in irgendeiner Weise unterstützte. Aber am Sonntag waren sicher alle, die sich sonst auf Empfängen und Galas zugunsten von Hilfsorganisationen tummelten, im Union Club. Beim Gedanken an das abendliche Bankett mit der feierlichen Verkostung bester Weine, das der Club traditionell zweimal jährlich ausrichtete, begannen Edwards Augen zu leuchten.
Alice lächelte. Edwards gute Laune war ansteckend. Sein fein geschnittenes, frisch rasiertes Gesicht war ausdrucksvoller denn je. Dieser junge Mann hatte einen untrüglichen Instinkt für die schönen Dinge des Lebens und verstand es, sie in vollen Zügen zu genießen. Seine tiefblauen Augen leuchteten beim Gedanken an ein gutes Glas Wein wie die Augen eines Schuljungen beim Anblick eines Feuerwehrautos. Doch dann glitt eine dunkle Wolke über Edwards Züge. Die Befürchtung, irgendeine andere gesellschaftliche Verpflichtung könnte ihn von dem Genuss fern halten, spiegelte sich auf seinem Gesicht wider.
Alice wartete gespannt ab. Es dauerte tatsächlich nicht lange, bis Edward wieder lächelte. Seine Sekretärin kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er bereits einen Plan hatte, mit dessen Hilfe es ihm gelingen würde, allen ungeliebten Terminen am Labor Day entwischen und doch noch in den Union Club gehen zu können.
»Du solltest endlich heiraten. Dann könntest du dich bei Veranstaltungen, die dir zuwider sind, durch deine Gattin vertreten lassen«, neckte sie ihn. »Und du müsstest keinen Sonntag im Club ausfallen lassen.«
»Willst du mir den Tag verderben, indem du von meiner Beerdigung sprichst?« Edward hob tadelnd den Zeigefinger, grinste aber dabei.
»Edward!«, mahnte Alice. »Ich bin doch auch verheiratet. Du solltest die Ehe wirklich nicht so verteufeln. Eine Heirat wäre sogar gut für dich. Seit du 30 geworden bist, wünscht sich deine Mutter nichts sehnlicher, als dass du dich verlobst. Sie will dich endlich glücklich sehen …«
»Alice«, unterbrach Edward seine Privatsekretärin und straffte die Schultern. »Komme ich dir auch nur ansatzweise unglücklich vor?«
Das war eine rein rhetorische Frage. Alice schüttelte verneinend den Kopf. Dabei blickte sie zu Boden. Sie hoffte, dass Edward ihr nicht ansah, wie sehr sie ihn bewunderte. Dieser junge Mann genoss das Leben wie kein Zweiter.
»Wie dem auch sei. Du könntest sicher mehr Zeit im Club verbringen, wenn deine Gattin dir einige besonders lästige gesellschaftliche Auftritte abnehmen würde«, beharrte Alice. Als sie den ersten Stapel Einladungsschreiben vom Tisch nahm, ließ die Morgensonne ihren dezenten transparenten Nagellack aufschimmern. Edward hielt sie mitten in der Bewegung auf. Er legte ihr die Hand auf den Arm und drehte ihren Kopf mit der anderen Hand zu sich herum. Dann musterte er sie aus zusammengekniffenen Augen wie ein Detektiv. »Ich muss wohl demnächst deine finanziellen Verhältnisse überprüfen lassen. Ich möchte wetten, es gibt da gewisse Unregelmäßigkeiten.«
»In meinen Verhältnissen?«, gab sie keck zurück.
»Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit.« Er ließ ihren Arm los. »Wer versucht, mir die Ehe schmackhaft zu machen, und mir auch noch weismachen will, ich könnte dann mehr Zeit im Union Club verbringen, wird sicher dafür bezahlt. Und zwar von Bunny Stirrup.«
Alice lächelte. Geld bekam sie nur von Edward – und zwar dafür, dass sie ihm die weniger angenehmen Details seines privilegierten Lebens abnahm. Sie war ein Ritter der Kirklandschen Tafelrunde, gehörte zum Tross ergebener Diener der Familie. Alice fühlte sich in dieser Position sehr wohl und strebte nicht nach mehr. Als Privatsekretärin, die in den Diensten derart wohlhabender Persönlichkeiten stand, begnügte sie sich gern damit, ein bescheidenes Leben im Schatten der Großen zu führen.
Es war nicht leicht, einem Außenstehenden zu erklären, worin ihre Arbeit im Einzelnen bestand. Denn ihre Aufgaben hatten nur entfernt etwas mit den Abläufen in einem gewöhnlichen Büro oder Sekretariat zu tun. Vielmehr betrachtete sie sich als Mädchen für alles. Sie war Kammerzofe und Übermittlerin vertraulicher Botschaften, fungierte als Vertraute und manchmal auch als Gewissen. Sie kannte sich mit sämtlichen Spielarten der feinen Gesellschaft bestens aus und erledigte ihre Arbeit selbstverständlich unter Wahrung äußerster Diskretion. Sie wusste sich in Wort und Schrift auszudrücken, und manchmal, wenn es sein musste, brachte sie auch unangenehme Tatsachen aufs Tapet. Privatsekretärinnen arbeiteten für Persönlichkeiten, die es ihrerseits nicht nötig hatten, einer festen Arbeit nachzugehen.
Alice war Edward von der Pavillon-Agentur vermittelt worden. Sie hatte beste Manieren und bei aller Zurückhaltung ein einnehmendes Wesen. Wie die meisten anderen Damen, die gemeinsam mit ihr die Ausbildung bei Pavillon durchlaufen hatten, war Alice als Kind auf Privatschulen gegangen und zählte einige gut betuchte Persönlichkeiten zu ihrem Freundeskreis. Sie bewegte sich sicher auf dem gesellschaftlichen Parkett, wusste aber gleichzeitig, dass sie in den vornehmsten Kreisen zwar geschätzt wurde, aber nicht wirklich dazugehörte. Alice sah sich selbst als eine Art charmantes Accessoire: taktvoll, zuverlässig und dabei ganz und gar harmlos.
Mit ihrer Unterstützung meisterte Edward ein Leben voller gesellschaftlicher Verpflichtungen und Veranstaltungen, das sich zwischen Manhattan, den Hamptons, England und den Bermudas abspielte. In jeder Saison und an jedem Ort gab es bestimmte Arten von Feierlichkeiten – viele davon steif und formal, andere wiederum dekadent und ausschweifend. Das hing ganz von den jeweils anwesenden Gästen und vom Anlass ab. Laut ihres Arbeitsvertrags war Alice die Sekretärin des Vorsitzenden der Kirkland Philantropic Foundation, einer mildtätigen Stiftung der Familie Kirkland. In dieser Eigenschaft befand sie sich nun auch mit Edward in dessen Büro. Hier arbeitete sie recht gern, denn an Bürotagen konnte sie die Mittagspause in der Stadt verbringen, anstatt mit den Zimmermädchen in der Dienstbotenküche der Kirklands zu Mittag zu essen. Juristisch betrachtet war die Kirkland-Stiftung nichts anderes als eine Körperschaft, ein offizieller Mantel, der Edwards Schultern bedeckte. Edward wiederum war die Sonne, um die sich Alice drehte. Sie verehrte ihn. Er war zehn Jahre jünger als sie, und sie betrachtete ihn als eine Art Neffen, oder sogar als Freund.
Sie schätzte Edward Kirklands freundliches, aufmerksames Wesen. Bei diesem liebenswürdigen jungen Mann angestellt zu sein, war für Alice um vieles angenehmer als die Arbeit, der sie vorher nachgegangen war. Sie hatte zuvor in Leslie Davis’ Diensten gestanden. Mrs Davis, Haupterbin des Standard-Oil-Vermögens, war eine überaus einträgliche Ehe mit dem Gründer einer bekannten Investmentfirma eingegangen. Alice wurde bei den Davis’ eingestellt, da Mr Davis’ Sekretär mehrmals mit der Kündigung gedroht hatte. Offenbar hatte Mrs Davis den Angestellten ihres Mannes nämlich als ihren Leibeigenen betrachtet und ihn in Ermangelung einer eigenen Sekretärin mit Sonderwünschen überhäuft. Wenn sich die Familie Davis zum Beispiel anschickte, nach St. Barts in die Karibik zu fliegen, musste der Sekretär vorausreisen, um vor Ort dafür zu sorgen, dass Mr und Mrs Davis bei allen wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen ganz oben auf der Gästeliste standen. Der Sekretär war von diesen Aufgaben ganz und gar nicht begeistert, und so war Alice von Leslies Gatten, Dick Davis, als Privatsekretärin für seine Frau engagiert worden.
Zunächst war Mrs Davis von den Fähigkeiten der bescheidenen Alice, die ein Zimmer im Haus der Familie bewohnte, begeistert gewesen. Dann hörte sie jedoch von einer Tennispartnerin, dass der Gründer einer Fortune-500-Firma, eines der 500 bedeutendsten Unternehmen der Vereinigten Staaten, die Privatsekretärin seiner dritten Frau geheiratet hatte. Leslie Davis fuhr daraufhin umgehend nach Hause und warf ihre verdutzte Angestellte auf der Stelle hinaus.
Alice hatte sich inzwischen längst von diesem Schreck erholt. Sie arbeitete jetzt für Edward, und für ihn war sie unersetzlich. Er vertraute ihr ohne Wenn und Aber – ein Umstand, der ihm einen festen Platz in ihrem Herzen sicherte.
»Bunny Stirrup bezahlt mir keinen Cent«, widersprach Alice nun lächelnd. »Das weißt du ganz genau. Aber was das Heiraten angeht, sind und bleiben wir offenbar geteilter Meinung. Ich bin noch immer überzeugt, dass du eine Frau brauchst.«
»Und ich bin der Meinung, du solltest dich mit der Tatsache abfinden, dass ich auch ohne Ehefrau rundum glücklich bin«, entgegnete Edward mit einem gutmütigen Lächeln.
Um der fruchtlosen Diskussion ein Ende zu machen, wandte sich Alice nun endgültig dem Grund ihres Aufenthalts im Büro zu.
»An die Arbeit«, sagte sie streng und nahm den ersten Umschlag von dem Stapel. Dabei fielen die anderen Umschläge zur Seite und verteilten sich fächerartig über die lederne Schreibunterlage.
Alice und Edward waren ein eingespieltes Team. Gestärkt durch eine Tasse Kaffee arbeiteten sie sich effizient und konzentriert durch den Berg der Einladungen.
»Okay. Wie halten wir es mit ›Golf gegen Glaukome‹? Spender, Sponsor oder Schirmherr?«, fragte Alice. Dabei hielt sie eine teure Karte mit Wappenprägung hoch.
»Gehört jemand aus der Familie zu den Initiatoren?«
»Nein.«
»Haben wir uns im letzten Jahr irgendwie beteiligt?«
»Ja. Muffy London setzt sich sehr für diese Sache ein. Das hast du doch wohl nicht vergessen? Ihr Großvater ist an einem Glaukom gestorben. Man sagt auch Grüner Star dazu.«
Edward versuchte, nicht laut herauszulachen. Ein Grinsen konnte er sich allerdings nicht verkneifen.
»An dieser Augenkrankheit stirbt man nicht. Ich erinnere mich noch recht gut an Pepper London. Er muss um die 200 Jahre alt gewesen sein. Eines Tages fiel er schlicht und ergreifend aus dem Bett, verschüttete dabei sein letztes Glas Brandy und verschied.«
»Muffy behauptet steif und fest, das Glaukom sei sein Tod gewesen. Sie sagt, er wäre nie und nimmer aus dem Bett gefallen, wenn seine Augen ihn nicht im Stich gelassen hätten.«
»Allzu schlecht war es um ihn mit Sicherheit nicht bestellt. Man sagt, er habe sich zu der bewussten Zeit gemeinsam mit Sharon Leland in dem betreffenden Bett befunden.«
Bei dem Gedanken an den unverbesserlichen alten Pepper musste nun auch Alice lächeln. »Du kannst es Muffy nicht verübeln, dass sie sich unter diesen Umständen lieber auf das Glaukom konzentriert«, gab sie zu bedenken.
»Ja, das verstehe ich.« Edward dachte einen Augenblick lang darüber nach, ob und in welcher Weise er Muffys karitative Bemühungen unterstützen sollte. Im Grunde war die ganze Veranstaltung ziemlich harmlos. Allerdings wollte er dem Kampf gegen den Grünen Star nicht einen ganzen Tag und einen ganzen Abend opfern. Aber so lange dauerte ein Golfturnier über 18 Löcher mit anschließendem Dinner nun einmal.
Edward versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie das Ganze im vergangenen Jahr abgelaufen war. An die Preise für die Sieger des Golfturniers konnte er sich noch erinnern. Der beste Spieler hatte einen Satz silberner Cocktailrührstäbchen gewonnen. Sie stammten von Tiffany und hatten die Form von Golfschlägern. Als Trostpreise hatte es Gucci-Sonnenbrillen und eine Sehtesttafel gegeben, gestiftet von der Zapper-Laser-Augenklinik.
Die Zapperklinik, im vergangenen Jahr wohl der Hauptsponsor der Veranstaltung, hatte darüber hinaus Golfhemden in Neonfarben und mit Glitzeraufdruck beigesteuert – ein Segen für alle Veranstaltungsteilnehmer, die sich über nachlassende Sehkraft beklagten. Solche Hemden waren auch aus größerer Entfernung nicht zu übersehen.
»In welcher Weise haben wir uns im letzten Jahr an der Veranstaltung beteiligt?«
»Du hast sowohl gespendet als auch an der Veranstaltung teilgenommen.«
»Gibt es irgendeinen Grund, es diesmal anders zu halten?«
»Nein.«
Edward schob seine leer getrunkene windsorblaue Kaffeetasse von sich. Er war ein Freund guten Essens und Trinkens, doch er verabscheute den Anblick von Essensresten und benutztem Geschirr.
»Wie viel?«
»10 000, wenn du nur spendest. 20 000 für einen Tisch.«
Alice beeilte sich, Edwards Kaffeetasse wegzuräumen. Sein leicht angewiderter Gesichtsausdruck war ihr nicht entgangen. Leere Tassen waren ihm ein Greuel. Genau wie Tischdamen, die zum Frühstück blieben.
»Wo findet ›Golf gegen Glaukome‹ statt?«
»In Piping Rock«, antwortete Alice über die Schulter, während sie die Tasse abspülte.
»Gut. Also einen Tisch.«
Alice nickte und nahm wieder an Edwards Seite Platz.
»Acht Personen pro Tisch«, sagte sie, den Federhalter schon in der Hand.
Edward verschränkte die Hände hinter dem Kopf und lehnte sich zurück. »Acht – das dürfte kein Problem sein. Ruf George und Bonnie Whelan an, Clifford und Susie Marks, Arthur Sterns und Amy Kolasky, und … für mich …«
Er dachte nach. Schließlich musste er es mit der Dame seiner Wahl einen ganzen Tag lang aushalten.
»Ich weiß nicht recht. Was hältst du von Cricket Quinn?«
Alice legte die Stirn in Falten. »Sie spielt in der LPGA, und ich weiß nicht, ob Profis bei ›Golf gegen Glaukome‹ erwünscht sind.«
»Warum denn nicht?«
Als Vorsitzender der mildtätigen Stiftung seiner Familie hatte Edward Kirkland im Wesentlichen zwei Aufgaben: Er entschied, welche Benefizveranstaltungen er mit dem Geld der Familie unterstützen und welche er mit seiner Anwesenheit beehren wollte.
Nahm Edward eine Einladung an, so machte sich Alice sofort ans Werk. Sie verfasste das Antwortschreiben und rief die Dame an, die sich Edward zur Begleiterin erwählt hatte. Gegebenenfalls suchte sie den Tisch aus, lud Gäste ein und brachte die Speisenfolge in Erfahrung. Außerdem gab sie dem Bedienungspersonal der Veranstaltung hilfreiche Tipps, wie eventuelle Würdenträger anzusprechen waren, und achtete darauf, dass Links- und Rechtshänder einen für sie günstigen Sitzplatz erhielten.
Alice rief außerdem Edwards Fahrer James an, der die jeweilige Veranstaltung in seinen Terminplan aufnahm und dann seinerseits mit Edwards Mutter telefonierte. Catherine Kirkland legte Wert darauf, stets darüber informiert zu sein, wo sich ihr Sohn gerade aufhielt. Zahlungsanweisungen für Spenden wiederum reichte Alice an Milton Korick weiter, der bei Morgan Stanley Edwards Konten verwaltete. Milton führte die Bücher und sorgte dafür, dass Spenden und Zuwendungen termingerecht überwiesen wurden.
Bevor sich Edward auf den Weg zu einer der Veranstaltungen machte, drückte Alice ihm meist noch einen Zettel in die Hand. Diesem nützlichen Stück Papier konnte er hilfreiche Informationen über die Art des Festes, seinen Sinn und Zweck sowie Hinweise auf passende Gesprächsthemen mit Gästen, die er weniger gut kannte, entnehmen. Als speziellen Service fügte Alice meist noch allerhand Wissenswertes über Edwards Tischdame hinzu. Das konnte deren Geburtsort sein oder welche Speisen sie bevorzugte. Edward stand in dem Ruf, ein besonders aufmerksamer Gesellschafter zu sein. Diesen Umstand schrieb Alice insgeheim ihrer Leidenschaft für gründliche Recherchen zu.
Weiter ging es nun mit einer Einladung zu ›Tango gegen Thrombosen‹. La Paella, ein beliebtes Tapas-Restaurant, würde das Catering übernehmen. Alice drängte Edward, eine Begleiterin für die Veranstaltung zu benennen.
»Mit wem bin ich denn am Abend vorher verabredet?«, fragte Edward und wartete, bis Alice in ihren Unterlagen nachgesehen hatte. Zu diesem Zweck drückte sie ein paar Tasten auf einem handtellergroßen elektronischen Gerät. Wenn Edward irgendwelche Informationen brauchte, drückte er immer nur die Tasten seines Mobiltelefons und rief Alice an.
»Du dinierst mit Cricket Pierpont bei der New York Historical Society.«
Gut, dachte Edward zufrieden. Die lebhafte Cricket würde dafür sorgen, dass er sich bei dieser steifen Veranstaltung nicht zu Tode langweilte.
Noch eine Cricket, dachte Alice. Manchmal war es schwierig, die jungen Damen, mit denen Edward ausging, auseinander zu halten. Erstaunlich viele von ihnen hatten denselben Vornamen.
»Bin ich in dieser Woche mit noch jemandem verabredet?«
»Ja. Mit Bee Frothingham, mit Bitsy French und Whitney St. Clair. Bee und Bitsy führst du zum Dinner aus, Whitney zum Lunch.«
»Ist Morgan Devonshire inzwischen aus Wales zurück?«
»Selbstverständlich. Sie hat ein Zelt beim Harriman.«
»Tatsächlich? Gut, dann gehe ich mit Morgan zum Tango.«
»Wunderbar«, sagte Alice. Schon hatte sie den nächsten Umschlag in der Hand.
»Hier – das hatten wir noch nie: ›Gesellschaft zur Unterstützung der Einbalsamierung‹. Ein Dinner.«
Edward verzog das Gesicht. »Dinner?«
Sie zuckte die Achseln.
»Ablehnung mit Spende«, sagte er kopfschüttelnd. Er hatte schon Galadinners erlebt, bei denen Chirurgen detailliert eine Herztransplantation geschildert oder sich über Spenderorgane oder Prostatakrebs ausgelassen hatten. Aber sich ein saftiges Filet einzuverleiben, während ein Tischgenosse womöglich in den höchsten Tönen für das Einbalsamieren von Leichen schwärmte, das ging eindeutig zu weit.
»Okay.« Alice zog einen rosaroten Umschlag mit Goldkante aus dem Stapel. Dieser Einladung – sie kam von der ›Gesellschaft für den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika‹ – war ein persönlicher Brief an Edward beigefügt. Er stammte von einer seiner Verflossenen, die einst eine schwere Mandelentzündung hatte erdulden müssen und dabei feststellte, dass ihr Körper gegen die meisten Antibiotika resistent war. Die Dame bat Edward inständig, an der Veranstaltung teilzunehmen.
»Vielleicht hätte sie sich die Mandeln herausnehmen lassen sollen«, sinnierte er. »Aber wenn ich mich recht entsinne, war sie Sängerin. Möglicherweise behält man seine Mandeln da lieber. Jedenfalls hat sie ihren Hals-Nasen-Ohren-Arzt geheiratet. Wo findet der Abend statt?«
»Im River Club.«
»Weiße Krawatte?«
»Halte ich für passend.«
»Ich nehme Minnie Forehand mit.«
»Die ist inzwischen verheiratet.«
Edward zog überrascht die Augenbrauen hoch, doch er fing sich schnell wieder. »Dann eben Deb Norwich.«
»Sie gehört zu den Veranstaltern. Hatte wohl irgendwann eine antibiotikaresistente Form von Mono. – Du weißt schon – man kann auch Pfeiffersches Drüsenfieber oder Kuss-Krankheit dazu sagen. Deb ist jedenfalls schon dort.«
Edward zuckte die Achseln. »Dann eben Cricket St. James.«
»Die ist in Paris.«
»Sicher kommt sie spätestens bis zum Labor Day-Wochenende wieder zurück.«
»Ich rufe sie gleich heute Abend an.« Alice schenkte sich Kaffee nach. Edward lehnte eine weitere Tasse Kaffee ab und entschied sich stattdessen für ein Glas von dem frisch gepressten Orangensaft, den Alice immer für ihn bereithielt. Ohne dass er danach fragen musste, holte sie zusätzlich eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank, denn sie wusste, dass er seinen Saft gern mit etwas Sprudel vermischt trank. Wenn es später am Tag gewesen wäre, hätte sie der Mischung noch Preiselbeersaft hinzugefügt. Dieses Getränk nannten sie seine »Nachmittagsjungfer«.
Alice machte es nichts aus, Edward zu verwöhnen. Im Gegenteil, sie tat es gern, und das lag allein an seinem unwiderstehlichem Charme. Wie eine leidenschaftliche Köchin, die glücklich ist, wenn es ihren Gästen schmeckt, freute sich Alice über Edwards Wohlbehagen, wenn sie ihm wieder einmal einen seiner Wünsche von den Augen abgelesen hatte. Er wiederum war dankbar für die vielen Geschenke, die das Leben für ihn bereithielt, und er zeigte das auch.
»Eins würde mich noch interessieren. Natürlich nur, wenn es dir nichts ausmacht«, sagte Alice, während sie ihm das halb volle Glas Orangensaft und die Wasserflasche reichte. »Warum nimmst du Bunny zu keiner der Veranstaltungen mit?«
Edwards Miene verfinsterte sich. Doch Alice ließ sich nicht beirren. »Den Sommer über habt ihr doch öfter etwas miteinander unternommen.«
»In den Hamptons sind wir ja auch Nachbarn«, antwortete Edward und bemühte sich, so unbeteiligt wie möglich zu klingen. »Da kann ich ihr schlecht aus dem Weg gehen. Außerdem gehört sie sozusagen …«
Alice ließ Edward nicht aus den Augen. Er wiederum studierte intensiv die Holzdielen des Fußbodens, während er weitersprach.
»Sie gehört sozusagen zur Familie.« Alices Blick auszuweichen nutzte ihm nichts. Er konnte sich nichts vormachen. Selbst der Teppich unter dem Schreibtisch erinnerte ihn noch an Bunny. Im Speisezimmer ihrer Eltern lag ein beinahe identisches Stück. Oft schien es ihm, als wäre das Wohnhaus im Tudorstil, dessen 22 Zimmer Bunnys Familie in den Hamptons bewohnte, nichts weiter als ein Seitenflügel seines Elternhauses.
Die Bilder hingen auf derselben Höhe und an denselben Stellen. In fast jedem Zimmer konnte man die Konterfeis von jeweils vier Ahnen bewundern, wobei das des ältesten Verwandten natürlich über dem offenen Kamin prangte. Kandelaber waren an den gleichen strategischen Stellen angebracht, goldgerahmte rechteckige Spiegel hatten in beiden Häusern ihren Platz über der Couch. Orientalische Muster, darunter der Klassiker mit den Äffchen, die Quastenmützen trugen und durch blütenreiche Urwälder hüpften, zierten in allen Zimmern entweder die Polster oder die Übervorhänge – nie aber beides. Gewaltige und kaum zu unterscheidende Landschaftsbilder in Öl hingen in den Eingangshallen beider Häuser, während Darstellungen verschiedener sportlicher Aktivitäten die Wände der Arbeitszimmer schmückten. Die schweren, mit Blattgold belegten Bilderrahmen erinnerten Edward stets an stumpfe Guillotinen.
Im Haus von Bunnys Eltern gab es ein überaus schmeichelhaftes Porträt einer inzwischen verstorbenen Tante. Es zeigte sie als Debütantin, und nichts deutete darauf hin, dass sie sich zeitlebens nur im Rollstuhl hatte fortbewegen können. Vasen mit frischen Blumen waren so im ganzen Haus verteilt, dass sie planmäßig von der Morgen-, Mittags- oder Abendsonne beschienen wurden. Perserteppiche lagen parallel zu den Wänden auf den Parkettböden, umlaufende Holzleisten hoben sich in strahlendem Weiß von dem eleganten Ziegelrot der Wände ab. Standuhren, Schirmständer und Lampen mit handbemalten Schirmen standen in denselben Ecken beinahe identischer Räume. Manchmal schien es Edward, als hätten die beiden Häuser sich aus ein und derselben Mutterzelle entwickelt und sich nur irgendwann voneinander abgespalten.
Bunnys Vater, Randall Stirrup, lebte nicht mehr. Er und Edwards Vater hatten über ein Dutzend geschäftlicher Projekte gemeinsam zum Erfolg geführt. Seit sich Edward erinnern konnte, verbrachten die Kirklands und die Stirrups die Sommerwochen gemeinsam in ihren benachbarten Häusern in den Hamptons. Wie gut sich die Mütter verstanden, konnte man allein daran sehen, dass Edward und Bunny in einem Jahr den ganzen Sommer über ein gemeinsames Kindermädchen gehabt hatten.
Zum Glück war Bunny nach Choate gegangen, weil dort Reiten auf dem Stundenplan stand, während Edward seine Schulzeit in St. George vorwiegend mit Segeln verbracht hatte. Auf diese Weise hatte er Bunny wenigstens in den High-School- und College-Jahren nicht ständig um sich gehabt. Auch waren Bennington und Harvard so weit voneinander entfernt, dass Edward während des Studiums nur selten mit Bunny zusammengetroffen war. Thanksgiving und Weihnachten hatten sie dann allerdings wieder gemeinsam gefeiert. Und natürlich waren sie in den langen Sommern viel zusammen gewesen.
Edward wusste, dass man ihm Bunny im Grunde schon vor Jahren mehr oder weniger eindeutig auf einem silbernen Tablett serviert hatte. Man erwartete, dass sie eines Tages heiraten würden. Manchmal kam es Edward fast vor, als hätten seine Eltern dieses Mädchen eigens für ihn erfunden.
Alice goss ihm schweigend Mineralwasser in den Saft.
»Danke.«
»Heute Abend bist du gemeinsam mit Bunny auf einer Veranstaltung«, sagte sie mit sanfter Stimme.
»Kann ich die nicht einfach schwänzen?«, fragte Edward hoffnungsvoll.
»Nein, Sir. Es handelt sich um eine Ehrung, und einer der beiden Geehrten bist du.«
»Wer ist der Zweite?«
»Die Zweite ist Bunny.«
Edward seufzte. Seine Anwesenheit war offenbar unvermeidlich.
»Worum geht es denn diesmal?«
»Um ›Armani für alle‹.« Alice schaffte es, halbwegs ernst zu bleiben, während sie ihm die Altkleidersammlung besonderer Art beschrieb, die Bunny initiiert hatte. Bunny saß einem Komitee vor, das unter den oberen Zehntausend abgelegte Kleidungsstücke von Giorgio Armani und anderen namhaften Designern sammelte und diese dann an Obdachlose verteilte. Die Bereitwilligkeit, mit der die Spender ihre begehbaren Kleiderschränke entrümpelten, war wohl dem Umstand zuzuschreiben, dass man in gewissen Kreisen Haute Couture für ein Grundbedürfnis jedes Menschen hielt. Auf einem Festempfang, der im Rahmen einer Armani-Retrospektive im Guggenheim Museum stattfand, sollten Bunny und Edward nun für ihr Engagement geehrt werden. Sie für ihr persönliches, er für sein finanzielles.
Über einen gravierenden Mangel bei der aufwändigen Umverteilung edler Kleidungsstücke sahen die Organisatoren der Ehrung diplomatisch hinweg: Als Spenden waren durchweg Designerstücke in den amerikanischen Größen zwei bis sechs eingegangen. Schließlich hatte auch die Großherzigkeit betuchter Modejünger ihre Grenzen. Man gab nun einmal nicht gern ein Stück von Armani aus der Hand, das man selbst noch tragen konnte. Infolgedessen passten die gespendeten Kleider nur den Ausgemergeltsten unter den Obdachlosen. Bunny hatte es deshalb auch rundweg abgelehnt, sich mit einer dieser armen Seelen fotografieren zu lassen. Ihrer Vorfreude auf den Empfang und die Ehrung tat das allerdings keinen Abbruch.
Edward schüttelte den Kopf. »Und was trägt man dazu?«
»Armani natürlich.«
Alice erwähnte noch beiläufig, dass Bunny schon am Morgen im Büro vorbeigeschaut und nachgefragt hatte, welchen Frack von Armani Edward tragen würde, und ob er sich für eine Weste oder einen Kummerbund entschieden hätte. Sie hielt es für absolut unabdingbar, dass sie ihre Kleidung aufeinander abstimmten. Schließlich würde man sie auf dem Podium zusammen für die Gesellschaftsseiten der New York Times fotografieren.
»Hat sie sonst noch etwas gesagt?«
»Ja. Sie kommt um sieben Uhr zu dir ins Carlyle, damit ihr vor dem Empfang noch einen Drink nehmen könnt.«
Edward stöhnte gequält auf. Offenbar wollte Bunny ihn erst einmal zu Hause in Augenschein nehmen und gegebenenfalls dafür sorgen, dass er sich noch einmal umzog. Das dominante Wesen seiner Mutter ertrug Edward mit stoischer Geduld, denn sie tat ihm Leid. Aber niemals würde er sich von Bunny oder irgendeiner anderen Frau herumkommandieren lassen.
»Vielleicht verpassen wir einander ja zufällig«, sagte er hoffnungsvoll.
»Rechne lieber nicht damit.«
Edward warf einen Blick auf seine Patek-Philippe-Armbanduhr.
»Wo findet die Ehrung denn statt?«
»Im Guggenheim.« Alice lächelte. Sie wusste, was Edward von dem spiralförmigen Museumsbau hielt.
»Im Schneckenhaus!« Edward vergrub das Gesicht in den Händen. Er hasste Veranstaltungen im Guggenheim! Ihm wurde sogar schwindelig, wenn er nur bewegungslos in der Mitte des ungewöhnlichen Baus stand. Und ganz gleich, wohin man ging, immer befand man sich auf schrägem Untergrund und musste gegen das Gefühl ankämpfen, man könnte jeden Moment einen Abfluss hinuntergespült werden.
»Am besten gehe ich vorher noch zur Apotheke und besorge mir etwas gegen Übelkeit.« Edward war tatsächlich ein wenig blass geworden. Ob ihm eher das Guggenheim als Veranstaltungsort oder der Bunny-Faktor auf den Magen geschlagen war, vermochte Alice nicht zu sagen.
Als das Telefon klingelte, schüttelte Edward energisch den Kopf.
»Lass es läuten«, sagte er zu Alice. »Wenn es Bunny ist, ruft sie in zehn Minuten sowieso noch mal an.«
»Okay. Was soll ich ihr dann sagen? Wo kann sie dich erreichen?«
»Nirgends«, antwortete er. »Ich bin den ganzen Tag über unterwegs.«
Als Antwort auf den missbilligenden Blick, den Alice ihm zuwarf, fügte er hinzu: »Keine Sorge, Alice. Ich werde pünktlich im Museum sein und mich anständig benehmen. Mit Bunny komme ich schon zurecht.«
Alice schüttelte kaum merklich den Kopf. An Edwards letzter Aussage hatte sie gewisse Zweifel. Es gab Kräfte, denen Edward trotz all seines Charismas nicht gewachsen war. Kräfte, die danach strebten, zwischen ihm und Bunny Stirrup eine horizontale Linie in den Familienstammbaum zu malen, damit das Kirkland-Erbe weitergegeben werden konnte. Bunny umkreiste ihr Opfer schon seit geraumer Zeit. Alice wünschte Edward von Herzen, dass es ihm gelang, aus dem Netz, das sich immer enger um ihn zog, zu entkommen. Doch das war in etwa so wahrscheinlich wie die Vorstellung, dass seine Mutter in einem Betsey-Johnson-Minikleid zum Tee erschien.
Was konnte ein einzelner Mensch schon gegen die festgefahrenen Strukturen der feinen Gesellschaft von Manhattan ausrichten? Die Kirklands hatten hier schon etwas gegolten, bevor das Social Register – eine Art Verzeichnis der Begüterten und Einflussreichen – überhaupt erfunden worden war. Edward würde dasselbe tun wie Generationen von Kirklands vor ihm: Er würde heiraten. Alice war sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Denn wenn er seine Zukunft nicht selbst in die Hand nahm, würde sich seine Mutter darum kümmern. Catherine DeBeer Whitney Kirkland, der seit dem Augenblick ihrer Geburt elf Prozent der größten Diamantenmine Südafrikas gehörten, war nicht unbedingt für ihre grenzenlose Geduld bekannt.
Alice betrachtete Edward voller Zuneigung. Sie wünschte ihm von Herzen, dass er sein Leben so weiterführen konnte wie bisher. Doch leider war das völlig unmöglich.
»Schwindelst du notfalls ein bisschen für mich?«, fragte er mit der Zuversicht eines Menschen, der weiß, dass ihm seine Bitten selten abgeschlagen werden. In dem Lächeln, das Alice ihm daraufhin zuwarf, lag ein Anflug von Traurigkeit.
»Ich gehe mit Jenny Maifair zum Lunch. Rufst du sie für mich an? Bitte! Sag ihr, ich erwarte sie im Balthazar.«
»In Ordnung, Edward«, antwortete Alice. Sie musste über den Seufzer der Erleichterung lachen, der ihm entfuhr. »Bist du für jemanden zu erreichen?«
Edward dachte darüber nach, während er sich zum Gehen fertig machte.
»Für meine Mutter natürlich.«
»Das versteht sich von selbst.«
»Aber sonst für niemanden.«
Alice nickte.
»Was würde ich nur ohne dich anfangen, Alice?« Er drückte ihr schnell einen Kuss auf die Wange und eilte dann zur Tür.
Sie grinste. »Das weiß ich nicht. Aber an deiner Stelle würde ich die Treppe nehmen. Man weiß nie, wer einem im Fahrstuhl begegnet!«
»Du bist unbezahlbar!«, rief Edward. Dann zog er die Tür hinter sich zu.
Drittes Kapitel
Bunny Stirrup brauchte keinen Spiegel. Wie umwerfend sie aussah, konnte sie an den bewundernden Blicken der elegant gekleideten Gäste ablesen. Triumphierend zog sie gemessenen Schrittes ihre Bahnen. Die tausend Details, um die sich Bunny als Vorsitzende von ›Armani für alle‹ gekümmert hatte, vereinten sich nun zu einem brillanten Gesamtkunstwerk. Voller Ehrfurcht vor ihrer eigenen Großartigkeit schritt sie durch die Galerie.





























