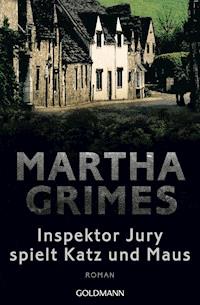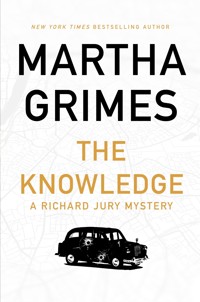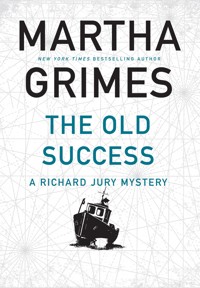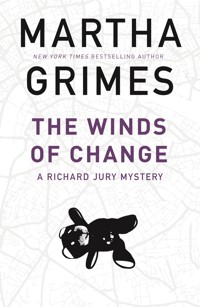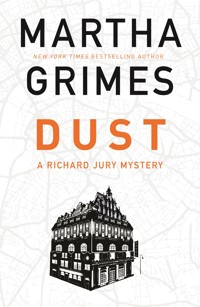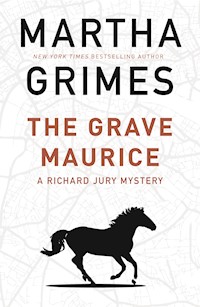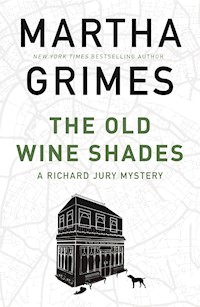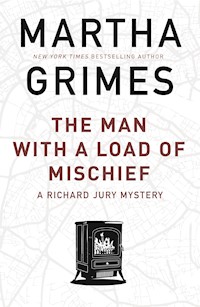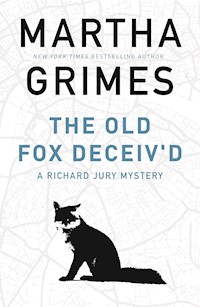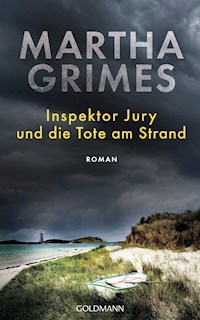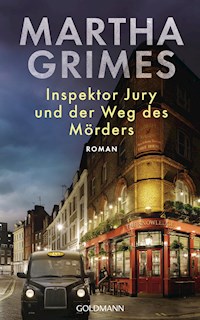4,99 €
Mehr erfahren.
Die Autorin Cindy Sella weiß nicht weiter. Ihr ehemaliger Literaturagent L. Bass Hess droht damit, ihre Karriere zu zerstören, es sei denn sie zahlt ihm eine Provision für eine Leistung, die er gar nicht erbracht hat. Zum Glück gibt es Candy und Karl, die etwas anderen Auftragskiller. Sie lösen ihre Fälle auf besondere Weise und kennen sich mit den Machenschaften der Verlagswelt aus. Gemeinsam mit dem Bestsellerautor Paul und dem Verleger Bobby wollen sie der jungen Autorin helfen und planen den hinterhältigen Agenten zur Strecke bringen. Doch ihn einfach nur zu töten, wäre viel zu langweilig ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Das Leben der jungen Autorin Cindy Sella steht kopf. Ihr ehemaliger Literaturagent hat sie verklagt, ihm eine Provision für ein Buch zu zahlen, an dessen Verkauf er nicht beteiligt war. Ihre Karriere steht auf dem Spiel, doch anstatt nachzugeben, investiert Cindy einen Großteil ihres Geldes in zwei Anwälte. Was sie jedoch nicht weiß, ist, dass diese für den skrupellosen Agenten L. Bass Hess arbeiten. Doch zum Glück gibt es Candy und Karl, zwei etwas andere Auftragskiller. Sie lösen ihre Fälle nicht wie die meisten ihrer Branche und mischen die Verlagswelt gehörig auf. Als sie auf die Probleme der jungen Frau aufmerksam werden, beschließen sie, ihr zu helfen und den Literaturagenten ein für alle Mal loszuwerden. Doch anstatt ihn einfach zu töten, kommt ihnen etwas ganz anderes in den Sinn. Mit Unterstützung des Verlegers Bobby Mackenzie und des Bestsellerautors Paul Giverney wollen sie sowohl L. Bass Hess als auch den beiden illoyalen Anwälten eine Lektion erteilen. Eine Lektion à la Candy und Karl …
Weitere Informationen zu Martha Grimessowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
MARTHA GRIMES
Ein Mordmacht noch keinen Sommer
Roman
Aus dem Englischenvon Cornelia C. Walter
Die englische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »The Way of all Fish« bei Scribner, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Shakespeare-Zitate wurden der Übersetzungvon A.W. Schlegel und D. und L. Tieck entnommen.
1. AuflageDeutsche Erstveröffentlichung Oktober 2016Copyright © der Originalausgabe 2014 by Martha GrimesCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: FinePic®, MünchenRedaktion: Sigrun ZühlkeAG · Herstellung: Str.Satz: DTP Service Apel, HannoverISBN: 978-3-641-18807-8V001www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
»Das Erste, was wir tun müssen, ist,dass wir alle Rechtsgelehrten umbringen.«
Heinrich der Sechste, Zweiter Teil
Nicht ganz. Hier sind drei von den Guten:Kenneth Swezey, David Wolf und Ellis Levine
»Reardon (ist) seiner Zeit hinterher,er verkauft ein Manuskript, als lebte er in Sam Johnsons Grub Street.Aber unsere heutige Grub Street ist ganz anders …sie weiß, welche literarische Ware in allen Teilen der Welt verlangt wird,und ihre Bewohner sind Geschäftsleute, wie schäbig auch immer.«
George Gissing, New Grub Street
Zwischenfall im Clownfish Café
1. Kapitel
Sie kamen herein, in Mäntel gehüllt, die Hüte tief ins Gesicht gezogen, zwei untersetzte Ganoven wie einem George-Raft-Film entsprungen, mit eisigem Blick und zusammengekniffenen Lippen. Aus den Schulterhalftern unter ihren Überziehern schwangen sie Uzis hervor und sprühten die Ladung wie in Wasserbögen kreuz und quer durch den Raum. Es waren etwa zwanzig Gäste da – mehrere Paare, zwei Geschäftsmänner in Nadelstreifen, ein paar einzelne Speisende, die erst gesessen hatten und nun dastanden, manche schrien, einige krochen wie Krebse unter die Tische.
Trotz der geballten Menge an Schießpulver, das die Luft vernebelte wie billiger Champagner, bekam von den Gästen merkwürdigerweise keiner einen Schuss ab. Es war das Aquarium des Inhabers, zwischen Bar und Restaurantbereich aufgestellt, das auseinanderflog. Große Glasscheiben glitten eher wie kalbende Eisberge denn wie berstendes Glas zu Boden, und dreißig bis vierzig Fische ergossen sich auf ihrer kleinen Flutwelle ins Freie und zuckten in Pfützen auf dem Fußboden umher. Ein Drittel davon waren Clownfische.
Das Ganze dauerte vier Sekunden.
Innerhalb der darauffolgenden vier Sekunden hatten Candy und Karl ihre Waffen gezogen – Karl aus dem Schulterhalfter, Candy aus dem Gürtel – Candy auf der Erde kniend, Karl im Stehen. Es folgte ein Schusswechsel, dann zogen sich die beiden George-Raft-Typen zur Tür zurück, drehten sich, unablässig weiterfeuernd, herum und machten sich durch die Dunkelheit davon.
Candy und Karl starrten einander an. »Was war denn das für ’ne Scheiße?«, rief Candy und rappelte sich von den Knien hoch.
Ebenso geschmeidig, wie sie sie gezogen hatten, steckten sie die Waffen wieder in die Halfter, wie Bullen, die sie ja gar nicht waren. Mit ihrer üblichen launigen Gerissenheit nahmen sie die Gäste ins Visier, schätzten ab, ob sie ihnen für eventuelle zukünftige Zwecke nützlich sein könnten: ein Tisch weiter hinten, die beiden Anzugträger, die Handys inzwischen emsig ans Ohr geklemmt, setzten einen Notruf ab oder verständigten ihre Aktienmakler; ein älteres Paar, sie heulend, er sie tröstlich tätschelnd; zwei zusammengeschobene Tische, um die unter schallendem Gelächter ein Grüppchen Bekloppte gestanden hatte, wahrscheinlich aus Brooklyn oder Jersey, die kauerten alle immer noch unter dem Tisch; ein paar weitere Geschäftsleute mit Bluetooth-Geräten über den Ohren, die sich entweder miteinander oder mit ihren Gesprächspartnern in Tokio unterhielten; eine blonde Frau, oder war es ein Mädchen, die allein dasitzend weiter ihre Spaghetti vertilgte und dabei ein Buch oder eine Zeitschrift las; eine Dunkelhaarige mit einer LeSportsac-Tasche über der Rückenlehne ihres Stuhles, die während des Essens die ganze Zeit über in ihr Smartphone gesprochen hatte; und ein Vierergrüppchen beim Mädelsabend, das seine Mädelszeit allerdings längst hinter sich hatte. Insgesamt zwanzig Tische, einige davon unbesetzt.
In weniger als einer Minute alles ruiniert.
Das Clownfish Café war nichts Besonderes, ein düsteres, kleines Lokal in einer schmalen Nebenstraße der Lexington, dessen höhlenartige Anmutung der schlechten Beleuchtung geschuldet war. In die Steinmauern waren ein paar Nischen eingelassen, die offenbar ein Korallenriff simulieren sollten. Dicke Stumpenkerzen spendeten dem Raum nur spärliches Licht, in kleinen eisernen Käfigen mit Drahtgeflecht darüber flackerten ihre Flammen kaum merklich, als wäre das Licht ein Schatz, den sie nicht hergeben wollten. Sie hätten auch am Meeresgrund stehen können.
Und nun lagen die leuchtend bunten Fische, Clownfische, Doktorfische und Engelfische in Neonblau und sonnenhellem Gelb in den letzten Zügen, bis die Blonde, die Spaghetti gegessen hatte, plötzlich ihren Rest Rotwein wegschüttete, mit dem Glas Wasser aufschöpfte und einen von den Fischen in ihr Weinglas tat.
Als er das sah, schnappte Candy sich einen Wasserkrug, schöpfte möglichst viel Wasser auf und stupste einen Clownfisch in den Krug. Das sahen die anderen Gäste, fanden es toll und griffen mit jenem Kameradschaftsgefühl, das man sonst bloß im Angesicht lebensbedrohlicher Gefahr erlebt, nach ihren Wassergläsern oder schütteten das billige Gesöff des Hauses aus ihren Weingläsern, um sie aus den Wasserkrügen an den Serviertischen frisch zu füllen. Die Kellner selbst liefen sinn- und nutzlos herum. Der Barmann allerdings schwang sich mit seinem Wasserschlauch über die Theke, um die Fische kräftig zu bespritzen. Unter beträchtlicher Gefahr für Leib und Leben wateten Gäste und Personal durch die Glasscherben, um die nach Luft schnappenden Fische aufzusammeln und in Gläser und Krüge zu setzen.
Was für ein Anblick bot sich, als sie damit fertig waren!
Auf jedem Tisch standen Wasserkrüge und Gläser, immer ein oder zwei oder drei Gefäße, hohe und tiefe, dünne und dicke, und in jedem Glas schwamm ein farbenfroher Fisch, von unten beleuchtet durch eine Stumpenkerze, die nun offensichtlich endlich ihren Daseinszweck gefunden hatte.
Sogar Frankie, der Inhaber, war fasziniert. Er habe, verkündete er, die Leute vom Aquarien-Notdienst verständigt, die kämen gleich mit einem Behälter.
»Verdammt, wer war das überhaupt?«, fragte Karl, während er mit Candy den dunklen Gehweg an der Lexington Avenue entlangging.
»Ich wette, die Typen hat Joey G-C angeheuert, weil’s ihm gestunken hat, dass wir uns so Zeit lassen.«
»Dabei haben wir ihm klar und deutlich verklickert, dass wir so arbeiten. Die zwei spechten Hess da drin oder jemand steckt’s ihnen, dass er dort ist, und dann laufen die mit ihren Scheißsturmgewehren auf, weil sie meinen, der sitzt auf der anderen Seite von dem Aquarium, und schießen deswegen das Ding zusammen?«
»Ruf ihn an«, meinte Candy, seinen kleinen Wasserkrug fest im Griff.
Karl zog sein Handy heraus, wählte eine Nummer aus der Kontaktliste und bekam ihn auch sofort dran, als hätte Joey G-C mit einem Anruf gerechnet. »Was soll der Scheiß, Joey? Erst heuerst du uns an, und dann schickst du deine zwei Gangster, damit die in ’nem rappelvollen Restaurant ’ne Show abziehen? Die Typen haben doch null Klasse, null Stil. Laufen mit ihren Uzis auf und schießen den Laden zusammen. Und haben sie die Zielperson erwischt? Nein, haben sie nicht, aber eine elende Sauerei angerichtet, inklusive ein Riesenaquarium, dafür kannst du jetzt aber wenigstens ordentlich blechen. Ja …«
Candy stieß ihn mit dem Ellbogen in die Rippen. »Sag ihm, alle Fische sind jämmerlich erstickt.«
»Und die ganzen vom Aussterben bedrohten Fische, die da auf dem Fußboden rumgeschwappt sind, manche von denen sind ja so gut wie ausgestorben, so wird’s dir auch gehen, Joey, wenn du uns noch mal so reinlegst. Jawoll. Der Auftrag wird erledigt, wenn es so weit ist. Bye-bye.«
»Wir haben Hess doch durch den Seiteneingang abziehen sehen. Man könnte meinen, der wusste, dass die im Anrollen sind.«
»O Mann, ich kann dir sagen, C. – das Buchgeschäft, das ist wie Rollschuhfahren in Scheißafghanistan. Lebensgefährlich.«
»Das kannst du aber singen.«
Sie gingen weiter, und Karl schlug Candy so herzhaft auf die Schulter, dass das Wasser aus dem Krug schwappte. »Gute Idee, C. Eins muss dir der Neid lassen, wegen dir haben sich alle beeilt, die Fische zu retten.«
Candy lief das Wasser am Arm seiner Boss-Jacke herunter. »Nicht mein Verdienst, das war die Blondine. Die hat als Erste ihren Wein weggeschüttet. Hast du die gesehen?«
»Die Blondine? Kann sein. Wie sah die denn aus?«
Als Candy mit den Achseln zuckte, ergoss sich ein kleiner Wasserschwall auf die Lexington. »Ihr Gesicht konnte ich nicht gut sehen. Hatte ’ne Spange im Haar. Komisch.«
»Ihr Gesicht hast du nicht gesehen, aber die Haarspange schon?« Karl lachte. »Verrückt, Mann.«
Sie gingen weiter.
Da gibt es die Mädchen mit dem goldenen Haar, die man in der Menge kaum bemerkt. Man sieht eine im Augenwinkel, inmitten der Leute, die auf der Lexington oder Park oder Seventh Avenue auf einen zuströmen, den Blondkopf unbedeckt, der sich zwischen den dunklen durchschlängelt, den Mützen und Hüten, und der Blick erhascht das Blonde, registriert aber sonst nichts. Und wenn sie vorbei ist, erkennt man, dass es zu spät ist.
Ein Mädchen, bei dem man sich wünscht, man hätte es beachtet.
Ein Mädchen, bei dem einem klar wird, man hätte es von vorne sehen sollen und nicht erst, als es um die Ecke verschwand.
So ein Mädchen war Cindy Sella.
Einige von ihnen sprachen später noch darüber und das ziemlich lange. Die Geschäftsleute, die ins Taxi stiegen, das Mädchen mit der LeSportsac-Tasche, deren Droid im Lokal verschollen war.
Als wäre Apple untergegangen, Microsoft zerborsten, als hätte ein Schirokko die iPhones, BlackBerrys, Thunderbolts, Gravities, Galaxies und all die anderen Smartphones durcheinandergewirbelt und ins süße Nirwana befördert, ja, als hätte es sie nie gegeben – niemand, kein Einziger griff nach seinem Handy, nachdem die Fische gerettet waren. Sie waren viel zu sehr damit beschäftigt, den Fischen zuzuschauen, die leicht benommen in den Weingläsern schwammen.
Niemand hatte gemailt oder getextet.
Niemand hatte getwittert.
Niemand hatte auf Facebook gepostet.
Niemand hatte ein Foto gemacht.
Sie waren an den Ufern ihrer eigenen armseligen Möglichkeiten, etwas zu beschreiben, gestrandet, und einige holten tatsächlich ihre alten Tagebücher hervor und schrieben nieder, was geschehen war.
Ja, sie redeten über das Ereignis im Clownfish Café an dem Abend, an dem sie nicht angeschossen worden waren, erzählten es Freunden, Kollegen, Pfarrern, den Kellnern in ihren Klubs, ihren Partnern, ihren Angetrauten und Kindern.
Ihren Kindern.
– Ey, cool. Und wo sind die Fotos?
– Erstaunlich, keiner hat welche gemacht.
– Wow. Prähistorisch.
– Na ja, da waren diese neonleuchtend blauen und orangefarbenen und grünen und gelben Fische, die wir alle aufgesammelt und in Wassergläser getan haben, und stell dir vor, stell dir mal vor, diese Farben, das Wasser, das Kerzenlicht. Schau mal, da kannst du es sehen …
Der es aber sehen sollte, sah nichts und ging davon.
New Grub Street
2. Kapitel
Cindy Sella ging die Grub Street im West Village entlang, einen Clownfisch in einem Zip-Beutel, den Frankie ihr gegeben hatte, als sie gefragt hatte, ob sie ihren Fisch, denjenigen, den sie gerettet hatte, behalten und mit nach Hause nehmen könne. Ja, gern, hatte er gesagt.
All die Male, die sie schon im Clownfish Café gegessen hatte, konnte sie sich nicht erinnern, jemals Frankie begegnet zu sein. Er musste da gewesen sein, irgendwo hinter der Theke oder in der Küche oder beim Betrachten der Fische, aber irgendwie war er ihr nie aufgefallen.
Das war der Unterschied zwischen Heute und Gestern.
Sie dachte über die außergewöhnliche Episode im Clownfish nach, während sie an den kümmerlichen Bäumchen in ihrem bisschen Erde vorbeikam, die die Straßen von Manhattan verschönern sollten. Sie blühten spärlich, ihre Zweige waren dürre Ranken. Um welche Baumart es sich handelte, wusste sie nicht. Das, fand sie, war eine Schande. Wenn ihr jemand drohen würde, sie mit dem Schürhaken zu verprügeln, bis sie zehn Bäume nannte, dann läge sie schon tot auf dem Gehsteig der Grub Street.
Cindy wusste, dass sie einer der unwissendsten Menschen war, die sie kannte. Dabei war sie Schriftstellerin. Wie wollte sie es je schaffen, ein Buch zu verfassen, wenn sie selbst die einfachsten Fakten nicht einmal ansatzweise kannte, wie zum Beispiel, was für ein Bäumchen da direkt vor ihrer Haustür stand? Welcher Leser würde sich in die Hände einer Autorin begeben wollen, die so etwas nicht wusste?
Kam sie wirklich auf keine zehn Baumnamen? Apfel, Kirsche, Zitrone, Orange, Pfirsich, Banane. Meine Güte, ein paar Obstbäume aufzählen, das schaffte doch jede Fünfjährige.
Apropos: so eine saß gerade auf der Treppe vor dem Reihenhaus gleich neben ihrem. Ein fünfjähriges Mädchen namens Stella Sowieso. Was hatte die abends um zehn ohne ihre Mutter hier draußen verloren?
»Stena!«
Ah, da war sie ja.
»Stena!«, rief Mrs. Rosini von der Haustür her. Stena, nicht Stella, denn Mrs. Rosini hatte Polypen oder vielleicht eine Gaumenspalte. Siehst du, schalt sich Cindy, nicht einmal den Unterschied zwischen diesen körperlichen Defekten kennst du.
Stella stand auf und glotzte Cindy an, die sagte: »Hallo.«
Stella streckte ihr die Zunge heraus.
»Stena, komm jetzt rein!«
Als Stena sich umgedreht hatte, streckte Cindy ihr ebenfalls die Zunge raus. Dann betrat sie ihr Haus.
Cindy mochte ihr Wohnhaus. Es war weiß gestrichen und bloß acht Stockwerke hoch. Das neue Hochhaus mit den Genossenschaftswohnungen gegenüber ließ es zwergenhaft aussehen, da drüben war alles aus Metall und Glas, Glas in seltsamen Schrägen, um die die Sonne wie betrunken von ihrem eigenen Licht herumstolperte und sich scharfkantig spiegelte. Bis zu dreißig, vierzig Stockwerke hoch ragte das Gebäude unregelmäßig auf. Je höher es wurde, desto mehr wurde es zum zerbrochenen Spiegel der Sonne.
Mickey, der Portier, hielt die Tür, als sie sie aufstieß. Mickey und sein kleiner mausbrauner Terrier standen Wache. Der Hund war so winzig, dass man ihn hätte auf einem Löffel davontragen können. Im Licht aus einer der Türnischen im Art-déco-Stil, das den Hund beschien, wirkte die kleine Szene wie eine Illustration von Sempé auf einem Cover des New Yorker. Sempé mit seinen Kätzchen und Hündchen.
Cindy begrüßte den Portier und beugte sich zu dem Terrier hinunter, um ihn zu streicheln. Der bellte kurz und wedelte wie besessen mit seinem Stummelschwänzchen.
Mickey tippte sich an den abgegriffenen, glänzenden Mützenschirm. Seine Uniformjacke hatte schon bessere Tage gesehen. »Miss. War Ihr Abend voller Lachen und Musik?«
Er konnte nicht einfach »hallo« sagen, nein, er schien immer den Drang zu verspüren, sich solche Sachen auszudenken.
»Schon, wenn man Schüsse in einem Restaurant als Musik zählt.«
Natürlich dachte er, sie mache Witze, und hielt ihr kichernd die Tür auf.
In Prag oder Marienbad oder woher in der Tschechoslowakei auch immer er stammte, war Mickey Ballettmeister gewesen – eine unglaublich romantische Beschäftigung, die er schmerzlich vermisste, ebenso wie er Prag (oder Marienbad) vermisste.
Cindy kam aus einer Kleinstadt in der Nähe von Topeka in Kansas, wo sie nicht Ballettmeisterin, sondern Kassiererin in einem Walmart gewesen war, ihrer Ansicht nach die seelentötendste Arbeit im ganzen Universum. Abends nahm sie Kurse in einer Volkshochschule, unter anderem in Kreativem Schreiben. Sie hatte entdeckt, dass sie schreiben konnte. Erst Kurzgeschichten, dann einen Roman. Ganz naiv hatte sie ihren Roman nach New York mitgenommen. Dann war sie zurück nach Kansas gegangen und hatte noch einen geschrieben.
Nach Mickeys ausgedehntem Gutenachtgruß, der es ohne weiteres mit Raymond Chandlers Langem Abschied aufnehmen konnte, betrat Cindy den Aufzug. Der war immer da und wartete, als hätte auch er etwas zu erzählen, und sie fuhr hoch und hörte sich dabei seine Geschichte an, wer an dem Tag hinaufgefahren oder heruntergekommen war, bevor sie auf ihrem Stockwerk landete.
Sie schritt über den schlichten beigen Teppichboden den in Calamity-Weiß gestrichenen Hausflur entlang (bei der Farbenfirma musste jemand Humor gehabt haben) zu ihrer eigenen, mietpreisgebundenen – wir schnappen uns jeder einen Hammer und bringen euch alle um – Wohnung. Eine mietpreisgebundene Wohnung in Manhattan war weitaus gefährlicher als haushohe Schulden bei Visa oder bei der Mafia.
Ihr Kater Gus saß in dem kleinen Eingangsbereich und guckte gelangweilt. Der wartete nicht auf sie, sondern auf ein bisschen Action. Er blinzelte in seiner trägen Art, als hätte man ihn gezwungen, den ganzen Abend Justin Bieber anzuhören, bis er sah, was Cindy bei sich trug. Er hechtete drauf los.
»Nicht so schnell!« Schnell riss sie den Zip-Beutel in die Höhe, ging zum Küchenschrank und holte eine große runde Glasvase herunter, in der einmal Blumen geliefert worden waren. Die füllte sie bis zur Hälfte mit lauwarmem Wasser und ließ den Fisch zusammen mit seinem Wasser behutsam in die neue Kugelvase gleiten.
Gus saß auf der Anrichte, die Pfote beinahe im Fischglas, bis Cindy ihn wegschubste und er umfiel wie ein Sack Getreide.
Cindy nahm einen Arm voller Bücher von einem stabilen Regal an der Wohnzimmerwand, das so weit von den anderen Möbelstücken entfernt stand, dass Gus nicht herankonnte. Morgen würde sie ein richtiges Aquarium besorgen und vielleicht noch einen Fisch. Sie konnte Frankie oder jemanden in einer Zoohandlung fragen, ob ein Clownfisch sich mit einem anderen Fisch vertrug. Sie konnte ja auch einen zweiten Clownfisch besorgen oder den rosa Halsband-Anemonenfisch, der war auch nett. Den hatte ihr Frankie in einem der Gläser gezeigt.
Erst dann zog sie die Daunenweste und die Schuhe aus und ließ sich in einen der Sessel sinken, die zu dem kleinen Sofa passten. Die ganze Sitzgruppe war mit cremefarbenem, dunkelbraun paspeliertem Köperstoff bezogen und bildete mit dem niedrigen Sofatisch in Glas und Holz ein »Ensemble«. (»Die auseinanderzureißen wäre doch ein Jammer«, hatte die Verkäuferin gesagt, als handelte es sich bei dem Sofa und den Sesseln um drei Kätzchen aus demselben Wurf.)
Schließlich schaute Cindy sich in dem in Calamity-Weiß gestrichenen Zimmer um. Als letztes Jahr die Hausflure gestrichen wurden, beschloss sie, ihre Wohnung ebenfalls zu renovieren, und fragte den Hausmeister, der sich um alles kümmerte, ob vielleicht ein Eimer übrig wäre und sie den kaufen könne? Er sagte, er hätte noch zwei Eimer, die er ihr mit Rabatt überlassen könnte, oder besser noch: wenn sie ihm den Auftrag erteilte, würde er ihr die Farbe gratis dazugeben.
Der einzige Grund, weshalb sie die Farbe wollte, war der Name: Calamity-White, und wenn sie sich die jetzt so anschaute, wusste sie nicht, was zu dem Namen geführt hatte. Es war eben einfach ein Weißton. »A Whiter Shade of Pale«, fiel ihr ein, und sie griff in den kleinen Stapel CDs neben ihrer Bose-Anlage, suchte und legte den gleichnamigen Song auf, in der Version von Joe Cocker. Sie hatte ihn schon von verschiedenen Interpreten gehört und einige Wörter immer noch nicht verstanden, was sie für einen Pluspunkt hielt, denn es machte den Song, der sowieso schon recht geheimnisvoll war, noch geheimnisvoller. Darin gab es Tänzer, die einen Fandango tanzten und dann Rad schlugen. Bei dem Geschehen, das Cindy nicht verstand, ging es um eine Frau, die einem Müller bei seiner Geschichte zuhörte, während ihr Gesicht »zunächst nur sehr schwach, einen helleren Blasston annahm.«
Cindy glaubte nicht, jemals auch nur eine einzige Zeile geschrieben zu haben, die so gut war wie diese. Es war eine erschütternde Zeile, wie Emily Dickinsons erschütternde Zeilen, Zeilen, die einen treffen wie ein Schlag ins Gesicht.
Gus saß neben ihr auf dem Sofa, und beide betrachteten sie das Fischglas (aus höchst unterschiedlichen Gründen). Der Clownfisch war der Beweis für die Ereignisse jenes Abends. Es war wirklich passiert. Wenn sie morgen aufwachte und der Fisch nicht mehr da wäre, würde sie das Ganze für einen Traum halten.
Die beiden Männer im dunklen Mantel, die ins Café marschiert waren, hatten bestimmt zur Mafia gehört. Und doch hatten sie auf das Aquarium geschossen, nicht auf die beiden anderen (die vermutlich ebenfalls zum organisierten Verbrechen gehörten), die da im Restaurant gegessen hatten. Die ihre Waffen gezogen und den anderen Gästen wahrscheinlich das Leben gerettet hatten. Allerdings hatten die ersten beiden auch nicht auf die Gäste gezielt.
»Die wollten die Fische umbringen«, sagte sie zu Gus, der den Blick unverwandt auf das Glas gerichtet hielt.
Hatte jemand die Polizei gerufen? Es waren keine Bullen gekommen. Natürlich, es war ja niemand erschossen worden, und alle waren damit beschäftigt gewesen, die Fische zu retten. Etwa dreißig Fische waren auf zwanzig Gäste gekommen. Manche hatten mehr als einen gerettet.
Frankie war zu beschäftigt gewesen, den Notdienst für Fische anzurufen, als dass er die Polizei hätte verständigen können. Und als die Fische sicher in ihren Kelchmeeren schwammen, hatte Frankie sich beeilt, Leute zu umarmen und Hände zu schütteln und so schnell auf Italienisch und Spanisch zu quasseln, dass er sich dabei fast die Zunge abgebrochen hätte.
Plötzlich fiel Cindy ein, dass sie wie alle anderen im Clownfish Café nicht den blassesten Dunst hatte, was eigentlich passiert war. Wenn sie – wie in dem Song – alle angefangen hätten, auf der Tanzfläche Rad zu schlagen, so lange, bis irgendwann das Dach wegflog, es hätte nicht seltsamer gewesen sein können. Ein Abend voller Kalamitäten: Wie die Wandfarbe, wie der Song, ergab er keinen Sinn.
Lediglich ein Fisch war verloren gegangen: ein Albino-Clownfisch. »Geisterfisch«, nannte Frankie ihn. »Mein armer Geisterfisch.«
War er vom Wasser weggeschwemmt worden in irgendeine dunkle Ecke, wo er zuckend gelegen und beim Ersticken einen immer geisterhafteren, immer helleren Blasston angenommen hatte?
In der Nacht träumte sie, sie wäre Dorothy (ohne Zöpfe) und Gus wäre anstelle von Toto, dem Hund.
Sie waren in ihrem Häuschen, als der Wirbelsturm – buchstäblich – über Kansas angewalzt kam, während im Hintergrund die »Geschichten aus dem Wienerwald« erklangen.
Alles wirbelte in die Luft, unablässig rissen die Winde am schilfbestandenen Marschland. Aber wo hatte es in Kansas je Marschland gegeben? Selbst in Träumen konnte sie das Redigieren nicht lassen. In diesem Marschland gab es Enten, die aufflogen und davonflatterten, und Gewehre, die losgingen und alles verfehlten, worauf sie zielten. Das Häuschen drehte sich wie ein Windrad, das Unterste zuoberst kehrend, und sie flogen Hals über Kopf in den Wolken Rad schlagend mit.
Wieder wach, lächelte Cindy und schaute zu, wie der Himmel davonflog.
Richtig wach, sah sie dann, dass die Zimmerdecke (leider) intakt war. Und Gus war nicht auf dem Bett, also war er draußen in …
Sie wälzte sich aus dem Bett und lief ins Wohnzimmer.
Das Fischglas stand immer noch auf dem Regal, der Clownfisch war unversehrt. Darunter lag Gus, die Pfoten um den Brustkorb gelegt, und guckte.
Sie ging wieder ins Schlafzimmer, zog ihren blauen Chenille-Morgenmantel über und ging in die Küche, während der Gürtel hinter ihr herschleifte.
Auf der weißen (nun, relativ weißen, wenn auch nicht calamity-weißen) Kunststoffanrichte lag die gestrige Post, obendrauf ein Schreiben von ihren Anwälten, in dem diese ihr weitere Nachrichten über das Gebaren ihres durchgeknallten Exagenten mitteilten, das in einer fünfzigseitigen Klageschrift allmählich zutage trat, die dieser beim Gericht des Staates New York eingereicht hatte, seinen verqueren Plan, wie er für ein Buch, das er nicht einmal als Agent betreut hatte, die Provision von ihr einstreichen wollte. Sie hatte ihn bereits vor Jahren gefeuert.
Sie füllte Wasser in ihre Mr.-Coffee-Kaffeemaschine, gab den ganz normalen Kaffee von Dunkin’ Donuts dazu und schaltete ein. Den Brief schob sie beiseite, sie wollte gar nicht wissen, um welchen Akt im Theaterstück von L. Bass Hess es ging, obwohl es ja eigentlich über den I. Akt nie hinausgekommen war, oder? Nicht einmal über das Probenstadium. Das gleiche alte Zeug wurde durchforstet und herumgeschoben und wiedergekäut, belabert und in neue Intrigen gesponnen.
Endlich spuckte Mr. Coffee sein Gebräu aus, und sie füllte einen von ihren dickwandigen weißen Bechern damit. Den nahm sie mit ins Wohnzimmer zu Gus und setzte sich wie am Vorabend aufs Sofa. Doch ihr ging die Farce mit L. Bass Hess nicht aus dem Kopf. Solche Gedanken musste sie umgehend abstellen. Immer wenn sie nicht an etwas denken wollte, holte sie sich entweder den Proust aus dem Regal und las ein paar Seiten oder sie gestattete sich eine bestimmte Zeitspanne zum Nachdenken. An diesem Morgen gab sie sich sechzig – nein, dreißig – Sekunden. Sie beobachtete den kleinen Zeiger an ihrer Armbanduhr, während sie überlegte:
Entsetzlicher Typ, als Agent ein entsetzlicher Kontrollfreak, Soziopath – vielleicht gar Psychopath? – nein, Soziopath, weil (das »weil« strich sie durch, ermahnte sich, keine unnötigen Wörter zu benutzen) eiskalt wie Alaska – dreißig Sekunden! Stopp!
Sie trank ihren Kaffee und fragte sich, ob das, was sie da gerade getan hatte, eine Art Anti-Zwangshandlung war. Wie wenn, sagen wir mal, Lady Macbeth sich lediglich einmal am Tag Händewaschen gestatten würde.
Als sie mit dem Nachdenken über L. Bass Hess fertig war, ließ sie den Blick auf dem Clownfisch ruhen, der in seiner kleinen Wasserwelt hin und her huschte (soweit Huschen überhaupt möglich war). Sie dachte darüber nach, ihm zur Gesellschaft noch ein oder zwei weitere Fische zu beschaffen. Ein weiterer Clownfisch dürfte eigentlich kein Problem sein, oder? Nett wäre, wenn sie Frankie dazu bewegen könnte, ihr noch einen von seinen Fischen zu verkaufen, sie war sich aber ziemlich sicher, dass er das ablehnen würde. Netter für ihren Fisch wäre es schon, wenn er den neuen Fisch kennen würde.
Sie richtete sich auf. Jetzt wusste sie, wie sie Frankie noch einen Fisch abluchsen konnte!
3. Kapitel
»Muss ich mir dein Getue mit dem Scheißfisch eigentlich gefallen lassen?« Karl las gerade den Kunstteil der Times. Er raschelte ungehalten mit der Seite, um Candy von C. F. abzulenken. Das war der Name, für den sich Candy letztlich entschieden hatte – C. F. Das sei ja wohl der bescheuertste Name für einen Fisch, den er je gehört hätte, hatte Karl – sehr hilfreich – kommentiert. »Ach echt?«, hatte Candy gesagt. »Was für Fischnamen kennst du denn sonst so?«
Sie hatten darüber gestritten, ob der Fisch vielleicht überhaupt kein Clownfisch war. Karl hatte ein farbenprächtiges Buch über exotische Fische aufgeschlagen, das er just an dem Morgen erstanden hatte. »Der ist doch wie so ein Symphon-was-weiß-ich. Der sieht total anders aus.«
Candy beharrte darauf, dass er gestreift war, also …?
»Meine Güte, das sind rote Krakellinien. Der sieht nicht die Bohne wie ein Clownfisch aus.«
Das Aquarium war um Mitternacht von einem »Kollegen«, der ein Lagerhaus hatte, erstanden worden, und es war groß. Der Kollege hatte gratis noch einen Sack rosafarbener Steine dazugegeben, etwas Kies, ein paar Korallen und anderen Krimskrams wie zum Beispiel einen Miniaturtiefseetaucher. Annähernd eine Stunde hatte es gedauert, bis sie wieder in East Houston in ihrem eigenen Lagerhaus waren, dessen Obergeschoss in zwei sehr geräumige Apartments umgewandelt worden war. Die Renovierung hatte für jede Etage anderthalb Millionen gekostet. Der Innenarchitekt, Lenny Babbo, war völlig von den Socken gewesen, wie viel Platz und wie viel Geld er zur Verfügung hatte.
»Und überhaupt gibst du ihm zu viel zu fressen«, sagte Karl. »Frankie wäre entsetzt.« Karl hatte das Fischbuch beiseitegelegt und las jetzt die Besprechung einer Neuerscheinung.
Candy betrachtete seinen Fisch und überlegte, ob er ihm einen neuen Namen geben sollte. »Meinst du, wir sollten vielleicht zu Frankie gehen und mal schauen, wie’s ihm geht? Nach gestern Abend«, schloss er vage.
»Keine Ahnung. Hör mal zu: Da ist die Rezension eines Buchs von so einer bescheuerten Autorin, die sich Angel nennt. Was soll der Scheiß mit bloß einem Namen? So was verdienen nur Leute wie Elvis und Frank.«
»Frank Giacomo?«
»Sinatra, du Blödmann.«
»Ach, ja. Old Blue Eyes. Was ist mit Madonna?«
Karl schüttelte den Kopf. »Nein. Das ist doch was ganz anderes. Die war schon immer Madonna. Wie heißt die denn, Madonna Jones? Nein, das war immer ein Name. Die hat sich das Recht nicht verdient, nur einen Namen zu haben. Nicht so wie Elvis. Bevor der berühmt wurde, hieß er Elvis Presley. Der hat sich den einen Namen verdient. So wie Sinatra.« Er schmiss die Zeitung hin. »Ach, egal. Das Buch hört sich sowieso misslungen an.« Er rutschte auf Candys weißem Ledersofa etwas tiefer. »Wie zum Teufel kommt die blöde Schlampe eigentlich zu einem Verleger?«
Seit ihrer Konfrontation mit Bobby Mackenzie, dem Verleger von Mackenzie-Haack, der den neuen Plan ausgeheckt hatte, sich einen Autor namens Ned Isaly vom Hals zu schaffen, indem er ein paar Auftragskiller anheuerte, trieben sich Candy und Karl mit Vorliebe bei Barnes & Noble herum. Eins musste man Bobby aber lassen: die Idee war nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern stammte von dem Mega-Bestsellerautor Paul Giverney, den der geldgierige Bobby Mackenzie publizieren wollte, der jedoch nur unter der Bedingung zustimmen wollte, dass Ned Isaly der Garaus gemacht wurde. Keiner wusste, wieso Paul ihn aus dem Weg haben wollte, auch die Auftragskiller nicht. Es war ein Glück, dass Candy und Karl »gewisse Standards« hatten, deren wichtigster darin bestand, dass sie die Zielperson kennenlernen wollten, bevor sie sie beseitigten, und darauf bestanden, selbst diejenigen zu sein, die entschieden, ob der Kerl am Leben bleiben durfte oder weg musste. Vor zwei Jahren war der »Kerl« ein preisgekrönter Schriftsteller namens Ned Isaly gewesen. Jetzt war der Kerl der New Yorker Agent L. Bass Hess, dem sie ein paar Wochen lang quer durch Manhattan gefolgt waren.
Bücher hatten ihrem Leben eine neue Dimension hinzugefügt. Für Bücher konnte man sterben. Buchstäblich. Bücher waren etwas, wofür man ermordet wurde. Candy und Karl kannten New York, das legale und das illegale, besser als die halbe Metropolitan Police es kannte und genauso gut wie die andere Hälfte. Wie hätten sie je ahnen sollen, dass es so viel böses Blut in der Verlagswelt ab, dass sie jemanden eher ermorden als veröffentlichen würde?
Bevor Danny Zito ihnen den Auftrag zugeschanzt hatte, hatte sich ihre Erfahrung auf Danny Zito selbst beschränkt. Danny hatte sich insofern kopfüber ins Verderben gestürzt, als er einen Enthüllungsbericht (»zumindest teilenthüllend«, hatte Karl gemeint) über die Familie Bransoni geschrieben und als Buch veröffentlicht hatte. (»Danny kann schreiben?«, hatte Leo Bransoni gekichert. »Verdammt, Danny kann nicht mal buchstabieren.« »Hatte wahrscheinlich einen Ghostwriter«, hatte Candy gesagt. »Der wird innerhalb von achtundvierzig Stunden wahrscheinlich selber zum Ghost«, hatte Leo entgegnet.)
Danny hatte sich ins Zeugenschutzprogramm begeben und hielt sich in Chelsea versteckt. Davon hatten die vom Zeugenschutzprogramm streng abgeraten. »Direkt in die Schusslinie«, hatte Danny denen gesagt. Er schrieb Bücher und malte. In Chelsea gab es jetzt jede Menge Galerien.
Joey Giancarlo, oder Joey G-C, wie er genannt wurde, hatte Candy und Karl drei Wochen vorher gebeten, einen Typen namens L. Bass Hess um die Ecke zu bringen – den Inhaber der Literaturagentur Hess drüben am Broadway.
»Mein Sohn Fabio, der hat da so ’n Buch geschrieben. Einen Roman über Chicago in den dreißiger Jahren. Von der Zeit hat er zwar nicht den blassesten Dunst, aber es ist ja Literatur, also was soll’s?« Joey zuckte die Schultern, die so massig waren, dass der Hals komplett darin verschwand. »Also, Fab, der hat sich mit Danny Zito unterhalten …«
»Danny ist doch im Zeugenschutzprogramm. Wie hat Fabio sich da mit ihm unterhalten können?«
Wieder Schulterzucken. »Was weiß ich. Danny hat sein Buch ja publiziert …«
Karl lachte. »Drum ist er ja im Zeugenschutzprogramm.«
Das ignorierte Joey. »Fab denkt sich also, Danny kann ihm ’n paar Tipps geben, wer das Buch rausbringt, aber Danny meint, ›Nein, erst mal nimmst du dir ’nen Agenten.‹ ›So ein Scheiß‹, sagt Fab, ›was denn für’n Agenten?‹ ›Der Agent verkauft das Buch‹, meint Danny, ›nicht der Autor.‹ Danny gibt ihm den Namen von diesem Hess. Fabio also gleich nach Manhattan zum Broadway runter …«
Das Gespräch fand hinter der zweieinhalb Meter hohen Steinmauer statt, die das zwei Hektar große Grundstück an der Küste von Jersey umschloss.
»… und der Typ empfängt ihn nicht. Empfängt ihn einfach nicht.« Joey nahm die kubanische Zigarre aus dem Mund und spuckte ein Fitzelchen Tabak aus, als wollte er L. Bass Hess ins Auge spucken. Dann fuhr er fort: »Das knallblonde Flittchen bei dem im Vorzimmer hinter dem Tresen meint, er soll ihr sein Manuskript dalassen, die würden sich dann bei ihm melden. Ha, das passt Fabio nicht so recht, aber dann lässt er es doch da. Und meldet sich dieses Arschloch von Agent bei ihm? Ein Monat vergeht, ein geschlagener Monat, bis das Flittchen anruft und sagt« – an der Stelle ging Joey mit der Stimme ein paar Dezibel höher –, »›Mr. Hess sagt, in der vorliegenden Form lässt sich das Manuskript nicht vermarkten. Sorry.‹« Joey schüttelte ein paar Mal langsam den Kopf. »Ich kann euch sagen, so down hab ich Fabio noch nie gesehen. Ihr kennt doch den Jungen …«
Das stimmte: ein Volltrottel.
»… stets ein Lächeln auf den Lippen, immer ein sonniges Gemüt, der Fabio. Ein richtiges Sonnenscheinchen.«
Key West hat Sonnenuntergänge und vielleicht auch Santa Fe, nicht aber Fabio. Fabio zog seine schlechte Laune mit sich herum wie ein Karrengaul das Elend dieser Welt.
Nachdem seine Zigarre erkaltet war, riss Joey ein Streichholz am Daumennagel an und murmelte schiefmäulig: »Das ist eine persönliche Beleidigung der Familie. Schnappt euch den.«
»Du weißt ja, wie wir arbeiten, Joey: Wir folgen der Zielperson, machen uns mit ihr vertraut, schauen, wie sie sich verhält …«
»Menschenskind, Karl, ich sag dir doch grade, wie der Scheißkerl sich verhält … Okay, okay, ich weiß, ihr habt eure Bedingungen. Aber ihr seid die Besten, also macht los.« Joey nahm einen dicken Umschlag aus der Innentasche seiner Jacke.
Sie winkten ab. »Keine Vorkasse, Joey. Erst wenn wir den Auftrag annehmen.«
Joey G-C verdrehte die Augen. »Ihr seid mir vielleicht welche.«
Pünktlich um halb eins verließ L. Bass Hess jeden Tag sein Büro, um im 21 oder in der Gramercy Tavern zu Mittag zu essen. Das waren die Restaurants, in die er Kunden ausführte oder wo er sich mit Lektoren und anderen Verlagsleuten traf. Während der Woche übernachtete er in seiner Zweitwohnung an der Upper East Side und begab sich zum Abendessen nach Downtown ins Bhojan auf der Lexington (was Candy und Karl überraschte, dass Hess indisch aß, andererseits war es ja auch billig). Da das Bhojan aber ein paar Tage geschlossen hatte, war er ins Clownfish Café gegangen. Auch dies sehr zu Candys und Karls Überraschung.
Neben dem Sofa, auf dem Karl saß, war ein Stapel Zeitschriften, hauptsächlich Fachzeitschriften wie Publishers Weekly, Booklist, Kirkus Review. Sie hielten sich gern auf dem Laufenden, gerieten aber manchmal in Verzug. Karl hatte sich die ein paar Wochen alte Publishers Weekly vom Stapel genommen und blätterte sie durch.
In einem altmodischen Coffeeshop, wo immer ein Stapel auf Vorrat lag, hatte Candy morgens ein paar Hefte National Geographic mitgenommen. Eben hatte er aus einem mit dem Foto von Korallenriffen auf dem Umschlag laut vorgelesen, bis Karl sagte, er solle den Mund halten und ihn einfach in Ruhe seinen Kaffee trinken lassen.
E-Books fanden sie beide schrecklich. Den Kindle hielten sie für Schwachsinn. Wenn man liest, will man doch ein Buch lesen und nicht auf so einem platten elektronischen Täfelchen.
Candy hatte es mit knapper Not unversehrt an Körper und Geist durch die Grundschule geschafft, allerdings ohne Bücher. Karl dagegen war aufs College gegangen und hatte Hemingway und Fitzgerald gelesen, jedenfalls vor der Kabbelei mit dem Studienleiter. Er hatte nur noch einen Monat bis zur Abschlussprüfung gehabt (eine Tatsache, die Candy verblüffte, der noch niemandem begegnet war, der es auch nur Lichtjahre in die Nähe eines Schulabschlusses geschafft hatte), als er sich verpflichtet hatte, dem Studienleiter einen Denkzettel zu verpassen. Nichts Ernsthaftes, kein Mordanschlag, bloß ein Warnschuss, eins vors Schienbein, als plötzlich ein paar Typen aus dem Dunkel aufgetaucht waren – Typen, die unsere Jugend unterrichten, ist es denn zu fassen, kamen mit Knarren daher, Lehrer mit Knarren!, und ließen mir gar keine andere Wahl, oder?
Die Einzelheiten hatte Candy nie so recht herausgekriegt, wie etwa, wer Karl bezahlt hatte und warum. Der Studienleiter war zu Boden gesackt, und Karl hatte sich aus dem Staub gemacht, aus dem College, aus der Stadt, mit nichts als seiner .38er, der Browning mit Kammerverschluss, und einem Exemplar von Der Große Gatsby.
»Hey, C«, sagte Karl von der Couch herüber, »hör mal: Dieser Scheißagent, dem wir die ganze Zeit hinterherhechten. Das Arschloch verklagt eine ehemalige Klientin wegen einer Provision für ein Buch, von dem die Autorin behauptet, er hätte nie was damit zu tun gehabt. Sie sagt, sie hätte einen neuen Agenten dran.« Karl ließ die Zeitschrift sinken und überlegte. »Vielleicht ist es Zeit, dass wir uns mal persönlich mit Hess treffen.« Sie machten immer ein persönliches Treffen, bevor sie entschieden, ob die Zielperson die Kugel wert war. Karl schwang die Beine vom Sofa.
»Du meinst, jetzt gleich?«
Karl schlüpfte in seine Arfango-Loafers. »Ja, jetzt gleich.«
»Bass Hess«, sagte Candy. »Klingt wie Schlangenzischen.«
Sie waren L. Bass Hess jetzt zwei Wochen lang überallhin gefolgt, und einem übleren Geizkragen waren sie nie begegnet. Es war das erste Mal, dass sie mit dem Gedanken spielten, einen Auftrag sausen zu lassen, weil die Zielperson so langweilig war, dass sie sich nicht mit ihr abgeben wollten.
Sie hätten den Typen locker im Schlaf erledigen können. Der hatte eine Routine wie ein Tag mit Martha Stewart (ob im Gefängnis oder außerhalb). Sie hätten vor Saks stehen bleiben und an der Fifty-first und Fifth über die Schulter feuern und Hess auf dem Gehsteig vor der St. Patrick’s Church ablegen können, vorausgesetzt sie taten es exakt um 17.55 Uhr an einem Mittwoch, wenn er, weshalb auch immer, zur Kirche ging. Tagtäglich dieselbe Routine, der einzige Unterschied waren die Leute, die er zum Mittagessen in der Gramercy Tavern oder im 21 traf oder in einem neuen französischen, total angesagten Lokal namens Arles in SoHo. In diesen Lokalen traf er sich gewöhnlich mit Klienten oder Lektoren oder anderen Agenten.
Da Candy und Karl im Voraus wussten, dass er in eines dieser Restaurants gehen würde, riefen sie jedes Mal an und fragten, ob er schon angekommen war. Nachdem sie herausgefunden hatten, in welches er gehen würde, fuhren sie hin und nahmen sich einen Tisch in der Nähe. Sie bestellten sich Whisky und Steaks, aber blutig, und kümmerten sich nicht um die Speisekarte. Was da drin stand, war ohnehin kaum auszusprechen, geschweige denn essbar. Sie machten sich nichts aus Soupe de mer, jungen Blattsalaten oder Ahi-Thunfisch (Karl meinte, das hörte sich an, wie wenn ein Fisch niest) und Charcuterie Pâté. Sie schauten gern zu, wie die Teller aufgetragen wurden, mit neckischen Designs, leuchtenden Farben, Brokkoli-Bäumchen, Römersalat-Schiffchen, die auf irgendeinem See draußen schwimmen sollten, spitzen oder schneckenförmig gewundenen Gebilden, pudrigem Gestöber, Gesprenkel. Was zum Teufel hatte so ein Zeug auf einer Gabel zu suchen? Das gehörte auf ein Rollfeld. Die sollten Teller mit Füßchen machen, die laufen konnten, sich umdrehen, herumwirbeln und zurück in die Küche hoppeln.
Die Gramercy Tavern mochten sie am liebsten. Sie mochten deren anständige Fischgerichte (obwohl der Küchenchef den Kabeljau und den Heilbutt gern mit überflüssigem Schnickschnack aufmotzte). Sie hörten gern zu, wie Hess den Streifenbarsch bestellte. Das machte ihnen einen Riesenspaß. Hess verzehrte immer irgendein Stück Fisch mit einer gekochten Kartoffel, Erbsen oder grünen Bohnen. Nie verstieg er sich in gebratene oder mit Saucen garnierte Gefilde. Aber das war fast wie nichts zu essen. Kein Dessert, kein alkoholisches Getränk. Eistee trank er. Kein Wunder, dass er dünn wie eine Bohnenstange war. Candy und Karl waren immer glücklich, wenn Hess’ Gast, ein Autor oder Lektor, einen doppelten Martini bestellte, on the rocks und mit drei Oliven, gefolgt von einem butter- und öltriefenden Essen, das irgendein Baukünstler in der Küche fabriziert hatte, dazu eine Flasche Sancerre und zum Nachtisch eine ordentliche Ladung Eiscreme.
Dafür musste Hess dann wirklich ein Heidengeld berappen. Candy und Karl machte es Spaß, das Gespräch zu belauschen, denn sie mochten Klatsch aus der Verlagsbranche. Etwa wenn ein Lektor sagte: »Der Vertrag stinkt zum Himmel. Wenn die mit der Ausschüttung nicht raufgehen, machte der die Fliege.« Oder: »Ich hab die Schnauze voll, von den Typen hingehalten zu werden.«
»Okay, dann macht er’s eben nicht. Wir können ja Bobby Drei Winde unter Vertrag nehmen.« »Bobby Drei Winde?« »Wieso nicht? Erinnerst du dich an die Geschichte in Vegas? Steve Wynn und das Bellagio?« »Das war perfekt.« »Super. Der Kerl liefert immer.«
Es klang genauso wie Joey G-C, wenn er einen Mordauftrag erteilte. Der Schütze, den er am liebsten wollte, war ein kleiner, muskelbepackter Typ namens Ralph »Doppelschuh« Bono. Ralph ließ sich seine Schuhe maßanfertigen, mit ein paar zusätzlichen Zentimetern. Die anderen Kerle hatten irgendwann angefangen, ihn »Doppelschuh« zu nennen, und der Name war an ihm hängen geblieben.
»Wer zum Teufel ist Bobby Drei Winde?«, wollte Karl hinterher wissen.
»Dieser Schriftsteller, halb Sioux oder Cherokee. Ein Indianer.«
»Ur-Amerikaner sagt man dazu«, meinte Karl.
»Okay, also ein uramerikanischer Indianer. Ein total angesagter Reiseschriftsteller.«
Karl kicherte. »Die bitterböse Verlagswelt.«
»Giftnudeln.«
Sie kannten sich also aus mit L. Bass Hess’ Gewohnheiten und der Route in sein Büro in der Nähe von Broadway und Twenty-third. Sie hätten es mit verbundenen Augen gefunden.
Und da gingen sie nun hin.
4. Kapitel
Cindy stand im Sunset Park in Brooklyn auf einer Straße vor einem verfallen aussehenden Gebäude, eher einer Lagerhalle als einem Wohnhaus, und bezweifelte, dass es richtig gewesen war, auf die Anzeige mit dem Albino-Clownfisch auf Craigslist geantwortet zu haben. »Einhundert«, hatte der Verkäufer gesagt.
Sie hatte eingewilligt und gesagt, in einer guten Stunde sei sie da. Sie war sich nicht sicher, wie lange sie bis dorthin brauchen würde. Weil er gemeint hatte, sie solle den N-Zug nehmen, war sie zum Washington Square gegangen.
Sie war froh, dass es wenigstens noch nicht dunkel war, obwohl es schon ziemlich dämmrig aussah. Trotzdem – es war mitten am Nachmittag, wahrscheinlich eine schlechte Zeit für Killer, Drogenkuriere, Autodiebe, Vergewaltiger, Kinderschän…
»Ja?«
Die eine Silbe platzte durch die Türöffnung und riss sie unsanft aus ihrer Träumerei. Die schwere Tür war mit lautem Getöse nach innen aufgeschwungen, und es hörte sich an, als würden Schrauben und Muttern aus den Angeln fallen.
Sie sah das platte Gesicht des ziemlich jungen Mannes vor sich, die zerrissenen Jeans, das T-Shirt mit aufgedruckten Blitzstrahlen, Messern und anderen Mordwerkzeugen. Ihre Zuversicht stärkte das nicht.
Als sie sich mit ihrer Antwort Zeit ließ, wiederholte er es – »Ja?« – und musterte sie von oben bis unten, wenn auch auf eine seltsame, nicht anzügliche Art.
Sie fasste sich an den Hals. »Oh, Verzeihung, ich muss mich in der Tür geirrt …« Sie wich zurück.
»He. Sie sind doch die Frau, die wegen dem Fisch angerufen hat. Ich heiße Monty. Immer rein, immer rein.« Er drehte sich zum Flur hin um und beschrieb mit dem Arm einen Bogen wie ein Diskuswerfer, um sie hereinzubitten.
Jetzt war es zu spät. Sie folgte ihm durch einen schmalen Flur, mit düsterem Teppich belegt, in düsteren Farben gestrichen, deren Oberfläche mit einem feinen Netz aus Rissen überzogen war.
Er ging in ein Zimmer, in dem sich drei weitere Männer befanden – oder waren es Jungs? Sie hätten zwischen achtzehn und achtunddreißig sein können – alle mit glasigem Blick und unbestimmtem Lächeln, weil sie (vermutlich) das gleiche Zeug rauchten wie Monty, der Fischbesitzer. Auch sie trugen zerrissene Jeans, allerdings weniger bedrohliche T-Shirts. Auf einem stand »Now you See It.« Auf dem anderen T-Shirt prangte ein lächelnder Alligator.
Die drei saßen blinzelnd, nickend und paffend auf ein paar zerschlissenen Schlafsofas. Einer hatte sich in eine Indianerdecke gewickelt. Die beiden anderen richteten sich beim Anblick der Fremden ein wenig auf, und einer schob mit lässigem Blick, der nichts mit ihr zu tun hatte, seine Genitalien von einer Seite auf die andere.
Monty stellte ihr die anderen vor: Molloy, Graeme und Bub. Bub war der in der Decke.
Weil sie sie offenbar als einen der Ihren betrachteten, hörte Cindy auf, an Mord und Vergewaltigung zu denken. Trotzdem war sie etwas enttäuscht, weil es anscheinend keinen interessierte, dass diese blonde junge Frau sich in eine Lage begeben hatte, die für sexuelle Zudringlichkeiten nicht passender hätte sein können, wenn sie von Bob Fosse choreographiert worden wäre oder wer auch immer West Side Story auf die Bühne gebracht hatte.
Ihr Gastgeber hatte sich in dunklere Gefilde zurückgezogen und kam nun wieder zum Vorschein. »Bitte schön! Hier Ihr Fisch. Ein Albino-Clownfisch.« Das Fischlein befand sich in einem überdimensionalen Zip-Beutel. »Süßes Kerlchen, was?«
»Ist das auch wirklich ein Geister-Clownfisch?« Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr, die aber anscheinend nichts mit ihr zu tun hatte.
»Mögen Sie Fische?« Das war Molloy, der da so verschlafen, durch einen Rauchschleier hindurch, gesprochen hatte. War es eine echte Frage? War es eine Traumfrage? Sein T-Shirt war das mit dem freundlichen Alligator. Er trug ein Stirnband, auf dem in Schnörkelschrift aquaria stand.
»Ja«, sagte sie zu ihm, und an den Besitzer gewandt noch einmal: »Es ist aber doch ein Geister-Clownfisch?«
»Hm, ja, ich glaub schon.«
»Er sieht, hm, nicht direkt opak aus.«
Alle musterten sie mit diversen Abstufungen von Stirnrunzeln.
»Ich meine, so ein transparentes Orange, nicht direkt Weiß.« Der Hauch, der Geist eines Clownfischs oder ein sich langsam verziehender Clownfisch. Sie lächelte.
Er hielt den Beutel in die Höhe und blinzelte wie in eine zu grelle Sonne. »Ja, ja.« Er hatte nicht den blassesten Dunst.
Molloy mit dem Alligator-Shirt sagte: »Das ist ein Albino, ja, ein Geister-Clownfisch auf jeden Fall. Ein Albino-Clownfisch.« Er sprach mit einiger Autorität. Cindy überlegte, ob Aquaria vielleicht ein Geschäft für Fische und Aquarien und dergleichen war. Sie fragte sich, ob er vielleicht dort arbeitete.
»Also?« Monty schob sich das braune Haar aus der Stirn und schaute sie unschuldig an. Er sah aus wie ein Sechsjähriger.
Das war es, was ihr so vertraut vorkam, was sie aus der Kindheit wiedererkannte: ihren kleinen Bruder in einem alten Schuppen im Garten hinten mit ein paar von seinen Freunden. Das war ihr Klub. Es war, als wären sie es: von den Feldern in Kansas direkt hierher nach Brooklyn verpflanzt. Das machte sie so traurig, dass sie fürchtete, sie würde gleich anfangen zu heulen, wenn sie nicht schnell hier wegkam.
Sie machte ihre Handtasche auf und holte die beiden Fünfziger heraus, die sie zusammengefaltet in einem kleinen Innenfach verstaut hatte. »Hundert, stimmt’s?«
»Hundert? Einhundert für das bisschen Fisch? Monty, willst du die verarschen?«, kam es von dem, den sie für Graeme hielt. Sie waren nur hastig einander vorgestellt worden.
Cindy hielt abwehrend die Hand hoch. »Nein, tut er nicht. Anderswo kostet diese Art von Clownfisch sogar noch mehr.« Ob das stimmte, wusste sie nicht. »Das ist ein fairer Preis.«
Monty setzte wieder sein Lächeln auf, als sie ihm das Geld überreichte. Er legte es auf einen Tisch und stellte ein Glas darauf zum Beschweren, als würde es stürmen.
Cindy rückte ihre Schultertasche zurecht und verabschiedete sich mit einem Lächeln. Sie hielt den Beutel hoch, als wollte sie dem Fisch die Gelegenheit geben, sich auch zu verabschieden.
Alle nickten oder grinsten durch den Vorhang aus Rauch und hielten die Hände wie zum Powwow in die Höhe: Indianer ums Lagerfeuer.
Nun wünschte sie, sie hätte ihnen viel mehr mitgebracht, denn plötzlich verspürte sie den Drang, sie zu engagieren. Wenn ich euch fünfhundert zahle, würdet ihr dann nach Manhattan fahren und ein paar Typen für mich zusammenschlagen? Oder sogar tausend? Ich wäre euch wirklich sehr dankbar.
Sie würden die Köpfe zusammenstecken. Ja, okay. Wo finden wir diesen Kerl?
Kerle. Mehr als einer: Zwei Anwälte und ein Literaturagent.
Klar, Mann. Und dann würden sie sich der Reihe nach abklatschen.
Und dann würde sie ihnen sagen, wie sie sie finden konnten – ihren Anwalt Wally Hale und den Rechtsberater von Mackenzie-Haack und L. Bass Hess –, würde die Fünfhundert auf den Tisch legen, mit einem Glas drauf zum Beschweren, und weggehen, bevor die Decke davonflog.
Sie wollte nicht mit einem Fisch in einem Plastikbeutel zu Fuß bis zur Haltestelle an der Thirty-sixth laufen. An der Ecke hielt sie ein Taxi an, saß friedlich gestimmt auf der langen Fahrt zurück in die Grub Street darin und dachte darüber nach, in was für einer Welt Monty und seine Freunde eigentlich lebten.
Sie saß da und dachte über sie nach, mit dem Wasserbeutel auf dem Schoß auf der Rückfahrt nach Manhattan.
5. Kapitel