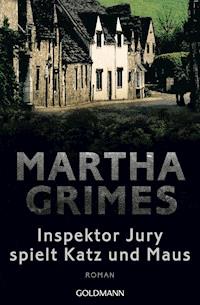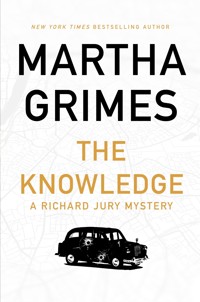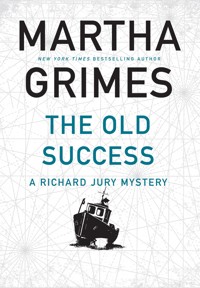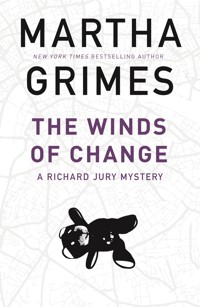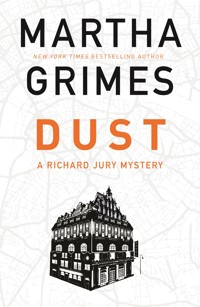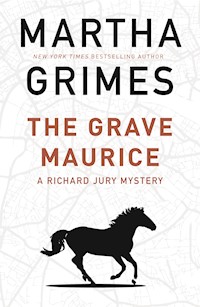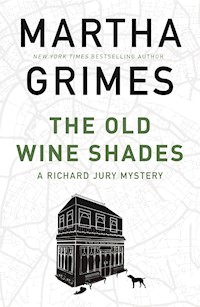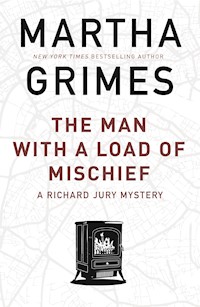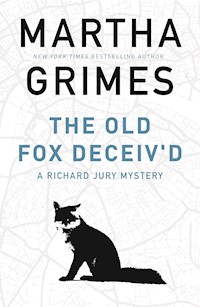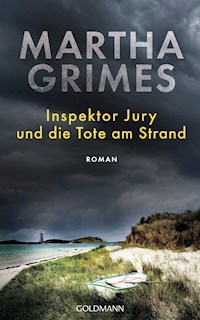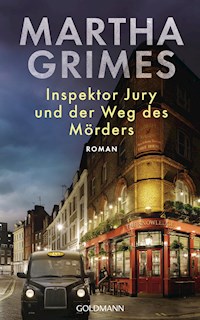
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Inspektor-Jury-Romane
- Sprache: Deutsch
Robbie Parsons kennt als Taxifahrer jeden Winkel Londons. Nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. Bis eines Tages zwei seiner Fahrgäste, David und Rebecca Moffit, beim Aussteigen wie aus dem Nichts erschossen werden – und der Mörder prompt in Robbies Taxi springt, um sich durch die Stadt chauffieren zu lassen. Doch zum Glück steigt der bewaffnete Fahrgast am Bahnhof Waterloo aus und verschwindet. Inspektor Jury ist schockiert, als er davon erfährt, denn er hat kurz zuvor Bekanntschaft mit dem sympathischen David gemacht. Eine erste Spur führt ihn in einen exklusiven Londoner Club. Und was er dort erfährt, stellt ihn vor ein Rätsel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
So wie alle Fahrer der schwarzen Londoner Taxis ist auch Robbie Parsons stolz auf seine Arbeit. Ohne Navigationsgerät oder Karte befördert er tagtäglich Kunden an die entlegensten Winkel, findet stets den kürzesten oder schnellsten Weg. Auch als eines Abends ein sympathisches Paar zu einem exklusiven und bekanntermaßen schwer zu findenden Klub gefahren werden möchte, bringt ihn das nicht ins Schwitzen. Doch als David und Rebecca Moffit am Ziel aus dem Wagen steigen, werden sie wie aus dem Nichts erschossen – und der Mörder steigt in Robbies Taxi. Aber die Taxifahrer der Stadt sind eine eingeschworene Gemeinschaft, und so schafft es Robbie, seine Kollegen auf seine Notlage aufmerksam zu machen. Zu aller Erleichterung steigt der bewaffnete Fahrgast am Bahnhof Waterloo aus. Allerdings sind die anderen Taxifahrer ihm auf den Fersen und haben außerdem kleine Helfer: Des Mörders Weg wird von einigen gut vernetzten Kindern weiterverfolgt, die in den Bahnhöfen leben. Die letzte Späherin, die neunjährige Patty Haigh, nimmt ihre Aufgabe sogar so ernst, dass sie mit dem Schützen in ein Flugzeug steigt. Über die anderen Kinder und die Taxifahrer erreichen alle Informationen schließlich auch die Londoner Polizei. Inspektor Jury, der eigentlich gar nicht mit dem Fall betraut ist, liest in der Zeitung davon – und erschrickt, als er David wiedererkennt. Er hatte zufällig zwei Tage zuvor in einem kleinen Laden für Astronomie-Fans seine Bekanntschaft gemacht. Und David hatte ihm anvertraut, dass er das Gefühl hat, verfolgt zu werden …
Weitere Informationen zu Martha Grimes sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
MARTHA GRIMES
Inspektor Jury und der Weg des Mörders
Ein Inspektor-Jury-Roman Band 24
Roman
Aus dem Amerikanischen von Cornelia C. Walter
Für meinen großartigen Enkel Scott Holland
(der diesen Test mit einer Hand am Steuer bestehen würde)
Black cabsSchwarze Taxis
London,
1. Nov., Freitagabend
1. Kapitel
Er war ein toter Mann, und er wusste es.
Sobald er diesem Dreckskerl nichts mehr nützte, würde der ihn erschießen.
Also musste Robbie Parsons ihm weiter nützen.
Er war froh, dass er sich seine grüne Kennmarke verdient hatte, dankbar für all die Monate, die er auf dieser oder jener Strecke in London in der Gegend umhergefahren war, um sich als Fahrer eines schwarzen Taxis zu qualifizieren.
Robbie hatte Straßenkarten im Kopf. Manchmal, wenn er umherfuhr und nach einem Fahrgast Ausschau hielt, machte er sich den Spaß und setzte sich Zielmarken mit Orientierungspunkten, an denen er auf dem Weg zu einem bestimmten Ort entweder vorbeikommen musste oder nicht. Mit solchen Straßenkarten im Kopf war es egal, wohin dieser schwarze Typ ihn fahren ließ (bisher hatte er ihm noch gar nichts gesagt), und Robbie wusste, wie er den längsten Weg nahm, ohne Argwohn zu erregen.
Robbie wusste Bescheid, weil er schon seit fünfunddreißig Jahren alle möglichen Menschen in der Gegend herumkutschierte. Trotzdem, so clever war er nicht, dass er sämtliche afrikanischen Länder durchgehen konnte, um festzumachen, aus welchem dieser Kerl stammte. Normalerweise drangen kleine Gesprächsfetzen an sein Ohr – etwa dass ein Fahrgast Kapstadt erwähnte oder Nairobi oder Victoria Falls, so in der Art. Dieser Fahrgast heute Abend war allerdings nicht an Smalltalk interessiert. Es herrschte Schweigen. Robbie hatte noch nie ein solch lastendes Schweigen erlebt.
Allerdings auch noch nie Schweigen plus Schusswaffe.
Vor knapp einer Stunde war er die Ebury Street entlanggefahren, hatte ein bisschen in Belgravia herumgeschaut und war dann in Richtung Beeston Place abgebogen, wo sich das Goring Hotel befand. Er hatte den Portier nach einem Taxi Ausschau halten sehen, hinter sich das Pärchen, für das es anscheinend gedacht war, während der die beiden mit einem riesigen Schirm schützte. Gar nicht so einfach bei dem Regen.
Ein sehr gutaussehendes Paar. Robbie fuhr beim Goring vor, der Portier riss den Wagenschlag auf und half der Frau hinein. Sie war wirklich wunderschön, ihr Haar hell schimmernd wie Mondlicht, das Perlweiß ihres Gesichts noch verstärkt von ihrem weißrosa Kleid. Der Mann, groß und dunkel, trug einen Abendanzug unter dem schwarzen Kaschmirmantel. Er schob sich ins Taxi, schüttelte sich dabei den Regen von den Mantelaufschlägen, achtete jedoch darauf, dass die Frau nichts abbekam.
Robbie schob das Glasfensterchen auf und sagte über die Schulter: »Ihr Zielort, Sir?«
»Ein Klub im Finanzdistrikt. Die Straße ist schwer zu finden, sagte man mir.«
Geht es Uneingeweihten nicht allen so?
»Der Name des Klubs, Sir?«
»The Artemis. Ein Spielcasino?«
»Ein sehr exklusiver Klub, Sir, einer der besten in London. Sie haben Glück, dass Sie da überhaupt reinkommen. Die Warteliste ist ein Jahr lang.«
Sie sagte: »Wieso wartet jemand ein Jahr, um in ein Casino zu kommen?« Dann lachte sie.
»Ich weiß, was Sie meinen, Madam.«
Der Mann sagte: »Die haben alle möglichen Regeln. Man muss zur vereinbarten Zeit ankommen und sich richtig fein machen. Ziemlich seltsam, dabei will man bloß ein bisschen spielen.«
Geschmeidig fädelte sich Robbie in den Verkehr Richtung Knightsbridge ein. »Ich glaub, das Artemis versteht sich nich bloß als Casino. Von den Regeln hab ich gehört. Die wollen nich so viele Leute auf einmal, dann is auch die Auffahrt nich so voll mit Autos.«
»Ich hoffe, es braucht keinen geheimen Handschlag«, meinte sie, »damit kennen wir uns nämlich nicht aus.«
Robbie fasste lachend ans Schiebefensterchen und überlegte: für Eurydike wäre es einfacher gewesen, aus der Unterwelt zurückzufinden, wenn sie sich einfach ein schwarzes Taxi hergewunken hätte, anstatt auf Orpheus zu warten. Komisch, dass ihm das bei den beiden hier einfiel. Orpheus da unten in der Unterwelt, um sie zurückzuholen. Robbie hatte das Gefühl, der hier würde es auch tun für sie.
Als der Mann an die Scheibe tippte, schob Robbie sie wieder auf.
»Und Sie finden hin, wenn Sie bloß den Namen haben?«
»Ja, Sir, mach ich.«
»Sie haben aber gar kein GPS.«
Robbie verdrehte die Augen. »Nein, Sir. So was brauchen wir nicht.«
»Erstaunlich. Den Taxifahrern in Manhattan muss man die nächste Querstraße nennen, wenn man irgendwo hinwill. Ich wollte mich mal zum Waldorf fahren lassen, da sagte der Fahrer in diesem missmutigen Ton, in dem die New Yorker Taxifahrer reden, ›Welche Querstraße?‹. Stellen Sie sich das mal vor!«
Die Frau sagte: »Ich fand es schon immer erstaunlich, wie ihr Fahrer euch in dieser Stadt auskennt.«
Robbie staunte über ihr Staunen. Ihr Akzent ließ erkennen, dass sie Britin war, seiner war dagegen definitiv amerikanisch. An welchen Service waren Amerikaner denn gewohnt? New York. Wie konnte man in einer Stadt herumfahren und sich so schlecht auskennen? Das machte doch keinen Spaß, fremd sein in der eigenen Heimatstadt!
Den Artemis Club hinter sich, befand sich das schwarze Taxi jetzt im Finanzdistrikt in der Old Broad Street. Und hintendrin saß ein Typ mit einer Knarre in der Hand.
Robbie versuchte, cool zu bleiben. Gar nicht so einfach. »Wenn Sie mir Ihren Zielort sagen könnten …?«
»Wenn’s so weit ist. Fahren Sie.«
Also gut. Dann würde er eben in irgendeine Stauecke im West End fahren – Charing Cross oder Piccadilly – in der Hoffnung auf eine günstige Gelegenheit.
Am schnellsten wäre es um Bank herum und die Walbrook runter zur Upper Thames Street. Von dort zum Embankment. Die Strecke gedachte er aber nicht zu nehmen. Der Kerl würde es nicht merken. Wohin Robbie auch fuhr, er hatte es jedenfalls nicht eilig.
Zu dieser Uhrzeit an einem Freitagabend wäre der nächste große Verkehrsstau am Piccadilly – von Green Park am Ritz vorbei bis Piccadilly Circus und Shaftesbury Avenue mit all den Theatern. Also beschloss er, in diese Richtung zu fahren. Zuerst schlängelte er sich aber durch und kam auf die A40 heraus, die er entlangfuhr bis zum Holborn Viadukt. Nach ein paar Minuten bog er rechts ab nach Snow Hill.
Dort nahm er den Fuß vom Gas und hielt nach Polizeiautos Ausschau, sah jedoch bloß ein paar Polizisten, die gerade aus der Polizeiwache Snow Hill kamen. Mittlerweile müsste eigentlich die ganze Polizei im Finanzdistrikt alarmiert sein. Sachte schaltete er seine Scheinwerfer ein und aus, ein und aus und sah, wie die Bullen stehen blieben, sich umdrehten und in der Ferne verschwanden. Das Funkradio war natürlich außer Betrieb. Dafür hatte der Kerl schon gesorgt.
»Da hinten war eine Polizeiwache.«
»Ja Sir, davon gibt’s dreitausend in London. Schwierig, nicht an einer vorbeizufahren.«
Der Typ rückte auf einen der Notsitze direkt hinter Robbie, steckte die Waffe wieder durch das offene Schiebefensterchen und sagte: »Dann versuchen Sie’s.«
Robbie schwieg. Er hörte, wie der andere sein Gewicht wieder auf den Fahrgastsitz verlagerte.
»Wo fahren Sie hin?«, wollte er wissen.
»Ins West End.«
»Warum?«
»Nachdem Sie mir keine Adresse gegeben haben, fahr ich eben einfach. Wie Sie sagten.«
Der andere brummte bloß.
Oh Mann, dachte Robbie.
Zwanzig Minuten zuvor war Robbie die halbrunde Auffahrt vor dem Artemis Club hoch bis zum Eingang gefahren, wo kaum andere Fahrzeuge standen. Man hätte meinen können, das Artemis hätte überhaupt keine Gäste, bei den wenigen Autos. Das lag zweifellos daran, dass Besuchern mitgeteilt wurde, wann sie kommen konnten, und außerdem wurden die Autos vom Personal auf einen vom Klub bezahlten Parkplatz chauffiert.
Robbie hatte gebremst und schob gerade das Glasfensterchen auf, als er überrascht sah, wie eine übergewichtige Frau in Orange die Zufahrt entlangkam, nachdem ihr Wagen wohl von einem der Bediensteten in Empfang genommen worden war. Schnaufend bewegte sie sich in Richtung Eingangstür.
»Ist es hier?«, fragte die schöne Ehefrau.
»Ja, würde man gar nicht denken, stimmt’s?«
»Sehr gediegen«, sagte sie, während ihr Mann ausstieg und herumging, um ihr den Wagenschlag zu öffnen. Er bezahlte Robbie mit einem beiläufigen »Der Rest ist für Sie« – und der Rest war ordentlich, ein stattliches Trinkgeld. Die beiden Reichen und Schönen blieben kurz stehen, während die Dame in Orange sich anschickte hineinzugehen.
»Oh, ich bin schon ganz starr vor K…«, begann die Frau.
Doch dann wurde alles starr. Robbie hörte einen ungewohnten Knall, der Mann stolperte und fiel voll aufs Gesicht. Ein paar Sekunden später ein weiterer Knall, und die Frau sank neben ihm zu Boden. Erst lag sie still, dann streckte sie den Arm zu ihrem niedergesunkenen Mann hin. Und dann, reglos, tot. Diese schönen Menschen, diese wunderschöne Frau – die blasse Haut, das Grace-Kelly-Haar, wie alles mit dem durchscheinenden Kleid verschwamm. Als er sie in der Auffahrt vorm Goring erblickt hatte, dachte Robbie, so weiß und federleicht war sie gewesen, so unwirklich, dass sie vom Wind und vom Regen hätte weggeweht werden können, durchsichtig und geisterhaft.
So hatte sie ausgesehen, wie ein Geist.
Und nun, niedergesunken, war sie es: ein Geist.
Robbie war völlig durch den Wind. Er stieß die Wagentür auf, wollte aussteigen, als ihm ein großer Schatten über den Weg fiel und er zurück ans Steuer geschubst wurde, während der Eindringling gleichzeitig mit der anderen Hand das Funkradio außer Betrieb setzte, indem er die Waffe wie einen Hammer darauf niedergehen ließ.
Der Mann riss die Fahrgasttür auf und stieg ein.
»Fahren Sie«, sagte eine tiefe Stimme.
Das, Kumpel, dachte Robbie, als brächen die Wörter wie eine Axt durch einen zugefrorenen See aus Angst, ist vielleicht dein erster Fehler.
Von Snow Hill fuhr er zum Embankment, dann weiter bis ins West End, nahm die Grosvenor Road, bog in die Chelsea Bridge Road ein und hinauf zum Sloane Square. Auf dieser Seite des Platzes befand sich ein Taxistand.
Als er an der Ecke King’s Road einen Streifenwagen kommen sah, überlegte er, ob er beschleunigen oder dicht an ihn heran- oder seitlich auf den Randstein hochfahren sollte. Aber dann wäre wahrscheinlich nicht bloß er selber tot, sondern auch der Fahrer des anderen Wagens.
Die Sloane Street war schön breit und leer, nicht überlaufen wie andere Teile Londons. Von der Stelle, wo der Streifenwagen angehalten hatte, fuhr er um den Platz bis auf die Seite mit dem Taxistand.
»Ist das hier Mayfair?«
»Sloane Square. Auf der einen Seite Chelsea, auf der anderen Belgravia. Dort drüben ist die King’s Road.«
Sein Fahrgast sagte nichts.
Am Taxistand warteten ein Dutzend Autos hintereinander, was ihn an diesem regnerischen Freitagabend wunderte. Es war eigentlich eine Zeit, in der die Leute sich um Taxis balgten.
So langsam er konnte, ohne Verdacht zu erregen, fuhr er an der Schlange vorbei. Als er die Taxis passierte, schaltete er sein Freizeichen erst ein, dann wieder aus. Das machte er noch zweimal, schaute dabei aus dem Beifahrerfenster, ob er vielleicht einen von den Kollegen erkannte. Brendan Small war zwar kein richtiger Freund, aber ein guter Bekannter. Er glaubte, auch einen anderen Fahrer zu erkennen – James Irgendwas, er kam jetzt nicht auf den Nachnamen. Die hatten ihn aber wohl nicht gesehen. Er wusste, dass er nicht noch einmal um den Platz herumfahren konnte, musste es also bei diesem einen Versuch belassen.
Beim Blick in den Seitenspiegel sah er, dass Brendan ausgestiegen war, an seiner Fahrertür stand und in Richtung King’s Road schaute, in die Robbie gerade eingebogen war. Vorbei am Kaufhaus Peter Jones, vorbei an einer Bushaltestelle, wo mehrere Leute, sichtlich genervt vom Warten auf den 22er oder 19er, sich ein Taxi herzuwinken versuchten.
Er schaltete sein Freizeichen aus, was die aber offenbar nicht abschreckte. Ein paar bedachten das Heck seines davonfahrenden Taxis mit einem Blick, als wollten sie sagen: »Was fällt dir ein?« Stinksaure Mienen, darin waren die Londoner ja Meister.
Etwas im Spiegel erregte plötzlich Robbies Aufmerksamkeit. Zwei Autos hinter ihm blinkte Licht. Es war ein schwarzes Taxi, dessen Freizeichen an und aus ging. Brendan! Du alter Sack, du reagierst ja auf mein Signal. Dann sah er, dass hinter Brendan noch ein weiteres Taxi sein Zeichen ein- und ausschaltete. Und dahinter noch eins. Kein Wunder, dass die Leute an der Bushaltestelle verrückt spielten: Nicht bloß Robbie, drei weitere Taxis mit eingeschaltetem Zeichen weigerten sich, für die Winkenden anzuhalten.
Wie lange würden sie ihm folgen? Er konnte bloß seinen nächsten Schachzug überlegen – von der King’s Road nach South Kensington, dann nach Mayfair um die U-Bahn-Station Green Park herum und von dort zum Ritz. Als der Kerl hinter ihm plötzlich brummte: »Gut, gut!« – als ob Robbie die ganze Zeit über mit ihm gestritten hätte –, fuhr Robbie erschrocken zusammen.
»Wir sind jetzt lange genug gefahren, dass wohl keiner mehr folgt …«
Wenn man drei schwarze Taxis als keiner bezeichnet.
»Nach Greenwich.«
Verdammt noch mal, Greenwich. Mit der weitläufigen, einsamen Parklandschaft, den verstreuten Reihenhäusern und leeren Spielplätzen. »Die Adresse, Sir?«
»Kriegen Sie, wenn wir in Greenwich sind.«
Mist!
Er fragte sich, ob die Londoner Taxifahrer so gut waren, wie er dachte, nämlich die besten in ganz Europa. Ja, sogar die besten weltweit. Vergiss Amerika, denen sind wir weit voraus. Den Fahrgast nach einer Querstraße fragen? Dass ich nich lache!
Robbie musste an all die Tausende von Meilen denken, die er und die anderen Knowledge-Jungs auf ihren Mopeds in London hatten herumkurven müssen, nicht bloß, um jede Straße im Umkreis von sechs Meilen auswendig zu lernen, sondern auch sämtliche Theater, etwa die in der Shaftesbury Avenue, und zwar wohlgemerkt inkorrekter Reihenfolge. Jede verdammte Sehenswürdigkeit, jedes Denkmal, jedes Bauwerk – alles ins Gedächtnis eingraviert. Er hätte einen Bogen Papier mit einem Gitternetz aus Straßen, Bauwerken, Restaurants und Sportstätten versehen können, ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen.
Vor vielen Jahren hatte er diesen sechzehnmonatigen Test gemacht, bevor er mit einem Prüfer in einem Taxi gesessen hatte. Einen Durchhänger hatte er gehabt, als der Prüfer ihn angewiesen hatte, von Marylebone nach St. Pancras zu fahren, aber ohne die Euston Road zu nehmen oder gar Euston Station zu umfahren. Die Gegend, in der sie sich befanden, war ein Gewirr aus Einbahnstraßen und Baustellen. Es war praktisch kein Durchkommen möglich, ohne die Euston Road zu benutzen.
»Nicht machbar«, hatte Robbie gesagt.
»Wirklich? Was machst du dann, wenn du einen Fahrgast hast, der den Zwei-Uhr-Eurostar erreichen muss?«
»Dann wär ich gar nicht erst in diesem Teil von Marylebone.«
Das gefiel dem Prüfer und ging als richtige Antwort durch. Dann hatte er eine Reihe von, vielleicht nicht direkt Fangfragen, aber Fragen gestellt, bei denen man viel um die Ecke denken musste.
Das alles ging ihm durch den Kopf, während er die King’s Road entlangfuhr. Er bog in die Fulham Road ein, in Richtung Old Brompton Road. Er fuhr jetzt zurück, einen Weg parallel zu der Strecke, die sie gekommen waren. Sein Fahrgast hatte anscheinend aufgepasst, denn als sie die U-Bahn-Station South Ken passierten, sagte er: »Ich dachte, wir wären von South Kensington her gekommen.«
»Richtig. Das ist ein großes Gebiet. Der Teil hier grenzt an Mayfair.«
»Mayfair? Habe ich Ihnen nicht gerade gesagt, Sie sollen mich nach Greenwich bringen?«
»Schon«, gab Robbie lässig zurück. »Aber dafür müssen wir ein Stück durch Mayfair. Und Sie müssen mir schon eine Adresse nennen. Greenwich ist sogar noch größer. Da muss ich über den Fluss und muss wissen, über welche Brücke.«
»Nehmen Sie die nächstgelegene.«
Das erste Taxi, vermutlich Brendan, war direkt hinter ihm, und der Fahrer hatte das Freizeichen ausgeschaltet. Die anderen weiter hinten ebenfalls, falls sie es waren, jedoch konnte Robbie nicht erkennen, wer sein Begleitschutz war und welche ganz normale Taxis mit Fahrgästen waren.
Als er sich dem geschäftigen Treiben vor der U-Bahn-Station Green Park und dem Hotel Ritz näherte, schaltete Robbie das Freizeichen ein und stellte bei einem Blick in den Seitenspiegel fest, dass das Taxi dahinter es ihm gleichtat und dass noch zwei weitere Taxis zwischen den Autos auf dem belebten Piccadilly ebenfalls beleuchtet waren.
Mindestens ein Dutzend Hände schossen in die Luft, Pärchen aus dem Ritz, in Samt und Smoking, und vor ihren erstaunten Blicken fuhren erst Robbie und dann Brendan einfach weiter. Die beiden anderen Taxis mit Freizeichen ebenso. Unerhört: Inzwischen schrie die ganze Menge, einige liefen ihnen hinterher. Ein kleiner Londoner Mob, wutentbrannt, dass hier Taxifahrer eine eiserne Regel verletzten.
Robbies Passagier – genauer gesagt, Kidnapper – drehte sich um und starrte durchs Rückfenster auf den Tumult, der inzwischen zu einem Polizeitumult geworden war. Um das Ritz standen Polizisten, und wenigstens ein Streifenwagen hatte sich dazugesellt.
»Was zum Teufel ist da los?«
»Keine Ahnung.« Robbie freute sich über den inzwischen stockenden Verkehr.
»Mensch, jetzt fahren Sie doch weiter!«
»Wir sitzen im Stau fest.« Ein paar gutgekleidete Männer mittleren Alters waren ans Taxi gelangt und trommelten an die Scheibe. Leider gab es plötzlich eine Lücke, und er musste losfahren. Die gesamte Strecke auf dem Piccadilly bis zum Circus machten ihm Autos links und rechts Platz, als spürte jeder Fahrer vor ihm den kalten Stahl im Nacken.
Zu jeder anderen Zeit, sinnierte er düster, hätte keiner auch nur um einen Zoll nachgegeben. Verdammt, man hätte meinen können, er hätte die Königin höchstpersönlich in seinem Taxi sitzen. Er umrundete Piccadilly Circus bis zur Shaftesbury Avenue, wo bestimmt hundert Theaterbesucher ein Taxi wollten, wenn er nicht zu spät dran wäre.
»Also, wie weit noch bis Greenwich?«
Noch eine Woche, wollte er sagen. »Halbe Stunde, je nach Verkehr.«
Covent Garden, bis Aldwych und zur Strand. Von hier aus konnte er die Waterloo Bridge sehen, der Dreckskerl hinter ihm aber auch. Die sollte er vielleicht lieber nehmen, dachte sich Robbie. Es gab jede Menge Stellen, wo man sich verfahren konnte, in Southwark und Greenwich oder wo der Revolverheld da hinten eben hinwollte.
Robbie war wirklich sauer auf sich, weil er sich die Chance dort bei der Metropolitan Police am Ritz hatte entgehen lassen. Hätte er sein Taxi ein bisschen zwischen Randstein und Autos geklemmt, oder hätte er doch … hätte, ja hätte! Noch dazu hatte er jetzt seine Kumpel abgehängt, die waren wahrscheinlich in der Nähe der Bullen steckengeblieben.
»Das ist die Waterloo Bridge«, sagte er. Man konnte ja auf die wichtigen Sehenswürdigkeiten hinweisen.
»Verdammt, dann nichts wie rüber.«
Southwark am anderen Ende war hackedicht. Gleich kämen sie am Bahnhof Waterloo Station vorbei, am Old Vic Theater. An einer Ampel direkt hinter einem neuen taubengrauen Mercedes bremste Robbie ab. Wie wär’s mit einem kleinen Unfall? Bloß ein Auffahrunfall vielleicht? Das würde die Bullen auf den Plan rufen. Aber auch einen wutschnaubenden Besitzer, der vom Fahrersitz hochgeschnellt schnurstracks auf sein Taxi zugerannt käme. Und auf die Knarre. Nein, Robbie durfte keinen mit hineinziehen.
Die Ampel schaltete um. Der Mercedes fuhr unversehrt weiter. Robbie ebenfalls.
In der Nähe des Bahnhofs Waterloo fächerte sich der Verkehr auf, und Robbie wollte schon links abbiegen, als die Stimme vom Rücksitz sagte: »Hier.«
Robbie drehte sich abrupt um. »Was?«
»Hier. Fahren Sie in den Bahnhof rein.«
»In die Waterloo Station? Sie sagten aber doch Greenwich.«
»Nein. Hier.«
Robbie schüttelte den Kopf und fuhr in den Bahnhof.
Dann war’s das also? Robbie musste auf einmal schwer schlucken. Die Pommes, die er vor zwei Stunden gegessen hatte, drohten sich zurückzumelden. Sie lagen ihm schwer im Magen, schwer vor Angst.
In der Taxischlange unter dem langen Bogen sollte er anhalten.
Eine Hand schob Geld durch den offenen Schieber. Eine Hand ohne Waffe. Zwei Fünfzigpfundscheine flatterten auf den Sitz. »Stimmt so. Sie sind ein verdammt guter Fahrer.« Der hintere Wagenschlag ging auf, sein Fahrgast war verschwunden.
Robbie blieb reglos sitzen, während der Kerl durch die Glastür ging und rasch in der Menge verschwand. Für so einen großen Mann war er sehr flink und beweglich.
Statt tot ein Kompliment.
Robbie war so verblüfft über die Tatsache, noch am Leben zu sein, dass er einen Augenblick ganz vergaß, dass er gerade einen Killer abgesetzt hatte. Mach was, du Arschloch, sitz nicht einfach rum, befahl er sich. Die Protestrufe der Taxistandaufsicht ignorierend ließ Robbie seinen Wagen stehen und rannte hinein, auf der Suche nach der Polizei. Verdammt, hatten denn sämtliche Bullen in Waterloo Feierabend gemacht? Er rannte wieder hinaus, suchte die Taxireihe ab nach Fahrern, die er kannte. Er entdeckte Brendan Small.
»Er is in den Bahnhof rein. Wir müssen was tun.«
»Mann, was is denn da los, Robbie?«
»Wer ist mir noch hinterher?«
»Keine Ahnung. Die haben einfach so mitgemacht.«
»Mein Radio ist hin«, sagte Robbie. »Wir müssen den finden. Über einsachtzig groß, ein Schwarzer. Grauer Überzieher, roter Schal. Der hat vor dem Artemis Club zwei Leute umgebracht.«
»Was?« Brendan guckte erschrocken. »Der bringt erst zwei Leute um und nimmt dann den Zug?«
London, Artemis Club
1. Nov., Freitagabend
2. Kapitel
Chief Inspector Dennis Jenkins schaute auf die Leichen der Opfer hinunter, während ein Grüppchen Leute Platz machte, vor sich zwei Kollegen von der City Polizei, falls es jemandem einfallen sollte vorwärtszudrängen. Doch die Leute schienen sich damit zu begnügen, auf der Steinstufe vor der Tür zum Artemis Club zu verharren.
Der Mann, der geschossen hatte, »kam einfach aus dem Nichts«. So die Beobachtung der Frau mittleren Alters, die er gerade befragte, in einem für ihr Alter und ihren Umfang viel zu lebhaften Orange.
»Können Sie sich noch einmal zurückversetzen?«, bat Jenkins. »So viel ›Nichts‹ ist hier nicht, aus dem man herauskommen könnte.« Er deutete mit dem Kopf nach links und rechts. Das Gebäude im King-George-Stil, das den Artemis Club beherbergte, war zur Rechten von einem Backsteinbau flankiert. Auf einem Messingschild war Peterman Versicherungen zu lesen. Links befand sich ein unscheinbarer grauer Steinbau, ohne Beschriftung oder Bezeichnung. »Keine Querstraße, keine Durchgänge, bloß ein paar Bäume und niedriges Buschwerk.« Auf den anderen Seiten der drei Gebäude standen Reihenhäuser, offenbar Privatwohnungen, aber auch kleine Geschäfte darunter. Zwei seiner Männer hatte Jenkins angewiesen, links und rechts an die Türen zu klopfen.
Die Frau in Orange war ungehalten, dass ihre Geschichte in Zweifel gezogen wurde. »Ich weiß bloß, ich bin da unten aus meinem Wagen gestiegen …« Sie deutete in Richtung Straße. »Ich bin die Auffahrt hoch und wollte gerade in den Klub, als plötzlich dieser Mann auftauchte.«
»Und die Opfer? Wo waren die?«
Das Wort »Opfer« ließ sie erschauern. Sie schaute nicht hinüber. »Nun, die sind aus ihrem Taxi gestiegen …«
»Haben Sie Ihr Auto denn nicht wegbringen lassen?«
»Nein. Das ist ein nagelneuer Lamborghini, und die Leute, die einem den Wagen parken, machen ja damit gern eine Spritztour, wissen Sie?«
Jenkins wusste es nicht. »Ist dieser Mann zur gleichen Zeit aufgetaucht, als die beiden ausgestiegen sind?«
Sie hielt sich die beringte Hand an die Stirn und dachte nach. »Ich war hier«, sie deutete zu Boden. »Das Taxi stand da drüben, der Mann mit der Schusswaffe ging auf sie zu.«
»Sie haben ihn also vorher nicht gesehen?«
»Nein, er war plötzlich da. Sagte ich doch schon.«
»Ja, stimmt. Tut mir leid, dass ich Sie bitte, es noch mal zu sagen. Wir wissen Ihre Unterstützung zu schätzen. Wenn Sie ihn jetzt einfach mal beschreiben könnten.«
Sie schüttelte den Kopf. »Sein Gesicht konnte ich nicht gut sehen. Groß war er, ein Schwarzer glaub ich. Begreifen Sie doch, wie traumatisch das alles war. Da nimmt man nicht alles wahr …«
»Boss.«
Es war seine Sergeantin, Nora Greene.
Jenkins hob den Blick von seinem Notizbuch. »Was ist?«
»Darf ich ihn befragen?« Sie sah zu dem Häufchen Schaulustiger auf der breiten Treppe hinüber.
Jenkins folgte ihrem Blick in die Richtung. »Wen?«
»Das ist Leonard Zane«, flüsterte sie aufgeregt.
Leonard Zane war weder Filmstar noch Sportikone, sondern der Besitzer des Artemis Club und ein bekannter Kunsthändler. Die Kombination von Kunstgalerie und exklusivem Casino hatte die Presse schon immer fasziniert.
»Der war gar nicht draußen, als es passierte, Nora«, sagte Jenkins.
»Mehr können Sie dazu nicht sagen?«
»Nein, ich kann es Ihnen auch abschlagen.«
»Och, Boss, lassen Sie mich …«
»Burns hat bereits mit ihm gesprochen, Nora. Sie gehen rüber und reden mit dem Parkwächter.«
»Chef …« Sie fing an, von einem Fuß auf den anderen zu treten, als müsste sie aufs Klo.
»Nora!« Jenkins’ Ton und Blick setzten ihrem Flehen ein Ende.
Jenkins überließ es dem Sanitäter, die beiden Toten aus der Auffahrt in den Leichenwagen zu schieben, und begab sich durch das Gedränge von Schaulustigen in Richtung Eingangstür. Seine Leute hatten bereits alle kurz befragt. Das Paar war erschossen worden, während die Glücksspieler und Abendessensgäste alle drinnen waren, entweder im Casino oder im Restaurant. Niemand hatte an den hohen Fenstern gestanden und zur Auffahrt hinausgeschaut.
Der Artemis Club gehörte zu Londons angesagten Lokalen, manche würden behaupten, es war das angesagteste. Das Casino verlieh der Galerie Pfiff, die Galerie dem Casino Gravitas. Dieser Doppel-Hit war Leonard Zanes Idee gewesen.
Drinnen hatte Jenkins den Blick über das Restaurant zur Rechten und eine Art Bibliothek zur Linken schweifen lassen, mit Büchern zugestellte Wände, Polstersessel, Leselampen. Eine schöne breite Treppe war mit einer Samtkordel abgetrennt. Jenkins wollte gerade die Kordel lösen, als er hinter sich eine Stimme hörte.
»Die Galerie ist geschlossen.«
Das kam von dem Mann, den Nora so gern befragt hätte: Leonard Zane.
»Mr Zane? Chief Inspector Jenkins von der City Police.« Er hielt seinen Ausweis in die Höhe.
»Ich wüsste nicht, was Kunst mit dieser Schießerei zu tun hat, Inspector.«
Leonard Zane war in den Vierzigern, unverheiratet, reich und gutaussehend. Das wusste Jenkins, weil Zane so oft in der Zeitung war. Obwohl er es hasste, fotografiert zu werden, tauchten ständig Fotos von ihm auf. Obwohl er Interviews hasste, kamen dauernd irgendwelche Interviews mit ihm in den Zeitungen oder in Zeitschriften wie etwa Time Out. Zane streckte einladend den Arm aus. »Könnten wir uns vielleicht in mein Büro setzen und reden?«
»Natürlich«, meinte Jenkins, während er Zane in einen behaglichen Raum gleich neben der Bibliothek folgte. Klein und elegant, viel Zebraholz und Mahagoni, Perserteppiche, Bilder und ein eingebauter Tresor. Sie nahmen Platz, Zane auf seinem Schreibtischstuhl, Jenkins ihm gegenüber in einem Klubsessel.
Jenkins sagte: »Ich bin mir auch nicht sicher, was Kunst damit zu tun hat. Nur gehört die eben zum Schauplatz des Verbrechens.«
»Der Schauplatz des Verbrechens ist aber doch da draußen.«
Anstatt dies zu kommentieren, wollte Jenkins wissen: »Kannten Sie die beiden?« Jenkins konsultierte sein Notizbuch: »David Moffit und seine Ehefrau Rebecca?«
»Sie waren noch nie im Casino. Das hätte ich sonst erwähnt.«
»Wer das Etablissement besucht, wird auf Herz und Nieren überprüft. Habe ich jedenfalls erfahren. Hier kommt niemand unangemeldet herein.«
»Das stimmt, Inspector. Nur führe ich die Überprüfungen nicht durch. Das macht meine Assistentin.«
»Und die heißt …?«
»Maggie Benn. Mit ihr werden Sie sprechen wollen, nehme ich an.«
»So ist es. Sagen Sie, wie viele Besucher lassen Sie denn maximal pro Abend herein?«
»Fünfzig. Dann ist der Saal ziemlich voll. Natürlich verlassen auch Leute den Spielsaal und gehen ins Restaurant. Wenn im Casino genug Platz ist, lassen wir andere herein.«
Jenkins staunte. »Das klingt ja so, als würden die Leute am Eingang Schlange stehen.«
»Eine Schlange gibt es nicht, obwohl das ja witzig wäre – danke für die Idee.«
Danke für die Idee?
»Davon haben wir bei der City Police viele auf Lager, Mr Zane. Nachdem es aber keine Schlange gibt, woher wissen die Leute dann, ob sie hereindürfen?«
»Sie werden angerufen. Man sagt ihnen, wenn sie gleich kommen, werden sie reingelassen.«
»Und darauf lassen sie sich ein?«
Zane nickte. »Keine Ahnung, warum. Ich finde das ziemlich amüsant.«
Dennis Jenkins fand es ziemlich merkwürdig. »Verfügt Ihr Klub denn wirklich über so viel Prestige?«
»Offensichtlich.« So wie er es sagte, hörte es sich an, als käme er in der Gleichung überhaupt nicht vor. »Sie sind doch bei der City Police, Inspector, stimmt’s?«
Jenkins nickte. »Eigentlich Chief Inspector.« Er würde auch ein bisschen Prestige einfließen lassen, dachte er sich.
»Oh, Verzeihung. Ich frage bloß, denn wenn diese Leute Amerikaner waren, wieso schaltet sich dann die amerikanische Botschaft nicht ein?«
»Wer behauptet, es waren Amerikaner, Mr Zane?«
Den Ball spielte Leonard Zane geschickt zurück. »Dass ich die Überprüfungen nicht selber durchführe, bedeutet noch nicht, dass ich nicht weiß, wer kommt. Etwa um sechs bekomme ich immer die abendliche Gästeliste.«
»Diese Liste verriet Ihnen also, dass die Moffits aus den Staaten kommen?«
»Diese Liste verriet mir noch mehr. Nämlich, dass David Moffit in Glücksspielkreisen bekannt war – ich überlasse es Ihnen herauszufinden, welchen Prozentanteil der Bevölkerung das abdeckt – und zwar bekannt dafür, mit einem ganz bestimmten System zu gewinnen.«
Die Tür ging auf, und Jenkins hörte auf dem weichen Teppichboden Schritte näher kommen.
»Leo!« Eine jüngere, völlig aufgelöste Frau erschien in der Tür. »Mein Gott, Leo …«
Er stand auf. »Ist ja gut, Maggie. Das hier ist Chief Inspector Jenkins. Maggie Benn, Chief Inspector.«
Jenkins erhob sich, doch sie würdigte ihn kaum eines Blickes. Ihre Aufmerksamkeit galt allein Leonard Zane. »Zwei Leute erschossen, direkt vor dem Klub, vor dem Artemis Club!«
Als ob eine Schießerei vor irgendeinem anderen Klub akzeptabler wäre, dachte Jenkins. Er fand, dass Maggie Benn wie eine seltsam schlicht gekleidete Ausgabe einer Casinosaalchefin wirkte. Das Etablissement besaß Glamour, sie nicht. Jenkins hatte die Deckenleuchter gesehen, die verblendeten Wandlampen, das Kristall, die ausladende Treppe. Maggie Benn hatte keine Spur von Glamour. Ihr Haar war zu einem Knoten zusammengefasst, bis auf einen Hauch von Lippenstift war sie ungeschminkt und trug abgesehen von einem Ring mit blauem Edelstein keinerlei Schmuck.
»Sie wussten also, dass die Moffits kamen«, wandte Jenkins sich an sie.
»Die Moffits? Selbstverständlich wusste ich das.«
»Sie waren Amerikaner.«
Sie schüttelte den Kopf. »Er ja, sie nicht. Sie war Britin. Mit doppelter Staatsbürgerschaft.«
»Lebten die beiden in London?«
»Nein, in den Staaten. In New York … zumindest hat er dort gelehrt.«
»Das verstehe ich nicht«, meinte Jenkins. »Sie haben doch eine Warteliste von einem Jahr. Wie konnte er da so kurzfristig reinrutschen?«
»Na, so kurzfristig auch wieder nicht. Er hat aus den Staaten geschrieben. Und immerhin ist er ja auch jemand.«
»Wer ist er denn?«
»Ein bekannter Physikprofessor der Columbia University. Außerdem ist er Spieler.«
»Sie wissen ja recht viel über ihn.«
»Zehn Minuten im Internet.«
Leonard Zane sagte: »In Atlantic City wurde Mr Moffit gebeten, das Casino zu verlassen, nachdem er etwa sieben- oder achtmal hintereinander beim Blackjack gewonnen hatte. Das ist unwahrscheinlich. Er muss geschummelt haben.« Zane zuckte die Achseln. »Wenn nicht, wüsste ich zu gern, was für ein System er hat.«
»Leo, die Mail hat bereits angerufen. Die wollen ein Interview.«
»Du weißt, wie ich das hasse, Maggie. Mist, wie haben die überhaupt davon erfahren?«
Jenkins musterte Leonard Zane aufmerksam. Der Kerl wirkte irgendwie widersprüchlich: Obwohl er öffentliches Interesse hasste – Fotos, Interviews –, wurde er ständig fotografiert und interviewt. Dabei brachte er es fertig, niemals etwas Substanzielles über sich verlauten zu lassen.
Verschleierungstaktik, dachte Dennis Jenkins.
Bahnhof Waterloo Station
1. Nov., Freitagabend
3. Kapitel
»Wo sind die Kids?«
»Ich hol sie«, sagte Brendan Small und tippte bereits eine Nummer in sein Mobiltelefon. »Jimmy – wir brauchen dich, hab ein Auge auf den Kerl und folg ihm. Großer Typ, Schwarzer, roter Schal. Erzähl es rum. Wir wollen den aufhalten, aber nich dass ihr Kids da Dummheiten macht … Ja, ja, sehr witzig. Schau einfach, dass du den Kerl im Auge behältst. Henry kann durch Wände schauen, der is gut … Ach, jetzt sei doch nich gleich eingeschnappt, Junge. Wir wissen, ihr seid alle gut, sonst würdet ihr nich für uns arbeiten. Na, denn los.«
Henry konnte tatsächlich durch Wände schauen, sozusagen. Seine Augen waren wie Laserstrahlen soeben auf eine kleine dramatische Szene gerichtet, die sich in der Nähe der Absperrung am Zug nach Porthsmouth abspielte: Ein Typ in Anzug und Krawatte, der aussah wie ein Geschäftsmann, aber in Wirklichkeit ein Taschendieb war, hatte die Hand in einer großen, paillettenbesetzten, über die Schulter einer schick gekleideten Frau geschwungenen Handtasche. Die Frau quasselte währenddessen ununterbrochen in ihr Handy, ohne im Geringsten zu merken, dass diese Hand etwas herausnahm. Was? Henrys Augen verengten sich zu Schlitzen – Geldbörse? Zu schmal. Reisepass? Wahrscheinlich. Gleich darauf zischte der Dieb davon, durch die Schlange der Wartenden am Zug nach Bournemouth und andere Umherstehende. Henry hätte sich drum gekümmert, wäre dem Kerl gefolgt, hätte ihm die Hand in die Tasche geschoben und den Pass, oder was es auch war, wieder herausgeholt. Schließlich war Henry selber Taschendieb, und es gab nichts, was ihm in seiner Berufsehre so viel Genugtuung verschaffte, wie einen anderen Taschendieb zu bestehlen.
Bloß kam da eben dieser Anruf von Jimmy. »Okay. Klar. Schon dabei.« Er machte Schluss und tippte Martins Nummer ein.
»Henry«, sagte der. »Ich bin grad mittendrin in was …«
»Lass sein.«
»Schon passiert.«
»Ich meinte, du sollst jemand beobachten.« Henry beschrieb ihm den Todesschützen. Martin verstaute das Falschgoldarmband in seiner hinteren Hosentasche, lächelte den Tölpel, den er soeben hatte abzocken wollen, gewinnend an und sauste dann durch die Menge an eine Stelle, von der man einen großartigen Überblick über den ganzen Bahnhof hatte.
Bevor er Sukis Nummer überhaupt eingeben konnte, hatte er ihn schon im Visier: hochgewachsener Typ, eckiges Gesicht, grauer Überzieher und immer noch den roten Schal um den Hals. Wieso nicht? Vielleicht war er mit jemandem verabredet, und der klatschmohnrote Schal war das Erkennungszeichen. Oh Mann, musste der sich so eine auffallende Farbe aussuchen?
Jetzt hatte er Suki dran. »Wo bist du?«
»Da, wo ich immer bin, am Café.«
Suki stellte sich immer neben die Tür von diesem Café und guckte hungrig drein, mit ihren großen braunen Augen und ihrem kleinen Hund. Martin kannte niemanden, der so hungrig dreinschauen konnte wie Suki. Wie sie es schaffte, die Backen so einzuziehen, war ihm schleierhaft, denn sie war gar nicht dünn. Es dauerte nie länger als fünf oder zehn Minuten, bevor das Zielobjekt – normalerweise eine Frau – mit ihr an einem Tisch saß und ihr was zu essen bestellte. Manchmal bat die Frau dann Suki, auf ihre Sachen aufzupassen, während sie aufs Klo ging. Und schon waren Sukis kleine Cargohosen vollgestopft mit allem Möglichen, was eben so herumlag – Geld, Schmuck, Lippenstift.
Als sie Henrys Stimme hörte, verlor Suki schlagartig ihren verlorenen Blick, machte Reno an der dünnen Schnurleine fest und guckte verwundert. »Wieso hat der immer noch den roten Schal um?«
»Vielleicht ist er mit jemand verabredet.«
»Aber der will doch bestimmt auf einen Zug. Wieso sonst Waterloo?«
»Da kann er in der Menge untertauchen. Läuft einfach so rum.«
»Warte mal. Ich glaub, ich seh ihn. In der Nähe vom Buchladen. Da drüben. Warte mal, der redet mit einem – oh Mann, das is ja ein Bulle.«
Martin sagte: »Schnappen die ihn?«
»Sieht nich so aus.«
»Der Typ hat vorm Artemis Club zwei Leute erschossen.«
»Vorm Artemis Club? Ey, cool.« Der Artemis Club war Sukis Vorstellung vom Himmel. Sie war zwar natürlich noch nie drin gewesen, sie war schließlich erst neun, träumte aber davon. »Dieser Idiot marschiert im Bahnhof rum, wedelt mit dem Schal … Außer …«, sagte sie zu Martin, »außer der zweite Typ is überhaupt kein Polizist.«
Der war überhaupt kein Polizist.
Suki, mit Reno an der Leine, folgte dem großen Mann (der sich mittlerweile seines roten Schals entledigt hatte) durch einen Ausgang an der Zufahrtsstraße zum Bahnhof. »Mist, die gehen auf ein Auto zu. Wow, ein Porsche.«
»Merk dir die Nummer und ruf Robbie an.«
»Jetzt stehen sie da und quatschen.«
Suki ließ Reno von der Leine und machte ihm ein Zeichen: na los. Reno trottete auf die beiden Männer zu.
»Ist das dein Hund, Kleine?«, fragte der eine, der wie ein Sicherheitsmann vom Bahnhof gekleidet war.
»Ja, hat er Sie belästigt?«
»Nein, der sollte aber angeleint sein.«
Der Schwarze sagte nichts, blickte sie bloß gleichgültig an, als fände er den Zwischenfall unendlich öde.
Das ärgerte Suki. Etwas mehr Interesse wollte sie schon erregen. »Der macht sich dauernd von der Leine los. Entschuldigung.«
»Komm jetzt«, sagte der Große. »Gehen wir.« Er hatte die Beifahrertür geöffnet und schon einen Fuß im Wagen.
Der andere starrte immer noch den Hund an. Schließlich setzte er den Fuß auf der Fahrerseite hinein. Suki hörte ihn gedämpft etwas von Heathrow sagen, von der Abflughalle und von Emirates, während er die Wagentür zuknallte.
»Heathrow, Terminal Drei. Em – wie heißt die Fluggesellschaft?«, sagte Suki in ihr Handy, als sie Martin zurückrief. »Welche sind da?«
Martin stöhnte. »Emirates vielleicht. Terminal Drei is voll das Chaos. Das is wie eine Stadt in sich. Da haben wir Aero und Patty.«
»Der Typ will außer Landes, also fährt er zum Waterloo, damit die Bullen denken, er will bloß aus der Stadt raus, oder was?«
»Der muss durch die Passkontrolle«, meinte Martin.
»Aber wohin? In welches Land? Wie wollen die ihn identifizieren? Dabei hat der Typ erst – Moment – vor paar Stunden zwei Leute abgeknallt? Da gibt’s noch keine Bilder.«
Martin mochte es nicht, wenn Suki anfing, so auf ihn einzureden. »Ruf Aero an und sag ihm, da kommen zwei Typen ins Terminal Drei, und dass unser Kunde richtig groß is und kräftig. Und schwarz.«
»Große, kräftige schwarze Typen gibt’s viele.«
»Der da steigt aber aus einem Porsche. Den sieht er dann schon.«
Flughafen Heathrow, London
1. Nov., Freitag, 22.00 Uhr
4. Kapitel
In schlappen zehn Sekunden konnte Aero die gesamte Ankunftshalle vor dem Terminal Drei mit den Augen absuchen. Als Suki ihm sagte, der große schwarze Typ würde einem Porsche entsteigen, meinte Aero, den auszumachen wäre ein Kinderspiel.
Zwanzig Minuten nach dem Anruf hatte Aero ihn im Blick – verdammt, der Kerl war bestimmt an die einsfünfundneunzig oder so. Schwer, sich in der Menge zu verlieren, wenn man so groß ist. Und schwarz.
Auf dem Skateboard war Aero der Hit. (Er war überhaupt gut in allem, wo man Gleichgewicht halten musste.) Da Skateboards in Heathrow aber nicht gestattet waren, hatte er sich mit einem Paar speziell angefertigter Rollschuhe ausgestattet, die so niedrig waren, dass man bloß einen Jungen sehr schnell über den Gehweg sausen sah.
Die Roller selber ließen sich in die dicken Schuhsohlen hochziehen, ähnlich wie wenn bei einem Flugzeug die Räder einfuhren. Aero konnte gleichermaßen fliegen und laufen. Die Schuhe waren eine Erfindung seines Freundes Jules, der sein Brot als Schuhmacher verdiente. Er fertigte Maßschuhe an und hatte seine Werkstatt im Erdgeschoss seines Häuschens in Notting Hill. Aeros Tante und Onkel wohnten in Notting Hill, einer Gegend von London, die Aero nicht leiden konnte, seit er den doofen alten Film mit Julia Roberts gesehen hatte. Anscheinend sollte der Anblick von Julias Titten das Highlight im Leben jedes Kinogängers sein. Dabei waren endlose Sandwüsten in Lawrence von Arabien weitaus aufregender als alles, was Julia Roberts zu bieten hatte.
Er sah den Kerl. Verdammte Fresse! Das war vielleicht ein Auto! Er zog sein Handy hervor und tippte Pattys Nummer ein.
»Wir wollen wissen, wohin der reist«, sagte er. »Soweit Suki rauskriegen konnte, fliegt er mit Emirates.«
»Dann stellt er sich nicht in der Schlange an. Er geht schnurstracks zum Flugsteig.« Patty klappte ihr Handy zu und steckte es in die hintere Tasche ihrer Jeans.
Manchmal wurde sie vom Sicherheitsdienst angehalten, der wissen wollte, ob alles in Ordnung war und auf wen sie denn wartete und noch so ein paar naseweise Fragen stellte.
»Meine Mum ist gleich da drüben«, sagte sie dann und deutete dabei auf irgendeine Frau, die zufällig gerade in ihre ungefähre Richtung schaute. Dann winkte Patty, und manchmal lächelte die Fremde daraufhin etwas verwirrt und winkte einfach so zurück. Dann ließ der Wachmann sie normalerweise in Ruhe. Wenn er ihr weiter im Nacken saß, ging Patty auf die Frau zu und sagte etwas in der Art wie: »Sie sehen genau aus wie meine Tante Mildred, die jetzt eigentlich hier sein soll«, und solange der Wachmann herüberschaute, redete sie weiter dummes Zeug. Wenn er wegsah, sagte sie zu der Frau, die sie gerade belabert hatte: »Ach, da is sie ja!«, und hüpfte in Richtung einer anderen Fremden davon.
Das alles war wirklich nervig. Es machte so ziemlich jede Überwachung zunichte, wenn sie die unterbrechen musste, um so ein Theater abzuziehen. Wenn sie also jemanden verfolgte, hielt sie sich ihr Handy ans Ohr, damit die vom Sicherheitsdienst dachten, sie sei im Gespräch. Manchmal lief sie auch in irgendeine Gruppe von wildfremden Leuten.
Einmal, bei einem besonders nervigen Wachmann, ging sie auf einen jungen Mann mit zusammengerolltem Schlafsack zu, der an eine Wand gelehnt dasaß. Der Wachmann hatte doch tatsächlich die Frechheit, hinzugehen und den zu fragen: »Ist das Ihre kleine Schwester?«
Ohne mit der Wimper zu zucken, meinte der: »Ja, wieso? Geht Sie das was an?«
Keine Antwort vom Wachmann, der sich einfach trollte.
Heute Abend stellte sich dieses Problem aber nicht. Der Sicherheitsdienst schaute wohl gerade in die andere Richtung. Vielleicht suchten sie ihn ja, den großen Schwarzen im grauen Mantel. Aero hatte sie informiert.
Sie hatte ihren Pass dabei (den, der auf Smith ausgestellt war, sie hatte auch noch ein paar andere), brauchte aber eine Bordkarte, und zwar eine für Emirates, falls das die Airline war, mit der er flog. Sie trat auf den Emirates-Schalter zu und beobachtete die Schlange von Passagieren, die auf ihre Papiere warteten. Sie zog ein Notizbüchlein und einen Stift hervor und suchte die Reihe mit Gepäckschildchen nach einer weiblichen Smith ab. Niemand beachtete sie, bis eine schwergewichtige Frau, die wohl alles wissen wollte, sie fragte, was sie denn da machte.
Patty sagte: »Ich muss einen Schulaufsatz schreiben, über die Gepäckstücke, mit denen die Leute reisen.«
Das hörte ein Pärchen und fand es niedlich, ein paar andere musterten sie nachsichtig. In dem Moment sah sie den Namen an einer Tasche, die einer genervt wirkenden jüngeren Frau gehörte: Alicia Smith. Alicia. Das würde reichen, obwohl Patty ja »Tricia« lieber gewesen wäre.
Nachdem diese Frau ihre Bordkarte in Empfang genommen, ihr Gepäck aufgegeben, kehrtgemacht hatte und davongegangen war, lief Patty ihr hinterher. Alicia Smith hatte ihre Bordkarte in eine Außentasche ihres großen Handgepäckstücks gesteckt (wie dumm!), das sie über die Schulter schwang, wo es gegen ihren Fotoapparat und das Fernglas stieß. Außerdem zog sie eine Reisetasche auf Rädern hinter sich her.
Das war viel zu viel, um es rings um sich auf ihren Sitzplatz zu quetschen und noch dazu im Auge zu behalten. Sobald Patty die Bordkarte in der Hand hielt, rannte sie um Alicia Smith herum und sprintete in Richtung Sicherheitskontrolle, wo sie lange vor Alicia ankam. Sie konnte ja wohl kaum hinter ihr stehen bleiben, sonst hätte sie sich eine hysterische Alicia Smith anhören müssen, die den Verlust ihrer Bordkarte bejammerte. Und dann könnte Patty sie ja nicht benutzen.
Natürlich würden die wissen wollen, warum sie denn allein unterwegs sei mit einem Pass, auf dem Patricia stand und nicht »Alicia«. Zu der Frau bei der Gepäcksicherheit sagte sie atemlos und hopste dabei von einem Fuß auf den anderen: »Meine Mum ist gleich da drüben, wir wurden plötzlich getrennt.« Kläglicher Blick, hops, hops, hops. »Bitte sagen Sie mir, wo die Toilette is, schnell!« Hopshopshopshops …
Die Frau deutete in die Richtung.
Patty hüpfte davon.
Der Mann war noch in Sichtweite. Als er zur nächsten Reihe von Toiletten kam, eilte er ins Männerklo, während Patty kurz in die Damentoilette ging, wieder herauskam, sich neben den Wasserspender stellte und wartete.
Als sie ihn aus der Toilette kommen sah, beugte sie sich rasch über den Wasserspender, trank und nahm die Verfolgung wieder auf. Sie gelangten zur letzten Ladenreihe an diesem Gang. Hinter den Läden waren dann ja die Flugsteige, wo es schwieriger wäre, ihm aus Versehen zu begegnen. Sie hoffte, er würde stehen bleiben.
Er blieb stehen.
Im Zeitungsladen standen die Leute Schlange, weil es die letzte Gelegenheit war, Lesematerial, Süßigkeiten und gekühlte Getränke zu erstehen, bevor man in der Lounge auf den Abflug wartete. Er hatte sich noch nicht angestellt, sondern besah sich die Zeitungen. Patty trat zur Kühltruhe und holte eine Flasche Wasser heraus, ging dann zu den Zeitschriften hinüber, wo sie nach etwas Ausschau hielt, das seine Aufmerksamkeit erregen würde. Bei den Zeitschriften war nichts, also ging sie zu den Büchern.
Als es so aussah, als würde er auf die Verkaufstheke zusteuern, griff sie rasch nach einem Buch über Kartenspiele und kam vor ihm zu stehen. Als die Kundin vor ihr mit Kaugummis und Lotion abzog, platzierte Patty ihr Wasser und ihr Buch auf dem Ladentisch und holte ihre Geldbörse hervor.
»Da wären wir dann bei sechs Pfund zehn, Liebes.«
Sechs! Du liebe Güte, Bücher waren ganz schön teuer. Sie reichte ihr einen Fünfpfundschein, eine Pfundmünze und zehn Pence in Kleingeld. Als sie nach dem Wasser griff, schob sie das Buch so hin, dass es zu Boden fiel. Er hob es natürlich auf und besah sich den Umschlag, bevor er es ihr wieder gab und ihr Dankeschön erntete.
»Poker: Strategien mit kleinen Einsätzen. Damit beschäftigst du dich in deiner Freizeit?«
»Ich? Nein, das ist ein Geschenk für meinen Dad. Der steht auf Glücksspiele.«
Und natürlich sprach er sie dann noch mal an, als sie in der offenen Tür stand und verwirrt von links nach rechts guckte.
»Suchst du deine Familie?«
»Was? Nein, ich überleg bloß gerade, in welche Richtung Flugsteig zwölf ist.«
Er lächelte. »Da muss ich auch hin. Komm mit.«
Unterwegs meinte er: »Fliegt deine Familie nach Dubai?«
»Nein, bloß ich. Dort wartet meine Tante auf mich.«
»Du bist allein? Das ist aber eine weite Strecke so ganz allein.«
Er meinte natürlich, als Kind so ganz allein.
»Na ja, ich bin viel unterwegs. Wegen meinem Dad. Der muss wegen seines Jobs in viele verschiedene Länder. Meine Mum ist schon tot. Ich wohne viel bei Tanten und Onkels.« Das, fand sie, klang ziemlich unüberlegt.
»Weißt du was, du bist genauso alt wie meine Großnichte. Ich hätte es nicht gern, wenn die in Flughäfen und Flugzeugen ganz allein unterwegs wäre.«
»Das mag Pop auch nich. Aber was will er machen?«
Inzwischen waren sie im Abflugbereich von Emirates. Er streckte ihr die Hand hin. »Man nennt mich B. B. Bushiri Banerjee. Vater war Bengale, Mutter Kenianerin. Hallo, freut mich!«
»Ich heiße Patty Smith. Auf meiner Bordkarte ist es falsch, da haben sie Alicia statt Patricia hingeschrieben.« Sie zeigte ihm, was sie von Miss Smith gemopst hatte. Mit einem einnehmenden Lächeln fügte sie hinzu: »Wär schön, wenn wir zusammensitzen könnten.«
B. B. dachte nach. »Da kann ich vielleicht was deichseln.« Er hatte seine Bordkarte gezückt und nahm ihre ebenfalls.
Patty sah ihm hinterher, als er zur Flugbegleiterin ging, um mit ihr zu sprechen. Die nickte und schaltete ihren Computer ein. Dann wandte sie sich ihm zu und sagte etwas, woraufhin er seine Kreditkarte zückte und sie ihr reichte. Nach dieser Transaktion kam er zu Patty zurück und überreichte ihr eine neue Bordkarte.
Sie staunte nicht schlecht. »Das ist ja Erste Klasse!«
»Na, ich reise auch so. Wir sitzen dann zwar nicht zusammen, weil wir je unser eigenes Abteil haben, können uns aber besuchen. Das ist bei dieser Airline sehr nett.«
Sie bedankte sich überschwänglich und fragte sich, ob dieser Kerl wirklich so ein erbarmungsloser Killer, so ein herzloser Auftragsmörder war, wenn er von einem Kind hinters Licht geführt werden konnte.
Oder war sie ganz einfach ein echt, echt schlaues Köpfchen? Mit dankbarem Blick schaute sie zu B. B. empor und entschied, lieber Letzteres zu glauben.
Ihr Handy bimmelte. »Hi.«
Es war Aero.
»Das ist meine Tante. Entschuldigen Sie mich kurz?« Patty trat in den Gang, außerhalb von B. B.s Hörweite. »Sein Name … lass mich überlegen … Na, jedenfalls geht der Flug nach Dubai, mit Emirates. Wo sind eigentlich die dämlichen Bullen? Die Maschine hebt gleich ab, und das Gate ist in fünf Minuten dicht.«
Inzwischen war B. B. aufgestanden und machte ihr Handzeichen.
»Das Problem is, dieser Typ, den du verfolgst, den hat außer uns bisher keiner auf dem Schirm.«
»Was ist mit Robbie? Wieso ist der mit der Polizei nicht längst hier?«
»Keine Ahnung.«
»Die Drecksbullen haben es also nicht geregelt gekriegt.«
Aero kicherte. »Wieso, glaubst du, heißen die Drecksbullen?«
»Sind die nicht Londons feinste Truppe?«
»Nein, Robbie und Konsorten sind Londons feinste Truppe.«
»Die Maschine hebt gleich ab. Muss ich etwa nach Dubai, bloß um den im Auge zu behalten? Wo liegt eigentlich Dubai?«
»Mein Gott, Patty, bloß nich! Bist du verrückt?«
»Jemand muss es ja sein. Sein Name ist B. B. Oder jedenfalls nennt man ihn so. Wir fliegen los! Bye.«
Patty rannte zur Schlange, wo B. B. bereits nahe am Flugsteig stand. »Das war Tante Monique. Die hat aus Dubai angerufen, deshalb konnte ich es nicht so gut hören.« Wie lächerlich.
Als ihr Flug aufgerufen wurde, kam die Flugbegleiterin vom Schalter herüber, um die Bordkarten einzusammeln. Sie lächelte B. B. zu und musterte Patty wohlwollend. »Du hast aber Glück, Kleine!«
Patty stimmte ihr aus vollen Herzem zu.
Was sie eigentlich sagen wollte: Glück war das nicht, Lady.
Islington, London
2. Nov., Samstagmorgen
5. Kapitel
Superintendent Richard Jury war mit seiner eigenen Verschleierungstaktik konfrontiert, und zwar in Gestalt seiner Nachbarin von oben, Carole-Anne Palutski, ihres Zeichens keine Polizistin, wenngleich sie sich bisweilen für eine hielt. Mit einer Tüte Milch und seiner Times war sie am frühen Samstagmorgen in seine Wohnung gekommen.
Sie übergab ihm die Milch und setzte sich aufs Sofa, um die Zeitung zu lesen, die sie gleich breit aufschlug, dabei die wichtigen Nachrichten ignorierte und stattdessen nach den Anzeigen Ausschau hielt, um zu sehen, welche Schuhe von Christian Louboutin oder Jimmy Choo wohl in ihre Richtung stöckeln mochten. Nach kurzem Schmökern sah sie zu ihm hoch. »Sie sind am Donnerstagabend ja ganz schön spät heimgekommen. Und unser Date fürs Mucky Duck haben Sie auch verschwitzt.«
Jury hatte gerade die Milch in die Küche bringen wollen und drehte sich nun noch einmal um. Wieso wartete sie bis jetzt, um ihm dafür die Ohren langzuziehen? Es war immerhin Samstagmorgen. Er konnte sich auch nicht erinnern, dieses angebliche »Date« vereinbart zu haben. Was öfters der Fall war. Doch während er nun in die Küche ging, um Milch in den Tee zu geben, sagte er lediglich: »Ich war im Yard.« Für den Fall, dass sie vergessen hatte, wo er arbeitete.
»Um was zu machen?«
Er überlegte, ob er das Starrdust überhaupt ins Spiel bringen sollte, da er sich nicht auf eine Diskussion über ihre übersinnlichen Kräfte und David Moffits dunkle Zukunft einlassen wollte. Über sein Abendessen mit den Moffits im Goring wollte er sich ganz sicher nicht auslassen. Also log er. »Überstunden.« Mit zwei großen Teetassen kam er ins Wohnzimmer zurück. Sie dankte ihm mit einem theatralischen Seufzer, als er ihr eine überreichte.
»Sie sind doch Superintendent. Da müssten Sie doch keine Überstunden machen.« Sie hielt die Zeitung so, wie kein echter Zeitungsleser sie halten würde: Die erste – die mit den üblichen Unsäglichkeiten – und die letzte Seite sichtbar, die ganze Zeitung in zwei Teile ausgebreitet.
Davids besorgter Blick fiel ihm wieder ein. »Jemand kam rein und musste mit einem Ermittler sprechen.«
»Der hätte doch mit sonst wem reden können.«
»Ich war zufällig da.«
»Der hat Sie reingehen sehen und ist hinterher.«
Jury guckte verständnislos. »Was reden Sie da?«
»Na, man kennt Sie doch, nach der ganzen Publicity.« Sie blätterte eine Seite um.
»Carole-Anne, das war vor über einem Jahr.«
»Meinen Sie, die Leute können sich nicht so weit zurückerinnern? Und Entschuldigung, aber gibt es bei New Scotland Yard denn keine Rezeption?«
»Wir haben einen Empfangsschalter, an dem ein paar Polizisten sitzen. Das heißt bei uns aber nicht ›Rezeption‹. Wir sind schließlich nicht das Connaught Hotel.«
»Und einen, der reinkommt und behauptet, er braucht einen Cop, den schicken die einfach so nach oben?«
»Nein, das tun die nicht. Die lassen ›von oben‹ einen Ermittler nach unten kommen.«
»Und das waren zufällig Sie. Ha.« Das »Ha« schickte dieses Detail an Information ins deduktive Hinterland, wo es hingehörte. »In Islington hat ein neues Fitnesszentrum aufgemacht. Heißt KO.«
»Das steht in der Times?«
»Nein, in der Essex Road.« Sie ließ die Zeitung sinken und musterte ihn von oben bis unten, während er mit seiner frisch nachgefüllten Tasse in der Küchentür stand. »Sie haben nie meinen Rat befolgt und sich im Fitnesszentrum angemeldet.«
»Das ist korrekt.« Er trank seinen Tee.
»Sie brauchen Bewegung. Sonst geht der Rest Ihres Aussehens auch noch den Bach runter.« Sie wandte sich wieder ihrer Zeitung zu, blätterte um.
»Ich bin froh, dass überhaupt noch was davon übrig ist.«
Sie setzte sich anders hin, sodass die erste Zeitungsseite herunterfiel. Als Jury die Innenseite sah, fiel ihm beinahe die Teetasse aus der Hand. Nein!, schrie er innerlich auf. Sein Mund wurde so trocken, dass er die Zunge nicht recht bewegen konnte, um es herauszuschreien. In zwei Sätzen war er an der Couch und griff hastig nach der Seite.
Carole-Anne sah erschrocken hoch. »Was ist los?«
Jury starrte auf das Foto von David Moffit. Und auf der anderen Seite der Zeitungsspalte das seiner schönen Frau Rebecca. Die Überschrift lautete: Ehepaar vor angesagtem Londoner Klub erschossen.
Jury ließ die Seite sinken und fiel in seinen Sessel. Er schlug die Hände vors Gesicht.
Carole-Anne hatte rasch nach der Zeitungsseite gegriffen. »Oh, mein Gott. Der war doch am Donnerstag im Starrdust. Kannten Sie den?«
Jury blieb die Antwort schuldig.
Carole-Anne las die kurze Meldung vor:
»Der renommierte Artemis Club im Londoner Finanzdistrikt war Schauplatz eines Doppelmordes, als die Amerikaner Rebecca und David Moffit dort beim Aussteigen aus dem Taxi im Vorhof erschossen wurden.
Der Todesschütze kam, laut Aussage eines Gastes, ›aus dem Nichts, stieg in deren Taxi ein und fuhr davon‹. Die City of London Police, angeführt von Chief Inspector Dennis Jenkins, war nach dem Notruf sofort am Tatort. Dr. Moffit war Physikprofessor an der Columbia University in New York, wo das Paar auch ansässig war.«
Sie schaute zu Jury hinüber. »Super?«
»Ich bin ihm im Starrdust begegnet.«
Ihr Stirnrunzeln verwandelte sich in Überraschung. »Der gutaussehende Typ! Ich hab ihm seine Zukunft vorhergesagt!« Sie hatte den Anstand, nicht hinzuzufügen: »Ich hab ihn gewarnt.«
Die einzig gute Nachricht war, dass Dennis Jenkins den Fall übernommen hatte. Jenkins war ein guter Freund. Jury stand auf und ging zum Telefon hinüber.
»Ich muss jemanden anrufen.« Er wählte die Nummer der Dienststelle Snow Hill und verlangte DCI Jenkins.
Als Carole-Anne sein Gesicht sah, kam sie herüber und legte ihm die Hand auf den Arm. Dann schickte sie sich an zu gehen. Jurys Telefonanrufe betrachtete sie für gewöhnlich zwar als ihre Domäne, aber diesmal nicht. »Tut mir leid, Super. Wenn Sie was brauchen, Sie wissen, wo ich bin.«
Während er darauf wartete, dass Jenkins sich meldete, saß Jury da und starrte auf einen abgeriebenen Fleck in seinem Teppich. Er merkte kaum, dass ihm eine Träne übers Gesicht gelaufen war, bis er sie auf die abgewetzte Stelle fallen sah. Dabei dachte er daran, was vor zwei Tagen geschehen war, erinnerte sich ans Starrdust und an David Moffit.
Spukhafte Fernwirkung
Covent Garden, London
31. Okt., Donnerstagnachmittag
6. Kapitel
»Schauen Sie sich das mal an, Sir!«, sagte Detective Sergeant Alfred Wiggins.
Als wäre Jury blind gegenüber diesem Schaufenster mit seiner Ansammlung von winzigen Gespenstern, Ghulen und Gräbern, von denen mehr als eines durch ein Skelett oder eine vermodernde Leiche aufgebrochen war, die sich ihren Weg aus dem Erdreich bahnten. Gespenster und Ghule regten sich gleichermaßen, manche auf der Erde, manche in den Bäumen, einige einen Kirchturm umflatternd. Die Beleuchtung war besonders wichtig, fachgerecht bewerkstelligt mittels winziger LED-Lämpchen, die in der Szenerie verteilt waren und den Lichtstrahl jeweils auf die Figur richteten, die gerade in dem Augenblick ihren großen Auftritt hatte.
Wiggins, treuer Gefährte und Führer im Lande der Blinden, fuhr fort, seinem Chef, Superintendent Richard Jury von der Mordkommission bei New Scotland Yard, über das Geschehen im Schaufenster zu berichten: »Sehen Sie mal da, der Zombie da links, der schüttet jetzt gleich – mach schon! – das Eimerchen mit Blut über den Mann mit Zylinder, der gerade die Straße entlanggeht. Jawoll! Total bekleckert, der Gute.«
Jury wollte ihm schon einen kräftigen Kinnhaken versetzen, als Wiggins flugs auf die Frankenstein-Figur deutete, die soeben hinter einem Baum hervortrat. Auf Wiggins’ Gekicher sagte Jury: »Gut, und jetzt meinen Blindenstock, Wiggins, damit ich mich in den Laden tasten kann.«
Die beiden waren nicht die einzigen Zuschauer bei dieser kleinen Halloween-Aufführung, sondern von Kindern unterschiedlichen Alters umgeben. Bei dem Laden handelte es sich um das Starrdust, eine der beliebtesten Örtlichkeiten in Covent Garden. Seinem Besitzer Andrew Starr war Jury besonders zugetan.
»Blindenstock, Sir?«, fragte Wiggins, wandte sein Interesse dann aber gleich wieder dem Geschehen im Fenster zu. »Ich begreif einfach nicht, wie die das machen.«
»Die« waren die Verkäuferinnen Meg und Joy. Unterstützt von Andrew Starrs Elektrotechniker waren es die beiden, die schon seit Jahren die Schaufenster des Starrdust »dekorierten«, wobei sie ihr besonderes Augenmerk dem Nachthimmel, den Sternbildern und Planeten widmeten. Wie weiland Kopernikus es getan hätte, achtete Andrew Starr penibel darauf, dass sie es auch richtig hinkriegten. Andrew war ein vielbewunderter und angesehener Astrologe. Er erstellte für einige hochbedeutende Londoner, die ihn seit Jahren konsultierten, die Horoskope. Auch war Andrew pfiffig genug, die Anziehungskraft von Meg und Joy zu erkennen, die ihrerseits das Ganze überhaupt nicht ernst nahmen. Daher das dramatische Geschehen um Mini-Kobolde und Eimerchen voller Blut. Andrew wusste, was gute Unterhaltung wert war.
Der Laden war ein Mekka für Erwachsene wie für Kinder, für alle, die die Nase voll hatten von der »realen Welt« und nur allzu gern eine unreale betraten, wo die Musik von einem alten Grammophon kam, das ausschließlich Lieder spielte, in denen es um die Himmelswelten ging. Hoagy Carmichaels näselnde Interpretation von Stardust gab so ziemlich genau das Thema vor, dazu Dinah Shores samtige Version von Stars Fell on Alabama oder Nat King Cole, der Moon River säuselte. Im Ladeninneren war es nur um wenige Lux heller als in den Schaufenstern, wenngleich ausgeleuchtet genug, dass man die Verkaufsartikel sehen konnte: Bücher, Fachzeitschriften, antiquarische Ausgaben von Bänden über Astrologie, Freimaurerei und Alchemie, dazu Sammlungen von Kinderbüchern; die »wilden Kerle« als Stofftiere sowie Spieluhren und raffiniert verkleidete Puppen. Trotz der Enge des Raumes hatte Andrew eine Reihe von Bücherregalen angebracht, in denen mehrere Kunden gerade stöberten und schmökerten. Einer davon, ein hochgewachsener, sehr gutaussehender Mann, hatte sich, in der Hand einen entsetzlich dicken alten Schmöker, an ein volles Regal gelehnt und beobachtete aufmerksam das Geschehen.