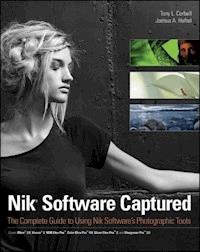Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Grüne Marsmenschen und telepathische Cyborgs kennen wir nur aus der Science-Fiction, die wissenschaftlichen Entdeckungen einfachen bakteriellen Lebens auf anderen Planeten erscheinen dagegen alles andere als aufregend. Doch wie könnte extraterrestrisches Leben, das komplexer ist als Einzeller, wirklich aussehen? Dieser Frage nähert sich der britische Zoologe Arik Kershenbaum ebenso wissenschaftlich wie spielerisch an. Geleitet wird er dabei von der Überzeugung, dass im All nicht nur die universellen Gesetze der Physik und Chemie gelten, sondern auch die der Biologie. Kenntnisreich und anhand von unzähligen mal komischen, mal bizarren, immer aber überraschenden Beispielen erläutert er jene Grundsätze, die unabhängig von unserem Heimatplaneten auch in anderen Galaxien gelten dürften, insbesondere das der Evolution durch natürliche Selektion. Kershenbaum nimmt uns mit auf eine Reise durch die Welten und führt uns die Kuriositäten der terrestrischen Tierwelt vor, von afrikanischen Fischen, die über elektrische Signale kommunizieren, weiblichen Erdmännchen, die sich komplett der Erziehung ihrer Neffen und Nichten hingeben, bis hin zu Ameisen, die als Gemeinschaft Pilze züchten. Und auch Beispiele aus bekannten Filmen wie Star Trek oder Romanen wie Die schwarze Wolke, Moby-Dick bis Harry Potter dienen der Veranschaulichung. So ist der Naturführer durch den Kosmos ein höchst unterhaltsamer Ausflug durch die Tier- und Pflanzenwelt unseres Planeten und darüber hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arik Kershenbaum
Ein Naturführer durch den Kosmos
Was terrestrische Tiere über Außerirdische verraten – und über uns selbst
Aus dem Englischen von Dirk Höfer
Meinem Hund Darwin,
der mich darüber auf klärte, wie viel Gemeinsamkeiten selbst die unterschiedlichsten Arten besitzen.
Und meinem Vater,
der mir beibrachte, sowohl auf Unterschiede als auch auf Gemeinsamkeiten zu achten.
Inhalt
1. Einleitung
2. Form und Funktion – was allen Welten gemeinsam ist
3. Was sind Tiere und was Aliens?
4. Bewegung – durch den Raum krabbeln und gleiten
5. Kommunikationskanäle
6. Intelligenz (was immer das ist)
7. Sozialität – Kooperation, Konkurrenz und Kaffeekränzchen
8. Information – ein uraltes Gut
9. Sprache – eine einzigartige Fertigkeit
10. Künstliche Intelligenz – ein Universum voller Bots?
11. Menschsein wie wir es kennen
12. Epilog
Danksagung
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Register
1. Einleitung
Dass auch anderswo im Universum Leben vorkommt, ist so gut wie sicher, etwas darüber in Erfahrung zu bringen jedoch nahezu unmöglich. Ich möchte mit dem vorliegenden Buch zeigen, dass wir eigentlich schon eine ganze Menge über das Aussehen, die Lebensweise und das Verhalten von Aliens sagen können.
Mit wachsender Zuversicht lässt sich behaupten, dass es auch anderswo im Universum Leben gibt und, weit aufregender, dass wir es vielleicht sogar entdecken können. Ellen Stofan, eine Wissenschaftsdirektorin der NASA, sagte 2015 voraus, dass wir in zwanzig bis dreißig Jahren auf anderen Planeten Leben nachweisen können. Natürlich dachte sie dabei an Mikroben oder deren außerirdisches Äquivalent und nicht unbedingt an intelligentes Leben. Aber im Prinzip ist dies noch immer eine atemberaubende Perspektive. Nach der Obsession für außerirdisches Leben zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts und einem selbstgefälligen Pessimismus in den 1970er und 80er Jahren sind wir inzwischen wieder bei einem realistischen wissenschaftlichen Optimismus angelangt. Dieses Buch handelt davon, wie wir uns mithilfe eines realistischen Wissenschaftsansatzes ein schlüssiges und einigermaßen zuverlässiges Bild über außerirdisches und insbesondere intelligentes außerirdisches Leben machen können.
Was können wir über das Aussehen von Aliens tatsächlich wissen, wo doch in New York bislang noch keine gelandet sind? Müssen wir uns auf die Fantasie Hollywoods und die von Science-Fiction-Autoren verlassen? Oder sind außerirdische Tiere gar nicht um so vieles bizarrer als auf riesigen Füßen hüpfende Kängurus oder Tintenfische, die mit Rückstoßantrieb und einer in allen Regenbogenfarben leuchtenden Haut durchs Meer schießen? Wenn wir auf die universellen Gesetze der Biologie vertrauen, denen wir zusammen mit allem Leben auf der Erde unterliegen – aber auch die mutmaßlichen Lebewesen auf anderen Planeten – wird deutlich, dass die Anpassungen, die die Tiere auf der Erde durchgemacht haben, sich wahrscheinlich Gründen verdanken, die auch auf anderen Planeten herrschen. Hüpfen und Wasser ausstoßen dürften auf zahlreichen anderen Planeten ebenso perfekte und angemessene Fortbewegungsmittel darstellen wie auf der Erde.
Wie selten ist das Leben im Universum? Bis in die 1990er Jahre hinein war es eine Sache der Spekulation und zum Teil mathematischer Berechnungen, ob Planeten (Exoplaneten) um andere Sterne kreisten. Es gab keine genaue Vorstellung, wie viele dieser Himmelskörper in unserer Galaxie existieren und wie sie beschaffen sein könnten: Welche Temperaturen, Schwerkraftverhältnisse und chemischen Elemente auf ihnen herrschen würden. Als die Technik so weit gediehen war, dass sie tatsächlich Planeten anderer Sonnensysteme aufspüren konnte, wuchs die Begeisterung. Vielleicht war es ja doch möglich, Planeten zu entdecken, die außerirdische Lebensformen beherbergten.
Die ersten Hinweise waren enttäuschend. Bei den wenigen Planeten, die man entdeckte, handelte es sich um große, heiße Gasriesen, die dem Leben, wie wir es kennen, aber auch anderen Formen, nicht unbedingt zuträglich sind. Doch weniger als zwanzig Jahre nachdem der erste Exoplanet entdeckt wurde, fand ein wichtiger Durchbruch statt. Das Kepler-Weltraumteleskop, mit dem man nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems suchen wollte, wurde ins All geschossen und fest auf eine winzige Himmelsregion ausgerichtet. Innerhalb von nur sechs Wochen nach Inbetriebnahme waren fünf neue Exoplaneten entdeckt worden. Als das Teleskop 2018 eingestellt wurde, waren allein in diesem einen winzig kleinen Himmelsgebiet – einer Fläche, die sich mit auf Armeslänge ausgestreckter Faust abdecken lässt – unglaubliche 2662 um Sonnen kreisende Himmelskörper entdeckt worden.
Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse sind überwältigend. In der Milchstraße gibt es weit mehr Planeten als gedacht und aufgrund von verbesserten Messmethoden wissen wir mittlerweile eine ganze Menge über ihre Beschaffenheit. Wir sind auf die gesamte Bandbreite planetarer Bedingungen gestoßen, von heißen jupitergroßen Gasplaneten bis zu solchen, die der Erde bemerkenswert ähnlich sind.1 Das Universum ist inzwischen viel überfüllter als es noch 2009 zu sein schien und unsere Enkel werden kaum glauben können, dass wir einmal der Auffassung waren, erdähnliche Planeten seien selten. Für die Behauptung, das Universum biete keine Heimat für außerirdisches Leben, gibt es keine Ausrede mehr.
Inzwischen verstehen wir weit besser, welche physikalischen Umwelten auf Exoplaneten existieren und sind sogar immer mehr in der Lage, sie direkt zu messen. Die zurzeit entwickelten neuen Instrumente werden die chemischen Elemente in der Atmosphäre eines Planeten bestimmen können, indem sie Veränderungen des Lichts registrieren, das durch die Atmosphäre des umkreisten Sterns dringt. Wir werden natürlich nach Sauerstoff suchen, aber auch nach komplexen chemischen Verbindungen, die auf eine industrielle Entwicklung hinweisen könnten. Umweltverschmutzung ist, so paradox es klingt, ein Zeichen für kosmische Intelligenz.
Leben ist im Universum mindestens einmal entstanden. Wir sind der Beweis dafür. Wie sich dies aber abgespielt hat, wissen wir nicht. Natürlich gibt es zahlreiche Theorien über die Vorgänge, die zur Entstehung des Lebens auf der Erde geführt haben könnten. Am wahrscheinlichsten ist, dass sich die lebensnotwendigen chemischen Elemente zufällig bildeten und sich dann durch einen weiteren glücklichen Zufall zu speziellen Molekülen zusammenschlossen, die sich selbst kopieren konnten. Insgesamt gesehen eine ziemlich unwahrscheinliche Reihe von Umständen. Bedeutet dies nun, dass das Leben auch auf anderen Planeten auf diese Weise entstand? Keineswegs. Wir wissen tatsächlich nicht, wie relevant die Prozesse, die mutmaßlich auf der Erde stattfanden, für andere Planeten sind. Außerirdische Lebensformen könnten auf einer der unseren gleichenden oder sich von ihr unterscheidenden Kohlenstoffchemie beruhen, oder einer Chemie, die völlig anders geartet ist.
Die chemischen Grundprinzipien sind weitgehend bekannt, sodass sich diese Vorstellungen im Labor überprüfen lassen; es lässt sich feststellen, welche chemischen Stoffe stabil sind und welche nicht. Wir gehen davon aus, dass die chemischen Verbindungen, aus denen unsere Körper bestehen, ziemlich gute Bausteine für etwas, »das lebt«, darstellen. Aber jenseits der grundlegendsten Vorstellungen, wie eine außerirdische Biochemie beschaffen sein könnte, liegt ein dicker Nebelschleier. Wir haben weder Proben außerirdischer Pflanzen oder Tiere, die wir untersuchen könnten, noch die geringste Ahnung, ob auf einem anderen Planeten Bezeichnungen wie »Pflanzen« und »Tiere« überhaupt angebracht sind. Ungeachtet des Optimismus der NASA, dass wir Anzeichen für außerirdisches Leben entdecken werden, würden die riesigen Entfernungen zwischen den Sternen einen enormen technologischen Sprung erfordern, wollten wir Planeten außerhalb unseres Sonnensystems besuchen. In unseren Labors sind wir vielleicht imstande, außerirdische chemische Verbindungen zusammenzumischen, schwieriger aber wird es sein, außerirdische Vögel durchs Fernglas zu beobachten.
Wenn wir das Wesen außerirdischer Lebensformen verstehen wollen, besteht ein Problem darin, dass wir nur einen einzigen Lebenstypus, nämlich den auf der Erde, als Vergleichsgröße heranziehen können. Bis zu welchem Grad lassen sich von dem Leben auf der Erde Schlüsse für ein mögliches Leben auf anderen Planeten ziehen? Manche Leute behaupten, dass Spekulationen über außerirdische Lebensformen müßig seien; dass unsere Vorstellungskraft viel zu eng an unsere eigene Erfahrung geknüpft sei, um die schwindelerregend vielfältigen und unbekannten Möglichkeiten ins Auge zu fassen, die vielleicht in anderen Welten Realität geworden sind. Der Science-Fiction-Autor und Verfasser von 2001: Odyssee im Weltraum, Arthur C. Clarke, sagte: »Nirgendwo im Weltraum werden unsere Augen auf die vertrauten Formen von Bäumen und Pflanzen oder von Tieren stoßen, mit denen wir unsere Welt teilen.« Der Glaube, dass außerirdisches Leben zu fremdartig sei, um sich ein Bild davon machen zu können, ist weit verbreitet. Doch ich bezweifle das. Die Wissenschaft hat uns Mittel an die Hand gegeben, eine solch pessimistische Perspektive zu überwinden und wir sind, wie es aussieht, durchaus in der Lage, ein paar Anhaltspunkte auszumachen, mit denen sich Aussagen über außerirdische Lebensformen treffen lassen. In diesem Buch geht es darum, aus unserem Wissen über das Leben und wie es funktioniert und wichtiger noch, wie es sich entwickelt hat, Erkenntnisse über mögliches Leben auf anderen Planeten zu gewinnen.
Warum interessiert sich ein bodenständiger Zoologe wie ich – der es eher gewohnt ist, Wölfen durch den Schnee der Rocky Mountains zu folgen oder pelzigen Klippschliefern in den Hügeln von Galiläa nachzuspüren – für die Suche nach außerirdischem Leben? Eines meiner Studienfelder ist die Kommunikation von Tieren und warum sie überhaupt Laute von sich geben. 2014 hielt ich einen Vortrag am Radcliffe Institute in Harvard mit dem Titel »Würden wir mitbekommen, wenn Vögel reden könnten?« Für uns mag es selbstverständlich sein, dass Menschen über Sprache verfügen, andere Tiere aber nicht. Doch können wir wirklich sicher sein, dass dem so ist? In der Kommunikation von Tieren suchte ich nach mathematischen Fingerabdrücken von »Sprache«, nach einem eindeutigen Maß, das besagen würde: »Ja, das ist Sprache« oder »Nein, das ist keine Sprache«. Ermuntert von guten, aber auch etwas exzentrischen Kollegen, war es ein naheliegender Schritt, sich mit der gleichen Fragestellung Signalen aus dem Weltall zuzuwenden. Handelt es sich dabei um Sprache? Und wenn ja, von welchen Lebewesen könnte sie stammen? Daraus ergibt sich, dass wir unsere Erkenntnisse über andere Aspekte des Lebens auf der Erde – Nahrungssuche, Fortpflanzung, Konkurrenz und Kooperation – auch auf andere Planeten ausdehnen können.
Warum sich aber mit außerirdischem Leben befassen, wenn wir noch keine außerirdischen Lebensformen gesehen haben und noch nicht einmal wissen, ob sie überhaupt existieren? Wenn die Erstsemester an die Universitäten kommen, frisch von der Schule und Prüfungen gewohnt, bei denen sie ihre Fähigkeit, endlose Faktenreihen auswendig zu lernen unter Beweis stellen mussten, ist es unsere Aufgabe als Lehrkräfte, sie davon zu überzeugen, dass Fakten zwar schön und gut sind, dass sie aber vor allem lernen müssen, Konzepte zu verstehen; nicht was in der natürlichen Welt geschieht, ist nun wichtig, sondern warum es geschieht. Entscheidend für die Zoologie auf der Erde ist es, Prozesse zu verstehen, wobei Einsichten in diese Prozesse helfen, über die Zoologie anderer Planeten zu spekulieren. Während der Niederschrift dieser Zeilen bereiten sich in Cambridge unsere Studenten im zweiten Studienjahr auf eine Feldforschungsreise nach Borneo vor. Einige von ihnen verlassen das Vereinigte Königreich zum ersten Mal in ihrem Leben. Erwartet man von ihnen, dass sie ein Handbuch zu den hunderten Vögeln und tausenden Insekten Borneos auswendig lernen? Natürlich nicht. Wie zukünftige Erforscher einer außerirdischen Welt müssen sie vor allem Einsicht in die evolutionären Prinzipien mitbringen, die zu der in Borneo zu beobachtenden Artenvielfalt führten. Erst wenn die Konzepte deutlich geworden sind, werden sie in der Lage sein, die Tiere, auf die sie stoßen, auch einzuordnen.
Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass die Gesetze der Physik und Chemie eindeutig und universell sind. Sie funktionieren auf jedem anderen Exoplaneten genau so gut wie auf der Erde. Vorhersagen, die wir über das Verhalten physikalischer und chemischer Stoffe unter unterschiedlichen Bedingungen treffen, lassen sich – bei gleichen Bedingungen – ebenso gut auf ihr Verhalten in anderen Teilen des Universums anwenden. Wir verlassen uns darauf, dass Wissenschaft auf eben diese Weise funktioniert. Die Biologie stellt jedoch für viele Menschen eine Ausnahme dar. Wir wollen nicht glauben, dass die biologischen Gesetze, die wir für die Erde herausgefunden haben, auch auf einem Exoplaneten gelten. Carl Sagan, einer der berühmtesten Astronomen des zwanzigsten Jahrhunderts und leidenschaftlich davon überzeugt, dass es auch anderswo im Weltall intelligentes Leben gibt, schrieb: »Nach allem, was wir wissen, ist die Biologie buchstäblich auf die Provinz der Erde beschränkt, und vielleicht ist das, was wir vor Augen haben, bloß ein Sonderfall in einem Universum mannigfaltiger Biologien.«2
Bei der Beschäftigung mit dem Unbekannten ist tatsächlich Vorsicht geboten. Aber es gibt auch guten Grund für Optimismus; es gilt lediglich, sorgfältig jene biologischen Gesetze auszuwählen, die ebenso universell sind wie die Gesetze der Physik. Warum sollte die Biologie »auf die Provinz der Erde beschränkt« sein und nicht auch universell gelten? Sind Naturgesetze – die der Physik, der Chemie und die der Biologie – nicht im gesamten Universum gleich? Unwahrscheinlich, dass die Erde so außergewöhnlich ist, dass sich die Gesetze hier von denen auf anderen Planeten unterscheiden. Der römische Philosoph Lukrez, der ca. 55 v. u. Z. starb, merkte an: »Die Natur ist nicht auf die sichtbare Welt beschränkt.« Selbst Exoplaneten, die wir noch nicht gesehen haben, verfügen über »Natur«.
Anders als oft geglaubt wird, verbringen Zoologen wie ich ihre Zeit nicht damit, Tiere zu bestimmen und zu klassifizieren. Wie Wissenschaftler in allen anderen Disziplinen auch versuchen wir zu erklären, was wir in der uns umgebenden Welt beobachten. In der Zoologie und in der Evolutionsbiologie im Allgemeinen geht es darum, Mechanismen vorzuschlagen, mit denen sich die Natur des Lebens erklären lässt. Warum leben Löwen in Rudeln, während Tiger allein jagen? Warum haben Vögel nur zwei Flügel? Warum eigentlich verfügen Tiere meistens über eine rechte und eine linke Seite? Beobachten allein reicht nicht aus. So wie Physiker Gesetze für Planeten und Sterne entdecken, wollen wir Gesetzmäßigkeiten für das Leben herausfinden. Wenn diese biologischen Gesetze so wie das Gravitationsgesetz universelle Gesetze sind, funktionieren sie auch auf anderen Planeten.
Natürlich wirkt die Biologie oft unstet und unvorhersehbar. Ein Physiker versteht genau, wie ein Ball einen Hang hinabrollt und hat eine Reihe von Gleichungen zur Hand, mit der sich überall im Universum die Bewegung eines Balls einen Hang hinab vorhersagen lässt. Physikalische Experimente basieren auf stark kontrollierten und vereinfachten Bedingungen – nicht gerade das, womit wir es in der Welt der Biologie zu tun haben. In einem gängigen Witz geht es um einen Physiker, der versucht Gleichungen aufzustellen, mit denen sich das Verhalten eines Huhns vorhersagen lässt, und dann erklärt, dies sei möglich, aber nur mit einem kugelförmigen Huhn in einem Vakuum. Echte Hühner gehören nicht in den Bereich der »Physik« und sind deshalb, wie ein Physiker sagen würde, unvorhersagbar. Warum aber können wir die Bewegungen eines Balls vorhersagen, nicht aber das Verhalten eines Huhns?
Biologische Systeme scheinen, weil sie auf eine tiefgreifende Weise komplex sind, keinen strengen Regeln zu folgen. Mathematisch gesprochen, ist ein komplexes System ein System, in dem mehrere Untersysteme in wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Dabei stellt sich heraus, dass bereits bei geringer Abhängigkeit zwischen relativ einfachen Systemen das Gesamtverhalten des Systems äußerst komplex und unvorhersagbar oder – um den technischen Begriff heranzuziehen – chaotisch wird. Man versuche nur, sich das Verhalten aller im eigenen Körper miteinander in Wechselbeziehung stehender Organe vorherzusagen, oder besser noch, aller Zellen in all diesen Organen und immer so weiter … Die geringste Veränderung in einem Element kann eine kaskadierende, unvorhersehbare Wirkung nach sich ziehen. Sogar einfachste Lebensformen sind eindeutig komplex. Und komplexe Systeme lassen sich schwer vorhersagen.
Zu den frustrierenden Eigenschaften eines komplexen oder chaotischen Systems gehört, dass man, egal wie gründlich man es untersucht, niemals alle seine Geheimnisse zu entschlüsseln vermag. Wir haben uns an die Idee gewöhnt, dass wir eine Sache, wenn wir sie nur eingehend genug unter die Lupe nehmen, irgendwann völlig verstehen. Offenbar basiert Wissenschaft auf dieser Vorstellung. Die Chaostheorie lehrt uns aber, dass man bei einem System, das man mit hundertfacher Genauigkeit untersucht, nur zehnmal mehr Aussagen über sein Verhalten treffen kann. Man kann immer mehr Mittel aufwenden, um ein komplexes System zu verstehen und wird doch nur sehr karge Ergebnisse bekommen. Es ist vergebliche Liebesmüh. Zum Glück weisen komplexe Systeme sogenannte emergente Eigenschaften auf: Man ist vielleicht nicht in der Lage, ihr Verhalten genau vorherzusagen, aber man wird die allgemeine Tendenz erkennen. Ein Huhn wird nach Körnern suchen, selbst wenn man nicht weiß, nach welchen. Praktisch gesehen heißt das für mich als Biologen, dass die Aussage »das Huhn sucht nach Körnern« letztlich brauchbarer ist als »das Huhn sucht nach diesen ganz bestimmten Körnern«. Wir werden demnach keine genaue Aussage darüber treffen können, wie die Biochemie außerirdischen Lebens funktioniert, oder wie die Augen von Aliens beschaffen sein werden; wir werden aber voraussagen können, dass ihre Biochemie sie mit Energie versorgt und ob sie Augen besitzen oder nicht.
Um welche universellen Gesetze der Biologie handelt es sich also, mit deren Hilfe wir zuverlässige Aussagen über das Leben auf anderen Planeten treffen können? Das erste und wichtigste Gesetz lautet, dass sich komplexes Leben durch natürliche Selektion entwickelt. Man kann die Bedeutung dieses Prozesses, der seit der bahnbrechenden Arbeit von Charles Darwin zu einem Eckpfeiler der Biologie geworden ist, nicht genug betonen. Die natürliche Selektion ist nicht nur der einzige uns bekannte Mechanismus, bei dem sich Komplexität aus Einfachheit ergibt (wenn wir nicht von einer göttlichen Kraft ausgehen wollen, die die Entwicklung von Komplexität vorantreibt), sie ist auch ein unabdingbarer Mechanismus, der nicht nur auf den Planeten Erde oder das »Leben, wie wir es kennen« beschränkt ist. Wenn wir im Universum auf Komplexität stoßen – der Art, die wir als Leben bezeichnen würden –, dann, weil dort natürliche Selektion stattgefunden hat.
Es gibt weitere exzellente Bücher, die für die Universalität der natürlichen Selektion plädieren,3 aber meine These ist so außergewöhnlich, dass ich im nächsten Kapitel genauer erläutern werde, was ich mit der Aussage »die Evolution außerirdischer Lebensformen fand durch natürliche Selektion statt«, meine. Wie der Philosoph Daniel Dennett herausstellte, handelt es sich bei der natürlichen Selektion und dem von Kreationisten verfochtenen Intelligent Design um nahezu das Gleiche: Der zunehmende Erwerb guter Eigenschaften und die Zurückweisung schlechter.4 Ob wir ein Flugzeug entwerfen oder eine Büroklammer, wir halten an den guten Einfällen der Vorgängerentwürfe fest. Allerdings unterscheiden sich Selektion und Design darin, dass letzteres ein Ziel vor Augen hat, während die Selektion immer nur einen Schritt nach dem anderen geht. Eine Giraffe »weiß« nicht, dass ein langer Hals gut für sie wäre, aber trotzdem entwickelt sie einen.
Im Grunde macht diese Kurzsichtigkeit der natürlichen Selektion unsere Vorhersagen über außerirdische Lebensformen leichter. Wir müssen keine Aussagen treffen, wie sie aussehen sollten, wir müssen lediglich die Bedingungen auf einem bestimmten Planeten zu einer gegebenen Zeit betrachten, um einschätzen zu können, welche Eigenschaften dort entstehen werden. Wenn wir wissen, dass auf einem Planeten hohe Bäume (oder deren Entsprechungen) vorkommen, können wir vermuten, dass es dort Tiere mit langen Hälsen, langen Beinen oder etwas Vergleichbarem gibt.
Evolution durch natürliche Selektion zeichnet sich noch durch eine andere nützliche Eigenschaft aus: Sie ist nahezu unabhängig von den Mechanismen, durch die Fortpflanzung und Selektion stattfinden. Richard Dawkins hat bekanntlich den Ausdruck »Mem« erfunden. Dabei handelt es sich um ein soziales Konzept oder eine gesellschaftliche Auffassung (wie etwa Religion), die sich durch Kommunikation fortpflanzt und nach dem Modell der Evolution mit anderen Ideen in Wettbewerb tritt.5 Natürliche Selektion lässt sich streng mathematisch und ohne Bezug zu einem bestimmten biologischen System oder einer organischen Fortpflanzungsform definieren. Deshalb ist sie ein so unglaublich mächtiges Konzept; ihre Einfachheit und Universalität bedingen, dass sie auf jeden mutmaßlichen Weg zu komplexem Leben im Universum zutrifft. Natürliche Selektion braucht keine DNA oder sonst eine Form irdischer Biochemie. Wir müssen also nicht genau wissen, wie die Biochemie außerirdischer Lebensformen beschaffen ist, denn wie auch immer sie funktioniert, sie ist durch natürliche Selektion bedingt.
Das Feld der Astrobiologie oder die Erforschung außerirdischen Lebens hat sich bisher auf ein paar klar umrissene Gebiete konzentriert. Meistens erforschen Astrobiologen den Ursprung des Lebens: Wie ist auf der Erde Leben entstanden und wie wahrscheinlich ist es demnach, dass es Leben auf anderen Planeten gibt? Ist das Leben auf der Erde einmal oder mehrmals entstanden? Fand dieses Wunder, wie Darwin vermutete, in warmen flachen Lagunen statt, oder an Unterwasservulkanen, wo das heiße Wasser und ein reiches Mineralvorkommen die besten Lebensbedingungen für seltsame und wundervolle Bakterien boten?
Eine weitere wichtige Frage lautet, welche anderen Formen der Biochemie es noch geben könnte. Vielleicht verwendet das Leben auf anderen Planeten keine DNA als genetisches Material, vielleicht ist die Biochemie außerirdischer Lebensformen völlig anders aufgebaut und basiert zum Beispiel auf einem anderen Lösungsmittel als Wasser. Dies ist besonders bedeutsam, da viele Planeten (auch solche in unserem Sonnensystem) zu kalt oder zu heiß sind, als dass flüssiges Wasser auf ihnen vorkommen könnte. Diese wichtigen Felder sind jedoch nicht Thema dieses Buchs. Wir möchten Fragen nachgehen, die Astrobiologen nur selten stellen: Wie könnten komplexe außerirdische Lebensformen aussehen? Lassen sich mit den Mitteln und Anhaltspunkten, die wir von der Erde kennen, konkrete Schlüsse hinsichtlich der Ökologie und des Verhaltens solcher Lebensformen ziehen?
Ein Zoologe, der aus der Ferne einen neu entdeckten Kontinent beobachtet, hätte eine lebhafte Vorstellung davon, welche Geschöpfe dort leben könnten. Dabei würde es sich nicht um wilde Spekulationen handeln, sondern um sorgfältig begründete Hypothesen, beruhend auf der großen Artenvielfalt von Tieren, die wir bereits kennen sowie auf ihren gelungenen Anpassungen an ihre Lebensumstände: wie sie fressen, schlafen, sich Partner suchen und Nester bauen. Je mehr wir darüber wissen, wie sich die Tiere an die alte Welt angepasst haben, desto besser können wir über die neue Welt spekulieren.
Diesem Ansatz folge ich, um über außerirdische Lebensformen zu sprechen. So unterschiedlich diese auch ausfallen mögen, gibt es doch manches, was wir von den Lebensweisen auf der Erde lernen können. Die Evolutionsprozesse, die wir hier beobachten, verdanken sich Anpassungserfordernissen und Mechanismen, die vermutlich auch anderswo eine Rolle spielen. Bewegung, Kommunikation, Kooperation sind evolutionäre Lösungen universeller Probleme.
Sollten wir jemals mit außerirdischen Zivilisationen – nicht nur Mikroben oder Quallen, sondern intelligenten Wesen – in Kontakt kommen, können wir zuverlässig davon ausgehen, dass sie über eine bestimmte Technologie verfügen (wie könnten wir sie sonst kontaktieren?), und das bedeutet, dass sie kooperative und daher soziale Wesen sind. Aber schon allein das Wissen, dass eine Art sozial ist, löst eine Lawine zusätzlicher evolutionärer Implikationen aus. Aliens könnten, wie wir, brutal und kriegslüstern sein; ich werde aber darauf abheben, dass sie als soziale Wesen auch altruistisch sein müssen. Wenn ein außerirdisches Raumschiff im Zentrum Londons landet, wäre dies ein sicheres Zeichen, dass seine Passagiere miteinander »sprechen« oder eine andere Art von Sprache benutzen. Ob diese Sprache akustisch, visuell oder gar elektrisch stattfindet, lässt sich nicht sagen. Ob zwei, viele oder keine Beine, letzten Endes wird, wenn wir einer außerirdischen Zivilisation begegnen sollten, Sprache das wichtigste Merkmal sein, das wir mit ihren Vertretern teilen.
Streng wissenschaftliche Erwägungen im Hinblick auf die Möglichkeit außerirdischen Lebens sind zwar nicht häufig, aber es gibt sie. Wir sind mit der modernen Science-Fiction der Star Trek-Reihe ebenso vertraut wie mit den mehr oder weniger dürftigen Spekulationen von H. G. Wells’ Krieg der Welten. Seit man davon ausgeht, dass die Planeten eigene stabile Welten bilden, versuchte man herauszufinden, ob es auf ihnen auch Leben gibt. 1913 veröffentlichte ein britischer Astronom namens Edward Walter Maunder6 ein schmales Buch mit dem Titel Are the Planets Inhabited? Darin geht er mit großer wissenschaftlicher Sorgfalt der Frage nach, ob auf den Planeten unseres Sonnensystems Leben möglich ist und handelt der Reihe nach jeden Planeten, den Mond und sogar die Sonne ab. (Von letzterer nahmen etwa Wissenschaftler vom Range eines William Herschel, dem Entdecker des Uranus, an, dass sie Leben beherbergen könnte.) Für Merkur, Mars, Mond und Sonne folgert er, dass diese Möglichkeit aufgrund der seinerzeit zur Verfügung stehenden Beobachtungen und Messungen klar auszuschließen sei. Sogar nach heutigen Standards sind seine Begründungen schwer zu widerlegen.
Gleichwohl lag er mit seinen Schlussfolgerungen oft falsch. Unser Verständnis des Universums ist beschränkt, nicht nur weil unser logisches Denken seine Grenzen hat, sondern auch die Genauigkeit unserer Messungen. Zudem verstehen wir die Mechanismen, die die auf unsere Umwelt einwirkenden biologischen und physikalischen Prozesse bedingen, nur unzureichend. Wir stellen womöglich fatale Fehlberechnungen an, einfach, weil es unserem Wissen an Details mangelt. Maunder sah in der Venus den besten Kandidaten für Leben im Sonnensystem, denn die Astronomen seiner Zeit schätzten die dort herrschende Oberflächentemperatur auf 95 Grad Celsius und nahmen an, die den Planeten bedeckenden dicken Wolken bestünden aus Wasserdampf. Mittlerweile mit besseren Messinstrumenten ausgestattet (ganz zu schweigen von den Raumsonden, die auf der Venus gelandet sind), wissen wir, dass die Oberflächentemperatur der Venus bei 450 Grad Celsius liegt und die schönen hellen weißen Wolken tatsächlich aus Schwefelsäure bestehen. Mangel an guten Daten wird unsere Erklärungsversuche immer behindern, aber wie Maunder sollten wir, nur weil unsere Daten ungenau sind, von unserer Suche nicht absehen.
Wir möchten alle wissen, wie Aliens aussehen, aber sich auf die Fantasie der Hollywoodproduzenten zu verlassen, ist nicht unbedingt realistisch. Über die Zeit hat man sich Aliens entweder als übersteigerte Menschen oder übergroße Erdentiere vorgestellt – vielleicht als riesige Spinnen oder Würmer, dazu ausersehen, Albträume hervorzurufen. Das Unbekannte und das Dunkel sind für uns so furchteinflößend wie für unsere Vorfahren vor der Erfindung des elektrischen Lichts und wir fürchten, dass »da draußen« Tiere und Dämonen auf der Lauer liegen. Doch trotz des großen Reizes, der sich in der Gleichsetzung des Unbekannten mit dem Unheimlichen auf der Kinoleinwand entfaltet, ist dies nicht gerade eine zielführende Forschungsmethode. Ginge es nicht wissenschaftlicher, wenn wir wissen wollen, wie Aliens aussehen? Leider wirken auch die besten Bemühungen um eine seriöse Argumentation noch immer ein wenig lächerlich, wenn es sich nicht ohnehin um reine Mutmaßungen handelt.
Leichter als das Erscheinungsbild von außerirdischen Lebensformen ist jedoch ihr Handeln vorherzusagen. Das Aussehen ist anfälliger für Unfälle der Evolution und für die Launen der embryonalen Entwicklung; Verhalten ist eine viel grundlegendere Reaktion auf die Umwelt. Wir besitzen zwei Arme und zwei Beine weitgehend wegen eines evolutionären Zufalls: Unsere Quastenflosser-ähnlichen Vorfahren nutzten zur Navigation durch die seichten Gewässer, in denen sie vor 400 Millionen Jahren lebten, vier Flossen. Diese vier Gliedmaßen finden sich auch heute noch bei den Nachfahren der urtümlichen Fische: Den heutigen Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren. Mit einem anderen Vorfahren, zum Beispiel einem Krebstier, hätten wir vielleicht sechs oder acht Beine. Ob wir gar mit einer ungeraden Zahl von Beinen hätten ausstaffiert sein können, lässt sich vielleicht nach Kapitel vier entscheiden, und auch, ob Sie mit mir einer Meinung sind, dass Aliens über Beine oder dergleichen verfügen müssen.
Verhalten dient einem Zweck. So löst etwa soziales Verhalten (dem wir uns in Kapitel sieben widmen werden) Probleme, die in allen Welten existieren – Probleme, die man nicht allein lösen kann, etwa die Jagd auf Tiere, die größer sind als man selbst, oder der Bau von Verteidigungsstrukturen, in denen man lebt. Wenn außerirdische Lebensformen mit Problemen konfrontiert sind, die sie nicht allein lösen können, dann werden sie unter Umständen ein soziales Verhalten an den Tag legen. Es stimmt, unser soziales Verhalten ist im Allgemeinen idiosynkratisch und es ist nicht zu erwarten, dass Aliens wie wir über Religion oder kapitalistische Ökonomien verfügen, doch bestimmte Grundzüge der Sozialität müssen universell sein. Allein, dass soziales Verhalten existiert, beruht auf solchen Faktoren wie Reziprozität, Altruismus und Konkurrenz; sie treiben die Evolution des sozialen Verhaltens an und müssten bei allen Arten, die sozial sind, vorkommen.
Andere Kapitel in diesem Buch befassen sich mit ähnlichen Verhaltenserfordernissen sowie ihren evolutionären Ursprüngen und Implikationen: Kommunikation, Intelligenz und sogar Sprache und Kultur spielen bei der Ausformung dessen, was wir als Humanität bezeichnen, eine Rolle. Und nicht einmal diese »Besonderheiten« der menschlichen Natur sind so idiosynkratisch wie sie zunächst erscheinen mögen. Sie könnten sogar eine verbindende Ähnlichkeit zwischen uns und den Außerirdischen darstellen. Wen interessiert es denn, ob letztere grün oder blau sind, solange auch sie Familien und Haustiere besitzen, Bücher lesen und schreiben und für ihre Kinder und Verwandten sorgen?
Jedes Kapitel in diesem Buch handelt von einem Aspekt tierischen Verhaltens, der nicht nur auf der Erde vorkommt, nicht nur auf der Erde vorkommen kann. Wir erfinden zwar gern seltsam aussehende Aliens, müssen aber keine sich seltsam verhaltenden Aliens erfinden, denn die Mannigfaltigkeit des Verhaltens hier auf der Erde umfasst bereits vieles von dem, was auch auf anderen Planeten anzutreffen sein dürfte. In Kapitel zwei stelle ich diese Idee vor – ich erkläre, warum wir auf irdische Beispiele zurückgreifen dürfen, um das Leben auf anderen Planeten zu verstehen. Kapitel drei befasst sich mit der Frage, was es bedeutet ein »Tier« zu sein: Handelt es sich bloß um die Definition eines Lebewesens, wie es auf der Erde vorkommt, oder lässt sie sich auch auf Organismen anwenden, die mit denen auf der Erde absolut nicht verwandt sind? In Kapitel vier und fünf wird es darum gehen, wie sich Tiere, auch außerirdische, bewegen und wie sie kommunizieren – zwei Verhaltensformen, die wir auch auf Exoplaneten vorfinden dürften und die den Zwängen physikalischer Gesetze in einer Weise unterliegen, dass wir ohne Weiteres Vermutungen anstellen können, wie sie funktionieren. In Kapitel sechs geht es um das so trügerische wie hochgeschätzte Merkmal der Intelligenz: Wie Tiere die Welt, in der sie leben, verstehen und wie sie Probleme lösen, mit denen sie konfrontiert sind. Wir glauben nur zu gern an intelligente Aliens und wie ich in diesem Kapitel darlege, ist es geradezu unvermeidlich, dass es sie gibt. Kapitel sieben handelt von einer weiteren Eigenschaft, die wir uns bei Außerirdischen erhoffen: Kooperation und soziales Verhalten.
Auf der Erde leben so viele Tiere in Gruppen, und das aus guten Gründen – Gründen, die nicht nur auf unseren Planeten beschränkt sind. Kapitel acht und neun befassen sich mit Informationsaustausch und mit der Sprache selbst, dem einen Merkmal, das nach heutigem Stand unter allen anderen Lebensformen auf der Erde einzig dem Menschen eigen zu sein scheint. Kapitel zehn widmet sich der komplizierten Frage künstlichen Lebens, und ob außerirdische Planeten so anders aussehen würden, wenn ihre Bewohner nicht Tiere wären, wie wir sie kennen, sondern Roboter oder Computer. Kapitel elf befasst sich schließlich mit einer schwierigen philosophischen Frage: Wie verändert sich der Blick auf Wesen und Einzigartigkeit des Menschen, wenn intelligente, sprechende, soziale Aliens tatsächlich existieren?
Unsere Versuche, die Natur außerirdischer Lebensformen zu verstehen, stecken vielleicht noch in den Kinderschuhen, ihnen kommt aber bei der Entwicklung der Astrobiologie als Disziplin, bei den Erkenntnisfortschritten der Lebenswissenschaften im Allgemeinen und bei der Vorbereitung auf die Zeit, in der die Menschheit sich mit der Tatsache abfinden muss, dass sie nicht allein im Universum ist, eine wichtige Rolle zu. Die Frage, wie wir als Spezies reagieren, wenn wir Leben auf anderen Planeten entdecken, ist noch nicht ausreichend erörtert worden.7 Werden wir es mit Massenhysterie und Plünderungen zu tun bekommen? Mit religiösem Fundamentalismus oder einer massenhaften Abkehr von religiösen Vorstellungen? Oder wird es vielleicht wie in dem Sechzigerjahre-Hit »Aquarius« heißen: »Dann wird Friede die Planeten leiten und Liebe wird die Sterne lenken«? Vorbereitet zu sein, kann jedenfalls nicht schaden.
Die Wissenschaftsgeschichte hat den Menschen von seinem Sockel als Krone der Schöpfung gestoßen, und die Entdeckung außerirdischen Lebens wird unsere Einzigartigkeit noch weiter infrage stellen. Oder vielleicht doch nicht? Wenn Evolutionsbiologen wie ich richtig liegen, dann teilen wir unser Erbe mit allem Leben im Universum. Es stimmt, wir haben jeweils einen anderen Ursprung, vielleicht ist auch unsere Biochemie sehr verschieden, und wir werden vermutlich keinen gemeinsamen Vorfahren mit dem Leben auf anderen Planeten haben. Aber wie wir entstanden sind, verdankt sich demselben Prozess. Unsere Evolutionsgeschichte ist vielleicht nicht identisch mit der von Bewohnern anderer Welten, aber zumindest werden wir für Zoologen auf diesen fremden Planeten als intelligente Lebensformen erkennbar sein.
Wenn sie wie wir in kooperierenden Gesellschaften leben, dann ist der Umstand, dass wir unserer Sozialität einen gemeinsamen evolutionären Ursprung zuschreiben können, keine Kleinigkeit. Und vielleicht, aber nur vielleicht, werden wir dann den Begriff »Menschheit« in einem etwas weiteren und bedeutsameren Sinne verwenden können als nur zur Beschreibung jener Nachkommen einer Horde von Affen, die einst in einem winzigen Winkel eines Kontinents, gelegen auf einem winzigen Planeten in einem entrückten Winkel in nur einer von Millionen Galaxien, über das Grasland gewandert sind.
2. Form und Funktion – was allen Welten gemeinsam ist
Im frühen neunzehnten Jahrhundert entdeckten die inzwischen legendären Fossilienjäger Mary und Joseph Anning am Strand von Lyme Regis an der englischen Südküste ein ungewöhnliches Skelett. Die Wissenschaftler, die es untersuchten, hatten Schwierigkeiten, es zuzuordnen. Die Knochen sahen aus, als gehörten sie zugleich zu einem Fisch und einem Reptil. Es handelte sich um einen Ichthyosaurier, ein im Meer lebendes Reptil mit einer langen Schnauze und gut entwickelten Augen, das bestens an eine schnelle schwimmende Fortbewegung angepasst war. Für die meisten Leser hört sich das wahrscheinlich nach einem heutigen Delfin an, aber trotz der offensichtlichen Ähnlichkeiten zwischen Delfinen und Ichthyosauriern sind die beiden Arten so wenig miteinander verwandt wie ein Mensch und ein Molch. Die Gestalt eines Tiers – wie es aussieht und sich verhält – ist unauflöslich mit der Funktion verbunden, mit der Art, wie es lebt, Energie aufnimmt und sich fortpflanzt. Dieser Zusammenhang liefert uns einen Schlüssel, anhand dessen wir, ohne uns in die Niederungen fiktionaler Spekulation begeben zu müssen, folgern können, wie außerirdische Lebensformen aussehen.
Ich habe versprochen, dass wir uns ohne Abstriche der Gesetze der Biologie bedienen, so wie wir uns der Gesetze der Physik und Chemie bedienen, um uns in einem System fundamentaler, universeller Wahrheiten zu verankern. Wenn das Universum überall gleicher Natur ist, dann richtet sich auch das Leben überall nach den gleichen Regeln. Aber wie genau sehen diese biologischen Gesetze aus? Eine Frage, der wir auf den Grund gehen sollten. Dabei gilt es zu vermeiden, aufgrund von Beobachtungen auf der Erde, die wir unsachgemäß auf andere Planeten übertragen, eine falsche Welt voll spekulativer Lebensformen zu konstruieren. Den eigenen Spekulationen zu vertrauen, die letztlich nur in der Fantasie existieren, ist eine riskante Angelegenheit.8
Abb. 1. Skelett eines Ichthyosauriers; Abb. 2. Skelett eines Delfins (unten). Beide Tiere pflegten offenbar ähnliche Lebensweisen als schnelle Unterwasserräuber (Funktion) und entwickelten deshalb ähnliche Körperstrukturen (Form).
Wir hingegen sind auf der Suche nach universellen Gesetzen, jenen absoluten Grundlagen, die das Leben bedingen und seine Natur diktieren. Bleiben Sie skeptisch. Ich könnte mich irren. Aber unsere Einsicht in die Biologie des Lebens und insbesondere in die Evolution hat einen Punkt erreicht, an dem sich meines Erachtens unser Wissen so weit generalisieren lässt, dass wir es auf andere Planeten übertragen können.
Das entscheidende Instrument, das uns in der Realität verankert und uns nicht in Science-Fiction abdriften lässt, ist die grundlegende Unterscheidung zwischen Form und Funktion. Alle Tiere besitzen bestimmte Formen, die sich deutlich unterscheiden und uns stark beeindrucken. Wir bewundern die verschiedenen Farben von Vögeln und Blumen, die seltsamen und wunderbaren Formen von Elefantenrüsseln und Narwalzähnen oder das Heulen der Wölfe und die Gesänge der Buckelwale. Die Vielfalt tierischer Formen lässt sich sowohl am Aussehen der Tiere als auch an ihrem Verhalten ablesen. Beim Aussehen geht es um Gestalt, Größe und Farbe, darum, ob sie Fell oder Gefieder tragen, ob sie über Rüssel, Stoßzähne, Schalen, Tentakel oder irgendwelche anderen Anhängsel verfügen, die die Tierarten so unverwechselbar machen.
Das Verhalten bestimmt sich durch die Art der Nahrungssuche, der Partnerwahl und des Umgangs mit Artgenossen und artfremden Spezies. Aber all diese Formen – ob Aussehen oder Verhalten – dienen einem bestimmten Zweck, erfüllen eine bestimmte evolutionäre Rolle. Gelegentlich treten evolutionäre »Unfälle« auf; dann besitzt eine Form keine Funktion mehr, besteht aber weiter. Vielleicht war diese besondere Form – wie etwa bei den Straußenflügeln – einmal nützlich, erfüllt aber keinen Zweck mehr; evolutionär gesehen entfallen dann die Gründe für weitere Veränderungen. Die meisten Formen aber dienen einer Funktion: Vögel sind farbenreich, um Geschlechtspartner anzulocken; Elefantenrüssel dienen der Manipulation von Nahrung und anderen wichtigen Gegenständen. Fast alle Formen, denen wir begegnen, erfüllen eine Funktion, die die Lebensfähigkeit des Tieres verbessert, die es gedeihen und überleben lässt – selbst, wenn nicht immer sofort deutlich ist, worin der Vorteil liegen mag.
Warum haben Zebras Streifen? Die Wissenschaft streitet schon lange über die Gründe. Charles Darwin etwa bezweifelte die oft zitierte Erklärung, die Streifen dienten zur Tarnung. Alternative Vorschläge lauteten, sie signalisierten dem anderen Geschlecht gewisse Qualitäten, sie würden mit den psychedelischen Mustern sich bewegender Linien Raubtiere verwirren, Stechmücken davon abhalten auf den Tieren zu landen, oder den Zebras bei der Wärmeregulierung helfen, da zwischen den wärmeren dunklen und den kühleren hellen Streifen Luftströme entstünden. Entscheidend dabei ist nicht, was richtig ist oder falsch. Entscheidend ist, dass jede Erklärung irgendeinen Vorteil, eine bestimmte Funktion beinhaltet. Die uns umgebenden und vertrauten Formen des Lebens haben sich entwickelt, weil sie spezifische Vorteile bieten.
Trotzdem können mitunter zufällige Ereignisse das künftige Schicksal mancher Lebensformen besiegeln, ohne eine spezifische Funktion zu beinhalten. Das kommt besonders zum Tragen, wenn Populationen aus nur wenigen Individuen bestehen. Wenn menschliche Kolonisten, die einmal einen fremden Planeten besiedeln, oder die ersten Vögel, die eine Insel erreichen, genetisch sehr ähnlich sind, werden ihre Nachkommen diesen Mangel an Diversität über Generationen hinweg widerspiegeln. Wenn Populationen isoliert sind, akkumulieren sich zufällige Veränderungen, die weder nützlich noch schädlich sind und dazu führen, dass verschiedene Arten unterschiedlich aussehen. Wir dürfen bei der Entdeckung neuer Arten – ob auf anderen Planeten, oder auf seit langer Zeit isolierten Inseln auf der Erde – nicht vorschnell annehmen, alle beobachteten Formen müssten einer bestimmten Funktion zuzuschreiben sein. Man nennt dieses Phänomen neutrale Selektion; über ihre Rolle für die Evolution wird heftig diskutiert. Doch diese eher zufälligen Formen sind eher unbedeutend, unauffällig, mit Sicherheit nicht dramatisch und wenig nachteilig – wie es bei Zebrastreifen und ihrer höheren Sichtbarkeit für Raubtiere wahrscheinlich der Fall ist.
Die Unterscheidung zwischen Form und Funktion ist der wichtigste Schritt, um uns von unseren fantasierten außerirdischen Lebensformen zu verabschieden. Meistens nehmen diese fiktiven Aliens eine Gestalt an, wie sie in Hollywood für Film und Fernsehen erdacht werden, Formen wiederum, die lediglich den Menschen übersteigern. Sie sind mit übermäßig betonten körperlichen Merkmalen (zum Beispiel Zähnen oder Augen) ausgestattet, die das Gefühl hervorrufen sollen, es mit übertrieben abstrakten menschlichen Eigenschaften wie Gefräßigkeit oder Intelligenz zu tun zu haben. Dieses Buch jedoch handelt nicht nur davon, wie Aliens aussehen, sondern auch, wie sie sich verhalten. Die Gesetze der Biologie, die wir mit außerirdischen Lebensformen teilen, bestimmen die Art, wie sie die schwierigen Probleme des Lebens lösen: Nahrung finden, nicht selbst gefressen werden, sich fortpflanzen.
Am Leben auf der Erde faszinieren uns weniger seine Funktionen als seine Formen: Die strahlenden Farben von Vögeln, Blumen und Pfeilgiftfröschen, die schiere Größe eines Blauwals, die Hartnäckigkeit, mit der ein Löwe einen Büffel erlegt. Doch wenn wir genauer darüber nachdenken, dann spiegelt die Vielfalt der Formen lediglich die Mannigfaltigkeit der Funktionen wider. Tiere sind so verschieden, weil sie unterschiedliche Probleme zu lösen haben: Sie sind farbenprächtig, um Partner anzulocken oder mögliche Fressfeinde zu warnen, sie sind groß, um sich gegen ebensolche Fressfeinde zu schützen, hartnäckig, um an Nahrung zu gelangen. Unsere äußerst allgemeinen und universalen Gesetze der Biologie erlauben uns vielleicht nicht, sehr spezifische Vorhersagen über Lebensformen auf anderen Planeten zu treffen, aber Vorhersagen allgemeiner Natur über die Funktionen, die diese Tiere innehaben, können wir sehr wohl stellen und wir können davon ausgehen, dass in diesen Funktionen eine ebenso große Formenvielfalt auftritt wie auf der Erde. Wenn auf anderen Planeten ein Äquivalent zu unseren Vögeln lebt, dann dürften diese Vögel so wie auf der Erde verschiedene Farben aufweisen. Wir wissen aber nicht genau, um welche Farben es sich handeln wird oder sogar, ob es sich um »Farben« handelt in der Art, wie wir sie wahrnehmen.
Sollten Sie nun enttäuscht sein, in diesem Buch keine Auskunft darüber zu bekommen, ob Aliens tatsächlich grün sind, kann ich Ihnen versichern, dass es einen beträchtlichen Vorteil mit sich bringt, erst die Funktion und dann die Form zu untersuchen. Wie sich außerirdische Lebensformen an ihre Umwelt und die damit verbundenen Herausforderungen anpassen, ist letztlich um Vieles interessanter als ihr Aussehen. Zumindest besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Verhaltensanpassungen mit uns teilen und wir mit intelligenten Lebensformen mehr Gemeinsamkeiten in unserem Verhalten als in unserem Aussehen aufweisen. In diesem Kapitel hoffe ich, Sie von der Trennung von Form und Funktion zu überzeugen und verdeutlichen zu können, warum letztere um so Vieles entscheidender ist. Dazu müssen wir einige Prinzipien der natürlichen Selektion und Evolution neu beleuchten und uns fragen, warum sie auf anderen Planeten genauso gelten wie auf der Erde.
Der universelle Mechanismus der natürlichen Selektion
Wie komplexe Lebensformen überhaupt entstehen konnten, ist viel schwieriger zu erklären, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Komplexes Leben existiert im Widerspruch zu einem der unerbittlichsten physikalischen Gesetze,9 nämlich dass Ordnung zur Unordnung, Komplexität zur Einfachheit, Information zum Unsinn tendiert. So wie sich ein Tintentropfen in einem Glas Wasser ausbreitet, Gebäude bröckeln und Fleisch verwest. Zu definieren, was Leben ist, war für Philosophen seit Menschengedenken eine Herausforderung, wobei das Ankämpfen gegen die allgemeine Tendenz zur Unordnung ein Merkmal war, das in jeder Definition enthalten sein musste: nicht zu bröckeln, nicht zu verwesen, nicht zu sterben. Wie lässt sich ein Steinbrocken, der stets die Tendenz hat, einen Hügel hinabzurollen, auf den höchsten Punkt des Hügels hieven? Wir benötigen eine mechanistische Erklärung, die Schritt für Schritt darlegt, warum es Leben gibt, aber vor allem wieso es – im krassen Widerspruch zu den erwähnten unerbittlichen physikalischen Gesetzen – immer komplexer werden konnte!
Lassen wir zunächst einmal die Vorstellung beiseite, dass eine voll entwickelte komplexe Lebensform einfach so entstanden sei – das wäre, sollte sie nicht von einer noch komplexeren Lebensform geschaffen worden sein, schlicht zu unwahrscheinlich. Vielleicht hat ja eine Gottheit das Universum in all seinen Einzelheiten geschaffen; dann jedoch könnten wir absolut nichts über außerirdische Lebensformen aussagen. Formen, Farben und Verhalten der außerirdischen Geschöpfe würden sich allesamt den Launen ihres Schöpfers verdanken. Stephen Hawking meinte, dass wir den göttlichen Geist durchschauen könnten, vorausgesetzt, dass wir die Gesetze der Physik in ihrer Gesamtheit verstehen.10 Von diesem Ziel sind wir noch ziemlich weit entfernt.
Leben beginnt also mit etwas Einfachem. Wie aber kann eine einfache Lebensform immer komplexer werden? Weiß sie, was sie an Komplexität hinzugewinnen will? Wir können vielleicht in Betracht ziehen, dass ein Mensch einen bionischen Arm für eine gute Idee hält, aber dass eine primitive Zelle oder ein Molekül über so viel Weitsicht verfügt, ist schwer vorstellbar (darüber mehr in Kapitel zehn). Wir suchen nach einer »guten« Erklärung für die Komplexität des Lebens und eine gute Erklärung muss in sich geschlossen sein, ohne Rückbezug auf äußere, unbestimmte Prozesse (wie etwa einen Gott), oder auf etwas, was wir nicht für möglich halten (etwa ein Molekül, das »weiß«, was es werden will). Komplexität muss aus sich heraus zunehmen und deshalb ist für eine gute Erklärung entscheidend, dass sie keine Vorausschau erfordert, denn sonst wäre sie nicht auf die frühesten, einfachsten Lebensformen anzuwenden.
Selbst wenn wir akzeptieren, dass wir über die Erschaffung einer anfänglichen Lebensform nichts wissen, müssen wir doch erklären, wie sie zunehmend komplexer werden konnte. Übereinstimmend mit fast allen heutigen Wissenschaftlern behaupte ich, dass die natürliche Selektion universell ist und sich mit ihr allein die Tatsache erklären lässt, dass das Leben heute komplexer ist als bei seiner Entstehung vor 3,5 Milliarden Jahren. Was aber hat es mit dieser »natürlichen Selektion« auf sich und warum sollte sie die universelle Erklärung für komplexes Leben abgeben?
Auf der einfachsten Stufe ist die natürliche Selektion leicht zu verstehen. Vorteilhafte Eigenschaften summieren sich. Neue Merkmale überleben, andere Neuerungen nicht, wobei in früheren Generationen entwickelte gute Ideen nicht verloren gehen. Richard Dawkins erklärt diesen Prozess so schön wie einfach in seinem Buch Der blinde Uhrmacher. Wählen wir zufällig eine Folge von zwanzig Buchstaben aus, etwa: SDFLKJFGOSDIFHGSOFGH. Die Chance, bei einer solchen Wahl eine bestimmte Reihenfolge zu erlangen, etwa »Der blinde Uhrmacher« ist überaus gering, nämlich 1 zu 42 Milliarden Milliarden Milliarden.11 Niemand glaubt, dass sich Ordnung zufällig aus Chaos ergibt. Aber wenn man jedes Mal, wenn in der obigen Abfolge eine zufällige Veränderung erfolgt, diejenige beibehält, die der gesuchten Sequenz, »Der blinde Uhrmacher«, entspricht, unterscheidet sich das Ergebnis beträchtlich. Gute Neuerungen, etwa eine, die das anfängliche S (das in der Zielsequenz nicht enthalten ist) durch ein D ersetzt (dem ersten Buchstaben von Der), verschwinden nicht, sodass nach und nach die beste, das heißt, die »richtige« Abfolge auftaucht. Bei diesem »Selektionsverfahren« stellt sich die korrekte Abfolge bemerkenswerterweise nach gerade einmal ungefähr 540 Versuchen ein – eine Verbesserung um den Faktor 80 Millionen Milliarden Milliarden.12 Selbstverständlich gibt es in der Natur keine Voraussicht. Es gibt keine »richtige« Abfolge oder Sequenz. Solange sich die guten Veränderungen akkumulieren, wird unsere Sequenz immer besser. Wir sind imstande, einen Felsbrocken einen Hügel hinaufzuschieben, wenn der Hügel aus Stufen besteht und wir bei jeder Stufe eine Pause einlegen können. Immer eine Stufe nach der anderen und bei jeder Stufe wartet man, bis sich wieder eine Veränderung ergibt, die einen eine Stufe weiterbringt. Das ist das Prinzip der natürlichen Selektion und es ist wunderbar einfach und einleuchtend.
Gibt es noch irgendwelche anderen Erklärungen?
Die natürliche Selektion zeichnet sich dadurch aus, dass Wissenschaftler ins Schleudern geraten, wenn sie realistische Alternativen vorschlagen sollen. Wenn eine Erklärung für ein Naturphänomen bezweifelt wird, werden in der Regel verschiedene Alternativen gegeneinander abgewogen und die überzeugendste wird vorläufig angenommen, bis weitere Befunde uns zu anderen Überlegungen nötigen. »Licht« könnte etwas sein, das aus sichtbaren Gegenständen strömt, oder es könnte ein von unseren Augen ausgehender Sehstrahl sein, wie manche griechischen Philosophen glaubten. Beide Male handelt es sich um plausible Hypothesen – solange, bis passende Experimente durchgeführt werden, durch die sie sich unterscheiden lassen. In der griechischen Klassik herrschte sowohl die Vorstellung, die Erde sei flach als auch die Idee, sie sei rund, und es gab Befürworter und Gegner beider Annahmen, bis Eratosthenes 240 v. u. Z. sein brillantes Experiment zur Messung des Radius der annähernd runden Erde durchführte.
Im Hinblick auf die natürliche Selektion ist es jedoch bemerkenswert, dass außer ein paar zutiefst unbefriedigenden und nicht-wissenschaftlichen Erklärungen für die Existenz komplexen Lebens keine ernsthaften Alternativen vorliegen.
Vielleicht müssen wir größere Denkanstrengungen unternehmen; vielleicht sind wir nicht klug genug. »Das ist die einzige Antwort, die mir einfällt« ist wohl kaum eine stringente Erklärung. Auch wenn der Mangel an Alternativen kein Beweis ist, so ist er zumindest ein Indiz dafür, dass die natürliche Selektion ein plausibler Kandidat ist. All die konkurrierenden Vorstellungen, die den Ursprung komplexen Lebens zu erklären versuchten, sind überaus deskriptiv und alles andere als erklärend.
Da gibt es zum einen die Möglichkeit, dass eine allmächtige Gottheit einzelne Veränderungen in der Form und im Verhalten von Lebewesen »lenkt« und sie auf den Pfad der Evolution schubst. Zum anderen könnte es eine bislang unentdeckte »Lebenskraft« geben, die den Artenwandel veranlasst. Oder vielleicht ist das Leben bereits mit den Anlagen für alle künftigen Entwicklungen erschaffen worden – eine bereits im Bakterium angelegte Blaupause für den Menschen. Es gilt nur die einzelnen Schichten abzuschälen und siehe da: Wir sind es. Jede Kultur verfügt über eine Art Schöpfungsgeschichte, und keine lässt sich objektiv gegen eine andere abwägen. Geschichten liefern uns keine Erklärungen, aber wir haben das starke Bedürfnis, einen Mechanismus herauszufinden, der mehr ist als eine Geschichte.
Mathematische Analysen liefern deutliche Belege dafür, dass die natürliche Selektion die einzige Erklärung für Leben im Universum ist. Und wenn wir nicht umhinkönnen, die natürliche Selektion als einen die Entwicklung des Lebens bedingenden Mechanismus zu verstehen, dann verdankt sich dies weitgehend der Mathematik. Die Gleichungen sind vielleicht ein bisschen trocken, aber die Vorstellungen, die ihnen zugrunde liegen, sind es mit Sicherheit nicht. Eine der nahezu vollständigen mathematischen Beschreibungen der Frage, wie und warum Evolution stattfindet, wurde von einer der bemerkenswertesten und unbekanntesten Gestalten der Wissenschaft des zwanzigsten Jahrhunderts erstellt. George Price war kein Biologe oder Mathematiker, sondern ein Chemiker, aber er arbeitete mit zwei Koryphäen der Evolutionstheorie, John Maynard Smith13 und William Hamilton, zusammen, und gelangte zur bisher umfassendsten mathematischen Beschreibung von Evolutionsmechanismen. Wie kolportiert wird, war Price dermaßen von der Zwangsläufigkeit der evolutionären Kräfte fasziniert, dass er – obwohl überzeugter Atheist – zum Christentum konvertierte, seinen Besitz verschenkte und den Rest seines Lebens damit verbrachte, Obdachlosen zu helfen. Er versank in eine tiefe Depression und starb schließlich in einem heruntergekommenen Wohngebäude.14
Eines der wichtigsten Elemente der Price-Gleichung lautet, dass das Maß sowohl des Merkmals eines Tiers – etwa die Länge seiner Zähne – als auch des Vorteils, den eine bestimmte Zahnlänge mit sich bringt, variiert. Manche Tiere haben längere Zähne und manche kürzere. Während es durchaus von Vorteil sein kann, längere Zähne zu haben, folgt daraus nicht zwingend, dass ein Tier mit doppelt so langen Zähnen auch einen doppelt so großen Vorteil erlangt. Vielmehr ist eine Tendenz gegeben, bei längeren Zähnen einen größeren Vorteil zu erlangen. Price zeigte mathematisch, dass die Rate, in der sich ein Merkmal innerhalb einer Population mit der Zeit ändert – die Rate, in der die Tiere über die Generationen immer längere Zähne bekommen – von der »Kovarianz« zwischen dem Merkmal und dem Vorteil abhängt, den es bietet, anders gesagt, davon, wie eng das Merkmal und der sich daraus ergebende Vorteil korrelieren. Wenn die Verdopplung der Zahnlänge einen doppelten Vorteil mit sich bringt, würde sich ein langer Zahn in der Population ausbreiten wie ein Flächenbrand. Wenn die Verknüpfung weniger stark ist – sagen wir, wenn ein doppelt so langer Zahn nur zehn Prozent mehr Vorteil bringt und dies nur in 50 Prozent der Fälle –, dann ist die Evolutionsgeschwindigkeit niedriger. Wie entscheidend es für die Wissenschaft war, über ein Modell zu verfügen, mit dem sich der Verlauf der Evolution vorhersagen ließ, ist kaum zu überschätzen. Dabei sind die Annahmen, die sich aus diesem Modell ergeben, keineswegs nur auf die Erde bezogen. Die Price-Gleichung funktioniert genauso gut auf jedem anderen Exoplaneten der Galaxie. Der britische Philosoph Bertrand Russell sagte: »Ich liebe die Mathematik vor allem deshalb, weil sie nichts mit dem Menschen und nichts Besonderes mit diesem Planeten oder dem gesamten zufälligen Universum zu tun hat – weil sie uns, wie Spinozas Gott, keine Liebe entgegenbringt.«
Manche dieser mathematischen Zusammenhänge lassen sich visuell etwas intuitiver darstellen. Stellen Sie sich vor, Sie werden mitten in einer in dichtem Nebel liegenden Berglandschaft ausgesetzt und sollen den Weg auf den höchsten Berg finden. Die Landschaft, in der Sie sich befinden, wird als »Fitness-Landschaft« bezeichnet. Obwohl sich dies leicht mit der Herzkreislauf-Fitness verwechseln lässt, die man beim Bergsteigen erlangen mag, handelt es sich um etwas völlig anderes. Bei der evolutionären »Fitness« geht es darum, wie effektiv man seine eigenen Gene an künftige Generationen vererben kann. Nicht nur, wie gut man selbst das Leben meistert und überlebt, sondern wie viele Nachkommen man hat und wie gut diese wiederum überleben und selbst Nachkommen haben, und immer so weiter über Generationen hinweg. In unserer visuellen Analogie heißt das, je höher Sie kommen, desto besser sind Sie an ihre Umgebung angepasst und desto mehr evolutionäre Fitness besitzen sie; je weiter Sie den Berg hinaufkommen, desto mehr Nachkommen ziehen Sie erfolgreich auf. Auf wie viele verschiedene Methoden können Sie zurückgreifen, um einen Berggipfel ausfindig zu machen? Vielleicht verfügen Sie über eine Landkarte, vielleicht können Sie den Gipfel sehen und in seine Richtung wandern. Wenn nicht, dann bleibt Ihnen nur, sich umzuschauen und auszukundschaften, in welche Richtung es bergauf geht, und stets der Steigung zu folgen. Wenn Ihnen nun gesagt würde, nicht dem Weg bergauf zu folgen, sondern sich eine andere Möglichkeit auszudenken, den Gipfel zu erreichen, würde Ihnen etwas einfallen? Nein, es gibt tatsächlich keine andere Möglichkeit. Sie könnten versuchen, nach dem Zufallsprinzip dahin und dorthin zu springen, aber dies ist, wie sich mathematisch beweisen lässt, nicht zielführend. Kleine Schritte, graduelle Verbesserungen sind das einzige Mittel, das Ihnen zur Verfügung steht. Und das nennt man natürliche Selektion.
Natürlich ist Wissenschaft immer offen für neue Entdeckungen und radikale neue Ideen, die die festen Fundamente, auf denen wir zu stehen glaubten, infrage stellen. Niemand hätte etwas einzuwenden, wenn eine Alternative zur natürlichen Selektion entdeckt würde. Aber das bedeutet etwas anderes, als dass es eine Alternative geben »könnte«. Das Eingeständnis, dass unser Verständnis der Physik unvollständig ist, ist etwas anderes als zu sagen: »Vielleicht gibt es Geister und Feen und wir müssen uns nicht um die Quantenphysik kümmern.« Leere »Vielleicht«-Aussagen lassen sich immer treffen, aber besonders hilfreich sind sie nicht.
Der berühmte britische Astronom Fred Hoyle war eine überaus wichtige Figur für die Entwicklung der Astronomie im zwanzigsten Jahrhundert, schrieb aber auch hervorragende Science-Fiction. In seinem 1957 veröffentlichten Buch Die schwarze Wolke erzählte er nicht nur brillant und überzeugend von der Existenz außerirdischen Lebens, sondern beschrieb auch sehr genau, mit welchen Methoden sich die Wissenschaft dem Unbekannten annähert. In seinem Buch postulierte er eine riesige Gaswolke, Hunderttausende Kilometer im Durchmesser, die empfindungsfähig und hochintelligent ist. Seine Beschreibung, wie eine solche außerirdische Lebensform existieren und funktionieren könnte, war zwar beispielgebend, wurde aber auch wegen ihres unzureichenden Verständnisses der Biologie kritisiert – sie versäumte zu erklären, wie ein solches Geschöpf entstehen konnte! Welche Schritte führten zur Existenz einer solchen hyperintelligenten Gaswolke? Wie sah der Vorläufer einer solchen Wolke aus und wie hat sie sich verändert: Wie wurde sie zu der aktuell existierenden Wolke?
Versäumnisse wie diese sind sehr verbreitet, wenn über Außerirdische nachgedacht wird: Aliens sind vielleicht intelligent und verfügen über so unglaubliche Fähigkeiten wie Telepathie, Telekinese oder die Macht, mit einem Fingerschnippen die Realität zu verändern. Aber warum? Warum sollte etwas so Unwahrscheinliches eintreten? Die einzige Antwort: Weil eine bereits bestehende Situation schrittweise weiterentwickelt wird. Einen Felsbrocken bergaufwärts zu schieben, geht nur Schritt für Schritt. Das ist natürliche Selektion.
Hoyle hatte eine einfache Antwort auf diesen besonderen Kritikpunkt parat. Damals, in den 1950er Jahren, wurde die Frage, warum sich sämtliche Galaxien im Universum von uns entfernen, überaus kontrovers diskutiert. Zwei Theorien wurden ins Feld geführt: Dass das Universum am Anfang sehr klein gewesen sei und sich seither immer weiter ausdehne oder dass das Universum keinen Anfang hatte und sich seit jeher ausgedehnt hätte, wobei in seinem Zentrum immer neue Materie erzeugt würde. Hoyle hielt die erste Erklärung für Unsinn und verspottete sie als »Urknalltheorie«. Der Name blieb hängen und heute gehen wir natürlich von ihrer Richtigkeit aus. Aber seinerzeit und auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Beobachtungen beharrten Hoyle und andere auf der Annahme, das Universum habe keinen Anfang. Es ist also keine Überraschung, dass die Schwarze Wolke auf die Frage ihres fiktiven Wissenschaftlers, wie das erste Exemplar ihrer Gattung entstanden sei, antwortete: »Ich glaube nicht, dass es jemals ein ›erstes‹ Exemplar gegeben hat.« Worauf der Wissenschaftler feixte: »Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Jungs von der Urknalltheorie.«
Wenn Zeit unbegrenzt ist, dann müssen wir über den Ursprung des Lebens neu nachdenken. Aber die Wissenschaftsgemeinde geht fest davon aus, dass das Universum einen Anfang hat und deshalb auch das Leben einen Anfang hatte, dass sich das Leben aus diesem Anfang entwickelte und in verschiedene Richtungen verzweigte. Die natürliche Selektion ist die einzige zur Verfügung stehende Erklärung für diesen Prozess.
Konvergenz: Der Schlüssel zu außerirdischem Leben
Meine kühne Behauptung, dass wir die Erkenntnisse aus dem Studium der Erde auch anderswo im Universum anwenden können, beruht auf einer einfachen Beobachtung: In ähnlichen Umgebungen funktioniert die Evolution offenbar nach ähnlichem Muster. Sowohl Vögel als auch Fledermäuse fliegen, ihr gemeinsamer Vorfahre aber lebte lange vor den Dinosauriern, vor 320 Millionen Jahren, als Reptilien gerade antraten, die Welt zu übernehmen. Dieser Reptilienvorfahre flog mit Sicherheit nicht, denn zu seinen Abkömmlingen gehören nicht nur Vögel und Fledermäuse, sondern alle Schlangen und Schildkröten, Dinosaurier und Säugetiere, vom Elefanten bis zum Menschen. Offensichtlich hat sich die Fähigkeit zu fliegen bei Fledermäusen und Vögeln in einem späteren Stadium unabhängig voneinander entwickelt.
Wir wissen, dass das selbstständige Fliegen auf der Erde mindestens vier Mal entstanden ist. Vögel entwickelten es vor ungefähr 150 Millionen Jahren, als die Dinosaurier über die Erde streiften. Das berühmte, aus dieser Zeit stammende Fossil des Archäopteryx scheint auf halbem Weg zwischen Dinosaurier und Vogel zu liegen und löste in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bei Wissenschaftlern – darunter Charles Darwin – große Verwunderung und Kopfschütteln aus. Fledermäuse hingegen entwickelten ihr Flugvermögen erst vor etwas mehr als 50 Millionen Jahren, mit ziemlicher Sicherheit erst nach dem Aussterben der Dinosaurier. Die Flügel von Vögeln und Fledermäusen unterscheiden sich so verblüffend stark, dass sich kaum glauben lässt, dass sie dem gleichen Zweck dienen. Fledermäuse besitzen enorm verlängerte Finger, die sich bis an den unteren Rand der Flügel erstrecken. Dazwischen befindet sich eine dünne Membran – ähnlich wie die Schwimmhäute an den Füßen von Enten, nur dass die Häute sich auch noch an den Armen entlangziehen. Vögel haben natürlich Federn statt Haut, aber anders als bei Fledermäusen verlaufen ihre Knochen lediglich entlang der Flügelvorderkante, wobei die Federn die dahinterliegende Fläche bilden.
Abb. 3. Künstlerische Darstellung eines Archäopteryx aus
On the Genesis of Species
(1871) von St. George Jackson Mivart, einem Zeitgenossen und Briefpartner Charles Darwins. Wie bei modernen Vögeln liegen die Federn hinter den Flügelknochen, die lediglich die Vorderkante des Flügels stützen.
Obwohl sich die Flugfähigkeit von Vögeln und Fledermäusen nahezu unabhängig voneinander entwickelte, wird diese Errungenschaft zu sehr ähnlichen Zwecken verwendet. Wenn man beobachtet, wie Schwalben und Mauersegler durch die Luft schießen, um Fluginsekten zu fangen, sehen sie den Fledermäusen, die man ein paar Stunden später in der Dämmerung nach Insekten jagen sieht, verblüffend ähnlich. Die winzige, nur 10 Gramm wiegende Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) wandert hunderte oder sogar tausende Kilometer weit und kann es mit den Langstreckenflügen mancher Vögel aufnehmen.15 Wie auch immer das Fliegen entstanden ist, es ist eine unglaublich nützliche Errungenschaft, und es überrascht kaum, dass sie immer wieder entsteht. Natürlich sind Vögel und Fledermäuse nicht die einzigen flugfähigen Tiere. Flugsaurier, riesige fliegende Reptilien, erhoben sich schon viel früher in die Lüfte als die ersten Vögel, womöglich schon vor 220 Millionen Jahren. Manche von ihnen (die Arten, die in zahlreichen Höhlenmenschen-Horrorfilmen mit falscher biologischer Genauigkeit verewigt wurden) konnten dank ihrer riesigen Flügel wie Geier gleiten, aber wie genau sie es geschafft haben, sich in die Luft zu erheben, ist nach wie vor Gegenstand intensiver Forschung.16 Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass sie sich völlig getrennt von den Vögeln entwickelt haben: Flugsaurier waren keine Dinosaurier, während Vögel direkt von den schnellfüßigen Dinosauriern abstammen, die enger mit dem Tyrannosaurus rex verwandt sind.
Abb. 4. Zeichnung eines Fledermausskeletts aus Peter Mark Roget,
Animal and Vegetable Physiology, Considered with Reference to Natural Theology
(1834). Die Fingerknochen erstrecken sich bis in den unteren Flügel und stützen die Membran.
Das vierte Beispiel für die Evolution des Fliegens – das am weitesten verbreitete für das Fliegen auf der Erde – reicht sogar noch weiter zurück, nämlich bis zu den ersten Insekten vor 350 Millionen Jahren. Als die Insekten zu den ersten wirklich erfolgreichen Landtieren wurden, führte ihre rasche Evolution zu einer enormen Formenvielfalt, die zudem einzigartige Anpassungen an das Leben in der neuen Umgebung ausbildete. Im Gegensatz zum langsamen und sanften Absinken des Lebens in den Ozeanen schlägt man beim Sturz von einem Baum schnell auf dem Boden auf! Vielleicht waren die frühen Flügel dazu angetan, den Fall zu verlangsamen und das fallende Tier sogar zurück zum Baumstamm zu lenken, damit es nicht wieder mühsam vom Boden aufsteigen musste (eine Technik, die noch heute von Flughörnchen genutzt wird, die mithilfe eines Hautlappens zwischen ihren Vorder- und Hinterbeinen von Baum zu Baum gleiten).
Allein der Nutzen, den das Fliegen diesen kleinen über das neu besiedelte Land krabbelnden Kreaturen brachte, führte zu einer enormen Bandbreite an Lösungen: lästig sirrende Mücken, anmutige Libellen, seltsam fliegende Käfer und natürlich die Hummel, deren Flug nahezu unmöglich erscheint. Zwar lässt sich kaum bezweifeln, dass sich Insektenflug und Fledermausflug verschiedenen Mechanismen verdanken und sich separat entwickelten, es sollte aber deutlich geworden sein, dass der Flug selbst unglaublich nützlich ist.
Dass sich ähnliche Lösungen – in diesem Fall das Fliegen – in nur entfernt verwandten Arten entwickelt haben, ist Teil eines als konvergente Evolution bezeichneten Phänomens.17 Bei ähnlichen Umweltproblemen sind offenbar ähnliche Lösungen von Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass bei einem bestimmten Problem nur eine begrenzte Anzahl von Lösungen möglich ist. Wenn dem so ist, dann sollte es uns nicht verwundern, dass Vögel, Fledermäuse, Flugsaurier und Insekten ähnliche, wenn auch unterschiedlich ausgeprägte Funktionen entwickelten.
Dabei ist die konvergente Evolution des Fliegens ein Beispiel, das lediglich an der Oberfläche eines viel weitergehenden Phänomens kratzt. Konvergenz ist überall. Augen wie die unseren, mit einer großen Linse, bildeten sich mindestens sechs Mal. Die Fähigkeit, mit dem Körper ein elektrisches Feld zu erzeugen – um Beute zu betäuben oder die Umgebung zu sondieren – hat sich mindestens ebenso oft entwickelt. Nachkommen lebend zu gebären ist eine Errungenschaft, die sich, offenbar relativ unabhängig voneinander, über 100 Mal evolutionär herausgebildet hat. Sogar die Fotosynthese, die Grundlage allen Lebens auf der Erde, ist wahrscheinlich in mindestens einunddreißig verschiedenen Abstammungslinien entstanden.18
Das vielleicht berühmteste Beispiel einer konvergenten Evolution ist der tasmanische Wolf (Thylacinus cynocephalus), ein erst vor Kurzem ausgestorbenes Beuteltier. Das letzte bekannte Exemplar starb 1936 in einem Zoo, aber bis zur Ankunft des Menschen und, vor etlichen zehntausend Jahren, des Dingos war er in Australien und Neu-Guinea weit verbreitet. Die Ähnlichkeit zwischen dem Beutelwolf und den Hunden (Canini