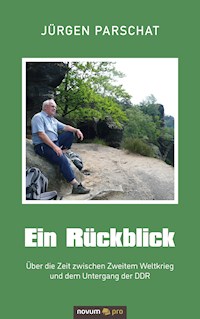Inhaltsverzeichnis
Impressum 2
Prolog 3
Kindheit 6
Jugendzeit 43
Erster Berufsversuch – Erlebnis Nationale Volksarmee 64
Auf dem Weg zum Wissenschaftler 90
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem VEB 98
Versuch als Literat 112
Musikalisches Hobby 125
Mit dem PKW durch den Kaukasus 150
Wandern als Lebensmotto 196
Plane mit, arbeite mit, regiere mit! 233
Erste Erfahrungen mit der Marktwirtschaft 252
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2021 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99107-392-5
ISBN e-book: 978-3-99107-393-2
Lektorat: Mag. Elisabeth Pfurtscheller
Umschlagfoto: Jürgen Parschat
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Privatbesitz von Jürgen Parschat
www.novumverlag.com
Prolog
Ich bin jetzt über achtzig Jahre alt.
Zeit, einmal Rückschau zu halten auf ein doch nun schon verhältnismäßig langes Leben. Auch schon aus dem Grunde, weil ich mich noch dazu in der Lage fühle, denn viele meiner Altersgenossen können das nicht mehr.
Zwar versuche ich, nicht ständig an ein mögliches Ende zu denken, was altersmäßig verständlich wäre, doch ich fühle mich noch einigermaßen fit. Noch schaffe ich meine persönliche Verpflichtung, mindestens sechs Kilometer am Tag zu Fuß zurückzulegen. Entweder ich mache beim Einkaufsgang einen entsprechenden Umweg oder ich laufe nur so durch das Stadtviertel, unter anderem auch einmal pro Monat per pedes in die Stadt zum Bibliotheksdienst im Vereinshaus vom Sächsischen Bergsteigerbund. Hier bin ich ja seit Beginn der Rentenzeit verantwortlich für die Kartensammlung. Und es sind an die zweitausend Karten im Bestand, die ich in mühevoller Kleinarbeit so regional sortiert habe, dass man mit einem Griff alle Karten einer Region erwischen kann, was vormals nicht möglich war.
Bei Wanderungen entweder mit Freunden oder nur allein sind bei zwanzig Kilometern auch noch nicht alle Reserven verbraucht.
Bis vor Kurzem hatte ich montags Probe im Haydnorchester, wo ich nach jahrzehntelangem Mitspielen jetzt nur noch neben vier jüngeren Damen geduldeter Alter war, der höchstens gefragt war, wenn deren Kinder mal krank waren. Dann kamen noch zwei jugendliche Klarinettisten dazu, sodass ich dort überflüssig wurde. Mittwochs habe ich seit mehreren Jahren Probe im Orchester des Mozartvereins, wo man froh ist, dass jemand mit so langer Orchestererfahrung noch mitmacht.
Und mit diesem Orchester konnte ich mir auch ein besonderes Geburtstagsgeschenk zu meinem Achtzigsten machen. Ich hatte erfahren, dass die Noten für Mozarts Klarinettenkonzert vorhanden seien, und so wünschte ich mir als Geburtstagsständchen den 2. Satz dieses Konzertes, also das Adagio. Mein Wunsch wurde respektiert und ich konnte dieses Stück endlich einmal wieder mit Orchester-Begleitung spielen – fast sechzig Jahre nach meinem ersten Versuch im Studentenorchester. Und zum Konzert im Rahmen von Dresdens Veranstaltungsreihe „Klingende Stadt“ durfte ich sogar das Adagio als Solobeitrag spielen!
Darüber hinaus halte ich immer noch hin und wieder Lichtbildervorträge in Altenheimen oder Seniorentreffs. Zwar lange nicht mehr so oft wie noch vor Jahren, da ich mit Beginn der Rentenzeit recht aktiv wurde. Ich hatte über fünfzig Altenheime und Seniorentreffs als Kundschaft und im Angebot an die dreißig unterschiedlichen Themen. Wurde irgendwo in Dresden ein Heim neu eröffnet, sprach ich vor und bot meine Dienste an. Und das sprach sich auch in der näheren Umgebung rum. So wurde ich zwischen Pirna und Meißen aktiv.
So aktiv bin ich jetzt natürlich nicht mehr. Doch das Erzählen über unsere nicht nur seit der Wende durchgeführten Reisen hält hoffentlich den Geist auch noch etwas frisch.
Diese Aktivitäten bedeuten doch sicher noch nicht, dass ich irgendein besonderes Leben hinter mir habe.
Aber ich denke, es gibt da eventuell Ereignisse, die für die vergangene Zeit nicht ganz untypisch waren und wo es bestimmt schade wäre, wenn diese völlig in Vergessenheit gerieten.
Wer kann sich heute noch vorstellen, wie wir Kinder die Kriegszeit überlebt haben, auch wenn es Gott sei Dank nur unbedeutende Erlebnisse waren.
Wer erinnert sich noch, welche Probleme es beim Reisen ins Ausland gab, auch bei Reisen in unsere benachbarten Bruderländer.
Und schließlich gab es die Organisation der Staatssicherheit, die jeden Bürger mehr oder weniger unter Kontrolle hatte.
Und dass die Stasi, also die Organe der Staatssicherheit, über jeden Bürger mit besonderen Tätigkeiten Bescheid wusste, erlebte ich persönlich: Es war zum zehnjährigen Jubiläum des Kampfgruppenblasorchesters der Stadt Dresden, also irgendwann in den Achtzigerjahren.
Auch die oberste Stasibehörde der Stadt war eingeladen.
Durch Zufall wurde ich von unserem Orchester-Stasibeauftragten diesem Genossen vorgestellt:
„Ich weiß, der Genosse organisiert die Wanderung ‚Rund um Dresden‘.“
Und das sagt er aus dem Gedächtnis heraus. Ich war also nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt bei diesen Leuten.
Besser hätte es heute mit einer kurzen Internetrecherche auch nicht geklappt.
Das bedeutete also für mich, der ich ja auch schon zwanzig Jahre vorher unangenehme Erfahrungen mit dieser Institution gemacht hatte, nicht allzu leichtsinnig zu sein.
Und so will ich über die vergangene Zeit berichten, natürlich auf Basis des persönlichen Erlebnisses. An manchen Stellen auch darüber hinaus, wo ich der Meinung bin, dass für ein Verständnis diese Ergänzung nicht uninteressant wäre. Die genannten Personen sind dabei nicht erfunden, aber in besonderen Fällen nur durch den Vornamen angedeutet.
Kindheit
Ostpreußen: „Land der dunklen Wälder und kristall’nen Seen, über weite Felder lichte Wunder geh’n“. Dieser Anfang der Hymne der Ostpreußen sollte eigentlich bei allen dort Geborenen ein Heimatgefühl entfachen. Nicht so bei mir. Vielleicht liegt es daran, dass ich, wenn auch in Königsberg geboren, schon mit sieben Jahren diese Gegend verließ. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass wir, wenn wir vom Bahnhof in Ludwigsort mit einer Kutsche abgeholt wurden, auf den rund zehn Kilometern bis zu unserem Dorf Großklingbeck durch dichte Wälder oder an kristallnen Seen vorbeigekommen sind.
Und wie unser Dorf zu dem Beinamen Groß gekommen ist, bleibt auch fraglich. Großklingbeck hatte so an die zweihundertfünzig Einwohner, also in etwa deißig Gehöfte, denn die Familien bestanden im Dorf meist aus mehr als sieben bis acht Personen, Eltern, Großeltern und in der Regel mehr als drei Kindern! Dann gab es eine Gaststätte und einen kleinen Kaufmannsladen an der einzigen Straßenkreuzung des Ortes – dort, wo die Straße von Ludwigsort nach Zinten führend eine Abzweigung nach Grünwiese, einem Nachbardorf, hatte. Richtung Zinten führte die Straße an dem Dorfteich entlang und dann als letztes Gehöft auf der linken Seite kam das Schulgebäude. Gegenüber waren noch ein paar Bauernhöfe.
Jedenfalls war das Schulgebäude mein erstes Zuhause. Das Schulgebäude, von der Straße aus durch eine Art Garten etwas versetzt, bestand aus zwei Gebäudeteilen: dem eigentlichen Schulhaus mit einem Klassenzimmer im Erdgeschoss und darüber im Giebeldach eine Art Kinosaal. Angrenzend daran ein Flachbau mit unserer Wohnung. Schließlich hatte mein Vater 1937 die Lehrerstelle in dieser einklassigen Volksschule erhalten, nachdem er vier Jahre als Lehrer an der Volksschule in Wolittnick und weitere vier Jahre in Gr. Windkein tätig war. 1938 wurde mein Vater zur Wehrmacht einberufen, sodass sich meine Erinnerungen an ihn nur auf gelegentliche Urlaubstage beziehen.
Ansichtskarte von Großklingbeck
Mit Mama und meiner zwei Jahre älteren Schwester Ulla durften wir aber weiter in dieser Lehrerwohnung leben.
Der Eingang zu unserer Wohnung lag hinter dem Haus, angrenzend an so eine Art Hof. Gegenüber befand sich so was wie eine Scheune, wo unsere drei Gänse und eine Handvoll Hühner ihr Zuhause hatten. Die Gänse hatten sogar persönliche Namen. Hinter der Scheune lag der Sportplatz, der von einem kleinen Bach begrenzt wurde. Ich erinnere mich noch, dass ich in einem Winter in den Bach gerodelt bin. Und wie das nun mal so ist, rettete ich mich durchnässt und frierend natürlich an das gegenüberliegenden Ufer. Und erst mein jämmerliches Gebrüll holte meine Mama zur Hilfe, welche zuerst durch den Bach watete, der zwar nicht tief war, aber es reichte für nasse Füsse und führte darauf zu einer starken Erkältung von Mama.
Angrenzend an den Sportplatz kam ein eingezäunter Garten mit Gemüse, Beerenpflanzen und einem herrlichen Kirschbaum. Dann kam der Hauseingang, links angebaut die Toilette (Plumpsklo). Parallel zum Schulgebäude befand sich eine Ackerfläche, in der Größe von einem drei Viertel Morgen, des damals üblichen Ackerflächenmaßes. Von diesem Acker ernteten wir unseren Kartoffelbedarf.
Noch weiter hinten, also hinter dem eigentlichen Schulgebäude, befand sich auch noch ein Garten mit Obstbäumen. Ich erinnere mich noch an die herrlich schmeckenden Klaräpfel, die frisch vom Baum gegessen wurden. Direkt an der Hauswand war so eine Art Spielplatz oder Sandkasten. Jedenfalls rannte ich einmal erschrocken zu Mama in die Küche, weil ich dachte, das Haus stürzt ein. Ich hatte beim Hochsehen das Wolkenziehen missverstanden.
Mein erster Schulbesuch
Und dann unsere Wohnung. Richtung Hof war die Küche, von der es ins Schlafzimmer ging und noch zu einer Kammer, in der das Pflichtjahrmädel schlief. Die Küche war für meine Begriffe recht groß, denn zum Baden wurde eine Wanne hineingestellt. Das tägliche Waschen fand auch in der Küche statt. Dann gab es direkt neben dem Hauseingang eine Pumpe, mit der wir unseren zusätzlichen Wasserbedarf deckten. Im Flur zwischen unser Wohnung und dem Klassenzimmer befand sich auch noch ein kleines Waschbecken aus Eisen.
Zur Straße hin kann ich mich an ein auch recht großes Wohnzimmer erinnern, mit einem gewaltigen runden Tisch mit einer Edelholzplatte. An der Wand stand ein Klavier. Dahinter ging es ins sogenannte Herrenzimmer, keine Ahnung, ob ich da jemals herinnen war.
Wenn wir mal ein Huhn zum Essen haben wollten, gingen wir zu dem uns gegenüber liegenden Bauernhof, wo die Hausherrin dann vor unseren Augen das mitgebrachte Huhn köpfte. Ich seh noch heute, wie das geköpfte Huhn der Bäuerin aus der Hand flog und erst einige Meter weiter kopflos zu Boden fiel. Der Nachwuchs der Hühner wurde von Hand aufgezogen. Ich weiß noch, wie niedlich das war, die Kücken mit Brei aus weichgekochten Eiern zu füttern.
Kühe hatte der Hof gegenüber nicht, sodass wir, meine Schwester und ich, die Milch mit einer Milchkanne von einem Hof holten, der sich etwa einen Kilometer entfernt, kurz vor der Reichsautobahn, befand.
Zu Weihnachten wurde eine Gans geopfert und da die Gänse individuelle Namen hatten, fiel die Aswahl immer recht schwer. Das Töten haben wir nicht miterlebt, aber anschließend viel Zeit mit dem Rupfen der Federn verbracht – die weichen Daunenfedern wurden separat gesammelt und mussten abgegeben werden. Dann wurde die Gans mit zu meinen Großeltern mütterlicherseits genommen. Die wohnten in Tapiau, einem Städtchen östlich von Königsberg am Fluss Pregel gelegen.
Die Eltern vom Vater im Samland haben wir nie besucht, Vater war ja im Krieg und Mama hatte keine besondere Beziehung zu ihren Schwiegereltern.
Nach Tapiau fuhren wir mit dem Zug von Ludwigsort aus über Königsberg. Zum Bahnhof in Ludwigsort brachte uns ein Pferdefuhrwerk von dem Hof gegenüber aus. Vom Bahnhof in Tapiau zu der Wohnung der Großeltern war es nur ein kleines Stück zu Fuß.
Die Wohnung von Oma und Opa war in einem größeren Mietshaus am Rande eines Betriebsgeländes, in der oberen Etage, und hatte für unsere Begriffe eine beachtliche Größe. Zwei nebeneinander liegende Stuben eigneten sich hervorragend zum Ausprobieren der zu Weihnachten erhaltenen Roller. Und Opa hatte sogar ein Radiogerät, einen sogenannten Volksempfänger, was damals noch nicht für jeden Haushalt eine Selbstverständlichkeit war. In Großklingbeck hatten wir jedenfalls kein Radio.
Geschlafen haben wir in einem separaten Schlafzimmer. Wo Omatante und Opa genächtigt haben, ist nicht in Erinnerung.
Für die Errichtung der Notdurft, ob Groß oder Klein, stand ein Nachttopf zur Verfügung. Wie und wohin dieser entleert wurde, hat uns nicht interesseirt. Zum Waschen stand eine Schüssel auf einem Tisch, darunter ein Eimer für das Altwasser und daneben ein größerer Krug mit Frischwasser.
Oma wurde Omatante genannt, weil ihre Mutter in einem Nebenzimmer auch noch lebte. Oma war die dritte Frau von Opa, nachdem die erste Frau starb, als meine Mutter noch ein Kleinkind war, die zweite Frau lebte auch nicht lange. Erst mit 16 Jahren erhielt meine Mitter die aktuelle Oma Clara.
Und von dem Gänseschmaus ist noch bleibend in Erinnerung die große Schüssel mit Sülze, aus den diversen Gänsekleinstücken.
Einmal zu Weihnachten bekam ich eine Eisenbahn, eine einfache Holzeisenbahn, aber für mich etwas ganz Besonderes. Am zweiten Tag trat Omatante aus Versehen auf die Bahn und kaputt war meine erste Spielzeugbahn. Einmal erhielt ich so eine Art Luftgewehr, die kleine Kugel war mit einer Schnur am Gewehr befestigt und konnte somit keinen größeren Schaden anrichten. Doch unter Opas Anleitung konnte ich vorzüglich die großen Christbaumkugeln treffen, selbstverständlich sehr zum Ärger von Mama.
Dann erhieit meine Schwester zwei Puppen, eine davon hieß Gustl und wurde von mir in Beschlag genommen, offensichlich weil kein geeignetes Spielzeug für einen kleinen Jungen zur Verfügung stand.
Natürlich wurden wir auch von Omatante verwöhnt, soll hei-ßen, dass sie uns mal etwas zusteckte, was eigentlich nicht üblich war.
Kriegsweihnachten
Ich weiß noch, dass es Würfelzuckerstückchen waren, die wir beide zum größen Ärger von Mama zum Naschen erhielten. Ulla hat diese Stücke ordentlich gelutscht, ich meinerseits habe diese stets zerkaut. Der Geschmack war dadurch kräftiger, wie ich fand.
Und jedes Mal wurde ich über dieses schädliche Kauen belehrt: Das macht die Zähne kaputt! Beim Zahnarzt dann das Ergebnis: Ulla bekam schon beizeiten kranke Zähne mit Plombenbehandlung und so. Meine Zähne blieben stabil (und das bis in spätere Jahre noch). Aber durch diese Zuwendung an Zuckenstückchen lernte ich zählen: „Ein Zucker – zwei Zucker“ – und so fort bis zehn!
Im Freien in Tapiau zu spielen, war für uns Landkinder problematisch. Na gut, meine Schwester konnte ihren Puppenwagen in dem recht großen Betriebshof spazieren fahren. Aber ich? Einmal schaufelte ich aus Verzweiflung an einer vor dem Haus stehenden riesigen Eiche. Hörte dann aber auf – aus Angst, dass die Eiche umkippen könnte. Einmal fand ich eine alte kaputte Fahradpumpe und spielte damit irgendwie herum. Jedenfalls verfing sich mein rechter Mittelfinger in dem leeren Rohr und konnte nicht mehr von mir befreit werden. Brüllend vor Schmerz und mit blutigem Finger, an dem die Luftpumpe hing, rannte ich zur Wohnung hoch. Wie und wo mir irgendwie geholfen wurde, ist nicht in Erinnerung, aber die Narbe ist heute noch an meinem rechten Mittelfinger zu erkennen.
Noch bleibend in der Erinnerung ist ein Luftangriff. Es war eines Nachts, zumindest war es stockfinster, als wir aus der Wohnung über den Hof in ein nahe gelegenes Fabrikgebäude mit Luftschutzkeller rannten. Über uns brummten die Flieger und der Hof war durch niedergehende sogenannte Christbäume grell erleuchtet. Am nächsten Tag erzählte Großvater, als er von der Arbeit auf der anderen Seite des Pregles kam, von einigen Bombenschäden, die offensichtlich der Brücke über dem Fluss gegolten hatten.
Und noch ein Luftangiff hat sich in mein noch junges Gehirn eingebrannt: der Luftangriff auf Königsberg im August 1944. Wir wohnten zwar über zwanzig Kilometer westlich von Königsberg entfernt, aber die anglo-amerikanischen Bomber flogen auch über unser Dorf. Ich erinnere mich noch an die Suchscheinwerfer, die einzelne Flugzeuge verfolgten. Eines sah man auch getroffen brennend abstürzen, wenn auch weit weg von uns. Und dann war da der rote Himmel durch die brennende Stadt. Auch heute noch, wenn, aus welchem Grund auch immer, der Himmel über der Stadt rötlich leuchtet, entsinne ich mich der damaligen Gefühle.
Mit sechs Jahren, also 1943, wurde ich eingeschult. Eine Zuckertüte bekam ich nicht, da ich zur Einschulungsfeier krank war. Und dann saß ich als Erstklässler mit noch einem Mädel in der rechten, ersten Reihe der Schulbänke. Insgesamt waren für die acht Klassen drei Reihen Doppelbänke vorhanden, jeweils vier hIntereinander, also für nicht mal fünfzig Schüler. Als Aushilfslehrer, Vati war ja im Krieg, diente ein Herr Tolksdorf, der mit seinem Motorrad aus dem Nachbardorf Grünwiese anreiste, dies aber nicht mal täglich.
Und auch nicht jede Klasse war besetzt, jedenfalls waren einige Bänke noch frei. Aber wir konnten jeder mithören, was der Lehrer den jeweiligen Klassenschülern erzählte. Klüger sind wir dadurch sicher nicht geworden. Genauer erinnere ich mich an Filmvorführungen, die auf dem Boden in einer Art Kinosaal stattfanden und im Wesentlichen von den ständigen Erfolgen unser siegreichen Armee berichteten. In den Ohren klingt noch die Musik von „Les Preludes“ von Liszt, was als Leitmelodie der Wochenschau lief.
Schulzeugnis 1. Klasse
Einmal herrschte große Aufregung im Dorf: Der Gauleiter Koch wurde erwartet, natürlich nur auf Durchreise nach Zinten. Jedenfalls wurden alle Dorfbewohner aufgefordert, am Straßenrand Spalier zu stehen und mit Blumen zu winken. Es durften aber keine Blumen in Blumentöpfen verwendet werden. Der eigentliche Besuch des Gauleiters verlief dann so, dass mehrere schwarze Limosinen ohne Halt durch das Dorf fuhren.
Eines Tages kam ein Mann an unseren Hintereingang und bettelte um irgendetwas. Mutter gab ihm ein Stück Brot und schickte ihn dann weg. Wir wurden ermahnt, niemandem von diesem ungebeten Besuch zu erzählen. Wahrscheinlich war dieser Mensch aus irgendeinem Lager geflohen.
Und noch ein Besuch ist in Erinnerung. Wahrscheinlich war es eine Nachbarin, die mit ihrem Töchterlein zum Kaffeeklatsch oder so bei uns vorbeisprach. Und das kleine Mädel war blind!
Was blind bedeutete, war uns Kindern natürlich nicht geläufig. Aber als meine Mutter dem Mädchen einen Muff (eine Art Pelzhandschuh) in die Hand gab: „Miezekatze“. Das Kind glaubte, eine Katze zu fassen. Und dies machte uns auf drastische Weise deutlich, was blind bedeutet.
Doch auch angenehme Erinnerungen gab es, sogar eine, die für mich so etwas wie prägend war. Es war im Frühjahr 1944. Ich war also gerade mal sieben Jahre alt, als meine Mutter eine sogenannte KDF-Reise (KDF – der Verein „Kraft durch Freude“) nach Oberstdorf im Allgäu genehmigt bekam.
Ob auf der Hinfahrt oder Rückfahrt weiß ich nicht mehr, jedenfalls übernachteten wir in München in einem renomierten Hotel. Wir staunten nicht schlecht, dass die Vorhänge an den riesigen Fenstern bis auf den Fußboden reichten. Zum Abendbrot gab es Makaroni mit Tomatensoße, damals schon mein Lieblingsgericht. Und ich bekam sogar Nachschlag und dies mehr als einmal. Jedenfalls freute sich das Personal über den Appetit des kleinen Jungen.
Und dann unsere Einfahrt in das tief verschneite Oberstdorf: Ich sehe noch heute unsere Einfahrt mit dem Zug in die Bergwelt vor mir – in weitem Bogen führt die Bahn vor herrlich weißer Bergkulisse hinein in den Ort mit seinem spitzen Kirchturm. Seitdem träume ich beim Anblick von Haufenwolken am Horizont von schneebedeckten Bergen.
Unser Quartier war die Pension Alpina. Von hier aus unternahmen wir oftmals Wanderungen in die winterliche Landschaft. Einmal erschreckte uns ein hinter einer Kurve plötzlich auftauchender Wasserfall. Ein anderes Mal erwischte uns eine Lawine – na sagen wir mal ein kleines abgehendes Schneebrett. Jedenfalls steckte meine Schwester mit ihren Beinen so fest im Schnee, dass sie nicht mehr selbstständig freikam. Gott sei Dank kam kurze Zeit später ein Mann mit Stock, der sie dann freihackte.
Wir waren auch auf dem Nebelhorn. Ich erinnere mit noch, wie wir aus der Seilbahnstation durch einen Schneetunnel gehen mussten, so viel Schnee lag damals noch im März.
Am Nebelhorn
In Königsberg wohnte unsere Tante Lene, irgendeine Verwandte von Oma Clara. Hier haben wir auch hin und wieder übernachtet, natürlich noch vor dem schrecklichen Luftangriff. Einmal sind wir sogar in die Oper gegangen: „Hänsel und Gretel“. Ganz schwach erinnere ich mich noch an die gruselige Hexe. An mehr aber auch nicht.
Im Oktober 1944 flüchteten wir aus Ostpreußen ins sichere Reich. Wieso meine Mutter schon so zeitig unsere Heimat verlassen hat, ist mir ein Rätsel. Meine Schwester glaubt, dass mein Vater, der damals schon an der Ostfront stationiert war, die Empfehlung gegeben hat. Wie das meine Mutter angestellt hat, dass unsere Fahrt nach Jena nicht als Flucht vor der Roten Armee aussehen konnte, bleibt ein Rätsel. Im Oktober 1944 aus Ostpreußen zu fliehen, wo die Rote Armee noch nicht einmal die Reichsgrenze überschritten hatte, hätte ja bedeuet, dass man nicht an den Endsieg der Deutschen geglaubt hätte und das wäre Hochverrat gewesen.
Und einfach verreisen war auch kaum möglich. Schließlich musst man sich auf irgendeinem Amt abmelden und bei dem neuen Wohnort auch wieder anmelden. Schon um die üblichen Lebensmittelkarten oder Karten für irgendwelche Sonderzuteilungen zu erhalten.
Jedenfall waren zwei Anlaufstellen im Kalkül: einmal Stargard in Pommern, weiß der Kuckuck, welche Verwandten dort lebten. Aber diese konnten nur Sachen aufbewahren, keine Personen aufnehmen, weshalb meine Mutter Wäsche und wer weiß was noch dorthin schickte. Ein Glück für uns, denn über Stargard zog später die Front und vernichtete fast den gesamten Ort.
Wir fuhren nach Jena zu Tante Else, eine Art Cousine von Großvater. Diese hatte im Erdgeschoß eines kleinen Hauses eine Zweiraumwohnung zur Miete. In ein Zimmer davon zogen wir drei, eigentlich nur zum Schlafen. Gewohnt wurde in der recht großzügigen Küche. Ich erinnere mich noch an den recht strengen Winter 1944/45. Und da unser Schlafzimmer über keine Heizung verfügte, war es auch noch im Bett eiskalt. Zur leichten Erwärmung stellte also Mutter ein elektrisches Öfchen vor unser Bett. Und einmal rutschte die Bettdecke vor das Öfchen und war kurz davor, Feuer zu fangen. Schließlich bestand das Öfchen aus einem offenen glühenden Spiralgebilde. Gestunken hat es mörderisch, aber wir haben überlebt.
Über Tante Else wohnte die Hauseigentümerin, mit ihrem Sohn Helmut, ungefähr im Alter meiner Schwester. Und dieser übte fast täglich Klavier und in ungemein brisanter Form, obgleich wir des öfteren Verspieler hörten. Ihn schien das aber offensichtlich nicht zu stören. Zudem spielte er Oboe, ob damals schon oder erst später weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war er erster Oboist in dem Orchester der Adolf-Reichwein- Oberschule, wo später auch meine Schwester mitspielte. Und dieser Musikfreund wurde später Korrepititor in der Deutschen Staatsoper Berlin. Ich erinnere mich noch, wie ich ihn Jahre später mit einem PKW der Marke Renault vorfahren sah. Damals war es in der DDR etwas Außergewöhnliches, mit einem Westauto zu fahren.
Aber noch sind wir ja nicht so weit. Also zurück ins letzte Kriegsjahr.
Meine Mutter schaffte es, noch zweimal in unsere Heimat nach Ostpreußen zu fahren, um noch irgendwelche Sachen von dort zu holen. Wir erinnern uns noch daran, dass sogar erst beim zweiten Mal der Puppenwagen mitgebracht wurde, in dem jede Menge Besteck versteckt war – es war ihr also bewusst, dass sie etwas Illegales tat! Ein drittes Mal war nicht mehr möglich, war es doch schon beim zweiten Mal einer der letzten Züge, der durch den sogenannten polnischen Korridor fahren konnte, vor der Besetzung durch die Russen.
Es war noch im Herbst unseres ersten Jahres in Jena, als wir mit unserer Tante Else zusammen einen Ausflug auf den Jenzig unternahmen. Der Jenzig im Nordosten von Jena gelegen ist eines der sieben Wunder der Stadt und ragt fast 300 Meter steil hoch aus dem Saaletal. Beim Abstieg über den serpentinenartigen Weg erspähte ich einen Weg, von dem ich mir eine Abkürzung versprach. Als ich wieder auf den Hauptweg stieß, war von den anderen nichts zu sehen. Warum ich nicht wartete, weiß ich nicht, jedenfalls ging ich einfach weiter bis nach Hause in die Gustloffstraße, und das mit kaum acht Jahren in einer für uns doch noch völlig neuen Gegend! Als dann Mutter, Ulla und Tante Else gegen Abend kamen, waren alle verwundert. Man hatte bereits die Polizei eingeschaltet, um mich zu suchen. Solch einen Orientierungssinn hatte man dem kleinen Buben nie zugetraut.
Ich hatte auch einen Spielgefährten in meinem Alter, Wolfgang Glas, der mit seiner Familie im Nebenhaus wohnte. Zusammen spielten wir vor allem Fußball auf der Straße. Dabei diente als Fußball ein Knäuel aus alten Stoffresten. Zum Geburtstag meiner Mutter war er eingeladen und es gab Kuchen, eine selbst gebackene Obsttorte. Die Pfirsiche dazu waren aus dem Garten vorm Haus. Jedenfalls gab es für jeden ein Stück von dem kostbaren Kuchen. Und Wolfgang: „Das Stücke nehm ich meiner Schwester mit!“
Natürlich bekam er noch ein Stück. Ob er den Kuchen dann wirklich seiner Schwester gegeben hat, weiß ich nicht. Jedenfalls war ich neidisch auf diese, wie ich meinte, Unverfrorenheit. Die Familie zog wenig später nach Spandau und von Wolfgang hab ich nie mehr was gehört.
Es war noch im Winter 1945, als wir im Nebenhaus, eigentlich ein Vier-Familienhaus, ein neues Zuhause bekamen. Die Wohnung bestand aus vier Räumen, darunter eine Kammer, in die gerade mal ein Bett und gegenüber ein Schrank hineinpassten. Und in diesem Bett aus Eisengestell mussten meine Schwester und ich eine Zeit lang gemeinsam schlafen – mit gegenüberliegenden Kopfkissen.
Dann gab es noch ein geräumiges Balkonzimmer, das Muttter in Beschlag nahm. Also mit einem Doppelbett und in einer Ecke so einer Art Schreibtisch und einem Kachelofen. Außerdem gab es noch eine geräumige Küche und einen Toilettenraum. Die Toilette hatte eine Wasserspülung mit federndem Spülknauf, der im Winter manchmal zufror und mit einer Kerze wiederaufgetaut werden musste. Dann stand da noch eine große Badewanne im Raum mit Kohlebadeofen, der ja höchstens einmal die Woche angeheizt wurde, und das warme Wasser reichte dann auch jeweils nur für ein Vollbad.
Wir teilten uns die Wohnung mit einem älteren Ehepaar, Büttner mit Namen.
In das etwas geräumigere Balkonzimmer mit Ehebetten zog ich mal kurzzeitig, als ich krank war. Ich hatte sogar Diphtherie und musste deshalb isoliert schlafen. Als Spiel fürs Krankenbett erhielt ich so etwas wie eine Pappeisenbahn: Die Schienen waren eine auf Pappe aufgeklebte Papprinne, die Lok und zwei Wagen waren ebenfalls aus Pappe und passten in ihrer Dicke genau in die Papprinne. Und da sogar zwei Abzweigungen vorhanden waren, also so etwas wie Weichen, reichte es jedenfalls, um Rangieren zu üben und somit die Zeit zu vertreiben.
Im Frühjahr erhielten wir dann die gesamte Wohnung für uns. Büttners zogen in die Nachbarwohnung, wo Frau Hertig wohnte, deren Mann gerade bei einem Luftangriff auf die Jenaer Südwerke ums Leben gekomen war.
Für uns war Frau Hertig mehr als nur eine Nachbarin. Ich erinnere mich, wie wir des Öfteren bei ihr zu Besuch waren. Das heißt eigentlich nicht zu Besuch, sondern es war wie ein zweites Zuhause. Da war zur kalten Jahreszheit ein herrlich warmer Kachelofen, an dem wir uns gemütlich wärmen konnten. Unser eigener Kachelofen war noch kalt gewesen, wer sollte ihn auch rechtzeitig anheizen. Mutter musste früh beizeiten aus dem Haus, zum Schuldienst in der Ostschule. Und dann bekamen wir auch stets von Frau Hertig selbst gemachte Kekse oder kleine Kuchenstücke. Frau Hertig hatte Zeit und freute sich offensichtlich, dass da zwei junge Menschen waren, um die sie sich kümmern konnte.
Sie schenkte mir dann später den Eispickel ihres Mannes, der 1937 damit den Großglockner bestiegen hatte – was mir dann 60 Jahre später auch und sogar noch mit dem alten Pickel, wenn auch etwas gekürzt, gelang.
Eigentlich hätten die anglo-amerikanischen Bomber die Zeißwerke nie finden dürfen, denn vor jedem Alarm wurde Jena vernebelt. Wie hoch, wie breit, das weiß ich natürlich nicht, aber von uns in Jena Ost war die Sicht zur Stadt nur einige Hundert Meter weit. Und dann wurden sogenannte Sperrballons aufgelassen, die sollten wohl ein Tieffliegen verhindern. Nach dem Krieg verschafften sich viele Leute das Material der Ballons, die ja noch irgendwo in der Landschaft herumlagen und fertigten daraus ideale Regenbekleidung.
Die Vernebelung bei Fliegeralarm wurde nicht ausschließlich bei ausgewählten Städten angewendet, sondern auch an anderen, strategisch wichtigen Stellen. Für Jena waren dies insbesondere die Saaletalsperren. Nicht nur, weil die Stromversorgung über das Pumpspeicherwerk Hohenwarthe erfolgte, sondern man befürchtete, dass ein Bomebangriff auf die Staumauer diese zerstören könnte, was katastrophale Folgen für die Orte im Saaletal bedeutet hätte.
Wir überlebten die Bombenangriffe auf Jena in einer nahe gelegenen Höhle am Burgweg. Die Höhle war ein Restloch einer ehemaligen Gipsabbaustelle und deshalb hinreichend nach oben abgesichert. Dies wurde bestätigt, als das Haus direkt über der Höhle durch eine Bombe zerstört wurde und wir darunter zwar die Erschütterung spürten, mit kurzzeitigem Stromausfall, aber weiter haben wir nichts gespürt.
Als persönliches Gepäck konnten wir natürlich nur sehr wenig mitnehmen. Ulla hatte vielleicht eine Puppe im Arm, vielleicht kümmerte ich mich um Gustl. Und Mutter hatte stets ein kleines braunes Lederköfferchen dabei, mit den wichtigsten Wertsachen und Unterlagen. Dazu schleppte sie jedesmal noch ein dickes Plaid mit, falls es uns mal zu kalt wurde, schließlich war immer noch Winter.
Bei einem der auf Jena erfolgten Bombenangriffe war das in der Gustloffstraße uns gegenüberliegende Mehrfamilienhaus mittig getroffen, sodass meine Schwester im ersten Moment dachte, es hätte das Haus von Tante Else zerstört. Wir erfuhren dann, dass ein Dienstmädchen dabei zu Tode gekommen war.
Die Innenstadt hatte es diesmal stark erwischt. Nach der Entwarnung gingen wir in die Stadt, um uns die Zerstörungen anzusehen. Zwar war die eigentliche Innenstadt abgesperrt, aber ich sehe auch heute noch den Turm des damaligen Universitäts-Hauptgebäudes zusammengebrochen und brennend vor Augen.
Irgendwann Anfang 1945 muss die Radartechnik im Flugwesen zur Anwendung gelangt sein. Jedenfalls fielen ab einer bestimmten Zeit lauter Fetzen aus Aluminiumfolie vom Himmel, die sollten wohl die deutsche Abwehr irritieren. Wir sammelten jedenfalls fleißig die Folienstücke und konnten diese dann an irgendeiner Sammelstelle abgeben.
Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner sahen wir einmal auf der gegenüberliegenden Saaleuferseite eine Kolonne von Menschen, die zur Camsdorfer Brücke durch bewaffnete Organe geführt wurden. Man sagte uns, dass dies ehemalige Lagerinsassen seien, die verlegt wurden. Für uns erschien das als nichts Außergewöhnliches. Irgendwie muss also der Begriff von Menschenlagern im Bewusstsein gewesen sein, ohne dass irgendwelche Hintergründe genannt wurden. Schließlich gingen wir ja während der Zeit der fast täglichen Bombenalarme in ein ehemaliges Maidenlager unterhalb der Kernberge zur Schule. Das Maidenlager war ein vom Reichsarbeitsdienst für die weiblichen Jugend eingerichtetes Lager.
Anfang April 1945 kamen die Amerikaner. Wir waren natürlich in dem schon erwähnten Bunker und haben da gar nicht so richtig mitbekommen, dass die Camsdorfer Brücke durch deutsche Pioniere gesprengt wurde, obgleich diese Sprengung völlig sinnlos war, da die Amerikaner bereits an anderen Stellen die Saale überquert hatten. Sie kamen nicht, wie der Frontverlauf es vermuten ließ, von Westen auf Jena zu, sondern von Nordosten. Und die Überquerung der Saale bereitete auch keine Probleme, schnell war eine Pontonbrücke erstellt, die auch später noch als Ersatzbrücke diente.
Beim ersten Einmarsch der amerikanischen Truppen in die eigentliche Innenstadt wurden diese von fanatischen Jugendlichen beschossen. Es sind bestimmt keine regulären Soldaten gewesen, denn diese waren rechtzeitig getürmt. Jedenfalls zogen sich die amerikanischen Soldaten schlagartig wieder über die Saale zurück und übermittelten ihrer Artillerie die genauen Ortsangaben, sodass noch mal auf die Stadt geschossen wurde, natürlich auf ein vom Bombenangriff verschontes Wohngebiet. Die Ruinen um die Fleischerei Schalling herum erinnerten noch Jahre später an dieses Ereignis.
Wie schon erwähnt, waren wir in der Zeit, als der Einzug der Amerikaner erwartet wurde, was durch einen Daueralarm angemahnt wurde, in dem Bunker, und das über mehrere Tage hinweg. In kurzen Pausen ging es auch jetzt immer mal kurz nach Hause.
Bei einem der letzten Male waren an der Böschung zwischen Burgweg und Oberen Burgweg Gräben ausgehoben – hatten da die rückziehenden Soldaten noch Schützengräber angelegt? Jedenfalls lagen diverse Patronen am Grabenrand.
Den eigentlichen Einzug der Amerikaner erlebten wir dann auch vom Bunker am Burgweg aus. Wir standen vor dem Eingang und staunten über die in endloser Kolonne fahrenden Autos, darunter viele offene Jeeps, sodass man den Soldaten quasi in die Augen sehen konnte. Wohin die Kolonne fuhr, bleibt fraglich, der Burgweg führt letztendlich ins Ziegenhainer Tal und damit strategisch in eine Sackgasse.
Bei der Einmündung des Burgwegs vom Camsdorfer Ufer aus standen dann zwei Panzer mit schwarzer Besatzung. Hier fielen wir Kinder aus allen Wolken, denn die Schwarzen sahen auch nicht anders aus als wir, wo wir doch in der Schule gelehrt bekamen, dass nur wir Deutschen wie richtige Menschen aussehen. Und diese Schwarzen verteilten sogar Schokolade, von der wir anfangs glaubten, solche sei vergiftet.
In besonderer Erinnerung ist auch die Änderung des Grußverhaltens mit Ende des Krieges. Von einem Tag zum anderen durfte nicht mehr der Arm zum Gruß erhoben und „Heil H…“ gebrüllt werden. Jetzt hieß es plötzlich „Guten Tag“ oder Guten Morgen“. Es dauerte lange, bis dies zur Selbstverständlichkeit wurde.
Aus der Gustloffstraße war übrigens eine Maurerstraße geworden.
Eine Maßnahme, die von den Amerikaner durchgeführt wurde, war so eine Art Umquartierung von Wissenschaftlern und leitenden Angestellten der weltbekannten Firmen Carl-Zeiss-Jena und Glaswerk Schott. Umquartierung insofern, dass die gesamte Familie in den Westen umgesiedelt wurde. Aus unserem Bekanntenkreis war aber niemand davon betroffen.
Am 1. Juli dann kamen die Russen. Weil die Amerikaner unbedingt auch die deutsche Hauptstadt Berlin besetzen wollten, die die Rote Armee vorzeitig überrollt hatte, wurden Thüringen und Teile Sachsens, wo die Amerikaner die deutsche Armee vertrieben hatte, gegen die westlichen Bezirke der Stadt Berlin getauscht, sodass wir in Jena seitdem unter russischer Besatzung waren.
Und dieser Einmarsch der russischen Truppen verlief so gänzlich anders als bei den Amerikanern. Vielleicht war auch das regnerische Wetter schuld, dass die Truppen so kläglich daherkamen. Wir waren vorher darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir nicht aus Neugier am Straßenrand stehen sollten und möglichst auch nicht vom Fenster aus die Truppen beobachten sollten. Jedenfalls kam keine motorisierte Truppe des Weges, sondern müde Soldaten in Regencapes trotteten hinter mit Planen bedeckten Wagen daher, die von Pferden gezogen wurden.
Eine der ersten Amtsbekanntmachungen beinhaltete die Abgabe vieler Gegenstände: Waffen natürlich, aber auch Radiogeräte, jede Art von Fotogerät, Ferngläser und so fort. Meine Mutter hielt sich natürlich strengstens an diese Verordnung. Wir hatten nur einen kleinen Fotoapparat mit aus Ostpreußen gerettet, weg war er.
Einige Zeit später fand man diverses Material dieser Sammlung auf einer Müllhalde. Viele Jungen brachten so optische Geräte, meistens nur davon Einzelteile, wie Linsen und Ähnliches, nach Hause. Meine Mutter verbot mir selbstredend diese Sammlermöglichkeit und so konnte ich nur neidvoll zu sehen, wie andere Spielkameraden mit den Linsen Ferngläser oder Mikroskope zu bauen probierten.
Eine weitere Sammlermöglichkeit für uns Kinder bestand darin, nach alter Munition oder gar Blindgängern vom Bombenangriff zu suchen. Die Muntion, also nicht nur Gewehrpatronen, wie wir sie am Burgweg gesehen hatten, sondern auch größeren Kalibers.
So fanden wir am Saaleufer mal eine wohl noch scharfe Panzerfaust. Machten aber einen großen Bogen um dieses Ungetüm.
Ein paar Jungen aus einer älteren Klasse der Talschule hatten sogar Granaten gefunden und wollten diese zur Sprerrung bringen, indem sie ein Holzfeuer machten und die Granaten dort hineinwarfen. Die Explosion muss diesen Jungen höllisch Spaß gemacht haben, denn es wurde mehrfach ausprobiert. Nur einmal wollte die Granate einfach nicht explodieren, obgleich sie schon eine Weile in dem Feuer gelegen hatte. Also machte sich ein Junge mit einem Stab daran, die Granate etwas näher an die Flammen zu bringen. Das aber nahm die Granate übel: Sie explodierte und riss den Jungen in Stücke. Durch dieses Unglück wurde dieses Tun dann auch bekannt und wir wurden strengstens darauf hingewiesen, solches Tun zu unterlassen.
Die Zeit wurde geprägt durch die Suche nach Nahrung. Die Zuteilungen auf Karte waren nicht gerade üppig und nicht mal immer garantiert. Zwar gab es auch schon zu Kriegszeiten Lebensmittelkarten und dazu gelegentlich Sonderzuteilungen, wie Eierkarte oder Bezugscheine für Schuhe oder wie meine Mutter mal einen Bezugsschein für eine warme Jacke beantragte. Aber jetzt unter russischer Besatzung lief das alles noch viel unregelmäßiger.
Manchmal fand man eine Kartoffel auf der Straße, von irgendeinem LKW gefallen, die durfte dann extra gegessen werden. Die LKW fuhren außerdem nicht mit Benzin, sondern waren sogenannte Holzvergaser, d. h., als Antriebsmotor diente eine mit Holz beheizte Dampfmaschine. Das Holz wurde dann bei Bedarf aus der Landschaft entnommen.
Zur Stärkung der Gesundheit von uns Kindern gab es Lebertran1. Davon musste man jeden Tag einen Löffel voll schlucken. Für welchen Zeitraum weiß ich nicht mehr, aber in Erinnerung ist immer noch der stark tranische Geschmack.
1 Lebertran, aus Fischöl gewonnen auf Basis von Vitamin B3, wird als Stärkungsmittel bei Kinderkrankheiten und Unterernährung sowie zur Verhütung von Rachitis eingenommen
Eine der ersten Wiederaufbaumaßnahmen war der Neubau der Camsdorfer Brücke. Schließlich war diese Brücke auch eines der sieben Wunder der Stadt, eine der wichtigsten Saaleüberquerungen vor allem für den Fern- und Güterverkehr. Die Autobahnbrücke bei Lobeda war schon längere Zeit kaputt und deren Wiederaufbau wäre zu kompliziert gewesen. Als Erstes mussten aber die Reste der alten Brücke gespengt werden.
Während dieser Sprengungen waren wir Bürger auf besondere Vorsicht aufmerksam gemacht worden. Irgendwie hatte aber Mutter bei ihrem Gang zur Ostschule diese Warnung nicht ernst genommen und so traf sie einmal ein Stein, der bei der Sprengung losflog, am Fuß und bereitete ihr für längere Zeit Beschwerden.
Beispiel für Zuteilungskarten zu Ende des Krieges
Der Bau der Brücke erfolgte durch die Firma Dyckerhoff & Widman, die im Westteil Deutschlands zu Hause war. Die einzelnen Fortschritte des Wiederaufbaus habe ich von Woche zu Woche zeichnerisch festgehalten und Opa nach Demmin geschickt. Schließlich war Großvater ja mal Brücken-Baumeister gewesen.
Und dass westdeutsche Firmen noch lange Zeit in Jena, also in der russisch besetzten Zone, aktiv waren, zeigte auch die noch lange anwesende Fisch-Verkaufsstelle „Nordsee“ am Holzmarkt. Der Holzmarkt, ein recht zentraler Platz der Stadt, war vom Bombenangriff weitgehends verschont geblieben. Damals hieß es, man könne vom Holzmarkt auf vier Meere sehen: gegenüber die Nordsee, dahinter ein Häusermeer, abends ein Lichtermeer und nachts, bei Stromsperre, gar nichts mehr.