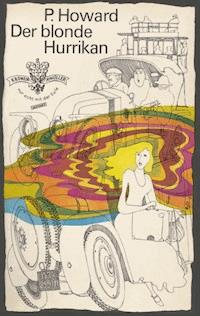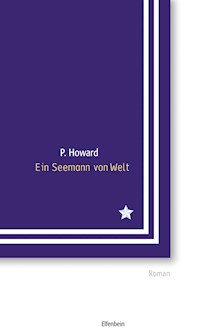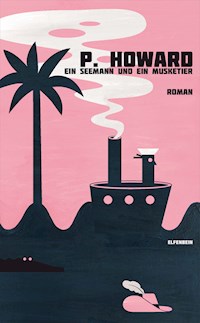Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Willkommen zurück im lauschigen Zwielicht der Hochseeganoven! Der vornübergeneigte Leser darf endlich aufatmen, denn Jimmy Reeperbahn gibt sich wieder die »Habe die Ehre!« und nebst ihm auch seine seriösen Gesinnungskumpel aus der Hautevolee aller Häfen dieser großen, weiten Welt: vor allem seine neueste Flamme Jennifer Fiasko und der zutiefst anrüchige Kapitän Fred Unrat, ferner der schillernde Menschenhändler Sülze Strebsam und erstmalig auch der mit allen alkoholischen Wässerchen gewaschene Herr Wagner mit dem blauen Bart (Arien inbegriffen) — eines der wunderlichsten Geschöpfe aus Rejtős visionärem Wachsfigurenkabinett — und sein Spatz Arnold! Haben Sie nicht auch schon öfter den Wunsch verspürt, zur mächtigen und be wunderten Kaste der Millionäre zu gehören? Natürlich haben Sie! Wenn Sie die sen Roman wieder aus der Hand legen, werden ihnen solche Grillen für immer ausgetrieben sein. Mr. Theo, unser Held, ist zwar Millionär, aber alles andere als beneidenswert. Nein, nicht wegen seiner charmanten Sommersprossen, sondern weil er, um seine Angebetete zu erobern, zu einem erbitterten Mittel greift, sprich: Er will ein nützliches und werktätiges Mitglied der Gesellschaft werden. Sobald als möglich, so leicht als möglich, so spektakulär als möglich. Den ersehnten Ruhm erhofft er sich vom Wiederauffinden eines verschollenen Forschers und Entdeckers, wobei er sich eines Tricks bedient, den ihm eben dieser nur angeblich verschollene Geograf in den Kopf gesetzt hat: Er nimmt ihn einfach in einer gemütlichen Kiste mit aufs Schiff — und »findet« ihn auf einer entlegenen Insel voller Kannibalen, nachdem er ihn dort ausgesetzt hat. So weit so schön. Aber einen Strich durch diese findig-faule Rechnung machen ihm viel zu viele widrige Gestalten und schräge Umstände: ein Pestkahn, maritimer Gespensterspuk, ein verschmitztes Schoßäffchen, jede Menge schlagkräftiger Gauner, eine wiedergängerische Mundharmonika, ein Sammelsurium völlig untragbarer Passagiere ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
P. Howard
(Jenő Rejtő)
Ein Seemann aus der
Neuen Welt
Ein analoger Revuekrimi
Aus dem Ungarischen übersetzt von Vilmos Csernohorszky jr.
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1940
unter dem Titel »Piszkos Fred közbelép«
bei Nova, Budapest.
»P. Howard« ist ein Pseudonym von Jenő Rejtő.
Vom selben Autor erschienen bereits in den Übersetzungen vonVilmos Csernohorszkys jr. die Romane
»Ein Seemann von Welt« (2004)
»Ein Seemann und ein Gentleman« (2008)
»Ein Seemann in der Fremdenlegion« (2012)
»Ein Seemann und ein Musketier« (2014)
© 2016 Elfenbein Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-93-0 (E-Book)
ISBN 978-3-941184-53-4 (Druckausgabe)
erstes kapitel
ICH MÖCHTE WELTBERÜHMT WERDEN!
Habe viel Geld, aber keine Einfälle!
Für jede gute Idee bedankt sich
ein reizender Junge, der die Lebenslust verloren hat.
Folgende Antworten hatten den Weg zum Wasserschloss in einem nach italienischen Vorbildern angelegten Privatgarten San Franciscos gefunden:
Antwort Numero 1
Habe Ihre Anzeige gelesen und fühle mich geehrt, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ich der ehrliche Finder Ihrer verlustig gegangenen Lebensfreude bin, die Sie sich, nebenbei gesagt, an den Hut stecken dürfen. Ich war, mit Verlaub gesagt, sechs Jahre lang ein glücklich verbeamteter Stromeinschalter am elektrischen Stuhl zu Boston, bis an einem schicksalsverhangenen Tage meine schicke und glänzende Kautschukmanschette einen völlig unvorhergesehenen Kurzschluss verursachte, so dass der verurteilte Delinquent infolge eines völlig unvorhersehbaren elektrostatischen Stromausfalls nicht entschlummerte beziehungsweise am Leben blieb. Leider gibt es keine definitive Hinrichtung ohne Opfer, weshalb ich unerwartet sofort aus meiner ruhigen Stellung geschasst wurde. So viel zu meiner seligen Kautschukmanschette. Danach versuchte ich natürlich, beim kinematografischen Film unterzukommen, da ich ausgebildeter Sattlermeister bin und als solcher im Westerngenre universal einsetzbar. So wurde ich bei Paramount Laufbursche auf dem Dreirad, heiratete jedoch unverhofft bald, so dass ich heute eine blühende, aber erstaunlich wenig einträgliche Gärtnerei in Oklahoma betreibe. Ich heiße Sokrates Schwachta oder Knapp (nach Belieben). Bin ein 45-jähriger, verwitweter Scharfrichter, der das untrügliche Gefühl hat, das Leben hätte für ihn noch einige Überraschungen der unerwarteten Art auf Lager. Habe Ihr freundliches Inserat gelesen, und mein sensationelles Angebot lautet wie folgt: Sie können weltberühmt werden, wenn Sie mich adoptieren und spontan mit Ihrem Vermögen beglücken, dann zu Fuß oder auf einem Tretroller nach Kalkutta pilgern und unterwegs durch ein Megafon unaufhörlich durch die Gegend brüllen, dass die Rohkost unerhörte Wunder wirkt! Diese haarsträubende Idiotie würde in der ganzen Welt bekannt werden und damit auch Ihr durchaus werter Name, denn die Menschheit würde sagen: »Sieh mal einer an …« Geben Sie mir Bescheid, mit welchem Zug Sie einen 45-jährigen, verwitweten Scharfrichter erwarten, der das untrügliche Gefühl hat, das Leben hätte ihm noch einiges zu bieten, und mit einer Ausnahme 72 vorschriftsmäßig vollstreckte, amtlich beglaubigte Hinrichtungen vorweisen kann und dem der Präsident während eines gemeinsamen Besuchs im Flohzirkus bescheinigt hat, ohne mich sei er nichts weiter als eine unglaubliche Null. Also? Ich bin Ihr Mann!
Mit freundlichen Grüßen
SOKRATES SCHWACHTA
oder Knapp (nach Belieben).
Antwort Numero 2
Mein Herr!
Weltberühmt zu werden ist kinderleicht. Ich habe ein vielseitiges Kinderspielzeug erfunden, verwendbar unter anderem als Spielzeugeisenbahn, Rassel oder Fliegenklappe. Das Gewicht zweier Fliegenkinder genügt, damit der patentierte Fliegenhammer niedersaust! Finanzieren Sie mich, und die gesamte Kindheit wird meinen Namen neben Edisons und Ihrem im kindlichen Gedächtnis bewahren, denn diese kunstreiche Apparatur vernichtet nicht nur zwei Fliegen mit eine Klappe, sondern macht Sie auch weltberühmt …
Antwort Numero 3
WOLLEN SIE WELTBERÜHMT WERDEN? MÖCHTEN SIE, DASS MAN SIE BEWUNDERT UND ACHTET? DASS MILLIONEN IHREN NAMEN KENNEN? SIND SIE BEREIT, DAFÜR GROSSE SUMMEN ZU OPFERN? ICH MEINE, DAS IST DER GRÖSSTE SCHWACHSINN DES JAHRHUNDERTS!
Ohne jede Hochachtung
B. Knox
Naturanbeter, Mormonenprediger, Bariton im Chor des Mazdaznan-Vereins
Antwort Numero 4
FÜR EINE BESCHEIDENE GEGENLEISTUNG KÖNNEN SIE WELTBERÜHMT WERDEN! WAS IST DAS GEHEIMNIS DES ERFOLGS?!
Ich habe das Leben Napoleons, Tolstojs, Chaplins und D. S. Windthorns sorgfältig studiert. Diese großen Männer sind unsterblich geworden, weil sie das »Zauberchen« genannte Flachsöl gegen Haarausfall benutzten.
Wollen Sie ein Begriff werden wie Rasputin, Beethoven, Shaw, Pasteur und D. S. Windthorn?
VERWENDEN SIE DAS FLACHSÖL »ZAUBERCHEN«! HERSTELLER:
Ingenieur D. S. Windthorn, Brooklyn.
Antwort Numero 5
Wenn Sie schnell und günstig weltberühmt werden wollen, lesen Sie mein Hauptwerk
WIE KÖNNEN WIR REICH, ERFOLGREICH UND GESUND LEBEN?
Ihre freundliche Bestellung erwarte ich im Hospiz für kranke Obdachlose, ja ich rechne sogar damit, denn es ist Ihre Pflicht, Ihrem Nächsten zu helfen, der seit fünf Monaten auf seinem verlausten Elendslager darniederliegt und eine nach Brot schreiende Familie zu ernähren hat!
Mit vorzüglicher Hochachtung
E. HUBERTON
Autor des Werkes Wie können wir reich, erfolgreich und gesund leben?
P. S.: Mein anderes Hauptwerk, Karriere, Kraft und Gesundheit durch Atemübungen und Schwedenturnen, können Sie ebenfalls im oben genannten Hospiz bestellen.«
Und so weiter und so weiter! Schrecklich … Eine Antwort unmöglicher und dümmer als die andere.
»Leider ist nicht eine zu gebrauchen«, seufzte Theobald Lincoln, kaum dass er die letzte gelesen hatte. Vor seinem Lehnstuhl stapelte sich ein Berg von Briefen, unter dem gerade sein ächzender Sekretär hervorkroch:
»Ich habe es geahnt. Die Menschen sind nicht besonders erfinderisch, Mr. Theo«, tröstete ihn der Aufgetauchte.
Ja, Sie haben richtig gehört, so nannte er ihn: »Mr. Theo«, denn der junge Mann wurde auch von seinen Angestellten nur mit diesem zutraulichen Fragment des erhabenen Namens »Theobald« angesprochen. Dass sie trotzdem jedes Mal ein »Mister« davorschoben, war nur dem Umstand zuzuschreiben, dass seitens seiner selbstlosen, ergebenen und jedweder Heuchelei abholden Umgebung eine gewisse Achtung, wenn auch nicht ihm persönlich, so doch seinen Millionen gezollt wurde.
Der junge Mann war nämlich … Ja! Er war ein Millionär! Bei diesem Aphrodisiakum von einem Wort fühlen wir uns gleich besser, vergessen den ranzigen Alltag und beginnen zu träumen, denn dieses Phänomen hat eine Menge mit der schwarzen Magie zu tun und saugt jede kleine, graue Motte, die ihr zu nahe fliegt, in ihr Feuer hinein. Frau Welt vermag beinahe jeden von uns zu bezirzen, denn von vorne gesehen ist sie wunderschön, auch wenn sie von hinten verfault und voller Maden ist. Aber wer macht sich die Mühe, hinter ihre Fassade zu schauen, wenn sie nur so umwerfend lügen kann?
Mr. Theo hatte jedoch auch einen Charakter! Und der setzte sich aus drei prägnanten Zügen zusammen, die da wären: ein sommersprossiges Gesicht, erdbeerrote Haare und ein tiefsitzendes Vorurteil gegenüber jeder Art nutzbringender Tätigkeit. Tja, was soll ich es beschönigen, ich sage es lieber freiheraus: Dieser junge Mann war mordsfaul.
Sonst aber galt er als ein abgrundtief angenehmer Jüngling. Seine stets fröhliche Miene, seine oberflächliche Lebensphilosophie, die breiten Schultern und die heiteren, blauen, einschmeichelnden Augen machten ihn ungemein sympathisch, was sich auch oder besonders in dem Fall als vorteilhaft erwies, wenn sich seine Damenbekanntschaften mit dem Ratespiel vergnügten, ob sie ihn lieben würden, auch wenn er arm wäre. Rührend, nicht wahr?
Langer Rede kurzer Sinn: Schließlich war eine Braut gefunden! Natürlich müssen wir auch den Stapel unsinniger Briefe auf sie zurückführen. Das war so: Die Erwählte hieß Charlotte Dusan, eine aus Frankreich importierte, erstklassige Künstlerin, die im »Tohuwabohu«, dem vornehmsten Varieté der Stadt, mit ihrer berückend synkopischen Bühnenagonie »Totentanz« so viel künstlerisches Interesse erregte, dass der Champagnerverbrauch besagten Kulturbetriebs um dreißig Magnumflaschen pro Tag stieg.
Mr. Theo war als Sohn des Generaldirektors des Pacific Ocean Trust geboren worden, und damit war ihm von Anfang an klar, dass es für ihn genügend Tagewerk und Lebensinhalt wäre, wenn es ihm gelang, die manchmal schon sehr lästige Langeweile irgendwie zu vertreiben. Anfangs wollte er auch mit Charlotte Dusan dieser strapaziösen Hauptbeschäftigung nachgehen, aber dann wurde er von seinen gefühlvollen Gefühlen veranlasst, nächtelang zu zechen.
»Charlotte! Ich nehme Sie zur Frau!«, eröffnete ihr eines Tages unser leichtsinniger Millionär. Leider entsprach die Antwort der Magnumkünstlerin keineswegs den kühnen Erwartungen des ebenso jungen wie oberflächlichen Herrn:
»Was soll ich mit einem Kerl anfangen, der nur Millionär ist? Meinst du, das reicht?«
»Ja«, antwortete der junge Mann aufrichtig, da ihm diese Überzeugung in Fleisch und Blut übergegangen war.
»Da bist du schiefgewickelt, Kleiner!«, erwiderte die Vampirin. »Niemand soll meinen Mann als Geldsack bezeichnen. Was ich will, ist ein richtiger Großkopferter. Geh doch malochen!«
»Das kann ich nicht«, antwortete Mr. Theo bescheiden. »Wer Geld hat, soll nicht selbst arbeiten und andere dabei stören.«
»Dann darfst du nicht mal von mir träumen!«, knallte sie ihm militant ins Gesicht.
Die noch von jeder Altersschwermut und Herzensverhärmung ungeschmälerte Leidenschaft des Jünglings kannte jedoch keine Hindernisse. Er suchte vielmehr nach einem gangbaren, barrierefreien Mittelweg zur Ehrbarkeit, ohne jedoch die anrüchige Notwendigkeit zu arbeiten.
»Mr. Thorn«, fragte er seinen Sekretär an einem dieser niederdrückenden Informationsabende, »was soll jemand tun, wenn er nicht arbeiten und dennoch seine ständige Anwesenheit auf der Welt möglichst einleuchtend begründen will.«
Der Sekretär rieb sich das markante, zerfurchte Gesicht. Emanuel Thorn war ein trockener, magerer Mann mit einer phlegmatisch müden Stimme.
»Sagen wir«, riet er besonnen, »Sie gründen einen Verein mit dem Namen ›Arbeit ist keine Schande, aber langweilig‹. Der Verein würde sein Programm Tag und Nacht verbreiten: ›Niemand soll arbeiten, dessen Arbeit nicht gebraucht wird, oder der kein Geld zum Überleben braucht.‹ Wenn das erreicht ist, dann bedeutet das den Beginn bedeutender Fortschritte für die Welt, einen Segen für die Menschheit, und der Name Theobald Lincolns stünde neben dem Galileis, der meiner Ansicht nach auch nichts arbeitete, denn nur weil es ihm furchtbar langweilig war, konnte er auf die idiotische Idee verfallen, dass die Erde um ihre eigene Achse rotiert und unbeholfen um die Sonne kreiselt.«
»Halt!«, rief Theo begeistert. »Hallooo! Sie sind doch der nützlichste Mann in meinen Diensten! Welchen Blödsinn Sie auch immer erzählen, Sie bringen mich doch immer auf eine Idee, die Hand und Fuß hat.«
»Yes …«, nickte der Sekretär und schloss zufrieden seine matten Augen. »Hauptsache ist doch, dass man irgendwie unverzichtbar ist. Ergebnisse machen den Wert der Arbeit aus, denn auch die wertvollste Arbeit ist keine Ausrede und entschuldigt nicht die Ergebnislosigkeit. Ich glaube, jetzt habe ich etwas sehr Gutes gesagt.«
»Ja! Vielleicht haben Sie sich irgendwo verkühlt. Meine Idee ist jedenfalls erstklassig! Ich werde weltberühmt! Das ist die einzige Möglichkeit, ohne Arbeit gut zu leben und von Tadel verschont zu bleiben. Wen interessiert es, ob Edison arbeitete, wenn er nicht gerade die Glühbirne, das Grammofon und ähnliche Dinge erfand? Oder wen kümmert es, ob Darwin unaufhörlich tätig war, nur weil er der Meinung war, unsere Körper seien entfernt mit den Affen verschwägert? Sie geben morgen eine Anzeige auf.«
Die Idee gefiel dem Sekretär gar nicht.
»Ich finde es entsetzlich, dass ein Gentleman vor die Öffentlichkeit tritt. Aber Sie sind ein hartnäckiger Mensch, Mr. Theo. Ich gebe also den Kampf und die Anzeige auf.«
So geschah es. Als sich aber – wie wir bereits festgestellt haben – niemand von Belang meldete, beschloss Mr. Theo, sich mit jenem hartherzigen Vater in Verbindung zu setzen, der hinsichtlich der Notwendigkeit einer nützlichen und gewinnträchtigen Tätigkeit schon viel früher als Charlotte Dusan deren verschrobene Ansichten vertreten hatte. Der junge Mann war zu allem entschlossen und bereit, sich endlich überreden zu lassen, in die Firma einzutreten.
»Mr. Thorn! Verbinden Sie mich mit der PACIOCI!«
Auch das war typisch für Mr. Theos Charakter, dass er das mächtige Unternehmen Pacific Ocean Trust kurz PACIOCI nannte, ähnlich den widerlichen Zungengeräuschen, mit denen man ein nettes Kätzchen heranlockt.
Er zündete sich schlechtgelaunt eine Zigarre an, denn die Aussicht auf harte Arbeit warf bereits ihre morbiden Schatten voraus: Sein Leben würde zwar bleiben wie zuvor, aber man würde ihn täglich zu Recht kritisieren.
»Die PACIOCI, Mr. Theo!«, zischte der Sekretär und übergab den Hörer.
Der junge Mann plapperte wie immer unüberlegt drauflos:
»Bitte den Papa! Hier spricht Theo!«
Die hausinterne Vermittlung verstand »Leo« und verband ihn mit dem Pförtner, der einen zwanzigjährigen Sohn dieses Namens hatte. Grob schrie der Pförtner in den Hörer:
»Warte nur, du Nichtsnutz! Ich sitze hier schon seit einer Stunde ohne Hose herum!«
»Aber wie ist das nur möglich?«, erwiderte Mr. Theo höflich, woraus der geneigte Leser ersehen kann, dass eine gute Erziehung Gold wert ist.
»Was soll ich ohne die Hose anfangen! Willst du, dass ich mich erkälte?!«
»Nein, um Himmels Willen!«, verneinte der Millionär erschrocken, da er seine Mitmenschen liebte.
»Ich habe bereits einen Schnupfen!«, beschwerte sich Leos Vater.
»Gibt es dort gar keine Bettdecke, um sich warmzuhalten?«, erkundigte sich Mr. Theo besorgt.
»Dummer Kerl! Mit einer Bettdecke kann ich doch nicht in die Empfangshalle!«
»Das leuchtet mir ein!«
»Wenn ich in fünf Minuten immer noch ohne Hose dasitze, setzt’s was!«
»Nur die Ruhe. Bin schon dabei.«
»Hallo! Und lass den Aufschlag verstärken, weil er sonst bei Regenwetter ausfranst. Und die Bügelfalte muss scharf wie eine Rasierklinge sein, sonst kannst du mich kennenlernen!«
Sobald der Pförtner wütend und entsprechend laut den Hörer aufgelegt hatte, klingelte Mr. Theo, worauf der Lakai Sigorski erschien.
»Sie bringen sofort eine Hose von mir zur PACIOCI«, befahl der Millionär, »aber mit einer Bügelfalte, scharf wie eine Rasierklinge, denn die Hose ist für den Pförtner, und wenn er nicht zufrieden ist, wird man uns körperlich züchtigen. Lassen Sie den Hosenaufschlag mit einem Stoßband versehen, weil er sonst ausfranst. Grüßen Sie den Pförtner von mir, und er soll mich ruhig wieder anrufen, wenn er auch einen Mantel braucht.«
Sigorski, der Lakai, hatte einmal eine Eisenbahnkatastrophe überlebt, hierbei jedoch ein Auge und etliche Gehirnzellen eingebüßt. Aus seinen gesunden Tagen waren ihm nur seine Unzuverlässigkeit und eine gewisse Schlampigkeit geblieben.
»Mr. Theo«, näselte er langsam und erhobenen Hauptes, »warum sollte die Hose ausfransen? Bei solchem Wetter verkehrt man doch mit dem Automobil.«
»Aber der Pförtner der PACIOCI besitzt wahrscheinlich gar keinen Wagen … Stimmt! Das ist auch nicht in Ordnung! Spring unterwegs bei Duesenberg vorbei und kauf dem armen Mann einen niedlichen Sportwagen.«
Mr. Baruch T. Livingstone war ungemein verblüfft, als der seh- und denkbehinderte Sigorski mit einer eleganten Hose und den Papieren eines sechszylindrigen Roadsters seine Loge betrat. Der zornentbrannte Pförtner war inzwischen Mr. Theos Rat gefolgt und saß mit einer Bettdecke umhüllt am Fenster und hielt ein Schild in der Hand: »besprechung, NICHT STÖREN!«, in der Absicht, es seinem Sohn Leo gegen den Kopf zu knallen, sobald dieser zwar verspätet, aber trotzdem das ersehnte Kleidungsstück brächte. Er hatte keine Ahnung, dass ihm diese Gefahr nicht drohte, nachdem der missratene Bengel um die Mittagsstunde als Matrose angeheuert und das Geld für den Schneider vertrunken hatte, bevor er sich mit der Hose nach Hawaii aufmachte, wo die Nächte duftend und die Frauen glutäugig sind, und außerdem die Gitarre klingt, wenn man den Tangodichtern glauben darf, was ich zu bezweifeln wage.
»Mein Chef lässt Ihnen ausrichten«, meldete Sigorski, »Ihre Hose werde in Zukunft nicht mehr ausfransen, da er Ihnen einen Personensportwagen mit fünftausend Kubikzentimetern gekauft hat.«
Der Pförtner staunte, sofern dieses Wort jenem besonderen Zustand zwischen Verwunderung und Ohnmacht hinreichend gerecht wird.
»Wer … sind Sie?«, stotterte er.
»Roland Sigorski, mit Verlaub. Sie haben mit meinem Chef in der Angelegenheit einer Hose konferiert, Sir.«
»Ich habe nicht das Vergnügen … Könnten Sie vielleicht Näheres über Ihre Person …?«
»Bitte, wie Sie wünschen, Sir.« Sigorski nickte kühl und begann auch schon aufzusagen: »Ich wurde in Odessa geboren, zähle zweiundvierzig Lenze und gelangte als ehemaliger Hauptrittmeister des im Ruhestand befindlichen griechischen Stationsvorstehers Papagalos in die Neue Welt. Hier Ihre Hose. Nehmen Sie, Sir.«
»Entschuldigen Sie bitte, aber hier liegt ein Irrtum vor …«, staunte Leos Vater. »Ich habe nie mit dem Herrn Stationsvorsteher gesprochen …«
»Er hat es nicht übel aufgenommen, Sir. Zumindest hat er mir gegenüber diesbezüglich nichts verlauten lassen. Der alte Herr ist ein durchaus wortkarger Mann gewesen: Bitte, Sir … Hier sind Ihre Wagenpapiere. Vorsicht, Sir, die Bügelfalte Ihrer werten Hose ist besonders scharf.«
»Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht irren?«
»Ich habe mir erlaubt, Sir, sie selbst zu bügeln. Wenn Sie aber wünschen, bügele ich sie noch einmal, da mein Chef die von Ihnen in Aussicht gestellten Tätlichkeiten vermeiden möchte. Nehmen Sie, Sir.«
Der Pförtner taumelte. Sigorski teilte ihm noch mit, welche Nummer er wählen müsste, wenn er auch einen Mantel brauchen sollte. Dann entfernte er sich. Baruch T. Livingstone blieb der Mund o-förmig offen, er selbst aber stand da mit der Hose in der einen Hand, mit den Wagenpapieren in der anderen, zu seinen Füßen die Bettdecke, und kein moderner Maler hätte eine so dekorierte und doch erschlagende Vision auf die Leinwand bannen können. Da aber erschien der Personalchef mit einem dicken Mann.
»Ich möchte Ihnen den neuen Aushilfspförtner vorstellen, Livingstone«, sagte der Personalchef. »Wie sehen Sie eigentlich aus?! Das ist ja skandalös! Lassen Sie sich umgehend Ihr Gehalt auszahlen und verschwinden Sie!«
»Umgehend geht das nicht.«
Und er zog umgehend die neue Hose an. Diese war mit gewissen grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der Physik bestens vertraut und zerriss infolgedessen mit gleichgültiger Leichtigkeit. Der durchtrainierte Mr. Theo hatte vergessen, dass der Pförtner wegen seiner sitzenden Tätigkeit ein kraftvolles Mannsbild war. Somit konnte Baruch T. Livingstone nichts anderes tun, als die Bettdecke um seine Hüfte zu schlingen, und der neue Pförtner sah staunend, wie sein Vorgänger ein schnittiges Luxusfahrzeug bestieg und davonfuhr.
»Sehen Sie, Marved?«, brüstete sich der Personalchef. »Unsere Angestellten scheiden schon nach wenigen Jahren so aus der Firma.«
Der neue Pförtner wusste nicht, wie er das verstehen sollte: Gefeuert und ohne Hose oder mit Auto? Oder geisteskrank? Das gehört jedoch nicht mehr zum engeren Themenbereich unseres Revuekrimis, und der Episode kommt nur insoweit Bedeutung zu, als die Hose die logische Folge der Ereignisse störte und Mr. Theo daran hinderte, mit seinem Vater über seine ehrenwerten Absichten zu sprechen, die er als Mann von Charakter nicht mehr aufgeben wollte. So aber verschob er das falsch verbundene Gespräch und ging in sein Schlafzimmer, um sich ein wenig hinzulegen, womit sein Leben einen raketenschnellen Verlauf nahm, und zwar unwiderruflich und endgültig, auf einer schnörkelreichen Bahn voller wahnwitziger Abenteuer: Um 10.45 Uhr hatte er beschlossen, schlafen zu gehen, und um 11.20 Uhr nahm er bereits ein wohlschmeckendes Frühstück ein, und zwar in Gesellschaft eines zu Staub zerfallenden Toten, der sich schon bald als die beharrliche Ursache ungezählter Wirrungen entpuppen sollte.
zweites kapitel
Dem notorischen Toten begegnete Mr. Theo in seinem riesigen Schlafzimmer, als er auf das zudringliche Schnarchen dieses verblichenen Herrn aufmerksam wurde. Mit gesträubten Haaren beugte er sich nieder, um unter das Bett zu spähen, und erblickte besagte Leiche, die heftig schlafend in Frieden ruhte.
»Hallo! Sie! Was soll denn das? Kommen Sie sofort unter meinem Bett hervor!«
Die sterbliche Hülle zuckte die Achseln, wie jemand, der es nicht mag, wenn jede Kleinigkeit gleich übertrieben wird, und knurrte mit beschwichtigendem Spott:
»Bitte, bitte … Warum regen Sie sich denn so auf, werter Herr?«
Er kroch hervor, wobei er mit seinen Schultern die Lampe mit dem weinroten Seidenschirm umstieß, stand auf und öffnete das Fenster. Dann streckte er seine rechte Hand hinaus, als wollte er die zahmen Hirsche des Schlossparks segnen, und bemerkte schließlich mit einem säuerlichen Gesicht:
»Es regnet … Erstaunlich, dass es in San Francisco jeden Mittwoch regnet. Daran sind wohl die Fabriken schuld. Wie spät ist es?«
Der rothaarige Millionär setzte sich sofort in einen Fauteuil, um das Geschehen bei vollem Komfort und mit seinem breitesten Grinsen zu genießen. Solche Menschen sammelte er – im Gefühl, dass auf der Welt jeden Tag so viel Widersinniges geschah, selten jedoch amüsanter Natur, dass man für jede Ausnahme dankbar sein musste.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Egon Small, Vertreter für Staubsauger und Eisenbahnfahrkarten. Sehr erfreut. Darüber hinaus bin ich schon seit einigen Jahren aus dem Leben geschieden, was nebenbei nicht ausschließt, dass Sie mir eine Zigarette anbieten dürfen.«
»Zigaretten habe ich keine. Wollen Sie vielleicht eine Zigarre?«
»Nein. Lassen Sie Zigaretten bringen. Einem Gast macht man keine Angebote, die nach einem Ultimatum klingen.«
»Werden Sie aber verzeihen, dass ich gewagt habe, mein Schlafzimmer aufzusuchen?«
»Natürlich. Das nehme ich Ihnen ja gar nicht übel. Aber was war denn so dringend, dass Sie mich unbedingt wecken mussten? Wir leben nicht in Zeiten, mein Herr, in denen ein intelligenter Mensch jeden wecken kann, besonders wenn man gerade einem wohlverdienten Nickerchen nachgeht … Schnaps haben Sie natürlich auch keinen, wie?«
»Einen Portwein kann ich Ihnen gern anbieten.«
»Typisch …«, brummte der Unbekannte mit spitz-bitterem Hohn. »Ein Millionär … Ja, typisch!« Er winkte mit der Hand, als ließe er sich nur von seiner resignierten Höflichkeit daran hindern, eine vernichtende Meinung zu äußern, und nahm vom Spiegeltisch einen Zerstäuber mit Kölnischwasser, mit dem er sein jäh verklärtes Gesicht besprengte.
»Ich lasse sofort Schnaps bringen«, rief Mr. Theo begeistert. »Und auch Zigaretten! Sie sind von nun an mein Freund!«
»Hm … Erlauben Sie, dass ich mich in diesem Fall nach Ihren familiären Umständen erkundige?«, entgegnete der mysteriöse Gast und fragte mit der Barschheit eines tadelnden Beamten, der aus dem Grabe steigt, um sich sogleich in ein unübersichtliches, aber nichtsdestoweniger gnadenloses Formblatt zu verwandeln:
»Name Ihres Vaters?«
»Walter Lincoln.«
»Sind sie entfernt mit dem seligen Abraham verwandt?«
»Insofern wir hoffen, eines Tages in seinem Schoße zu ruhen.«
»Ich meinte den großen Präsidenten, der in einer Theaterloge erschossen beziehungsweise niedergestochen wurde.«
»Wir sind unschuldig! Meine Ahnen haben in keinem Theater der Welt jemals einen Präsidenten umgebracht. Dieser Art Vergnügung huldigten sie nicht.«
»Eine hübsche Familie …«, höhnte der Besucher und kostete von einem puddingähnlichen Etwas, spuckte es aber wieder aus, als es sich als Pomade erwies.
»Ich würde gern kalten Aufschnitt essen, aber ich warne Sie: Wenn Sie antworten, Sie hätten nur warmes Schweinekotelett im Haus, dann werde ich Ihnen auf der Stelle und ohne zu zögern eine ausgewachsene Kränkung zufügen.«
»Wieso glauben Sie, es wäre meine Pflicht und Schuldigkeit, Sie zu verwöhnen?«
»Weil ich in der Anzeige las, dass Sie in monetärer Hinsicht ein ziemliches Schwergewicht darstellen. Daran beginne ich übrigens zu zweifeln, da Sie mir bezüglich des Ankaufs von Spirituosen und Tabakwaren ständig Versprechungen machen, nur damit Sie dieselben mit voller Absicht gleich wieder brechen und vergessen.«
Nach diesen zynischen Äußerungen verschwand er bis zur Hüfte im Schrank.
»Würden Sie irgendwo mit mir zu Mittag essen?«, lautete die spontane Einladung Mr. Theos, dessen Laune immer mehr einem Höhenflug glich. »Wann haben Sie gefrühstückt?«
»Es sind keine zwei Tage her«, antwortete der böse Gast.
»Die Hemden finden Sie zwei Schubladen weiter unten …«
»Bücken muss man sich auch noch …«, brummte der seltsame Unbekannte missmutig und wurde zusehends nervöser, während er unter den Hemden des Millionärs kramte, wobei er die Schlafanzüge ohne Umstände auf den Boden warf. »Ich muss schon sagen, Sie haben hier ja lauter geschmackloses Zeug. Wie kann man nur rote Krawatten tragen? Das Einzige, was diese Farbe erträgt, ist ein zweireihiger, moosgrüner Seidenblazer.«
»Haben Sie mich ausschließlich zu dem Behufe aufgesucht, um meine Garderobe herunterzuputzen?«
»Nein, das nicht … Ich habe Ihre etwas völlig bekloppte Anzeige gelesen. Ich dachte mir mal, ich komme allen zuvor, wenn ich mich persönlich präsentiere, statt zu schreiben; außerdem ist es sparsamer, da ich mich selbst nicht frankieren muss. Oder ist das zu weit hergeholt?«
Er nahm einen zur Hose passenden Gürtel, warf die anderen auf den Boden und strich sich das wirre Haar nach hinten.
»Na, kommen Sie endlich?«, drängte Theo ungeduldig.
Als sie im Auto saßen, wurde er wieder zutraulicher:
»Wenn Sie allen Ihren Mitbewerbern zuvorkommen wollten, haben Sie bestimmt eine erstklassige Idee für mich.«
»Natürlich … Keine Frage! Ich mache einen zweiten Stanley aus Ihnen! Na, ist das etwa nichts?!«
»Sie deprimieren mich!«, erwiderte Theo enttäuscht. »Ich habe nicht einmal vom ersten Stanley gehört.«
»Die Abneigung Ihrer Vorfahren gegen die Schauspielkunst hat sich anscheinend so weit vervollkommnet, dass Sie nicht mehr lesen können und daher ungebildet sind wie ein Teddybär aus dem Kaufhaus.«
»Wenn Sie so weitermachen, ist es möglich, dass ich Sie nach dem Essen verprügle«, drohte Mr. Theo, der langsam, aber sicher die Fassung verlor.
»Es wird Ihnen auch nicht auch der Patsche helfen, dass ich Sie dann für einen rabiaten Tölpel halte. Über Stanley nur so viel: Es war seine wunderbare Leistung, Livingstone aufzuspüren, den großen Entdecker und Forscher, der am Kongo verschollen war.«
»Hoppla«, rief Theo. »Warten Sie! Genau, jetzt erinnere ich mich. Wir hatten das in Geografie. Reden Sie weiter.«
»Da bin ich aber froh! Nun, wie die Dinge liegen, Sir, könnten auch Sie die Ehre haben, einen verschollenen Forscher aufzuspüren. Hören Sie gut zu! Vor genau zwei Jahren ging die Nachricht durch die Weltpresse, der berühmte Kartograf der pazifischen Inselwelt, Gustav Bahr, Mitglied der Königlich-Geografischen Gesellschaft, wäre von seiner Fahrt ins schwüle Herz Polynesiens nicht zurückgekehrt. Zuletzt kursierte sein Name auf der Speisekarte eines geschmäcklerischen Menschenfresserstammes, in Verbindung mit irgendeiner sauren Beilage, und seitdem fehlt jede Spur von ihm.«
»Ich denke, ich bin auf der richtigen Fährte, wenn ich aufgrund der Speisekarte vermute …«
»Reden Sie nicht weiter!«, winkte Egon Small ab. »Sie vergessen, man kritzelt in billigen Gaststätten oft vornehme Gerichte auf die Speisekarte, ohne sie je mit Butterbröseln zuzubereiten.«
»Ihrer Meinung nach ist Gustav Bahr also noch am Leben, da er in Wirklichkeit niemals zubereitet und mit Butterbröseln aufgetischt wurde?«
»Es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass er auf Rost gegrillt und mit Gurkensalat serviert wurde, oder gar in Bärlauchpesto gesotten, mit Frühkartoffeln und frischer Petersilie«, antwortete der Tote und lächelte eigenartig verschlafen und milde, während er in die Ferne blickte und schluckte. »Keines dieser Küchenrezepte hätte ihm nämlich erlaubt, am Leben zu bleiben. Und er ist am Leben! Auf der Insel Tsiui. Vor dem Kap Farör, nördlich von Fidschi. Dort können Sie ihn finden, wenn Sie nur wollen.«
»Das interessiert mich«, antwortete Theo lebhaft. »Und Sie sind ganz sicher, dass sich Gustav Bahr auf der Insel Tsiui aufhält?«
»Warum sollte ich sicher sein? Gustav Bahr befindet sich auf gar keiner Insel.«
»Ja, aber wo finde ich ihn dann?«
»Hier, in San Francisco und nirgendwo anders!«
»Was?!«
»Haben Sie sich nie die Frage gestellt, wie viel Mühen sich Stanley erspart hätte, wenn er Livingstone schon bei der Abfahrt bei sich gehabt hätte, im Handgepäck der Karawane sozusagen? Unglaublich töricht und ein Armutszeugnis für die gesamte zivilisierte Menschheit, dass man dieses einfache Verfahren noch nie angewendet hat. Sie werden der Erste sein … Vorsicht, Mann, das da in Ihren Händen ist ein Lenkrad!«
Mr. Theo dachte nach. Wenn Gustav Bahr tatsächlich hier irgendwo lebte, dann war das Patent gefunden, wie man gegen Nachnahme einen Weltruf ans Haus geliefert bekommt.
»Und wo hält sich Gustav Bahr in diesem Augenblick auf?«
»Sie meinen: jetzt? …« Die rätselhafte Leiche überlegte einen Augenblick. »Welchen Tag haben wir heute? Wissen Sie das zufällig?«
»Mittwoch.«
»Dann ist alles in Ordnung. Gustav Bahr sitzt hier neben Ihnen im Auto, ist hungrig und langweilt sich Tode … He! Sie fahren auf dem Bordstein …«
drittes kapitel
»Hören Sie mal zu«, begann Theo gereizt, nachdem sie sich endlich an einem erlesen gedeckten Tisch niedergelassen hatten und auf den Kellner warteten. »Sie sind unter mein Bett gekrochen. Ich sagte nichts. Sie sind frech geworden. Ich schluckte es. Sie haben in meinem Schrank gewühlt. Ich fand mich damit ab. Sie haben an meiner Ehrenhaftigkeit gezweifelt, aber in einer Art und Weise, als wäre das eine große Ehre für mich. Ich erduldete es. In Ordnung! Aber nun mache ich Sie auf Folgendes aufmerksam: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich Ihnen mein Hemd ausziehe, Ihr Frühstück nicht bezahle und Sie wegen Einbruchs zur Polizei schaffe, wenn Sie nicht bereit sind, Ihre unglaubliche und mysteriöse Unverfrorenheit zu erklären: Warum haben Sie gefragt, welchen Tag wir haben, bevor Sie mitteilten, Sie hießen Gustav Bahr? Was hätten Sie geantwortet, wenn heute Freitag wäre oder Dienstag?! Überlegen Sie gut, was Sie antworten, Sir, da ich Sie im Falle einer unzureichenden Begründung mit diesem stumpfen Speisemesser auf Indianerart skalpiere und Ihre Kopfhaut an meinen Gürtel stecke, den Sie um Ihre Hüfte tragen, um mich dann zu entfernen.«
Der Verstorbene nahm diesen Ausbruch jugendlicher Schroffheit unerschüttert hin:
»Ich fürchte nicht um meine Kopfhaut, Sir«, sagte er ruhig. »Wenn ich die glühende Holzkohle der Kannibalen mit stoischem Gleichmut ertragen habe, werde ich auch ohne meine Haartracht auskommen. Doch weil Sie so gastfreundlich gewesen sind, sollen Sie mehr erfahren.«
Er schloss für einen Augenblick die Augen, als wollte er kurz überblicken, was er zu sagen hatte. Dann begann er leise:
»Ich bin Staubsaugervertreter mit dem hintergründigen Decknamen Egon Small. Für meine bescheidenen Aufträge schickt man mir mittwochs mein Wochenhonorar nach Hause, da ich fast jeden Tag unterwegs bin. Ein echter Geograf kann mit dem Reisen nie endgültig aufhören. Alle meine Kollegen fahren mit dem Auto zu ihren Kunden, ich aber nicht, denn ich bin nicht so blöd, dass ich mich auf Ratenzahlungen einließe, und ich darf sagen, die mit dem Staubsauger unternommenen Gewaltmärsche bilden eine faszinierende Quelle erstaunlicher Entdeckungen und überraschender Erlebnisse voller Gefahren und Entbehrungen, und oft begegne ich Wilden, und sogar Zahmen, was seltener vorkommt. Ja, auch Zahme gibt es im grausamen, uralten Stamm der Staubsaugerkunden. Wenn nun die Öffentlichkeit erführe, dass ich Gustav Bahr bin, dann wäre mein heiteres, ruhiges Dasein zu Ende. Was geschieht, wenn wir zu keiner Vereinbarung kommen und ich den Folgen Ihrer eventuellen Indiskretionen entkommen muss? Ich mache ja jetzt schon einen Bogen um meine Firma und meine Wohnung. Wenn wir also Dienstag oder Samstag haben, so ist mein Honorar erst fällig, und ich erwäge genau, ob ich Ihnen meinen Namen mitteilen soll oder nicht. Nachdem wir jedoch Mittwoch haben und das Geld sicher schon unterwegs ist, konnte ich mein Inkognito ohne finanzielles Risiko lüften und kann auch davonlaufen, falls es denn sein muss. Sofern Sie sich jetzt nicht umgehend und umständlich bei mir entschuldigen, sollen Sie natürlich siebenmal verflucht sein.«
»Ich sehe ein, dass Sie recht hatten, Sir«, lenkte Theo zerknirscht ein. »Verzeihen Sie mir bitte und sagen Sie, was Sie denken. Vorher sollten Sie jedoch selbstverständlich Ihr gestriges Frühstück einnehmen.«
»Ganz richtig. Und dann folgt mein heutiges Frühstück.«
Und so geschah es. Er verzehrte besagte Frühstücke, zuerst das ausgebliebene vom Vortag, dann das andere, das an diesem Tag ausgeblieben war, und sogar – für den Hunger, der noch käme – auch noch ein drittes Morgenmahl. Als er damit fertig war, schloss er die Augen, ähnlich den mächtigen Sehern heidnischer Zeiten, die sich an ihre Dämonen wandten, bevor sie in Gegenwart ihrer Hörigen die verrücktesten Prophezeiungen verkündeten … und erzählte:
»Ich trat meine phänomenale Laufbahn mit kleineren Reisen an, und sie glichen eher botanischen Expeditionen denn Forschungsreisen. Mein erster Versuch galt der Entdeckung des Südpols. Nachdem wir diesen ominösen Ort gefunden hatten, kehrte ich heim. An große Forschungsfahrten dachte ich gar nicht, doch dem Schicksal genügt auch eine Straßenbahnteilstrecke, wenn es zuschlagen will. Dies ist eine traurige Tatsache, Sir! Mit meinem kleinen Schiff studierte ich gerade die Flora der Inselwelt, als wir vor Manila von einem Orkan überrascht wurden. So erfüllte sich mein Schicksal … infolge eines Sturms, der die riffgesäumten Ufer des Sündenpfuhls Manila drei Tage lang verwüstete … Ich nahm mir eine Frau! Ja! … Nach der Ankunft musste ich zu meiner furchtbarsten Entdeckungsreise aufbrechen: Im Sturzregen auf einer Rikscha durch das Lasterbabel, um ein Hotelzimmer zu suchen! Lassen wir die dramatischen Details! Ich schildere nicht die erstklassigen Hotels, in denen man mir, als gehörte ich zur wasserbewohnenden Bevölkerung des übervölkerten Japan oder des geschundenen Korea, nur noch das nackte Badezimmer anbieten konnte, wo es dem in seiner Wanne Schlafenden aus einem Duschrohr unaufhörlich auf die Stirn tropfte. Bedenken Sie, Sir, das ist eine der ältesten und grausamsten Foltermethoden. Ich könnte von billigen, weniger überfüllten Hotels erzählen, in die jeder seine Schlafstelle und seine ansteckenden Krankheiten mitbringt – gleich den Nomaden, die in den Steppen Asiens ihr Dasein als umherziehende Selbstversorger fristen. Doch dies ist unwichtig … Lassen Sie uns dort fortfahren, wo ich nachts um ein Uhr bei strömendem Regen erschöpft in einer Rikscha saß, die der Kuli in steilem und hohem Bogen über seinem Kopf im Gleichgewicht hielt, um sich vor dem Regen zu schützen. Und hätte ich wenigstens hoffen dürfen, dass er mich später zum Ausruhen in einen Schirmständer stellt. Doch damals war ich noch jung, leichtfertig und entschlossen wie mein Kollege Columbus, über den Sie vielleicht schon gelesen haben. Er suchte die Passage nach Indien und entdeckte durch einen unverzeihlichen Irrtum Amerika, nachdem sich dieser minderwertige Erdteil zufällig zwischen zwei Kontinenten aufhält. Wo war ich stehengeblieben? Ach ja … Ich musste also diese entsetzliche Monsunnacht irgendwie überleben. Zu einer Bar brachte mich die Rikscha mit eiligem Getrappel. Während meiner wissenschaftlichen Laufbahn verschlug es mich nun zum ersten Mal unter das sogenannte Fünfuhrvolk, das bekanntlich in den Grills haust. Mit ihren rasselnden Armreifen, ihrer üppigen Kriegsbemalung und den qualmenden Zigaretten ließen sie den unerschrockenen Forscher an Ägypten denken, das Heimatland der lackierten Zehennägel und der Sphinx, die schweigend im Sand hockt wie eine weltfremde Nixe auf der Reeperbahn. Noch nie zuvor hatte ich Gelegenheit, die Jeunesse dorée bei ihrem Kriegstanz zu beobachten, einem wilden Taumel, zu dem sie aus unverständlichen Gründen weder eine Lanze noch eine Streitaxt benutzt. Später wollte ich nichts anderes mehr als seinerzeit dieser gewisse Columbus: Ich suchte eine Passage vom Parkett zur Garderobe. Da aber versperrte mir plötzlich eine Frau den Durchgang, gerade so wie einstmals Amerika meinem unglücklichen Kollegen! Ich wurde von meiner Frau entdeckt! Damals war sie mir noch unbekannt und geheimnisvoll wie einst Australien in seinem Vorleben als Terra incognita, bevor es von Kapitän Cook entdeckt wurde, wie Sie sicher wissen.«
»Ich weiß es nicht, aber wenn Sie behaupten, dass dieser Polizeioffizier Ihre Gnädigste entlarvt hat, dann ist es sicher so.«
»Ich meinte Australien, mein Herr! Da stand also dieses Mädchen vor mir, schlank wie Feuerland, geheimnisvoll wie die iranische Hochebene und so kokett, dass wohl kein geografischer Begriff ausreicht, um es zu beschreiben.«
»Ich bestehe ja gar nicht darauf, dass Sie mir mit malerischen Reisebeschreibungen nahebringen, wie verführerisch Ihre Gnädigste war …«
»Ich tue es auch nicht. Nach Ansicht alter Alkoholiker vertragen nicht einmal die widerstandsfähigsten Geografen mehr als eine Flasche Champagner. Ausgenommen vielleicht Marco Polo, der bis zu einem gewissen Grad Hochstapler war, oder Cecil Rhodes, der heute eher als Diplomat gilt denn als diamantenbesessener Plünderer. Es ist also verständlich, wenn mein sanftes Lebensschiff auf unsicheren Wellen diesem Seidenriff nahte, hinter dem das Schicksal auf mich lauerte. Denn diese Frau war wie Afrika! Malerisch üppig, geheimnisvoll, exotisch, heiß … und sie konnte küssen, sag ich Ihnen! …«
»Verzeihen Sie, Sir, dass ich Sie unterbreche, aber von Geografie verstehe ich nichts: Inwiefern kann Afrika küssen?«
»Ihre niederen Späße sind viel zu trivial, als dass Sie mich verletzen könnten. Ich fahre also gelassen fort, und Sie hören gefälligst zu. Ich lernte an diesem Abend das Korallenriff meiner Laufbahn kennen. Stellen Sie sich so ein haifischumwittertes Riff vor, im schulterfreien Abendkleid, mit wunderbaren, blauen Augen, und sie war …«
»Ich weiß«, unterbrach ihn Theo, »sie war wie Feuerland, küsste wild wie Afrika, war wiegend wie das Hochland des Iran und umarmte Sie wie die Äußere Mongolei. Fahren Sie fort! Nur zu!«
»Ihre vulgäre Grobheit, Sir, beleidigt mich auch jetzt nicht. Wir kamen ins Gespräch, näher und immer näher, und ich trank eine weitere Flasche Champagner, was selbst einem Pizarro oder Cortez geschadet hätte, obgleich diese Herren in erster Linie Konquistadoren waren. Ist es wahr oder nicht? … Obwohl es wissenschaftlich nicht mehr nachzuweisen ist, behaupteten mehrere Zeitgenossen, ich hätte bei Tagesanbruch mit begeistertem Gewieher und heiterem Trab die Rikscha meiner Frau zum Hotel gezogen. Ich verstehe bis heute nicht, dass ein alter Kolonist trotzdem zufrieden aus der Tippelsänfte stieg und mir obendrein ein kleines Bakschisch überreichte. Der Monsun wütete noch zwei Tage und ich acht Jahre, nachdem ich binnen vierundzwanzig Stunden dieses hinreißende Mädchen geheiratet hatte. Ich täusche mich wohl nicht, wenn ich zu hoffen wage, ich konnte Ihnen verständlich machen, wie ein Korallenriff beschaffen ist. Obwohl ich darauf vertraue, Sie wussten dies bereits aus dem Geografieunterricht Ihrer sündteuren Schule, auf die Sie Ihr Herr Papa zweifellos geschickt haben wird.«
»Mein Vater ist ein unkorrigierbarer Demokrat der alten Schule«, wehrte Theo ab, »und hat deshalb eine ganz normale Anstalt für mich ausgesucht. Und was die Riffe betrifft, so wusste ich bis jetzt lediglich von Hindernissen unterhalb der Wasseroberfläche.«
»Egal. Wenn Sie so wollen, gelangte ich in die Mitte eines Korallenrings, oder aber, wenn Sie es vorziehen, an den Rand des Hindernisses: Hauptsache ist, dass es ein Riff war, ein geheimnisvolles Urgebilde unter dem Wasser … Nein, wie es küssen konnte!«
»Betonen Sie es nicht! Ich habe mir gemerkt, dass ein verwittertes Urgebilde küssen kann wie Afrika, reizend ist wie das schulterfreie Feuerland, und dass die Gnädigste geradeso kokettiert wie ein mongolischer Haifisch. Nun möchte ich aber den Kern all dieser Lobeshymnen kennen. Sie fassen sich nicht knapp genug, Sir.«
»Ich antworte Ihnen so kurz wie bündig, klar und einfach und ohne jede Umschweife: Die Laufbahn eines Geografen gewinnt im Allgemeinen einen gewaltigen Aufschwung, wenn er sich verheiratet. Jetzt ist die Zeit seiner langen, mehrjährigen Reisen von umwälzender Tragweite, und kein Urwald kann tief, dunkel, fern und gefährlich genug sein. Was meine Ehe betrifft, so war sie in dieser Hinsicht ideal. Meine Frau spielt nämlich leidenschaftlich Mundharmonika. Verehrter Herr! Ich habe den pirschenden Berberlöwen brüllen gehört und war in Bombay zugegen, als ein tollwütiger Elefant seinen letzten, waldhornartigen Seufzer tat. Diese Klänge gehören zu meinen liebsten Erinnerungen, wenn ich an das Mundharmonikaspiel meines Weibes denke. Dieses zart-kindliche Musikinstrument, das viel besser in die Hände eines zehnjährigen Knaben als in die Pranken einer Amazone passt, besiegelte meinen Entschluss, den Dschungel von Manaus zu erforschen, und es ist unerklärlich, dass es dort noch weiße Flecken gibt. Einmal bin ich wegen dieser musikalischen Ergüsse zum Rudolfsee in Zentralafrika aufgebrochen, ein anderes Mal schloss ich mich in meinem Badezimmer ein und ließ die Wasserhähne laufen … Endlich, auf der Insel Tsiui, spürte ich, als ich drauf und dran war heimzukehren: Genug! Das Maß war voll! Warum sollte ich von den Kannibalen heimkehren? Ich konnte dort meinen Frieden und meine Ruhe haben. So geschah es auch. Ich schlief gut und lebte herrlich. Und ich nahm zu. Das war mein Verderben. Die Kannibalen lächelten mir immer öfter mit schamhaften Blicken zu. Sie brachten mir Geschenke und Leckerbissen. Konnte ich ahnen, dass sie mich für die Feiertage mästeten und an ihre Verwandten auf dem Land Einladungen verschickten, in denen ich gaumenfreundlich und speicheltriefend erwähnt wurde? Eines Vormittags kam der Häuptling in peinlichster Verlegenheit zu mir, um sich händeringend zu entschuldigen und mitzuteilen, man würde mich für den Abend zubereiten. Was wohl mein letzter Wunsch wäre? Möchte ich gespickt oder in Kokusbeize auf den Tisch? Oder vielleicht am Spieß, denn, wie sie sagten, ihr Stamm wäre bekannt für seine Sanftmut, liebten sie doch die Geografen insgeheim am liebsten gespickt, und nur aus Entgegenkommen boten sie mir die Wahl an. Doch sie verzehrten mich trotzdem nicht …«
»Was Sie nicht sagen!«
»Es fehlte nicht viel, das dürfen Sie mir glauben. Zum Glück jedoch ankerte nachmittags ein Schiff vor der Insel, die Matrosen kamen an Land, und der Gedanke, für eine kalte Platte zu Würsten verarbeitet zu werden, widerstrebte ihnen. Können Sie mir folgen? Schon gut … Das führte zu einem peinlichen Wortwechsel, sodann zu einem burschikosen Handgemenge, und es gelang mir, zusammen mit den Wurstkandidaten zu entfliehen, wobei ich es nicht versäumte, von einer älteren Speisekarte den Namen des amerikanischen Hausierers Egon Small mitzunehmen. Ich teilte dann der Öffentlichkeit mit, Gustav Bahr wäre bei den Kannibalen ins Jenseits konsumiert worden. Das ist bereits Geschichte. Jetzt liegt es an Ihnen, Sir, die Expedition mit entsprechendem Werbeaufwand vorzubereiten, um mich dann aufzuspüren und zurückzubringen.«
»Wenn es so ist, wie Sie sagen, warum gehen Sie wieder weg? Gefällt es Ihnen denn nicht in San Francisco?«
Traurig nickte der andere:
»O doch … Es ist eine wunderbare Stadt … Aber diese Frau lässt mich nicht in Frieden.«
»Wollen Sie mir weismachen, dass Sie hören können, wie Ihre Gnädigste in London auf der Mundharmonika spielt?«
»Wissen Sie, was das Wort ›Spuk‹ bedeutet?«
»Sicher. Wenn Geografen mit einer angegriffenen Psyche nicht ihre eigene Todesnachricht in die Welt setzen, sondern brav zu ihrer Familie heimkehren.«
»Ich will nicht mit Ihnen streiten. Jedenfalls wurde meine Frau Spiritistin, nachdem sie von meinem Ableben erfahren hatte, und zitiert mich seitdem zu jedem Teufelstisch. Ich weiß nicht, ob die Totenbeschwörung einen wahren Kern hat, aber eines ist sicher: Ich träume jede Nacht, dass ich zu Hause in meiner Wohnung aufwache und bei meiner Frau bin. Und wir spielen Mundharmonika! Sie hat es mir im Schlaf beigebracht! Da ist es doch besser, wenn ich heimkehre, in meiner Wohnung schlafe und träume, dass ich in San Francisco aufwache, denn hier fühle ich mich wohl. Leider ist es so, mein Herr, dass ein Hausdrache, der einen bemitleidenswerten Ehemann quälen will, selbst den Tod besiegt. Dies ist die Lehre, die ich aus der Geschichte ziehe. Man soll mich finden, wie es sich gehört, auch wenn es Irrungen, Wirrungen und Kämpfe kostet.«
»Und wie gehört es sich, Sie zu finden?«
»Das ist nicht einfach. Sie müssen alles genau nachweisen können. Mit unwiderlegbaren, wissenschaftlichen Tatsachen. Wenn Sie mich nicht gefunden haben, wie es sich gehört, dann werden Sie nur ausgelacht und bloßgestellt. In dieser Hinsicht bedeute ich keine Vergünstigung, auch wenn ich mich auf Ihrem Schiff verborgen halte.«
»Wie stellen Sie sich die Suche vor?«
»Ich ziehe zu Ihnen und verstecke mich. Dann folgt die Pressekampagne: Was ist aus Gustav Bahr geworden? Endlich kommen Sie und organisieren eine Expedition. Los geht’s! Sorgfältige Ausführung. Sie führen Messungen durch, vergleichen die Resultate, befragen die Eingeborenen, dringen ins Inselinnere von Tsiui vor und finden mich – siehe da! – mitten in der Wildnis. Es wäre gut, wenn Sie den großen Augenblick in Stanleys Leben mit mir einüben würden. Er wurde zum Beispiel der Hochstapelei bezichtigt, dabei war es wunderbar, was er vollbracht hatte. Wir müssen mit Händen vorgehen, die sauberer sind, nachdem es sich hier tatsächlich um Hochstapelei handelt.«
»Und wie hat sich dieser Augenblick abgespielt?«
»Als Stanley Livingstone erblickte, sagte er: ›Mr. Livingstone, vermute ich!‹ In meinem Fall müssen Sie natürlich ›Mr. Gustav Bahr, vermute ich!‹ sagen. Ich reiche Ihnen die Hand und antworte mit matter Stimme: ›Yes …‹ Darauf sagen Sie mit Stanley: ›Ich danke Gott, dass ich Sie gefunden habe …‹«
»Das wird sehr schön sein«, seufzte Mr. Theo. »Wir werden jemanden brauchen, der es mir zuflüstert.«
»Es ist die Mühe wert! Das Jubeln der Eingeborenen und Ihrer Begleiter wird den klanglichen Hintergrund liefern, während wir aufs Schiff gehen, und Sie werden den völlig verwilderten Entdecker endlich seiner Frau wiedergeben.«
»Sie sehen aber nicht gerade verwildert aus.«
»Jetzt nicht. Aber Sie werden schon sehen, wenn Sie mich zu meiner Frau zurückbringen!«
Und tatsächlich sah er schon beim bloßen Gedanken ganz wirr und verwildert aus.
viertes kapitel