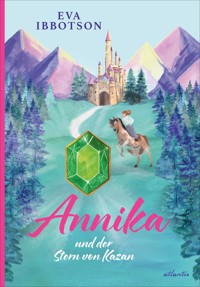19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer an der University of Cambridge aufwachsen darf, kann sich wahrlich glücklich schätzen, sollte man meinen. Harriet Morton sieht das anders. Ihr Vater, Professor für klassische Philologie, ist ernst, streng und prinzipientreu, ihre Tante eine hagere alte Jungfer, die ihrem Bruder den Haushalt führt und das Mädchen für töricht und nutzlos hält. Harriet will dem trostlosen Leben in dem kalten grauen Haus entkommen. Denn wenn nicht bald ein Wunder geschieht, muss sie Edward heiraten, der am selben College lehrt wie ihr Vater. Vollkommen glücklich ist die lebenshungrige Neunzehnjährige nur, wenn sie tanzt. Ungehörig für ein Mädchen ihres Stands im Jahr 1912. Als ein gewisser Monsieur Dubrow auf der Suche nach jungen Ballerinen für eine Südamerika-Tournee in Harriets Klasse kommt, ergreift sie die Chance und stiehlt sich davon. Inmitten des Regenwaldes, am legendären Opernhaus von Manaus, wird sie zum umjubelten Star und tanzt den Schwanensee vor heimwehkranken Europäern und kulturhungrigen Brasilianern. Und hier lernt Harriet Rom Verney kennen, den gut aussehenden und geheimnisvollen britischen Exilanten und Besitzer des Opernhauses. Die junge Ballerina ahnt nicht, dass ihr Vater und der Mann, dem sie versprochen wurde, sie bereits aufgespürt haben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eva Ibbotson
Ein Tanz für mich allein
Roman
Aus dem Englischen von Michaela Link
Kampa
1
Einen schöneren Ausblick als von dieser Brücke gabes in ganz England nicht, das wusste Harriet. Zu ihrer Rechten ragten die Türme der Kapelle des King’s College empor, und makellose Rasenflächen erstreckten sich bis hinunter zum Flussufer; zu ihrer Linken leuchteten Blausterne und goldene Narzissen in prachtvoller Fülle zwischen den Bäumen des Campusgartens. Dennoch war ihr Gesicht nachdenklich, als sie sich über die steinerne Brüstung beugte, und ihre Füße nahmen – ein eher ungewöhnliches Benehmen für die Tochter eines Professors für klassische Philologie im Jahr 1912 – die fünfte Position ein.
Sie war ein mageres Mädchen mit braunen Haaren und braunen Augen und einem ernsten, sanftmütigen Charakter, der ihren wachen Geist und ihren ausgeprägten Lebenshunger jedoch nicht immer verbergen konnte. Mit ihrer dunkelblauen Pelerine, der Schottenmütze – zweckmäßiger Kleidung, die vor allem haltbar sein sollte – und ihrer Notenmappe, die sie im Augenblick neben sich an die Mauer gelehnt hatte, war sie für die anderen Passanten ein vertrauter Anblick: Professor Mortons kluge Tochter, Miss Mortons folgsame Nichte.
Wer in Cambridge aufwuchs, konnte sich wahrhaft glücklich schätzen. Harriet, die gerade Brot ins Wasser krümelte, um die blasiertesten Enten der Welt zu füttern, hatte sich das wieder und wieder vor Augen gehalten. Aber nicht die Städte bestimmen das Schicksal achtzehnjähriger Mädchen, sondern die Menschen – und während sie so auf den trägen, schlammigen Fluss hinunterschaute und an ihre Zukunft und ihr Zuhause dachte, stand in ihren Augen ein trostloser und verzagter Ausdruck.
Professor Morton hatte bereits die vierzig überschritten, als er anlässlich einer Vortragsreise in der Schweiz eine junge Engländerin kennenlernte, die als Gouvernante im Haushalt eines Schweizer Industriellen arbeitete.
Sophie Brent war ein hinreißendes Geschöpf mit großen braunen Augen, weichem Goldhaar und einem betörenden Kichern. Sie war eine Waise, so arm und schutzlos, wie nur eine Gouvernante es sein kann, und zutiefst beeindruckt von den Aufmerksamkeiten des ernsthaften, gestrengen Professors mit den festen Überzeugungen und der kultivierten Stimme.
Sie heirateten und kehrten in das hohe graue Haus in Cambridge zurück, wo Louisa, die ältere Schwester des Professors – eine hagere alte Jungfer mit stahlgrauem Haar –, ihrem Bruder den Haushalt führte. Nach außen hin fügsam, doch innerlich verdrossen hieß sie das törichte, nutzlose Mädchen, das ihren Bruder eingefangen hatte, willkommen.
In der Scroope Terrace Nr. 37 galt das Motto: »Spare in der Zeit, so hast du in der Not.« Louisa Morton zählte donnerstags die Fischmesser nach und samstags das Tafelsilber, und in ihrem Schlafzimmer bewahrte sie eine Schachtel mit der Aufschrift Bindfäden, zum Verschnüren zu kurz auf. Obwohl der Professor neben seinem Gehalt über ein beträchtliches privates Einkommen verfügte, hatte man gehört, wie seine Schwester der Köchin wegen der zügellosen Verschwendung von drei Viertelpennys für ein Büschelchen Petersilie die Leviten las. Einladungen bei den Mortons gehörten zu den gefürchtetsten Ereignissen im Universitätskalender.
In dieser kalten, düsteren Umgebung verlor die hübsche junge Sophie schon bald allen Mut und alle Lebensfreude, und auch die Leidenschaft des Professors für seine Frau schwand schnell dahin. Es war unübersehbar, dass sie ihm bei seiner Karriere nicht von Nutzen sein würde. Obwohl Louisa und er selbst sie mit Belehrungen überhäuften, schien sie außerstande zu sein, auch nur die elementarsten Regeln des akademischen Protokolls zu erlernen. Als er in seinem College bei der Neubesetzung des Rektorenstuhls übergangen wurde, gab er Sophie die Schuld daran, und Louisa, die die Zügel im Haus nie wirklich aus der Hand gegeben hatte, zog diese jetzt um so fester an.
In dieses Haus wurde Harriet geboren, die während ihrer ersten beiden Lebensjahre ein glückliches, sonniges Baby war. Dann zog sich Sophie Morton, deren ganze Liebe dem Kind gegolten hatte, eine Erkältung zu, die sich in eine Lungenentzündung verwandelte, und starb. Zwei Wochen später entließ Louisa das Bauernmädchen, das sich bislang um Harriet gekümmert hatte.
Innerhalb weniger Monate wurde aus dem pummeligen, rosigen Baby ein in sich gekehrtes, mageres und beinahe stummes kleines Mädchen. Allzu früh brachte Harriet sich selbst das Lesen bei und verschwand für lange Stunden mit einem Buch auf dem Dachboden. Wenn sie überhaupt etwas sagte, galt es ihrem unsichtbaren Spielgefährten – einem Zwillingsbruder, wieselflink und stark – oder den kleinen Geschöpfen, mit denen sie sich in diesem lieblosen Haus angefreundet hatte: den Spatzen, die sich auf ihrem Fenstersims niederließen; einem Eichhörnchen, das sie auf dem glatt geharkten kleinen Kiesplatz, dem Garten der Mortons, vom Baum gelockt hatte.
Dennoch wäre es falsch zu behaupten, dass Harriet vernachlässigt wurde. Wenn es Louisa auch unmöglich war, dieses Kind zu lieben, so war sie doch fest entschlossen, ihre Pflicht zu tun. Harriet erhielt Musikstunden und – auf Empfehlung des Arztes der Familie, den ihre Blässe und Magerkeit beunruhigten – sogar Ballettunterricht. Sie bekam regelmäßig frische Luft und Bewegung und wurde mit jeder bärbeißigen ältlichen Dienstmagd, die Louisas Regime ertrug, auf lange Spaziergänge geschickt. Obwohl ihr Vater im Laufe der Jahre immer barscher und selbstgerechter wurde, war er doch in der Lage, ihren scharfen Verstand zu bemerken, und so brachte er ihr persönlich Latein und Griechisch bei.
Zu gegebener Zeit schickte man sie dann auf eine exzellente Mädchenschule, welche die Damen des Teekränzchens, die Louisa Mortons Leben beherrschten, überaus empfehlenswert fanden.
Kein Kind liebte die Schule je so sehr wie Harriet. Alles dort gefiel ihr, weil sie es mit anderen teilen konnte, weil es eine Welt voller Wärme und Freundlichkeit war.
Dann kam eine neue Direktorin, die in dem verwundbaren, dunkeläugigen Kind eine potenzielle Gelehrte witterte und es persönlich in Englisch und Geschichte unterwies: Unterrichtsstunden, an die Harriet sich bis an ihr Lebensende erinnern würde. Nach zwei Trimestern bat die Direktorin Professor Morton zu sich, um Harriets Universitätslaufbahn mit ihm zu besprechen. Am Ende dieser Unterhaltung kochten beide Parteien vor Zorn. Für den Professor war vollkommen unverständlich, wie jemand auch nur eine Woche in Cambridge leben konnte, ohne seine Ansichten über »Frauen an der Universität« zu kennen. Und da er sich außerstande sah, seine Tochter weiter dieser emporgekommenen Suffragette anzuvertrauen, nahm er Harriet von der Schule.
Das war nun ein Jahr her, und Harriet konnte noch immer nicht an dem vertrauten roten Backsteinbau vorbeigehen, ohne einen Kloß in der Kehle zu spüren.
Jetzt warf sie ihre letzte Brotkruste ins Wasser, die nur knapp den Kopf des Propstes von St. Anne verfehlte. Dieser war plötzlich mit seiner blonden Frau und seinen hübschen Töchtern in einem Kahn, den er flussabwärts stakte, unter der Brücke aufgetaucht. Wenn die Brotkrume ihn getroffen hätte, wäre das ein besonderes Desaster gewesen, denn der Propst war der wissenschaftliche Widersacher ihres Vaters, und mit der Frau des Propstes stand es sogar noch schlimmer: Man hatte sie vor dem Haus von Freunden gesehen, wo sie in einer wartenden Kutsche schamlos in die Lektüre eines Buches vertieft war, das von einem Schmutzfinken namens Sigmund Freud stammte.
»Armes Kind!«, sagte der Propst, als sie außer Hörweite waren.
»Ja, wahrhaftig«, pflichtete seine Frau ihm grimmig bei, nachdem sie noch einen Blick auf die verlorene kleine Gestalt auf der Brücke geworfen hatte. »Ich werde nie begreifen, wie ein so bezauberndes, empfindsames Kind in diesen Haushalt bigotter Pedanten hineingeboren werden konnte. Es war ein Verbrechen, sie von der Schule zu nehmen. Wahrscheinlich finden sie dieses Leben jetzt passender für die Kleine – Blumen arrangieren in einem Haus, in dem es keine Blumen gibt, und den Hund ausführen, obwohl sie gar keinen Hund haben.«
»Man munkelt, es gebe da einen jungen Mann«, murmelte der Propst.
Und der Propst hatte recht: Es gab einen jungen Mann. Sein Name war Edward Finch-Dutton, er war Fellow am selben College wie der Professor, St. Philip, und obwohl sein Fach die Zoologie war – eine neue, mit Skepsis betrachtete Disziplin –, hatten die Mortons ihm gestattet, ihr Haus zu besuchen. Denn die Entscheidung, Harriet zu Hause zu halten, hatte zu einer gewissen »Missstimmung« geführt. Selbst der Rektor des Trinity College, der bei den Mortons gleich nach Gott kam, hatte den Professor nach der Sonntagspredigt beiseitegenommen, um seiner Verwunderung Ausdruck zu verleihen.
»Schließlich haben Sie selbst sie zu einer richtigen kleinen Gelehrten gemacht«, sagte er.
»Wenn ich Harriet in den klassischen Sprachen unterwiesen habe, so geschah dies, damit sie sich mir zu Hause nützlich machen konnte, und nicht, damit sie sich zu einer unweiblichen Range und einer Schande ihres Geschlechts entwickelte«, hatte der Professor erwidert.
Aber ein Stachel war geblieben, und als dann Mrs Belper, Louisas Busenfreundin, eines Tages bemerkte, die beste Lösung für Harriet läge vielleicht in einer frühen Heirat, hatten die Mortons Edward Finch-Dutton auserwählt.
Eben diesen hervorragenden jungen Mann mit seinem langen, ernsten Gesicht sah Harriet jetzt, als sie ins Wasser hinunterblickte, vor sich, und wie immer erfüllte sein Bild sie mit Furcht.
»Bitte, lieber Gott, mach, dass ich nicht nachgebe«, betete sie mit in den Nacken gelegtem Kopf. »Lass mich Edward nicht heiraten, nur um von zu Hause wegzukommen. Bitte, hilf mir, lieber Gott! Bitte, zeig mir einen anderen Weg.«
Eine Kirchuhr schlug vier, und dann noch eine … und plötzlich lächelte sie. Das ernste kleine Gesicht war wie verwandelt, als sie nach ihrer Mappe griff. Wunderbarerweise hatten ihre Tanzlektionen überlebt; diese überaus kostbaren Stunden waren ihr geblieben.
Zehn Minuten später betrat sie das große, schäbige Gebäude in der St. Williams Street, das die Sonja-Lavarre-Tanzakademie beherbergte.
Sofort tauchte sie in eine andere Welt ein. Sie hätte in St. Petersburg in der kaiserlichen Ballettschule sein können, wo Madame Lavarre – damals noch Sonja Zugorski – acht Jahre ihrer Kindheit verbracht hatte.
An den holzvertäfelten Wänden, im Treppenhaus, überall hingen Gemälde und Fotos von weltberühmten Tänzern. Denn es waren nicht die vornehmen Tänze der Ballsäle, die Madame – nach einer kurzen Ehe mit einem früh verstorbenen französischen Professor in Cambridge gestrandet – lehrte, sondern die mühsame und von eiserner Disziplin geprägte Kunst des Balletts.
Außer Harriet gab es nur noch drei weitere Schülerinnen in der Fortgeschrittenenklasse, und heute war Harriet die Letzte, die den Umkleideraum in der oberen Etage betrat. Zuerst waren die anderen Mädchen reserviert und unfreundlich gewesen, da sie Harriet wegen ihres snobistischen Hintergrunds – ihr Vater war Professor – unannehmbar fanden. Die hübsche Phyllis mit ihren blonden Locken war die Tochter eines Krämers; sie nahm neben ihren Ballettstunden auch Schauspielunterricht und hatte bereits in Pantomimen getanzt. Mabel, gewissenhaft, fleißig und doch unabänderlich fett, war die Tochter eines Eisenbahnangestellten. Die Mutter der rothaarigen Lily arbeitete im Schwarzen Eber. Harriet mit ihrem »piekfeinen« Akzent waren sie anfangs mit Spott und Hohn begegnet.
Aber jetzt, als einzige Überlebende einer neunjährigen Ausbildung unter der Knute von Madame, waren alle vier gute Freundinnen.
»Sie hat jemanden bei sich«, sagte Phyllis, während sie sich die Schuhe zuband. »Einen Ausländer. Russe, glaub ich. Komischer Vogel!«
Harriet zog sich hastig um. Dann traten die Mädchen in den Übungssaal, knicksten vor Madame, die wie stets sehr beeindruckend war in ihrem schwarzen Plisseekleid und dem Chiffonschal, den sie sich um ihr orange gefärbtes Haar geschlungen hatte, und nahmen ihre Plätze an der Barre ein.
»Das ist Monsieur Dubrow«, verkündete Madame. »Er wird sich den Unterricht ansehen.«
Sie gab mit ihrem gefürchteten Rohrstock der eingeschüchterten Pianistin einen Stoß, und sogleich erklangen die ersten Töne eines Satzes von Delibes. Die Mädchen strafften sich, hoben die Köpfe …
»Demi-plié … Grand plié … tendu devant … hoch mit euch … dégagé … demi-plié in der vierten … Schlussstellung.«
Die unbarmherzige, monotone Arbeit begann, und Harriet, die alles vergaß außer der Notwendigkeit, ihre Füße perfekt zu setzen und ihren Rücken bis an seine Grenzen zu dehnen, merkte nicht einmal, dass sie, während sie tanzte, ausnahmsweise vollkommen glücklich war.
Neben der zierlichen und ehrfurchtgebietenden Gestalt von Madame stand Dubrow, dessen wilder grauer Lockenkranz eine unübersehbare, rosa schimmernde Glatze umringte. Mit wachsamen Augen verfolgte er das Geschehen; schon nach drei Minuten hatte er gesehen, was er sehen wollte.
»Ihr arbeitet jetzt allein weiter«, befahl Madame nach einer Weile und führte ihren alten Freund nach unten. Kurz darauf hatten sie es sich in ihrem überladenen Wohnzimmer bequem gemacht und rührten Himbeermarmelade in ihre Teetassen.
»Ja, du hattest ganz recht«, sagte Dubrow. »Es ist die kleine Dunkelhaarige, die ich haben will. Eine intelligente Tänzerin, und Gott weiß, wie selten man jemanden findet, der seinen Körper auf intelligente Weise einzusetzen versteht.« Aber es war mehr als das, überlegte er. Jede einzelne Note der Musik schien sich buchstäblich auf dem verzückten und so ausdrucksvollen Gesicht des Mädchens widergespiegelt zu haben. »Ihre Technik ist natürlich immer noch –«
»Ich habe dir doch gesagt, du kannst sie nicht haben«, unterbrach ihn Madame. »Also verschwende nicht meine Zeit. Ihr Vater ist Professor für Altphilologie; ihre Tante rümpft die Nase, wenn sie herkommt, als stänke das Haus zum Himmel. Harriet durfte nicht einmal an einer Wohltätigkeitsvorstellung für die Polizeiwaisen teilnehmen.« Sie schob eine Balkan-Sobranie in einen schwarzen Zigarettenhalter und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Das Kind war so enttäuscht, dass ich meinen Stolz heruntergeschluckt und ihre Tante besucht habe, um ein gutes Wort für sie einzulegen. Mon Dieu, dieses Haus – es war wie ein Grab! Es hat eine ganze Stunde gedauert, bis sie mir schließlich ein Glas Wasser und ein Biskuit anbot. Nein, meine arme Harriet musst du dir ein für alle Mal aus dem Kopf schlagen.«
»Aber das Reisen gehört doch heutzutage bestimmt zur Erziehung eines jeden jungen Mädchens?«, murmelte Dubrow.
»Diese Leute scheinen sich nicht übermäßig um Harriets Erziehung zu sorgen«, bemerkte Madame trocken. »Sie soll einen jungen Mann heiraten, der tote Tiere zerschneidet, heißt es. Aber ich muss sagen, ich selbst würde auch zögern, meine Tochter, wenn ich eine hätte, mit deinem verrufenen Corps de ballet den Amazonas hinaufziehen zu lassen und sie den Wutanfällen der Simonowa auszusetzen. Was willst du, Sascha, die Idee ist verrückt!«
»Nein, das ist sie nicht.« Die blauen Augen nahmen einen verträumten Ausdruck an. Er strich sich mit seiner dicklichen, aber wunderbar manikürten Hand über die Stirn und seufzte. Geboren als Kind reicher Grundbesitzer, die über zweitausend Seelen irgendwo an der Oberwolga herrschten, hätte Dubrow durchaus das zufriedene Leben seiner Ahnen führen können. Stattdessen besuchte er im Alter von fünfzehn Jahren seine Großmutter in St. Petersburg, und als sich dort im Marijnski-Theater die saphirfarbenen Vorhänge zur Premiere von Tschaikowskys Dornröschen öffneten, war sein Schicksal besiegelt. Während der letzten zwanzig Jahre hatte Dubrow – zuerst in seiner Heimat, später in ganz Europa – der Kunst gedient, die er so sehr bewunderte.
Dass dieser romantische kleine Mann sich für einen der legendärsten Namen auf dem Globus begeisterte, war unvermeidlich. Tausend Meilen von der Mündung des Amazonas stromaufwärts, inmitten des undurchdringlichen Regenwaldes, hatte der Reichtum der »Gummibarone« eine Stadt aus dem Boden gestampft, von der man nur träumen konnte. Eine Stadt mit weitläufigen Plätzen und Rokokovillen, imposanten Springbrunnen und mosaikbelegten Gehsteigen … eine Stadt mit elektrischem Licht, Straßenbahnen und Kaufhäusern, deren Kleider es mit denen von Paris und New York durchaus aufnehmen konnten. Und die Krönung dieser Stadt, die man Manaus nannte, war ihr Opernhaus: das Teatro Amazonas, angeblich das luxuriöseste und schönste Theater der Welt.
In dieses Theater wollte Dubrow mit seiner Balletttruppe und deren Leiterin, einer erfahrenen Ballerina, die zu lieben er das Missgeschick hatte. Deshalb hatte er sich auch an seine alte Freundin Sonja Lavarre gewandt: Er war auf der Suche nach jungen Tänzerinnen für das Corps de ballet.
»Manaus«, murmelte Madame. »Caruso hat da gesungen, nicht wahr?«
»Ja. Und Sarah Bernhardt hat ebenfalls dort auf der Bühne gestanden … Was könnte also passender sein als ein Auftritt der Balletttruppe Dubrow!«
»Hmm. Die Bezahlung muss sehr gut sein, wenn die Simonowa zugestimmt hat.« Aber ihr Gesicht strafte ihre Worte Lügen. Sie hatte in Russland mit der Simonowa gearbeitet und kannte sie als unvergleichliche Künstlerin.
Er zuckte mit den Schultern. »In diesen paar hundert Meilen am Amazonas gibt es mehr Geld als in ganz Europa zusammengenommen. Die Gummibäume haben jeden, dem es gelungen ist, da unten ein Stück Land zu kaufen, ungeheuer reich gemacht: Spanier, Portugiesen, Franzosen, Deutsche. Auch Engländer. Es heißt, der reichste Mann von allen da drüben sei ein Engländer.«
»Warum kommst du dann zu mir, um dir deine Tänzerinnen zu suchen? Warum stehen nicht alle jungen Mädchen Schlange, um mit dir zu fahren?«
Dubrow seufzte in seine Teetasse. »Die besten Tänzerinnen sind alle bei Diaghilew. Den Rest hat die Pawlowa.« Er sah sie unter seinen Nikolausaugenbrauen von der Seite an. »Und einigen gefällt natürlich der Gedanke an die Insekten nicht und an die Krankheiten und so weiter«, gab er zu. Dann kehrte er mit einer wegwerfenden Handbewegung zu seinem eigentlichen Thema zurück. »Ich könnte wohl die Blonde mit den Locken nehmen, aber solche Mädchen bekomme ich auch von einer Agentur. Es ist die kleine Brünette, die ich haben will. Lass mich selbst mit ihr sprechen; vielleicht kann ich sie umstimmen.«
»Wie stur du doch bist, mein armer Sascha! Aber es wäre sicher für alle Mädchen interessant, von deinen Plänen zu erfahren. Ich werde den Unterricht etwas früher beenden, dann kann Harriet zusammen mit den anderen hören, was du zu sagen hast. Es ist immer sehr aufschlussreich, Harriet beim Zuhören zu beobachten.«
Also machte die Fortgeschrittenenklasse früher Schluss als gewöhnlich, und die Mädchen kamen herunter. Phyllis hatte ihr Haarband abgenommen, damit ihre Locken ihr Gesicht umspielten, aber Harriet kam, wie sie war, und als sie sich auf einen Hocker sinken ließ, nickte Dubrow, denn sie hatte jene Gabe, die kein Lehrer lehren konnte und die doch nur jahrelanges Lernen mit sich brachte: diese harmonischen Bewegungen der Glieder und des Kopfes, die man »Linie« nennt. Und eigensinnigerweise, unvernünftigerweise – denn sie würde nur eines von zwanzig oder mehr Mädchen sein – wollte er sie haben.
»Wir werden in Liverpool an Bord gehen«, sagte er an alle Mädchen gewandt, obwohl er in Wirklichkeit nur mit einer sprach. »Das Schiff, mit dem wir reisen, ist sehr luxuriös, ein richtiges Hotel, mit dem wir westwärts über den Atlantik dampfen werden. Aber erst in Brasilien, im Hafen von Belem, beginnt unser eigentliches Abenteuer. Denn das Schiff wird in die Mündung des größten Flusses der Welt einlaufen – des Amazonas –, und tausend Meilen weit werden wir diesem Wasserlauf folgen, der so gewaltig ist, dass sie ihn den Rio Mare nennen … den Meeresstrom.«
Er sprach weiter, und während er sprach, schloss Harriet die Augen – und sah …
Sie sah ein weißes Schiff, das schweigend durch ein Labyrinth von Wasserwegen dampfte. Am Bug des Schiffes, das durch diese verzauberte Welt glitt, sah Harriet eine Frau mit rabenschwarzem Haar, versonnen und wunderschön: La Simonowa, das strahlendste Juwel des Marijnski-Theaters, und neben ihr, männlich und stark wie ein Löwe, der premier danseur Maximow … Sie sah, gleich einem Keil fliegender Wildgänse, zu beiden Seiten die weiß gekleideten Tänzerinnen, die der Simonowa als Schneeflocken und Schwäne und Sylphiden dienen würden …
»Wir werden Schwanensee geben, La Fille mal gardée und den Nussknacker«, sagte Dubrow. »Außerdem Giselle …« Er hielt kurz inne, um sich mit der Hand über die Stirn zu fahren, und Harriet sah die heimwehkranken Europäer vor sich, die berühmten »Gummibarone«, die in ihren Opernumhängen aus ihren Palästen am Fluss kamen, begleitet von ihren kostbar gekleideten Frauen, sah sie in Booten aus den Nebenflüssen herbeiströmen, in Kutschen, in Sänften, die durch den Dschungel getragen wurden, sah, wie sie sich dem hell erleuchteten Opernhaus näherten …
Dubrow warf einen schnellen Blick auf Harriet. Sie hört sogar mit ihren Wimpern zu, dachte er – und sprach weiter über den Lebensstil des Publikums, vor dem sie tanzen würden, dieses Flair von Tausendundeiner Nacht, das es umgab. »Dort unten lebt eine Frau, die ihre Kutschpferde mit Champagner waschen lässt«, erzählte er, »und ein Mann, der seine Hemden zur Reinigung nach London schickt.« An dieser Stelle musste Madame lächeln, denn wie erwartet erschien ein kleines Stirnrunzeln zwischen Harriets Augenbrauen. Harriet hielt es nicht für nötig, Kutschpferde in Champagner zu baden oder Wäsche in eine fünftausend Meilen entfernte Reinigung zu schicken.
Dubrow näherte sich nun dem Ende seines Vortrags. Flüchtig, ja beinahe abfällig kam er schließlich auf den Triumph zu sprechen, auf die zahllosen Vorhänge, die sie nach ihren Auftritten bekommen würden, und mit einer letzten, schwungvollen Gebärde brachte er die Truppe – überhäuft mit Juwelen und Silber, mit Ozelot- und Jaguarfellen – wieder heim nach England, wo sie betäubender Applaus und ein so gut wie sicheres Engagement an der Alhambra am Leicester Square erwarteten.
»Ihr könnt jetzt gehen«, sagte Madame, nachdem sie sich bei Dubrow bedankt hatte. Und als die Mädchen aus dem Zimmer schlüpften, hörte man Phyllis sagen: »Nicht im Traum würde ich dahin gehen! Ihr vielleicht? Nicht bei dem ganzen Gekribbel und Gekrabbel, das sie da haben!«
»Und bei den Einheimischen, die einen vielleicht auffressen«, fügte Lily hinzu.
Aber als Harriet sich anschickte, ihren Freundinnen zu folgen, versperrte Madame ihr den Weg. »Du bleibst, Harriet«, befahl sie. Und als Harriet sich umdrehte und mit respektvoll gefalteten Händen neben der Tür stehen blieb, fuhr sie fort: »Monsieur Dubrow ist hierhergekommen, um Tänzerinnen für die Tournee, die er euch gerade beschrieben hat, auszusuchen. Er hat dich bei der Arbeit gesehen und wäre bereit, dir einen Vertrag anzubieten.«
»Ihr Mangel an Erfahrung ist natürlich von Nachteil«, wandte Dubrow schnell ein. »Ihre Gage wäre daher auch geringer als die einer voll ausgebildeten Tänzerin.«
Es war dieses Feilschen, dieser Beweis dafür, dass sie nicht einfach träumte, der nun eine ungewöhnliche Veränderung bei Harriet bewirkte.
»Sie bieten mir ein Engagement an?«, sagte sie langsam. »Sie würden mich nehmen?«
»Es besteht überhaupt kein Grund, so überrascht zu sein«, fuhr Madame sie an. »Jede Schülerin meiner Fortgeschrittenenklasse hat einen professionellen Standard erreicht, der vollkommen genügt für das Corps de ballet einer Truppe, die auf Südamerikatournee geht.«
»Man wird mir nicht gestatten, mit Ihnen zu gehen«, sagte Harriet mit ihrer sanften, sorgsam modulierten Stimme zu Dubrow. »Es ist völlig aussichtslos, es auch nur zu versuchen; und ich bin erst achtzehn, wenn ich also wegliefe, würde man mich verfolgen und zurückbringen, und das würde Sie nur in Schwierigkeiten bringen. Aber ich werde nie vergessen, dass Sie mich haben wollten. Nie, solange ich lebe, werde ich das vergessen.«
Und dann trat dieses prüde erzogene Mädchen mit ihrem steifen akademischen Hintergrund vor, nahm Dubrows Hand und küsste sie.
Anschließend knickste sie kurz vor Madame und hätte das Zimmer verlassen, aber Dubrow hielt sie am Arm fest und sagte: »Warten Sie! Nehmen Sie das … Vielleicht geschieht ja doch noch ein Wunder.« Und als sie die Karte mit seiner Adresse entgegennahm, fügte er hinzu: »Sie können mich bis zum 25. April dort oder am Century Theatre erreichen. Wenn Sie bis dahin kommen, werde ich Sie nehmen.«
»Vielen Dank«, sagte Harriet, knickste noch einmal und war verschwunden.
Vor den Erstsemesterstudenten, die ihn im Zoologielabor von Cambridge umringten, sezierte Edward Finch-Dutton das efferente Nervensystem eines großen, leicht eingesalzenen Nordseehais. Eifrig verfolgten die jungen Männer seine Bewegungen und kritzelten sich Notizen in ihre Hefte. Edward beherrschte seine Knorpelfische so sicher, dass er es sich erlauben konnte, während seines Vortrags seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Und seine Gedanken galten an diesem Tag, an dem er in ihrem Haus speisen würde, einzig und allein Harriet.
Edward hatte ursprünglich beabsichtigt, noch für eine beträchtliche Zeit unverheiratet zu bleiben. Nachdem er seine Assistentenstelle am College erhalten hatte, war es offensichtlich das Vernünftigste, noch zu warten, denn er stimmte mit dem Rektor von St. Philip überein, dass acht oder zehn Jahre Zölibat kein zu hoher Preis für die Sicherheit einer akademischen Laufbahn waren.
Und doch beabsichtigte er, Harriet schon deutlich früher zum Altar zu führen. Natürlich würde er sie nur selten sehen. Die Regeln von St. Philip punkto Frauen im College waren besonders streng, aber es würde schön sein zu wissen, dass sie irgendwo in einem passenden Haus am Stadtrand auf ihn wartete. Ihre ruhige und sanfte Gegenwart, die intelligente Art, wie sie zuhörte, würden äußerst wohltuend sein für einen Mann, der sich das hehre Ziel gesetzt hatte, eine endgültige Klassifizierung der Aphaniptera zuwege zu bringen. In fünf oder acht Jahren, nachdem er zumindest ein Dutzend Schriften veröffentlicht und seine wissenschaftliche Laufbahn begründet hatte, würde er ihr erlauben, ein Baby zu bekommen. Nicht nur, weil Frauen ohne kleine Babys nie zu wissen schienen, was sie mit sich anfangen sollten, sondern auch, weil er selbst als Abkömmling einer alten und vornehmen Familie gern einen Erben hätte.
Der beste Zeitpunkt für seinen Antrag – und ihre offizielle Verlobung – war seiner Meinung nach der Maiball von St. Philip. Er hatte eine angemessene Summe Geldes für einen Ring beiseitegelegt und würde nach der Verlobung mindestens zwei Jahre lang vor weiteren Störungen seines Arbeitsfriedens sicher sein, bevor es notwendig wurde, Vorbereitungen für die Hochzeit zu treffen. Der Gedanke an einen Walzer mit Harriet zauberte ein leises Lächeln auf sein langes Gelehrtengesicht.
Zum ersten Mal hatte er sie in der Kapelle des King’s College gesehen, bei Bachs h-Moll-Messe, und ihre Ruhe und Andacht hatten ihn entzückt – entzückt hatte ihn aber auch, wie er zugeben musste, ihr zartes Profil und die Art, wie eines ihrer spitzen Öhrchen zwischen den Strähnen ihres offenen Haares hervorlugte. Natürlich war es auch sehr erfreulich, dass sie die Tochter von Professor Morton war – es wäre scheinheilig gewesen, das zu leugnen –, aber das Wissen, dass seine Gefühle in erster Linie uneigennützig waren, verschaffte ihm eine anhaltende und verständliche Befriedigung.
Um fünf Uhr war die Seminarübung beendet, und die Studenten zerstreuten sich; Edward räumte noch schnell das Laboratorium auf, stieg aufs Fahrrad und fuhr zu seiner bescheidenen Unterkunft auf dem Campus. Aber noch bevor er sich rasierte und die Smokingjacke anzog, schickte er einen der Collegediener in die Kantine und ließ sich vorsichtshalber eine Schweinefleischpastete bringen. Edward hatte bisher noch nicht bei den Mortons zu Abend gegessen, aber er hatte zweimal den Lunch dort eingenommen und wusste, dass man auf alles gefasst sein musste.
Es sollte ein ganz besonderes Abendessen werden – das erste Mal, dass Edward bei ihnen dinierte, und die erste Gelegenheit für Marchmont (den neuen Lektor für klassische Philologie) und seine junge Frau, dem Professor in der entspannten Zwanglosigkeit seines Hauses zu begegnen.
Also gab Louisa sich Mühe. Im Kamin im Speisezimmer lagen hinter dem eisernen Kamingitter mindestens ein halbes Dutzend Kohlen, die richtiggehend brannten und, gemessen an den Maßstäben des Hauses, ein loderndes Feuer darstellten.
Als Louisa in die Küche herunterkam, herrschte dort eine ähnlich festliche Ausgelassenheit. Der alltäglichen Suppe aus Rüben und Schinkenknochen hatte die Köchin gehackte Karotten hinzugefügt, wodurch die Brühe eine hübsche gelbliche Farbe erhielt. Ein kalter Kabeljau wartete in seinem Sud auf eine Sauce tartare, und die Hammelkeule brutzelte schon in der Röhre.
»Soweit scheint ja alles in Ordnung zu sein«, sagte Louisa an die Köchin gewandt. »Wie sieht es mit dem Nachtisch aus?«
Die Köchin zeigte mit dem Kopf auf ein großes Tablett, auf dem ein gerade erst aus seiner Form gestürzter Kaffeepudding noch immer leise vor sich hin zitterte.
»Ich werde ihn mit kandierten Kirschen verzieren«, bemerkte die Köchin weiter.
»Ich muss schon sagen, das scheint mir doch ein wenig übertrieben«, erwiderte Louisa. Stirnrunzelnd dachte sie nach. Immerhin handelte es sich um eine offizielle Abendeinladung. »Na schön – aber halbieren Sie die Kirschen vorher.«
Nachdem sie so ihrer Pflicht Genüge getan hatte, ging sie wieder nach oben und kam gerade rechtzeitig, um ihre Nichte bei der Rückkehr von der Tanzstunde abzufangen.
Es fiel Harriet immer schwer, den freundlichen, interessanten Straßen den Rücken zu kehren und das düstere Haus zu betreten, in dem es im Allgemeinen um einige Grad kühler zu sein schien als draußen. Heute, da Dubrows Worte ihr noch immer in den Ohren klangen, stand sie noch unglücklicher in der Diele als sonst und hing ihren unerfüllbaren Träumen nach – ein Anblick, der ihre Tante mit gerechtem Zorn erfüllte.
»Um Gottes willen, Harriet, trödle nicht! Hast du vergessen, dass wir heute Abend Gäste haben? Ich möchte dich um Punkt sieben umgezogen im Salon sehen.«
»Ja, Tante Louisa.«
»Du wirst das rosafarbene Crêpe-de-Chine-Kleid tragen. Und du kannst dir das Haar aufstecken.«
In ihrem Mansardenzimmer wusch Harriet sich langsam, streifte dann das abscheuliche Kleid über, das ihre Tante im Januarschlussverkauf für sie erstanden hatte, und widmete sich schließlich dem mühsamen Unterfangen, ihr langes, weiches Haar aufzustecken. Sie hätte alles für einen ruhigen Abend gegeben, an dem sie noch einmal durchleben konnte, was geschehen war … Alles, um nicht Edward gegenübertreten zu müssen mit seinem selbstherrlichen und besitzergreifenden Gehabe und jener unterschwelligen Freundlichkeit, die es ihr unmöglich machte, ihn so zu verabscheuen, wie sie es gern getan hätte.
Zwei Stunden später war die Dinnerparty in vollem Gange, obwohl das vielleicht nicht der Ausdruck gewesen wäre, den die hübsche Mrs Marchmont gewählt hätte, während sie mit einem Anflug von Ungläubigkeit ihre Suppe löffelte. Man hatte sie bezüglich der Abendeinladungen der Mortons gewarnt, aber man hatte sie nicht eindringlich genug gewarnt.
Am Kopfende des Tisches erläuterte der Professor Mr Marchmont die Ungerechtigkeit des jüngsten Beschlusses des Universitätssenats bezüglich der Notenvergabe beim Abschlussexamen. Edward unterhielt sich tapfer mit Tante Louisa darüber, »wie schrecklich teuer doch alles war«, während im Kamin die Handvoll glimmender Kohlen langsam schwarz wurde und schließlich erlosch.
»Nun, Harriet, und wie ist es dir heute ergangen?«, fragte der Professor, der sich an diesem Abend zum ersten Mal an seine Tochter wandte.
»Sehr gut, vielen Dank, Vater. Ich hatte heute meine Tanzstunde.«
»Ah, ja.« Der Professor hätte sich nun, nachdem er seiner Pflicht Genüge getan hatte, wieder an seinen Nachbarn gewandt, aber Harriet, die für gewöhnlich so schweigsam war, sprach weiter.
»Madame Lavarre hatte einen Gast. Einen Russen. Er wird mit einer Balletttruppe den Amazonas hinauf nach Manaus reisen. Um dort aufzutreten.«
»Ein überaus interessanter Teil der Welt, wie man hört«, sagte Edward. »Mit einer ganz außergewöhnlichen Flora und Fauna.«
Harriet sah ihn dankbar an. Und in einem Anfall von Tollkühnheit, der ihr selbst unverständlich war, fuhr sie fort: »Er hat mir ein Engagement angeboten … als Tänzerin … für die Dauer der Tournee.«
Ihre Bemerkung löste bei den Anwesenden eine wenn auch unterschiedliche, so doch durchweg heftige Reaktion aus. Ihr Vater legte, während sein Gesicht mit den scharfen Zügen rot anlief, seine Gabel beiseite, Louisa öffnete den Mund und starrte ihre Nichte sprachlos an, während Edwards Hemdbrust – Konsequenz der Tatsache, dass er jäh den Atem angehalten hatte – ein vernehmliches und plötzliches »Plop« hören ließ.
»Er hat dir ein Engagement angeboten?«, wiederholte der Professor langsam. »Dir? Meiner Tochter!« Er sah Harriet ungläubig an. »Noch nie in meinem ganzen Leben ist mir eine derartige Unverschämtheit untergekommen!«
»Aber nein!« Harriet, die sich der Nutzlosigkeit ihres Vorhabens sehr wohl bewusst war, konnte dennoch der Versuchung nicht widerstehen, es zumindest zu versuchen. »Es ist eine Ehre. Eine große Ehre. Auserwählt zu werden – für gut genug gehalten zu werden, professionellen Maßstäben zu genügen. Und außerdem geht es um eine gute Sache – Menschen Kunst zu bringen, die danach hungern. Das ist etwas objektiv Gutes, wie bei Marc Aurel.«
»Wie kannst du es wagen, Harriet? Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen!« Die Tatsache, dass seine Tochter den großen römischen Stoiker ins Feld führte, den der Professor als sein Eigentum betrachtete, hatte die Flammen seines Zorns auf gefährliche Weise weiter angefacht. Er funkelte Louisa an; sie hätte strenger mit dem Mädchen sein sollen, hätte sie schon vor Jahren von dieser unziemlichen Akademie entfernen müssen.
»Bitte, Vater. Bitte, lass mich gehen!« Harriet, die man sonst mit einem einzigen Blick zum Schweigen bringen konnte, schien plötzlich den Verstand verloren zu haben. »Du hast mich nicht weiter zur Schule gehen lassen, du hast mir nicht erlaubt, mit den Fergusons nach Frankreich zu fahren, weil sie Agnostiker sind … Nun, das habe ich verstanden – ja wirklich, das habe ich. Aber dies … sie haben eine Ballettmeisterin dabei, das Ganze ist durch und durch respektabel, und ich würde im Herbst wieder zurück sein.« Sie hatte ihren Teller weggeschoben und hielt sich an der Tischkante fest. »Bitte Vater, ich flehe dich an, lass mich gehen.«
Eine Szene! Eine Szene bei Tisch! Überwältigt von dieser schlimmsten aller Katastrophen, senkte Louisa den Kopf tief über ihren Teller.
»Du wirst das Thema auf der Stelle fallen lassen, Harriet«, blaffte der Professor. »Du bringst unsere Gäste in Verlegenheit.«
»Nein. Ich werde das Thema nicht fallen lassen.« Harriet war sehr bleich geworden, aber ihre Stimme war ruhig. »Du hast das Tanzen immer für frivol und töricht gehalten, aber das ist es nicht – es ist die wunderbarste Sache auf der Welt. Wenn man tanzt, kann man Dinge sagen, die man auf keine andere Art und Weise ausdrücken könnte. Seit Anbeginn der Zeit haben Menschen zum Ruhme Gottes getanzt. David hat vor der Bundeslade getanzt … Und diese Reise … Dieses Abenteuer …« Sie wandte sich flehentlich an Edward. »Sie müssen doch wissen, was für ein wunderbares Erlebnis es sein würde?«
»O nein, Harriet! Nein, der Amazonas ist ein überaus unpassender Ort für eine Frau. Das wäre er für jedermann! Es gibt dort Fische, die in die Körperöffnungen der Menschen eindringen, wenn sie im Meer baden, und …«
Ein leises Stöhnen von Louisa brachte ihn zur Besinnung. Körperöffnungen waren bei Tisch erwähnt worden, und das in Anwesenheit von Damen! Körperöffnungen und eine Szene am selben Abend! Und während der arme Edward dunkelrot anlief und Mrs Marchmont ein nervöses Kichern unterdrückte, erhob sich der Professor und sah seiner Tochter ins Gesicht.
»Du wirst jetzt den Tisch verlassen, Harriet, und sofort auf dein Zimmer gehen.« Und als sie sich nicht augenblicklich erhob, fuhr er fort: »Ich denke, du hast mich verstanden!«
»Ja.« Aber sie rührte sich immer noch nicht, sondern sah ihren Vater nur weiter an, und einen wahnwitzigen Augenblick lang hatte er den Eindruck, dass sie mit ihm Mitleid hatte.
Dann nickte sie kurz, als sei irgendein Geschäft nun zum Abschluss gekommen, und erhob sich mit der mühelosen Anmut, die sie jener verdammenswerten Tanzakademie zu verdanken hatte, ging zur Tür und war verschwunden.
2
Der Besuch auf Schloss Stavely, der drei Wochennach jener unglücklichen Abendeinladung stattfand, war für die Damen von Louisas Teekränzchen der Höhepunkt des Jahres. Sie ließen es sich angelegen sein, Harriet wieder und wieder darauf hinzuweisen, dass diese sich glücklich schätzen könne, mitgenommen zu werden. Wie ein Schwarm schwarzer Vögel aus der griechischen Tragödie hatten diese Damen über Harriets junges Leben geherrscht. Es waren etwa dreißig Frauen, die sich ursprünglich in der Villa Hermione Belpers versammelt hatten, um gegen die Vereinigung der Ehefrauen von Universitätsangehörigen zu protestieren – die Vereinigung hatte Geld für das Fitzwilliam-Museum gesammelt, damit ein bestimmtes Gemälde erworben werden konnte: das einer Dame, die nicht nur hüllenlos war, sondern eindeutig splitternackt.
Es waren eben jene Damen des Teekränzchens, die für Louisa beschlossen, wie Harriet sich zu kleiden hatte, welche Familien sie besuchen und wohin sie ohne Anstandsdame gehen durfte; sie waren es, die – wie eine Armee von Geheimagenten über die Stadt verstreut – Louisa hinterbrachten, wenn ihre Nichte in der Öffentlichkeit ihre Handschuhe ausgezogen hatte oder dabei beobachtet worden war, wie sie sich viel zu freundlich mit einem Ladenjüngling unterhalten hatte.
In den Augen jener Damen konnte Harriet doppelt glücklich sein, da auch Edward Finch-Dutton nach Stavely Hall mitkam. Zu dem Entschluss, dass auch ein Mann mit von der Partie sein sollte, hatten Mrs Belper und Tante Louisa sich nach Stunden durchgerungen. Doch es wurde ihnen klar, dass Edwards Anwesenheit Vorteile mit sich brachte. Seine Mutter hatte den alten General Brandon (den Besitzer Stavelys) zu dessen Lebzeiten gekannt, und wenn diese Tatsache von vornherein erwähnt wurde, konnte dies die Aussicht wesentlich erhöhen, von seiner Schwiegertochter, die in Abwesenheit ihres Mannes das Sagen in Stavely hatte, persönlich empfangen zu werden. Sowohl Mrs Belper wie auch Louisa waren leidenschaftliche Besucherinnen stattlicher Herrenhäuser und hegten fortwährend die Hoffnung, dass es bei einer bloßen Besichtigung irgendwann einmal zu einer wirklichen Begegnung und einem Gespräch mit einem Marquis oder einer Viscountess kam. Von Isobel Brandon, einer Enkelin des Grafen von Lexbury, hieß es, sie sei eine rothaarige Schönheit von unglaublicher Eleganz.
Demgegenüber waren die offensichtlichen Gefahren zu bedenken, dass die »jungen Leute« sich gehen ließen. Stavely sollte einer der prächtigsten und romantischsten Herrensitze in East Anglia sein, und der Gedanke, Edward und Harriet könnten hinter irgendwelchen undurchdringlichen Hecken oder irgendeinem reich geschnitzten Wandschirm verschwinden, war zu schrecklich, um ihn überhaupt in Betracht zu ziehen.
»Aber das werden wir doch verhindern können, Louisa«, sagte Mrs Belper entschieden und setzte sich für Edwards Mitkommen ein. »Schließlich sind wir dreißig. Ich werde mit den Mädchen reden.«
Also redete Mrs Belper mit ihnen – allerdings nicht mit der 87-jährigen Mrs Transom, der Witwe des emeritierten Architekturprofessors, von der man wenig erwarten konnte, aber mit Millicent Braithwaite, die eigenhändig drei betrunkene Studenten von einer mit Zacken versehenen Mauer heruntergeholt hatte, die sie übersteigen wollten, um ins College zurückzugelangen.
So war denn auch Edward eingeladen worden, der nun, nachdem er vernünftigerweise beschlossen hatte, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, neben Harriet stand, ausgerüstet mit seinem Schmetterlingsnetz und einer Umhängetasche aus Kaki, die sein Tötungsglas, seinen Sammelbehälter und seine Dosen enthielt.
Der Omnibus fuhr vor; Decken, Sonnenschirme und Picknickkörbe wurden verladen, und die Reise ging los. Harriet hatte eigentlich nicht mitkommen wollen; sie konnte sich kaum etwas weniger Vergnügliches vorstellen, als in Begleitung der Damen vom Teekränzchen durch ein großes Haus zu trotten. Edwards Anwesenheit war noch eine zusätzliche Qual für sie, denn sie hatte stets das Schreckensbild vor Augen, dass sie eines Tages so weit gebracht würde, seinen Heiratsantrag anzunehmen. Wenn sie Edward heiratete, könnte sie einen Garten haben, in dem auch wirklich Blumen wuchsen; auch einen Hund und einen Goldfischteich. Sie könnte in der Sonne sitzen und lesen und ihre Freundinnen einladen. Doch an diesem Punkt hörte sie auf, ihre Gedanken weiterwandern zu lassen, denn irgendwo in dem vorgestellten Garten stand ein Kinderwagen mit einem glucksenden Säugling – ihrem zarten, warmen Baby.
Aber es war nicht ihr Kind allein. Wie schon so oft, dankte Harriet im Stillen dem melancholischen, überspannten Dienstmädchen Maisie, das ihr, als sie sechs Jahre alt war, ausführlich und ohne Umschweife erzählt hatte, wie Menschen Babys machten. Manche Nacht hatte Harriet wach gelegen und versucht, die komplizierten Unannehmlichkeiten zu verstehen, die Maisie ihr beschrieben hatte. Jetzt war sie froh über die rohe Aufklärung. Wie leicht hätte sie sonst, wenn sie von Dantes hehrer Leidenschaft für Beatrice las, die Liebe für einen herrlichen Höhenflug des menschlichen Geistes gehalten. Das war sie natürlich auch, aber nicht nur das. Während sie Edward jetzt vorsichtig ihren Arm entzog – es war heiß geworden in dem vollen Bus –, wusste sie, dass eine Heirat mit ihm kein Ausweg für sie war.
Aber welche andere Wahl hatte sie? Ihr Vater war am Tag nach der Abendeinladung persönlich zu Madame Lavarre gegangen, um ihren Tanzstunden ein- und für allemal ein Ende zu bereiten. Jetzt war ihr nichts mehr geblieben – gar nichts.
Ich darf nur nicht verzweifeln, dachte Harriet, und als der Bus schließlich zwischen den steinernen Löwen auf den Torpfosten hindurchfuhr und sie sich über Stavelys berühmte doppelte Buchenallee dem Haus näherten, entsprang Harriets leises »Oh!« keineswegs einer vorsätzlichen Willensanstrengung. Sie hatte Pracht erwartet, Protzerei und Pomp, fand stattdessen nur reine und ehrfurchtgebietende Schönheit.
Das Haus war lang gestreckt und niedrig, gebaut aus warmen, rosigen Backsteinen: ein Ort zum Leben, für Musik und Feste, ein Haus, wie geschaffen, um eine Schar prächtiger Kinder großzuziehen.
Aber wenn Harriets erster Eindruck von Stavely der überwältigender Schönheit war, so stach ihr doch gleich darauf die Vernachlässigung ins Auge, die überall sichtbar wurde. Direkt am Haus, wo alles von einer sorgfältigen Pflege des Gartens abhing, war deutlich zu erkennen, dass etwas nicht stimmte. Unkraut wucherte auf den Kieswegen, und die Eibenhecken waren schon lange nicht geschnitten worden. Das Haus war in einen verwunschenen Schlaf versunken; die Anmut der grünen Kletterpflanzen, die sich über ein Gartentor geschoben hatten, und die frischen jungen Blätter einer unbeschnittenen Rose, die ihre Ranken über ein Fenster wachsen ließ, verschleierten nur den Verfall des Anwesens.
»War das Haus bei Ihren früheren Besuchen auch schon in diesem Zustand, Edward?«, erkundigte sich Harriet. »So verwildert und vernachlässigt?«
»Nein, ich glaube nicht. Aber bedenken Sie, dass ich damals noch sehr klein war, und nach dem Tod des alten Besitzers, Colonel Brandons, sind wir nie wieder hergekommen. Sein Sohn – der gegenwärtige Besitzer – war sehr unfreundlich zu Mama.«
Am Haupteingang stand ein düsteres, altes Individuum mit Mumiengesicht und leberfleckenübersäter Glatze, das sich als Mr Grunthorpe vorstellte. Er war der Butler der Familie, und nachdem er die Damen in einen großen holzvertäfelten Raum geführt hatte, spulte er sofort sein Programm ab.
»Der Raum, in dem wir uns jetzt befinden, ist als Große Halle bekannt. Bitte beachten Sie besonders das Kaminsims, über dem der Schild mit dem Wappen der Brandons und der Verneys hängt. Das Wappen geht zurück auf das Jahr 1633, in dem Henrietta Verney durch Heirat mit der Familie Brandon verbunden wurde«, dröhnte die Stimme des offenkundig desinteressierten Mr Grunthorpe.
Harriet beachtete die Besonderheiten, auf die sie hingewiesen wurde … ohne dabei jedoch den Staub zu übersehen, der überall lag. Sie gingen einen Flur hinunter und kamen in den Salon – ein wunderschönes Zimmer voller Hepplewhite-Möbel –, aber auch hier herrschte dieselbe Vernachlässigung. Anschließend strömte die kleine Gesellschaft in die Bibliothek.
Ach, die armen Bücher, dachte Harriet, während sie ihr Taschentuch verstohlen über die staubigen, in Kalbsleder gebundenen Bände auf einem offenen Regal gleiten ließ. Wie arm ich auch wäre, überlegte sie, die Bücher würde ich immer abstauben. Und wieder einmal fragte sie sich, was diesem wunderbaren Haus fehlte.
Als Nächstes stiegen sie die große Treppe hinauf. Hier waren die privaten Räume der Familie, an denen der mumiengesichtige Mr Grunthorpe sie nun vorbei in die Lange Galerie im obersten Stock führte.
Harriet war ein wenig hinter den anderen zurück geblieben, und so kam es, dass sie allein war, als plötzlich eine Tür aufgerissen wurde und sie eine hohe, herrische Frauenstimme rufen hörte: »Nein! Das glaube ich nicht! So furchtbar kann es einfach nicht sein!«
Unwillkürlich blieb Harriet stehen. Durch die geöffnete Tür sah sie ein mit blauer Seide drapiertes Himmelbett. Die Decken waren zerwühlt, und vor dem Bett stand eine Frau in weißem Negligé, der ein Schwall dunkelroter Haare über den Rücken wallte.
»Nicht einmal mein idiotischer Ehemann könnte so weit gegangen sein«, fuhr sie fort. »Sie wollen mir Angst einjagen.«
Ein Dienstmädchen hielt sich im hinteren Teil des Zimmers auf, um Kleider zurechtzulegen, aber die Person, mit der die Frau sprach, blieb unsichtbar – ein Mann, dessen leise Antwort Harriet nicht verstehen konnte.
»Oh!« Der verzückte Ausruf kam von Louisa, die zurückgekehrt war, um ihre saumselige Nichte zu ermahnen. Ihr langes Gesicht verklärte sich; ihr Mund stand vor Ehrfurcht ein klein wenig offen.
Hier hatten sie ohne Zweifel die Herrin des Hauses vor sich, Isobel Brandon, in deren Adern etwas vom blauesten Blut Englands floß. Doch während Harriet eine schöne und herrische Frau sah, die durch irgendeine Kalamität an den Rand der Fassungslosigkeit getrieben wurde, sah Tante Louisa nur die Tochter des Earl of Lexbury, deren Hochzeit in St. Margaret in Westminster vor etwa zehn Jahren so spektakulär gewesen war, dass nur eine Doppelseite im Tatler ihr hatte gerecht werden können.
Aber jetzt hatte Mrs Brandon sie gesehen.
»Um Himmels willen, Alistair, mach die Tür zu! Man kann hier nirgendwo hingehen, solange diese blöden Weiber durchs Haus stampfen. Außerdem habe ich sowieso alle Unterlagen weggeschickt …«
Die Tür wurde geschlossen. Harriet und ihre Tante gesellten sich wieder zu den anderen, und gemeinsam betraten sie die Lange Galerie.
An den Wänden, links und rechts der Tür, hingen die Familienporträts der Brandons. Nur zwei der faden, durch dicke Firnisschichten zu absoluter Einförmigkeit verurteilten Gemälde erregten Harriets Aufmerksamkeit: das eines Mannes, der dem alten General ähnlich sah und den das Modellsitzen so offenkundig gelangweilt hatte, dass es ans Komische grenzte; und dasjenige von Henrietta Verney, die die Brandons mit ihrem illustren Haus verbunden hatte – ein lebhaftes, intelligentes Gesicht, das den Jahrhunderten trotzte.
»Gibt es kein Porträt des augenblicklichen Besitzers?«, erkundigte sich Mrs Belper.
»Nein, Ma’am. Der gegenwärtige Besitzer hält sich häufig im Ausland auf und hat noch nicht für sein Porträt gesessen.«
Und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass er das jemals tun wird, dachte Mr Grunthorpe mit düsterer Befriedigung.
Zehn Minuten später war die Führung zu Ende, und die Damen standen wieder in der Eingangshalle. Und hier sollte Mr Grunthorpe sein Waterloo erleben. Tante Louisa, die Sekretärin des Teekränzchens, ging auf ihn zu und bedankte sich im Namen ihrer Freundinnen dafür, dass er sie herumgeführt hatte. Mr Grunthorpe, der seine gierige Hand schon erwartungsvoll ausgestreckt hatte, murmelte, es sei ihm ein Vergnügen gewesen. Er starrte noch immer fassungslos auf seine leere Hand, als Louisa den anderen Damen bereits durch die Vordertür gefolgt war.
Draußen stand nun die Wahl eines passenden Picknickplatzes zur Debatte. Dies war keine ganz leichte Aufgabe, aber schließlich ließ man sich an einer geschützten Stelle im Garten nieder, die Picknickkörbe wurden aus dem Ausflugsomnibus geholt, Decken ausgebreitet, Schirmchen aufgestellt, und die Damen nahmen Platz.
Edward war anfangs ganz zufrieden gewesen, neben Harriet sitzen und das exzellente Mahl genießen zu dürfen. Obwohl sie für ihre Verhältnisse ungewöhnlich still war, gefiel sie ihm doch sehr in dem blauen Rock und der weißen Bluse. Besonders mochte er die Art, wie sie ihr Haar trug: Es war mit einem Samtband zurückgehalten und fiel offen auf ihre Schultern. Doch nach einer Weile wurde er rastlos; immerhin war er Entomologe und nicht nur zum Vergnügen hier.
»Kommen Sie, Harriet«, sagte er schließlich. »Ich möchte das Lehrmaterial des Laboratoriums aufstocken. Würden Sie so freundlich sein, mir zu helfen?«
Sie nickte und erhob sich, und gemeinsam begaben sie sich in die Richtung, in der auch der Krocketrasen lag. Fast eine halbe Stunde lang lief Edward, blind für alles andere, in gebückter Haltung durchs Gras und ließ das schwere Schmetterlingsnetz unablässig über den Boden schnellen.
Als sie sich schließlich langsam der Terrasse näherten, erspähte Edward plötzlich auf einem blühenden Schneeball einen großen goldenen Zitronenfalter. Mit einem Mal war er wie verwandelt; er nahm die Stufen mit beinahe tänzerischer Anmut. Das hier war ein ganz neuer Edward: ein leichtfüßiger, entomologischer Ariel. Er zauderte kurz, nahm sein Opfer ins Visier – und schlug mit einem prachtvollen Schwung seines Netzes jäh zu!
»Ich habe ihn!«, verkündete er triumphierend, und als Harriet näher kam, hatte er bereits den Thorax des flatternden Geschöpfes, das er zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, zusammengedrückt.
Eine saubere und gekonnte Bewegung: ein augenblicklicher und humaner Tod. Aber dabei entstand ein Geräusch, das Harriet nicht erwartet hatte – ein kleines, aber unüberhörbares »Knack« –, und nun teilte sie Edward mit, dass er sie einen Augenblick entschuldigen müsse, und ließ ihn stehen.