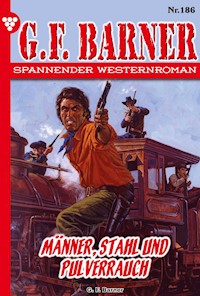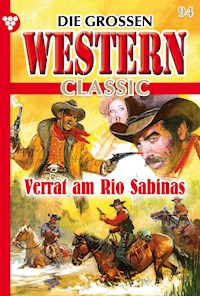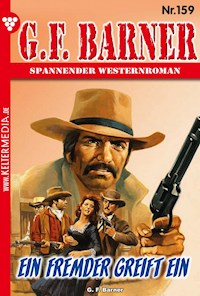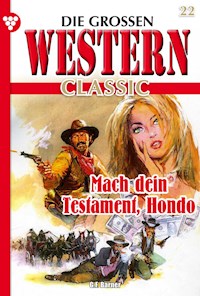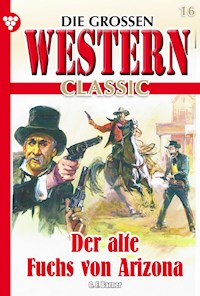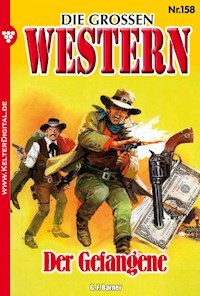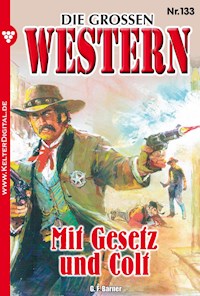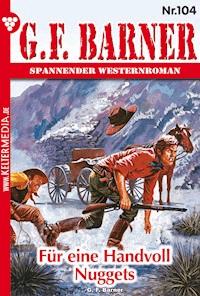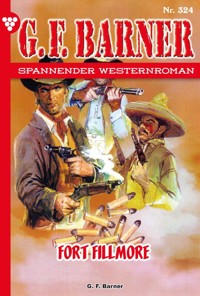Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Clay Horton weiß nicht, daß es die Pass-Creek-Berge sind, auf die er zugeht. Er hat nur rechts einen Bergzug vor sich und links den nächsten. Die Sonne steht im Südwesten, der Wind ist heiß und trocken. Der Mann geht mit regelmäßigen, gleichförmigen Schritten dem Einschnitt zwischen den Elch-Bergen und den Pass-Creek-Bergen zu. Manchmal verändert er die Lage seines Sattels. Das Klingeln des Bauchgurtes mit seiner Schnalle am Lauf der Winchester ist die gleiche Musik in seinen Ohren, die auch seine Sporen machen. Der Mann lächelt kaum, er hält auch nicht an. Er sieht weit und breit kein Haus, nur Berge, einige Bäume, sonst Buschgelände und das wadenhoch stehende Fettholz. Es riecht nach Sage, als er über einen Hügel geht und einen Schuppen links vor sich sieht. Einen alten, baufälligen Schuppen, dessen Erddach mit Steinen beschwert ist. Ein kleiner Zaun aus windschiefen Latten läuft um diesen Schuppen. Holz liegt verstreut umher, kein Mensch ist zu sehen. Unterhalb des Schuppens blinkt Wasser. Ein Erdwall, ein versandeter Bachlauf und ein paar Büsche, deren Blätter vom Staub gepudert sind, sieht man. Scharfer Wind kommt aus Westen. Seit dreieinhalb Stunden ist er schon unterwegs. Clay Horton betrachtet den Schuppen und das Wasser wie einen Palast. Er spürt das Brennen an seiner rechten Kopfseite, die Stiche im Hinterkopf, an dem er eine Beule hat. Und er grinst nun trotz all dieser Dinge, die einen anderen Mann vielleicht ärgerlich machen würden. Es ist sein Pech, und damit basta. Wozu sich ärgern, das Leben ist mal bitter, mal ist es spaßig. Scheint heute
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 106–
Ein Tramp aus Texas
… und ein verdammt sturer Dickschädel
G. F. Barner
Clay Horton weiß nicht, daß es die Pass-Creek-Berge sind, auf die er zugeht. Er hat nur rechts einen Bergzug vor sich und links den nächsten. Die Sonne steht im Südwesten, der Wind ist heiß und trocken.
Der Mann geht mit regelmäßigen, gleichförmigen Schritten dem Einschnitt zwischen den Elch-Bergen und den Pass-Creek-Bergen zu.
Manchmal verändert er die Lage seines Sattels. Das Klingeln des Bauchgurtes mit seiner Schnalle am Lauf der Winchester ist die gleiche Musik in seinen Ohren, die auch seine Sporen machen.
Der Mann lächelt kaum, er hält auch nicht an. Er sieht weit und breit kein Haus, nur Berge, einige Bäume, sonst Buschgelände und das wadenhoch stehende Fettholz. Es riecht nach Sage, als er über einen Hügel geht und einen Schuppen links vor sich sieht. Einen alten, baufälligen Schuppen, dessen Erddach mit Steinen beschwert ist. Ein kleiner Zaun aus windschiefen Latten läuft um diesen Schuppen. Holz liegt verstreut umher, kein Mensch ist zu sehen.
Unterhalb des Schuppens blinkt Wasser. Ein Erdwall, ein versandeter Bachlauf und ein paar Büsche, deren Blätter vom Staub gepudert sind, sieht man. Scharfer Wind kommt aus Westen. Seit dreieinhalb Stunden ist er schon unterwegs.
Clay Horton betrachtet den Schuppen und das Wasser wie einen Palast. Er spürt das Brennen an seiner rechten Kopfseite, die Stiche im Hinterkopf, an dem er eine Beule hat. Und er grinst nun trotz all dieser Dinge, die einen anderen Mann vielleicht ärgerlich machen würden. Es ist sein Pech, und damit basta. Wozu sich ärgern, das Leben ist mal bitter, mal ist es spaßig. Scheint heute nicht die Sonne, mein Gott, da wird sie morgen scheinen, oder übermorgen, das ist ganz sicher.
Er geht mit seinen langen Beinen weiter. Die Dämmerung kommt in drei Stunden, es wird jetzt erst gegen neun Uhr abends dunkel.
Vor ihm laufen zwei Wagenspuren durch das Tal und zweigen dann zum Schuppen hin ab. Clay nähert sich dem Schuppen ohne jede Vorsicht, denn hier ist doch niemand.
Und wirklich ist der Schuppen leer. Die Tür hat nur einen Holzriegel. In der einen Ecke liegen die Reste einiger Decken oder Säcke. Zwei Töpfe sind da, beide durchgebrannt. Aber eine Wasserkanne ohne Henkel mit abgesprungener Emaille liegt nahe der Säcke.
»Well«, sagt er ruhig, läßt den Sattel von der Schulter gleiten, packt sein Gewehr und sieht erst einmal hinter dem Schuppen nach. »Aha, da ist ein offener Herd. Sie haben also draußen gekocht und die Hütte nicht im Winter benutzt. Das Dach über dem Herd ist herabgefallen, aber der Herd ist in Ordnung. Habe ich noch Kaffee?«
Er dreht um, findet einige Krümel Kaffee und entfacht ein Feuer. Dann holt er Wasser, kocht es ab und legt sich neben dem Feuer hin. Er hat Zeit, nachzudenken und kommt zu dem Entschluß, weiterzugehen. Solange es noch hell ist, kann er eine Strecke schaffen. Clay trinkt den Kaffee, der gerade den Inhalt eines Bechers ergibt, dann packt er seinen Sattel, schiebt den Riegel vor die Tür und nimmt seinen Weg wieder auf.
Nach einer Stunde ist er auf der rechten Flanke des langgestreckten Höhenzuges, aber er ist immer noch nicht viel näher an den Einschnitt zwischen den Bergen herangekommen. Er geht in seinem üblichen Trott und pfeift.
Die Sonne steht tief, der Einschnitt zwischen den Bergen liegt nun vor ihm. Keine Meile weiter links blinkt der Lauf eines Creeks. Espen stehen dort, einige Pappeln und viel Büsche. Er schwitzt schon wieder, geht auf den Bach zu und schüttelt sich seinen Hut voll Wasser über den Kopf.
Clay Horton kommt langsam zwischen den Büschen durch, von seinem Gesicht tropft das Wasser, der nasse Hut sitzt nach vorn geschoben auf seinem Kopf und kühlt seine Beule wenigstens etwas.
Dann biegt er um die Baumgruppe, betrachtet das saftige Gras, das eine Strecke am Wasserfall entlang im vollen Grün steht und bleibt stocksteif stehen.
Rechts unter den beiden einzelnen Pappeln steht ein Pferd. Ein Gewehr steckt am Sattel, einem prächtigen Sattel mit einer Menge Brennarbeit und durchgeflochtenen Biesennähten.
Clay wendet langsam den Kopf, aber alles, was er zu sehen bekommt, ist eine Gerte, die blitzschnell nach hinten geschwenkt wird. Eine dünne Schnur, von der Wassertropfen davonschießen, segelt durch die Luft. Und im Wasser klatscht es leicht.
Das Pferd steht gegen den Wind, es kann ihn nicht wittern. Clay geht leise weiter, kommt an den Büschen links vorbei und sieht nun genau auf den Felsblock, der mitten im Wasser liegt. Wasser schießt gurgelnd über diesen Block hinweg.
Ein Junge steht mit hochgekrempelten Hosenbeinen barfuß im Wasser. Seine prächtigen Stiefel stehen ordentlich ausgerichtet am Ufer des Creeks.
Die Angel wippt einmal, der Junge bewegt blitzschnell die Angelrute und läßt dann nach. Mit einem geschickten Griff klemmt sich der Junge die Rute unter den linken Arm und zieht dann die Schnur Hand über Hand, immer wieder etwas nachlassend, irgend etwas heran.
Aus dem Wasser taucht der silbrige Leib eines Fisches auf. Clay beobachtet die Geschicklichkeit, mit der der Junge seinen Fisch vom Haken löst, ihn hochhebt und sich nun umdreht. Und erst in dieser Sekunde entdeckt Clay, daß der Junge gar kein Junge, sondern ein Mädchen ist.
Das Mädchen zuckt heftig zusammen, hält den zappelnden Fisch in der Hand und schrickt noch einmal zusammen, als der Fisch ihr aus der Hand gleitet und in wildem Aufbäumen über den schmalen Kiesstreifen in die Rinne des hinter dem Felsen durchschießenden Wassers zu entkommen versucht.
Der Sattel hinter Clay plumpst zu Boden, das Gewehr poltert hin, dann macht Clay einen riesigen Satz und fliegt in das aufspritzende Wasser.
Es ist klares und ziemlich kaltes Wasser, in das Clay hineinhechtet. Er richtet sich auf und wie eine Trophäe hebt er den Fisch zwischen den Händen hoch.
Er sieht das Mädchen an, die großen grünen Augen, das rote Haar, den leicht geöffneten Mund und hält ihr, im Wasser kniend, den Fisch entgegen.
»Hier«, sagt er ruhig, während ihm das Wasser über das Gesicht läuft. »Er wäre Ihnen nicht entwischt, wenn ich Sie nicht erschreckt hätte, Lady.«
Sie starrt ihn nur groß und verstört an. Wahrscheinlich hat sie erstens seine Schnelligkeit verblüfft und zweitens sein Sprung in das Wasser. Bestimmt hat sie noch keinen Mann gesehen, der wegen eines Fisches in den nächsten Bach springen würde.
»Hallo«, sagt Clay noch einmal, packt den Fisch fester, geht zu ihr hin und wirft den Fisch zwei Schritt links von ihr ins Gras. »Ich hole nur meinen Hut.«
»Nur den Hut«, sagt sie verwirrt und sieht, wie der langbeinige, große Bursche sich umdreht, zum Ufer geht und seinen Hut aus den Zweigen nimmt.
»Hallo, Mister, wir kennen uns doch?«
Sie blickt an sich herunter, hebt dann den linken Fuß und beginnt, das Hosenbein wieder nach unten zu krempeln. Sie hat kleine zierliche Füße, denkt Clay, zierliche Zehen. Ich erkenne sie wieder. Das Mädchen saß auf dem Wagen, den ich zusammen mit dem dicken Denson durch Cheyenne habe fahren sehen. Wie heißt sie doch nur?
»Ja«, sagt er ruhig. »Wir haben uns schon mal irgendwo gesehen. In Cheyenne, glaube ich. Sie haben auf einem Wagen gesessen, neben Mr. Waltman, ja, ich glaube, Waltman, wie?«
»Ja, Brian Waltman. Und Sie sind der Mann, der sein Pferd nicht erschießen konnte, ja?«
Er blickt auf ihr Haar. Sie schleudert den Hut in den Nacken und mustert ihn, während sie das andere Hosenbein nach unten krempelt, aufmerksam. Dann sagt sie.
»Sie sind ja ganz naß, Mister.«
»Ach, ich bin ein Stück zu Fuß gegangen, etwas Abkühlung kann nicht schaden, Lady.«
»Sie sind Texaner, nicht wahr?«
»So ungefähr, Madam.«
»Ich bin Sandra Needhan, Mister. Sie sind hier auf unserem Land, unsere Außenstation liegt acht Meilen von hier. Ohne Pferd, Mister…«
»Horton, Clay Horton, Madam. Ich habe kein Pferd mehr.«
»Natürlich, Sie haben Ihr Pferd ja erschießen müssen, Denson hat es erzählt. Woher kommen Sie denn jetzt? Sie sind ziemlich weit von jeder Straße entfernt, Horton.«
»Ich bin von dem Zug gesprungen, etwa zwischen Ramsey und Hanna muß es gewesen sein.«
Sie geht zu ihren Stiefeln, zieht sich Wollstrümpfe an und fährt dann in den ersten Stiefel.
»Vom Zug gesprungen, Mister? Warum denn das? Eine ganz schöne Strecke ist das von Ramsey bis hierher. Warum vom Zug gesprungen, Horton?«
Jetzt werde ich ihr die Wahrheit sagen und sehen, ob sie mich davonjagt, oder Angst vor mir bekommt, denkt Clay bitter. Ich werde diesem Girl alles sagen, wenn sie mich noch viel fragt. Seltsam, was sie für große Augen hat?
»Der Zugbegleiter wollte mir eins über den Kopf geben.«
»Aber, Horton, warum denn das?«
»Ich hatte kein Geld für eine Fahrkarte und mich in einem Waggon versteckt.«
Sie zieht nicht mehr den anderen Stiefel an, sie blickt ihn nur verwundert an und fragt: »Weshalb haben Sie denn ein Versteck in dem Waggon gesucht, Horton?«
»Oh, in Cheyenne waren einige Männer hinter mir her, Lady. Ich bin weggelaufen und in den Waggon gekrochen, ehe sie mich erschießen konnten.«
»Warum?«
»Oh, es gibt unfreundliche Leute hier«, bemerkt Clay und lächelt schwach. »Ja, sie wollten mich erschießen, damit ich nichts sagen konnte. Hat Denson, der Viehhändler, nichts davon erzählt, daß ich mit seinen Freunden gewürfelt habe?«
»Denson? Denson hat nur gesagt, daß Sie der verrückteste Bursche seien, entschuldigen Sie, Horton, der ihm jemals über den Weg gelaufen sei. Sie hätten beinahe einen Ohnmachtsanfall bekommen, als Sie Ihr Pferd erschießen mußten.«
»Mein Pferd, sicher«, erwiderte er düster. »Es hatte mich noch nie im Stich gelassen. Ich mag Pferde, Lady.«
Sie schweigt einen Augenblick, zieht den zweiten Stiefel an und fragt: »Mit welchen Leuten haben Sie gewürfelt, Horton?«
»Mit den beiden Holloways und dem Zureiter John, Miss Needhan. Ich hatte ein wenig getrunken.«
»Ja, das hörte ich von Denson. Sie wären ganz verrückt auf eine Flasche Whisky gewesen. Nun, wenn ich mein Pferd erschießen müßte, weiß Gott, Horton, ich bin nicht sicher, ob ich nicht auch trinken würde.«
Er krempelt seine Ärmel herunter, damit sie schneller trocknen. Natürlich hat er noch das Hemd mit dem zerrissenen Ärmel an.
»Oh«, sagt er verlegen. »Ich habe beim Sturz mein Hemd zerrissen, Lady.«
»Bei dem Sturz aus dem Zug?«
»Nein, als Jimmy gestürzt ist.«
»Wer ist Jimmy, Horton?«
»Jimmy ist mein Pferd, war mein Pferd, Miss Needhan. Ich werde machen, daß ich weiterkomme. Nehmen Sie nur Ihren Fisch und lassen Sie sich durch mich nicht aufhalten. Es wird dunkel, Sie wollen sicher auf die Außenstation reiten, wie?«
»Man wird mich dort erwarten, sicher. Ja und Sie, Horton?«
Er lächelt und sagt knapp: »Ich habe noch einen weiten Weg, Lady.«
»Sie wollen zu Fuß weiter? Hören Sie, Horton, auf unserem Außenwerk sind zwar nicht viel Leute, aber Sie kommen natürlich mit. Ich lasse Sie doch nicht hier allein zurück oder bei Nacht zu Fuß durch die Berge laufen. Kennen Sie sich hier überhaupt aus?«
»Ich bin überall zu Hause«, antwortet er träumerisch. »Ein paar Sterne genügen, ich verirre mich nie, Miss Needhan. Danke für Ihr Angebot, aber ich werde nicht mitkommen.«
»Nicht?« fragt sie verwundert. »Horton, ich habe genug von Texanern gehört, mein Vater ist selbst einer. Und er hat den dicksten Schädel, den ein Mann überhaupt haben kann. Horton, Sie kommen mit, das ist ganz einfach. Meine Stute trägt uns zwei glatt die wenigen Meilen.«
Clay klopft sich leicht ab. Es ist noch warm, die Sachen werden an seinem Leib trocknen. Dann blickt er das Mädchen groß und kühl an und sagt bitter: »Sie werden mich nicht mitnehmen, Miss Needhan. Ich bin sicher, es wird eine Menge Ärger für Sie bedeuten, wenn Sie mich aufnehmen. Nein, danke, ich bleibe lieber allein. Vielleicht vergessen Sie auch, daß Sie mich getroffen haben. Es kann sein, daß jemand nach mir fragt.«
»Jemand nach Ihnen fragt? Horton, was ist los? Da sind einige Männer, die versucht haben, Sie umzubringen. Das sagten Sie. Was sollten Sie nicht sagen können, Mister? Sie reden nur herum, anstatt die Wahrheit zu sprechen. Was ist passiert?«
»Natürlich nichts«, erwidert er trocken. »Man wird Ihnen sagen, daß ich ein Falschspieler sei, daß ich im Jail in Cheyenne gesessen habe und danach wird man mich hinauswerfen, wenn ich nicht vorher Besuch bekomme. Es könnte jemandem nicht sehr gefallen, wenn ich rede.«
»Zum Teufel«, ruft sie wütend. »Was ist das für eine Geschichte? Sie haben im Jail gesessen? Wann denn, zum Teufel? Und warum? Haben Sie falschgespielt?«
»Natürlich nicht, Lady. Ich war betrunken und habe Hugo Densons Platz am Tisch eingenommen, als er fortgegangen war. Dann habe ich gespielt und in meinem Zustand die Flasche vom Tisch geworfen. Mein Gewehr und meinen Revolver bin ich schon vorher losgeworden, verloren im Spiel, Lady. Ich habe mich dann nach der Flasche gebückt und mich an Brett Holloways Arm hochziehen wollen, aber dabei sind aus seinem Ärmel ein halbes Dutzend Würfel gefallen. Ich war klar genug, um zu erkennen, daß sie mich die ganze Zeit ausgenommen hatten. Und da bin ich wild geworden. Man schlug mich nieder, und ich erwachte dann, nun ja, Lady, eben im Jail.«
Sie bleibt stocksteif stehen und hebt die Hand zum Mund.
»Mein Gott, im Jail sind Sie aufgewacht? Ja, und dann? Hat Ihnen Sheriff Perkins wenigstens die verlorenen Sachen beschafft?«
»Nein«, erwidert er bitter. »Die drei Spieler hatten mir die angebohrten Würfel in die Tasche geschmuggelt und meine Sachen wieder zurückgegeben. Der Sheriff sollte glauben, daß ich der Falschspieler gewesen sei. Stunden hatte es gedauert, bis ich dem Sheriff klarmachen konnte, daß ich unschuldig war. Als ich aus dem Jail kam, verfolgten mich die drei Halunken.«
Clay nimmt das Netz aus dem Wasser und legt den letzten Fisch hinein.
»Du lieber Himmel, dann sind Sie nur in den Zug gestiegen, weil die Burschen hinter Ihnen her waren?«
»Nein, ich will in dieser Ecke jemanden treffen, einen alten Bekannten. Sie glauben mir natürlich kein Wort, schließlich ist Perkins sicher ein ehrlicher Sheriff, und ich bin folglich ein Lügner, ein Tramp dazu, aber was ändert das an der Geschichte?«
»Ich glaube Ihnen, Horton, so verrückt die Geschichte auch ist. Warten Sie, Salem hat mir da etwas gesagt, vor drei oder vier Jahren schon, irgend etwas von Brett Holloway. Der soll ihm schon früher mal begegnete sein, als Spieler in einem Saloon in Rapid City. Warten Sie, Horton, wenn ich mich recht erinnere, dann hat Salem mir gesagt, daß dieser Brett einen Mann in Deadwood erschossen haben soll, der ihn des Falschspieles bezichtigte. Wenn die Sache so ist, dann kann alles stimmen.«
»Sie kann nicht nur, sie stimmt«, brummt Clay düster. »Denson muß es auch wissen, genau wie Harry Holloway. Sie haben gedacht, einen Tramp aus Texas vor sich zu haben, nur einen harmlosen, betrunkenen Tramp. Vielleicht sollte die ganze Sache ein harmloser Spaß sein, jedenfalls so lange, bis ich die Würfel aus dem Ärmel von Brett Holloway fallen sah. Erst dann wurde daraus blutiger Ernst. Nun, Lady, ich bin hier ein Fremder, jemand, dem man kaum glauben wird. Der Sheriff hat den Burschen ja auch geglaubt.«
»Perkins ist gewiß kein schlechter Mann, er ist früher für uns geritten und von uns gewählt worden. Ich glaube Ihnen trotzdem, Horton.«
»Danke, daß Sie mir glauben, Lady. Doch reiten Sie zur Ranch, ich gehe allein weiter.«
»Ja, zum Teufel, Horton, und diese Burschen sollen ungestraft aus der Geschichte herauskommen?«
»Ich habe nicht einmal einen Revolver«, sagt er gallenbitter. »Und dann, mir ist weiter nichts passiert. Ich kann nur eins tun, wenn ich etwas beweisen will: Gewalt anwenden. Und was das heißt, das weiß hier jeder. Ich glaube, darin steht Wyoming Texas in nichts nach, wie?«
»Ja, wahrscheinlich würde es einen Kampf geben. Haben Sie Angst vor dem Kampf? Ach so, Ihr Pferd…«
»Sie meinen, weil ich mein Pferd nicht erschießen konnte, da muß ich auch Angst haben, auf einen Mann mit dem Revolver loszugehen? Lady, ich schieße niemals gern, niemals. Ich will keinen Kampf wegen dieser Narrheit. Kampf heißt schießen, schießen heißt treffen. Und treffen bedeutet am Ende töten. Ich habe die Nase davon voll.«
Er wirkt plötzlich kalt und zornig. Ein Mann, der sich erregt und allein sein möchte. Sie begreift gleichzeitig, daß er noch seltsamer ist, als sie gedacht hat. Von jenem Augenblick an, in dem sie ihn verstört und wie zerbrochen über die Straße in Cheyenne hatte gehen sehen, von dieser Sekunde an hat sie immer wieder an den Mann denken müssen, der sein Pferd nicht hat erschießen können. Sie erinnert sich noch genau an den Abend, an dem Denson auf ihre Ranch kam und die Sache mit dem Gaul erzählt hat.
Big Needhan hatte nur dagesessen und seine Tochter angesehen. Und sie hat gewußt, daß Big Sam den Mann verstand, denn ihr Vater ist ein Pferdenarr und besitzt die besten Pferde auf hundert Meilen in der Umgebung.
»Ich habe nicht gedacht, daß Sie feige sind, Horton. Nun gut, wohin wollen Sie von hier aus?«
»Nach Saratoga«, erwidert er nach kurzem Zögern und nimmt sich vor, irgendeinen Namen zu erfinden, wenn sie nach dem Mann fragen sollte, den er zu treffen beabsichtigt.
»Gut, Horton, Sie kommen mit zur Außenstation, dort gebe ich Ihnen ein Pferd. Dann reiten Sie nach Saratoga.«
»Lady, Sie wollen mir ein Pferd geben?«
»Ja, ich habe es gesagt. Wir haben genug Pferde da draußen. Dort ist nur unsere Pferdestation. Mein Vater und Brian Waltman sind am Nachmittag auf die Jagd in die Pennocks geritten. Sie bekommen ein Pferd, Horton.«
Sie schenkt mir ein Pferd, oder borgt sie es mir nur? denkt Clay. Das ist ja verrückt! Wie kommt sie dazu, mir ein Pferd zu geben?
»Hören Sie, Miss Needhan, ich kann das nicht annehmen. Ich kann ein Lügner, ein wirklicher Tramp sein.«
»Reden Sie nicht solchen Unsinn zusammen, Horton. Kommen Sie, es ist dunkel, ehe wir dort sind. Nun, was ist noch?«
»Ich möchte wirklich nicht.«
»Dann gehen Sie doch zum Teufel«, sagt sie wild. »Ich will Ihnen nur helfen. Und alles, was Sie Narr tun, das ist, mit Ablehnung zu antworten. Gehen Sie zum Teufel!«
Sie rafft ihre Angel auf, greift nach dem Fischnetz und geht zu ihrem Pferd. Sie ist zierlich gebaut und geht in ihrem Zorn sehr schnell. Dann schwingt sie sich in den Sattel, blickt ihn von oben grimmig an und sagt scharf: »Folgen Sie meiner Spur, Mister. Sie werden auf die Station stoßen und dort ein Pferd am Stall angebunden finden, auch einen Revolver. Und dann hole Sie der Teufel!«
Sie reitet an. Er bleibt verstört stehen und sagt, während er dem Hufschlag lauscht und sich am Kinn kratzt: »Alle Teufel, dieses Girl hat nicht nur Feuerhaare, sondern auch Feuer in den Adern. So weit kommt das noch, daß sie mir ein Pferd schenkt. Ich lasse mir nichts schenken. In diesem Wyoming sind die Leute allesamt verrückt und nicht mehr zurechnungsfähig. Ich werde gehen, aber nicht auf diese Station.«
Er packt seinen Sattel auf den Rücken, nimmt das Gewehr als Tragestock nach vorn unter den Armen durch und marschiert los. Und genau wie vorher hält er sich südwestlich und nicht etwa an die Fährte, die Sandra Needhans Pferd gezogen hat. Er entfernt sich im spitzen Winkel immer mehr von der Fährte und marschiert leise summend in die dunkle Nacht hinein.
Clay Horton läßt sich nichts schenken, schon gar nicht von einer Lady. Genauso ist es!
Horton marschiert stur wie eine Maschine nach Südwesten. Seine feuchten Sachen trocknen, die Luft ist noch warm genug, es wird erst gegen Mitternacht kühler.
Es mag keine Viertelstunde vergangen sein, als er den Hufschlag hinter sich hört, er dreht sich um. Aus dem Schatten der Dämmerung kommt die rostbraune Stute mit Sandro angefegt.
Das Girl sitzt wie des Teufels wahrhaftiges Verführungsgirl im Sattel und hat anscheinend den Zorn von des Teufels Großmutter im Bauch, denn sie rast im halsbrecherischen Tempo genau auf ihn zu und reitet ihn um ein Haar nieder. Als sie endlich anhält und sich vorbeugt, da sieht er in den Lauf ihres zweiunddreißiger Revolvers.