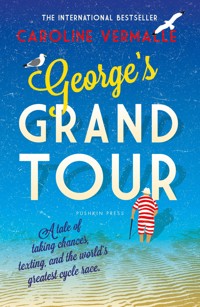4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England, 1770. Als der junge Gärtner Francis Masson den Auftrag erhält, im Namen des englischen Königs in Afrika nach einer raren Orangenblüte zu suchen, ahnt er nicht, dass ihm das Abenteuer seines Lebens bevorsteht. Während seiner Jagd nach der geheimnisumwobenen Blüte erwarten ihn nicht nur ungebändigte Natur, sondern auch manch raffinierte Intrige seitens konkurrierender Pflanzenjäger. Als er Bekanntschaft mit dem exzentrischen Botaniker Carl Thunberg und dessen eleganter Begleitung macht, nimmt Massons Schicksal abermals eine unerwartete Wendung ...
Ein wunderbar lebendig erzählter Entdeckerroman vor der farbgewaltigen Kulisse südafrikanischer Blütenpracht.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
Epilog
Nachwort der Autoren
Über die Autoren
Weitere Titel der Autorin
Fußnote
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
England, 1770. Als der junge Gärtner Francis Masson den Auftrag erhält, im Namen des englischen Königs in Afrika nach einer raren Orangenblüte zu suchen, ahnt er nicht, dass ihm das Abenteuer seines Lebens bevorsteht. Während seiner Jagd nach der geheimnisumwobenen Blüte erwarten ihn nicht nur ungebändigte Natur, sondern auch manch raffinierte Intrige seitens konkurrierender Pflanzenjäger. Als er Bekanntschaft mit dem exzentrischen Botaniker Carl Thunberg und dessen eleganter Begleitung macht, nimmt Massons Schicksal abermals eine unerwartete Wendung …
Caroline Vermalle undRyan von Ruben
EINE BLUMEFÜRDIE KÖNIGIN
Aus dem Französischen von Gabi Reichart-Schmitz
FÜR HEATHERUND RUSSEL
1. KAPITEL
21. NOVEMBER 1805, KANADA
»Wenn ich noch einen Nachruf schreiben muss, dann sterbe ich – das schwöre ich«, sagte Jack Grant und zog die Winkel seiner dunkelroten Lippen verdrießlich nach unten.
Die Reisekutsche rumpelte dahin, und das Pferdegespann reagierte schnaubend auf die Peitsche des Kutschers und unterbrach dadurch die bleiche Stille eines Novembermorgens auf der Straße von Montreal nach Pointe-Claire. Sowohl die Kutsche als auch die Pferde bildeten schwarze Tupfen in der unermesslichen Weite der weißen Landschaft unter einem stahlgrauen Himmel.
Der Kutscher, der sich tief in seinen dicken Mantel vergraben hatte, hielt Ausschau nach Schlaglöchern oder Anzeichen von Eis, während seine beiden Passagiere sich unter ihre Decken und dicken Schals verkrochen, denn das Innere der Kutsche bot nur wenig Schutz vor dem kanadischen Winter.
Jack heftete den Blick auf seinen Vater und versuchte, dessen Gemütslage auszuloten, während er sich fragte, mit wie viel Nachdruck er auf seinem Standpunkt beharren sollte.
»All diese erfüllten Leben! Da muss ich unwillkürlich daran denken, wie kurz mein eigener Nachruf sein wird, falls ich nicht bald etwas Sinnvolleres in Angriff nehme. Ich brauche eine eigene Kolumne, Vater.«
Der ältere Mann reagierte nicht, sondern las weiter in den Dokumenten, die auf seinem Schoß lagen. Ab und zu hielt er inne, um mit einem Bleistiftstumpf bedächtig Berechnungen auf den Rändern jeder Seite durchzuführen, während die Winterlandschaft an der Kutsche vorbeizog.
Als Jack schon glaubte, dass sein Vater ihn vielleicht gar nicht gehört hatte, nahm George Grant schließlich seine Brille ab, rieb sich die Nasenwurzel und blickte zu seinem Sohn hinüber. Er fand es bemerkenswert, wie wenig sie sich äußerlich ähnelten. George war klein und untersetzt und hatte einen kräftigen Brustkasten und breite Schultern. Sein Gesicht war zwar größtenteils von einem ordentlich gestutzten Bart bedeckt, aber man konnte sehen, dass seine Gesichtszüge deutlich vom Leben geprägt waren. Jack hingegen war groß und dünn, und sein Gesicht sah aus, als wäre es aus feinstem Kristall geschnitten, und zeigte noch keinerlei Spuren von Sorgen und auch keinen Bartwuchs. Während sein Vater fast vollkommen stillsitzen konnte, war er ständig in Bewegung, rutschte herum, zupfte an einem Rockaufschlag oder zog eine Manschette an seinem Ärmel zurecht. George kam es so vor, als würde alles an seinem Sohn vor Ungeduld vibrieren.
»Das haben wir doch schon mehrmals besprochen, Jack«, sagte er. »Du musst erst Erfahrungen sammeln und die Welt kennen lernen, bevor du sie beurteilen kannst. Man muss erst kriechen können, bevor man …«
»Aber wie soll ich Erfahrungen sammeln, wenn ich nur die Taten von Verstorbenen aufliste? Ich brauche etwas, an dem ich mich festbeißen kann, etwas Ernstzunehmendes!«, fiel Jack ihm ins Wort.
»… laufen lernt«, fuhr George in müdem Ton fort und ignorierte die Unterbrechung einfach. »Außerdem gibt es nicht viele Dinge, die ernster zu nehmen sind als das Verfassen passender Grabinschriften für die Verstorbenen. Das ist eine gute, sinnvolle Arbeit, Jack.«
»Sinnvoll?« Jack erstickte fast an dem Wort. »Tag für Tag reduziere ich ganze Leben auf wenige Zeilen, und kaum jemand macht sich die Mühe, sie überhaupt zu lesen. Wo liegt da der Sinn? Mit einer Kolumne hingegen hätte ich die Freiheit, all diesen Heldentaten den Raum und die Bedeutung zuzumessen, die ihnen gebühren.«
»Im Leben geht es um mehr als um großartige Leistungen und Heldentaten, Jack.«
Ein plötzlicher Ruck beendete die Debatte und schleuderte beide Männer aus ihren Sitzen. Kisten voller Orangen und Gepäckstücke, die auf den Ablagen über ihren Köpfen verstaut waren, purzelten herunter und sorgten für eine vorübergehende Pause im Wortgefecht zwischen Vater und Sohn.
»Was war das denn?«, fragte Jack erschrocken.
George Grant klopfte an das Dach der Kutsche und unterbrach damit die gedämpfte Fluchtirade, die vom Kutschbock ins Innere der Kutsche drang. »Smithers!«
Der Kutscher zügelte die Pferde und hielt die Kutsche an, bevor er vom Bock sprang. »Ein Mann auf der Straße, Sir. Er hat sich direkt vor die Pferde geworfen!«
»Dort!«, rief Jack, der sich umgedreht hatte und aus dem Rückfenster zeigte. Ein paar Meter hinter ihnen taumelte neben der Straße eine schemenhafte Gestalt und wurde anschließend vom Nebel verschluckt.
»Sind die Pferde unversehrt?«, wollte George Grant wissen.
»Unversehrt genug, um uns nach Hause zu bringen, Sir.«
»Nun gut, dann lasst uns weiterfahren. Wir sind schon spät dran, und Mrs Grant wird nicht erfreut darüber sein.«
»Wollen wir ihm denn nicht helfen?«, protestierte Jack.
»Sei kein Narr, Jack. Schließlich könnte es sich um einen Straßenräuber handeln. Zudem verschlechtert sich das Wetter.« George Grant warf einen letzten Blick nach hinten in den Nebel, bevor er die Angelegenheit mit den Worten »Auf geht’s« beendete.
Doch bevor der Kutscher die Bremse lösen konnte, hatte Jack die Tür aufgerissen und war auf den vereisten Weg hinabgestiegen.
»Straßenräuber werfen sich nicht vor Pferdekutschen. Der Mann weiß eindeutig nicht mehr weiter, höchstwahrscheinlich ist er verletzt. Und jetzt willst du ihn sterben lassen?« Herausfordernd blickte er zu seinem Vater hoch, drehte sich um und marschierte die Straße entlang zu der Stelle, an der die Gestalt verschwunden war.
Die beiden Männer, die bei der Kutsche zurückblieben, sahen Jack nach, der bald in Nebel und Schnee verschwunden war. »Der Eissturm hat uns fast erreicht, Sir«, sagte der Kutscher trocken. Stumm blickte George zum Himmel, bevor er tief aufseufzte, sein Gewehr aus der Halterung hinten im Wagen nahm und in den Schnee hinunterstieg.
Inzwischen hatte Jack die Straße verlassen und stapfte durch kniehohen Schnee. Der Saum seines Überrocks war bereits durchnässt und schleifte hinter ihm her. Mit der ganzen Autorität seiner neunzehn Jahre rief er: »Hallo, Sir, sind Sie verletzt?«
Doch die rätselhafte Gestalt blieb verschwunden, verschluckt von der Kälte und dem Nebel. Das Gewieher der Kutschpferde, die nun ungeduldig wurden, weil sie die Nähe ihres Stalles spürten, wurde über den Schnee getragen. Es war das einzige Geräusch, das über dem Rauschen des aufkommenden Nordostwindes zu hören war. Jack hielt kurz inne, um zu verschnaufen, und setzte dann seinen Weg die Böschung hinunter fort. Mit jedem knirschenden Schritt schwand sein Eifer. Plötzlich blieb er stehen.
Mittlerweile hatte George ihn eingeholt und warf einen Blick auf das, was Jack zum Stehenbleiben veranlasst hatte: Blutstropfen im Schnee.
Mit einem Nicken forderte George seinen Sohn zum Weitergehen auf. Nachdem Jack nun mit einem handfesten Beweis für die Existenz des Fremden konfrontiert worden war, wich sein selbstbewusstes Gehabe Furcht und Unsicherheit. Er zögerte.
Missbilligend presste George die Lippen zusammen, während er sich an seinem Sohn vorbeidrängte und den rot-grauen Fußabdrücken folgte, die sich weiter von der Straße entfernten und auf die Baumgrenze zuhielten.
Als er sich weiter vorarbeitete, tauchten allerlei seltsame Gegenstände auf, die im Schnee verstreut lagen: Beutel aus Sackleinen, Ziegenledertaschen, Holzschachteln in allen möglichen Größen, eine Schere, ein kleiner Spaten und etwas, was wie ein kleines Fernglas aussah, das auf einer Art Messingständer befestigt war. Doch am merkwürdigsten war ein verrosteter Vogelkäfig, in dem sich leuchtend gelbe Blumen befanden, die je vier rankenartige Blütenblätter besaßen.
Das Rauschen des Windes legte sich vorübergehend, und stattdessen war ein leises, rasselndes Geräusch zu hören, das aus einer Senke ganz in der Nähe drang. George Grant spannte den Hahn seines Gewehrs und lauschte aufmerksam, bevor er sich weiterwagte. Und dann sah er ihn.
In einem flachen Graben lag ein alter Mann. Sein Mantel und seine übrige Kleidung ließen auf einen gewissen Wohlstand schließen. Doch obwohl sie von Schnee und Blut durchnässt waren, konnte man deutlich erkennen, dass ihr Glanz schon lange verblasst war. Auf die Ellbogen des Mantels waren Flicken genäht, und die Holzabsätze seiner Stiefel waren abgelaufen. Das leise Geräusch seines schwachen, stoßweisen Atems hing kurz in der Luft, ehe es vom Nebel erstickt wurde.
»Sir, ist alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte George und suchte mit den Augen die Umgebung ab, bevor er sich wieder dem alten Mann zuwandte.
Doch abgesehen von dem mühsamen Rasseln seines Atems gab der alte Mann keinen Ton von sich. Seine Fingerspitzen, die schon ganz weiß waren und zu erfrieren begannen, umklammerten mehrere abgenutzte, ledergebundene Tagebücher. Sie wurden von einem Lederriemen zusammengehalten, der mit einem Schloss gesichert war.
»Vater, ist er …?«
»Noch nicht, doch wir müssen uns beeilen. Hier, nimm das Gewehr. Und bring seine Sachen mit.«
George legte sich den alten Mann mit Leichtigkeit über die Schulter und machte sich auf den Rückweg zur Kutsche. Jack folgte ihm und sammelte unterwegs die verstreuten Besitztümer des Fremden ein.
»Smithers!«, rief George, als sie sich dem Wagen näherten.
Der Kutscher, der den Ruf durch die Windböen kaum hören konnte, zog die Bremse an, bevor er heruntersprang, um die Tür zu öffnen.
Sobald er den alten Mann auf Jacks Sitzbank gelegt hatte, zog George ihm den nassen und blutbefleckten Mantel aus und hüllte ihn in eine der Decken. Nachdem der Fremde versorgt war, stieg auch Jack in die Kutsche.
Während jetzt Hagelkörner auf das Dach prasselten, setzte sich die Kutsche in Bewegung und nahm allmählich an Fahrt auf. Das Knallen der Peitsche war über dem Wind, der sie nach Hause trieb, kaum noch zu vernehmen.
2. KAPITEL
Mit seinen zwei Stockwerken war das Haus der Grants zwar nicht klein, jedoch auch nicht überwältigend geräumig. Es hatte ein Schindeldach, eine weiß gestrichene Holzverschalung und weiße Fensterrahmen. Damit war es ein gutes, wenn nicht sogar repräsentatives Beispiel für den georgianischen Stil, den wohlhabende Händler und Kaufleute bevorzugten, die sich für ein Leben in der ländlichen Umgebung von Montreal entschieden hatten.
In sämtlichen Räumen prasselten Feuer, und die warmen Farben von polierten Holztischen, Eichendielen, Velourstapeten und Polsterstühlen hätten kaum einen größeren Kontrast zu der eiskalten, einfarbigen Landschaft draußen vor den Fenstern bilden können.
Bedienstete eilten mit verhaltener Hast hin und her, fegten, staubten ab und verrückten alles, was nicht niet- und nagelfest war. Im Mittelpunkt der Betriebsamkeit bewegte sich Mary Grant wie das Auge des Sturms, hinterließ jedoch nicht Chaos und Zerstörung, sondern Ordnung und ein gesundes Maß an Präzision.
Sie trug ein tiefblaues Hauskleid, und ihr dunkles Haar war unter einer gestärkten Haube verborgen. Die langen kanadischen Winter hatten ihre Spuren in ihren einst zarten und feinen Gesichtszügen hinterlassen. Aber auch wenn sie nicht mehr über die jugendliche Schönheit verfügte, die so viele Blicke auf sich gezogen hatte, so war doch an ihre Stelle eine starke Persönlichkeit getreten, die kaum weniger Aufmerksamkeit erregte.
»Dieser Sturm sollte besser nicht mehr lange dauern, sonst werden sich unsere Gäste gezwungen sehen, zu Hause zu bleiben«, sagte sie und sah aus dem Fenster des Speisezimmers, während sie einen alten Spitzentischläufer ausrollte. Danach wandte sie sich an ihren Sohn: »Dies war nicht der richtige Zeitpunkt, um den barmherzigen Samariter zu spielen, Jack. Ganz und gar nicht der richtige Zeitpunkt.«
»Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, Mutter?«, fragte Jack amüsiert. Er stand vor dem Feuer und wärmte sich.
»Jederzeit, nur nicht an Thanksgiving!«, konterte Mary, ehe sie sich wieder auf ihren Tisch konzentrierte und das polierte Silberbesteck überprüfte, das gerade aufgelegt wurde.
»So ist’s recht!«, bemerkte Jack ironisch.
»George! George! Hast du herausgefunden, wer er ist?«, fragte Mary ihren Mann, der gerade mit einer ramponierten Kiste Orangen die Treppe hinaufstieg, die aus der Küche im Untergeschoss heraufführte.
»Es ist alles in Ordnung, kein Grund, sich Sorgen zu machen«, sagte er, wobei er erst Mary und danach demonstrativ Jack ansah. »Er ist kein Straßenräuber. Inzwischen ist er verbunden und ruht in der Nähe des Feuers. Jack, warum lässt du nicht deine Mutter in Ruhe und setzt dich zu ihm?«
»Nicht nötig«, erwiderte Jack. »Großmutter ist ja dort.«
»Oh, komm schon, Jack«, sagte Mary, die einen weiteren Streit zwischen Vater und Sohn verhindern wollte. »Du kannst mir hier nicht helfen, und außerdem solltest du ihm etwas Tee bringen. Vielleicht kommt er dann wieder zu Kräften.«
»Na schön«, antwortete Jack.
»Eine interessante Lektion für dich, Jack«, sagte George und legte seinem Sohn im Vorbeigehen leicht die Hand auf die Schulter.
»Und welche wäre das?«, erkundigte sich Jack mit belegter Stimme.
»Konsequenzen tragen.«
Jack schüttelte die Hand seines Vaters ab und verließ den Raum mit großen Schritten. Wie ein Korken in einer Flasche steckte sein Kopf zwischen seinen Schultern und hielt den Unwillen unter Verschluss, der sich einen Weg bahnen wollte.
Mary korrigierte die Gedecke und kontrollierte sorgfältig die Abstände zwischen den Besteckteilen. Ohne aufzublicken, erkundigte sie sich: »Wie schwer ist er denn verletzt?«
George zögerte und wägte seine Antwort bedächtig ab. »Ich weiß, wie viel dieser Abend dir bedeutet, aber den alten Jungen hat’s böse erwischt. Außerdem ist das Wetter äußerst garstig. Doch du wirst bestimmt zurechtkommen, wie immer.« Er nahm eine Orange aus der Kiste und hielt sie ihr als Versöhnungsangebot hin.
Doch Mary verschränkte die Arme vor der Brust, und ihre Stimme wurde hart. »Mir tut es auch leid, George, aber schlechtes Wetter hin oder her, wir erwarten acht Gäste zum Essen. Vier davon bleiben über Nacht, das Personal nicht mitgerechnet. Wir haben einfach nicht genug Platz. Der Mann muss noch vor heute Abend fort sein.«
»Also gut.« George seufzte und legte die Orange zurück in die Kiste. Nach all den Jahren und unzähligen Thanksgiving-Festen hätte er es eigentlich besser wissen müssen. Um Mary Grant zu besänftigen, reichte eine exotische Frucht nicht aus, selbst wenn sie ein kleines Vermögen gekostet hatte.
»Ich meine es ernst, George. Lass nach dem Arzt schicken und bezahl dem Mann ein Zimmer im Gasthaus, wenn es nötig sein sollte, aber er kann nicht …«
»Ja, meine Liebe«, erwiderte George und wandte sich zur Treppe. »Heute Abend wird er nicht mehr hier sein, versprochen.«
3. KAPITEL
Die flackernden Schatten des Feuers huschten über die niedrige Decke der Sommerküche. Es handelte sich um einen einstöckigen, kastenförmigen Anbau an das Haupthaus, der aus einem einzigen, rechteckigen Raum mit einem einfachen Kiefernholzboden und schlichten, weiß getünchten Wänden bestand. Die drei Schiebefenster an zwei Seiten, die ein Querlüften zuließen, um den Raum im Sommer zu kühlen, waren nun gegen die Kälte fest geschlossen. Die Ritzen zwischen den Fensterscheiben und den Rahmen hatte man mit grobem Stoff abgedichtet.
Die Sommerküche war jetzt für die Vorbereitungen des Thanksgiving-Dinners in Betrieb genommen worden; außerdem sollten dort die Dienstboten jener Gäste untergebracht werden, die über Nacht bleiben würden. Überdies war der Raum auch als vorübergehende Krankenstube bestens geeignet: Da sowohl im Steinofen als auch in der offenen Herdstelle Feuer brannten, war er schön warm. Und er lag abgeschieden genug, sodass der Haushalt bei seinen Vorbereitungen für die Abendveranstaltung nur minimale Beeinträchtigungen hinnehmen musste.
Der alte Mann, der in Decken gehüllt war und einen Kopfverband trug, saß in einem Schaukelstuhl vor dem Herd. Er hatte das Gesicht den Flammen zugewendet und genoss die Wärme – wie eine welkende Blume, die im Sonnenlicht badete. Sein Gesicht war von tiefen Furchen auf der Stirn durchzogen, und seine Mundwinkel hingen leicht nach unten. Zusammen mit den Krähenfüßen, die von den Augen bis zu den Ohren reichten, ließ die Landkarte aus Falten in seinem Gesicht auf ein Leben schließen, in dem er genauso viel Zeit mit ernsthaften Gedanken wie mit freudigen Momenten verbracht hatte. Jedoch wurde Letzteres hauptsächlich durch die Augen und weniger durch das gesamte Gesicht übermittelt.
Seine Hände waren wettergegerbt, und ihre beachtliche Größe wurde etwas kaschiert durch das Alter und eine Arthritis, die sie auf Dauer zusammengekrümmt hatten. Seine Finger waren hellgelb verfärbt, weil er viele Jahre mit Gerbrinde hantiert hatte, doch sie bewegten sich mit einer Präzision und Geschicklichkeit, die nur leicht durch die altersbedingten Beschwerden beeinträchtigt wurden. Seine Augen waren hellgrün, als wären sie durch die jahrelange Einwirkung derselben Umwelteinflüsse ausgewaschen worden, die auch sein Gesicht und seine Hände in Mitleidenschaft gezogen hatten.
Sein Blick huschte vorsichtig zwischen dem Feuer und der Gestalt hin und her, die schweigend in einer Ecke des Raumes saß. Auf einem harten Stuhl mit einer hohen Rückenlehne saß Mary Grants Mutter vor einem der Fenster und stickte. Ihr Gesicht lag im Schatten ihrer Haube.
»Guten Tag«, hatte der alte Mann zur Begrüßung gesagt, doch die alte Frau schien ihn nicht gehört zu haben. Ohne aufzusehen, konzentrierte sie sich weiterhin auf die Arbeit in ihrem Schoß, wobei ihre Finger behände der Spitze der Nadel auswichen, die einen leuchtend orangefarbenen Seidenfaden hinter sich herzog.
»Großmama ist nicht taub, sie hat nur einfach nichts mehr zu sagen«, erklärte Robert Grant, Jacks neunjähriger Bruder, der auf den Knien neben dem Feuer hockte und die Hände im Schoß gefaltet hielt. »Das sagt Mutter jedenfalls immer. – Stimmt es, dass Sie beinahe tot waren und mein Bruder Sie dann gerettet hat?«, wechselte er das Thema, während er die Gegenstände musterte, die Jack aus dem Schnee aufgesammelt hatte und die jetzt auf dem Boden neben dem alten Mann ordentlich aufgereiht lagen.
»O ja«, antwortete der alte Mann, löste den Blick von der Gestalt in dem Stuhl und sah den Jungen mit einem Ausdruck echter Verlegenheit an. »Dein Bruder hat einen alten Esel vor sich selbst gerettet. Was für ein couragierter junger Mann er ist … genau wie dein Vater. Oh, welche Unannehmlichkeiten meine Anwesenheit deiner Familie bereiten muss.«
Die alte Frau hob weder den Blick von ihrer Handarbeit, noch protestierte sie, als er den Versuch unternahm aufzustehen. Doch der Schaukelstuhl, die zahlreichen Decken und sein Kräftemangel verbündeten sich gegen ihn und zwangen ihn, sein Vorhaben aufzugeben. Durch die Anstrengung bekam er einen Hustenanfall, und er ließ seinen bandagierten Kopf wieder an die hohe Lehne des Stuhls sinken.
»Junger Mann, wäre es zu viel verlangt, dich zu bitten … Mein Mantel …«
Robert tat ihm den Gefallen, sprang auf und lief quer durch den Raum zu dem Ständer neben dem Herd, auf dem man das Kleidungsstück zum Trocknen aufgehängt hatte. Nervös tastete der alte Mann mit seinen wunden, roten Händen das Futter ab, fand aber nicht, wonach er suchte.
»Hmm.« Sein Blick huschte von dem Mantel zum Boden neben seinem Stuhl. »Offenbar habe ich meine Brille verloren. Egal … Hast du ein in Leder gebundenes Tagebuch gesehen? – Ich hatte es bei mir, aber anscheinend ist es ebenfalls …« Mit einem Anflug von Panik suchte er mit zusammengekniffenen Augen den Fußboden und schließlich den ganzen Raum ab.
Ohne Zögern steuerte Robert auf den zerfetzten Stoffbeutel zu, der zu Füßen des Schaukelstuhls lag, und zog die ledergebundenen Tagebücher heraus. »Ist es das, wonach Sie suchen? Mein Vater hat erzählt, dass Sie die Bücher in den Händen hielten, als sie Sie gefunden haben. Sie wollten sie nicht loslassen.«
Der alte Mann griff unter die Decken und zog einen kleinen Schlüssel an einer Kette hervor. Er schob ihn in das Messingschloss am Riemen des Tagebuchs, der den Inhalt des Bündels zusammenhielt, und öffnete es. Nachdem er den Riemen gelöst hatte, konnte man erkennen, dass es sich nicht, wie es zuerst den Anschein gehabt hatte, um mehrere Bücher handelte, die lose zusammengebunden waren, sondern um einen einzigen dicken Band. Die Ledereinbände der Tagebücher waren zusammengenäht worden. Die kleinen Unterschiede in der Größe, der Papierart und in dem Abnutzungsgrad ließen darauf schließen, dass die Sammlung im Laufe der Zeit schrittweise erweitert worden war.
Jetzt schlug der Mann das Tagebuch hinten auf und blätterte die letzten Seiten zurück, die vollkommen leer waren. Schließlich stieß er auf fleckige, zerknitterte Blätter, die mit Anmerkungen versehene, minutiöse anatomische Zeichnungen von Pflanzen und Blüten enthielten, die jeweils ein vollständiges Exemplar darstellten.
Robert beugte sich vor, um besser sehen zu können, trat jedoch nicht näher, sondern hielt respektvoll Abstand. »Wissen Sie, ich kann schon Bücher lesen, in denen sich keine Bilder befinden.«
Der alte Mann verzog das runzelige Gesicht zu einem Lächeln. Als er fast genau in der Mitte des ersten Buches der Sammlung angelangt war, sah Robert, dass dort eine Seite fehlte. Auf der Seite, die dem zerrissenen Rest gegenüberlag, war statt einer richtigen Zeichnung nur eine Art rostfarbenes Wasserzeichen zu sehen, das den groben Umriss einer vogelähnlichen Gestalt zeigte.
»Was ist das?«, wollte Robert wissen.
»Bitte lassen Sie sich nicht durch meinen Bruder stören, Sir«, mischte sich Jack ein, ohne von der Anrichte aufzublicken, die an der dem Feuer gegenüberliegenden Wand stand und auf der er gerade einen Tee zubereitet hatte. »Wie fühlen Sie sich? Haben Sie all Ihre Sachen?« Jack stellte ein Tablett auf einem großen Tisch mitten im Raum ab und schenkte in die erste von mehreren Porzellantassen Tee ein.
»Oh, es scheint alles in Ordnung zu sein, danke.«
»Robert, sei so nett und bring das deiner Großmutter.« Robert stand widerstrebend auf, nahm die zerbrechliche Tasse mit der Untertasse und stellte sie auf einem kleinen Tisch neben seiner Großmutter ab. Die alte Dame reagierte nicht, sondern fuhr mit ihrer Handarbeit fort, als wäre sie ganz in die Einzelheiten des Musters versunken, das allmählich in dem Rahmen entstand.
»Darf ich Ihnen vielleicht ein wenig Tee und Gebäck anbieten?«, fragte Jack, während er Tee in einen verbeulten Blechbecher goss, den er von einem Haken an der Wand genommen hatte.
»Vielen Dank, sehr gern«, antwortete der alte Mann. »Leider habe ich mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Francis Masson, und ich stehe für immer in Ihrer Schuld, Sir.« Erneut versuchte er, sich zu erheben, um Jack die Hand zu schütteln, doch ihm fehlte die Kraft dazu. Mit einem entschuldigenden Lächeln sank er wieder in den Stuhl zurück.
Die Tasse und die Untertasse der alten Dame fielen klirrend zu Boden. Robert eilte herbei und hob die Porzellanscherben auf, während Jack sich alle Mühe gab, den Vorfall zu ignorieren. »Jack Grant. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr Masson.« Statt ihm die Hand zu schütteln, reichte Jack ihm den Tee. Der Gast schloss die Hände um den Becher und wärmte sich die Finger.
»Geht es dir gut, Großmutter?«, erkundigte sich Jack laut und deutlich.
Doch sie schien ihn nicht gehört zu haben, und nachdem Robert den verschütteten Tee mit einem Tuch aufgewischt hatte, richtete Jack seine Aufmerksamkeit wieder auf den alten Mann. »Wenn ich mir die Frage gestatten darf, Mr Masson, was hatten Sie bei solch einem Wetter auf dieser gottverlassenen Straße zu suchen?«
»Gott hat diese Straße nicht verlassen, denn Er hat Sie auf meinen Pfad geführt, Mr Grant.« Der alte Mann schloss die Augen, hob den Becher an seine Nase und atmete den Duft des Tees ein. »Ich habe nach Pflanzen gesucht, nach Zauberhasel, um genau zu sein.« Vorsichtig nippte er mit geschlossenen Augen an seinem Tee. »Oh, der ist köstlich. Ceylon, nicht wahr?«
»Es tut mir leid, ich kenne mich mit Tee nicht besonders gut aus, Mr Masson, ich bin eher für Kaffee zu haben.« Jack sah zu, wie der alte Mann seinen Tee trank: Bei jedem Schluck schloss er die Augen und atmete tief ein, bevor er vorsichtig und mit Bedacht schluckte.
»Nun, Ihre Familie sorgt sich doch sicherlich um Sie, nicht wahr?«, fuhr Jack fort. »Der Sturm ist inzwischen fast vorüber. Sobald es sicher ist, wird Smithers Sie nach Hause fahren. Wo wohnen Sie denn?«
»Meine Familie? O nein, ich … ich lebe allein. Eigentlich wollte ich nach England segeln, allerdings hat sich das Auslaufen des Schiffes durch den Wetterumschwung verzögert. Daher bin ich auf die Idee gekommen, noch einen letzten Streifzug zu unternehmen.«
In diesem Moment fielen ein paar Wintersonnenstrahlen durch die nach Süden zeigenden Fenster und deuteten das Ende des Sturmes an. Robert stand auf, ging zum Fenster und sah hinaus. Der Garten war in eine Welt aus Kristallen und Eiszapfen verwandelt worden, die in der zaghaften Sonne glitzerten und funkelten.
»Dieser Eissturm war nicht ohne, stimmt’s?«, meinte der alte Mann. »Ich habe zum ersten Mal einen miterlebt. Dieses Klima, die Kälte … Ich fürchte, daran werde ich mich nie gewöhnen.«
»Kommen Sie nicht aus dieser Gegend?«
»Aus England. Na ja, ursprünglich aus Schottland. Doch Seine Majestät der König hat mich vor einigen Jahren hier hergeschickt.«
»Tatsächlich?«, fragte Jack, und sein überraschter Ton verriet seine Skepsis. »Und in welcher Eigenschaft, wenn ich fragen darf?«
»Ich bin … ich war … sein Gärtner. Man könnte wohl sagen, dass ich hergekommen bin, um zu suchen. Sie sind so unglaublich, diese Blumen. Und diese Kälte ist viel schlimmer, als ich erwartet habe. Inzwischen habe ich mich so an die Hitze gewöhnt …« Seine Stimme wurde leiser und verstummte schließlich, während er in seinen Träumereien versank.
»Mein geografisches Wissen ist nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte«, sagte Jack, dessen Geduld allmählich nachließ. »Dennoch erinnere ich mich nicht daran, dass England ein besonders warmes Klima hätte, und Schottland schon gar nicht.«
»Das stimmt.« Der Mann trank den letzten Rest Tee aus dem Blechbecher. »Aber wissen Sie, meistens habe ich Pflanzen in Afrika gesammelt.«
»In Afrika?«, stieß Robert mit leuchtenden Augen hervor. »Haben Sie Löwen gesehen? Haben Sie einen erlegt?«
»Also wirklich, Robert!«, rügte Jack verächtlich.
»Der Löwe hat mich beinahe umgebracht!«, rief der Fremde aus. »Ich versichere dir, junger Mann, dass ich nie wieder einem Löwen gegenüberstehen möchte.«
»Kannst du das glauben, Jack?«, fragte Robert aufgeregt. »Wie groß war er? Und wie haben Sie ihn getötet? Haben Sie ein Gewehr oder einen Speer benutzt?« Robert hüpfte auf und ab, lief quer durch den Raum und hielt ein eingebildetes Gewehr im Anschlag, wobei er schussähnliche Geräusche von sich gab.
»Also wirklich, Robert!«, unterbrach Jack, blickte seinen Bruder streng an und nahm dieselbe Haltung und denselben Ton an, die er schon so viele Male bei seinem Vater beobachtet hatte. »Ich bin sicher, dass Mr Masson zu erschöpft ist, um Geschichten zu erzählen. Lass ihn in Ruhe!«
»Das macht mir überhaupt keine Umstände, Mr Grant, wirklich nicht«, versicherte ihm der alte Mann, bevor er sich zu Robert umwandte und mit gedämpfter, verschwörerischer Stimme sagte: »In Afrika gibt es auch Nilpferde. Weißt du, was das ist? Hippopotamus amphibius …«
Robert lauschte mit offenem Mund, als der Mann zu einer detaillierten Beschreibung des Vierbeiners ansetzte. Jack hingegen verließ die Sommerküche, ging durch den Empfangssalon, durchquerte die Haupthalle und betrat den Speiseraum. Dort fand er seine Mutter vor, die gerade letzte Hand an den Festtagstisch legte. Sie trat einen Schritt zurück und erlaubte sich ein zufriedenes, kleines Lächeln, während sie ihr Werk begutachtete.
»Hübscher Tisch, Mutter. Ich würde sagen, das ist bislang dein schönster.«
»Danke, Jack. Aber ich dachte, du würdest nach deinem Gast sehen?«
»Nun, wenn du Lust hast, dir Märchen über Löwen und Nilpferde anzuhören, nur zu. Ich bin sicher, dass Mr Francis Masson, Diener des Königs von England, sie dir nur zu gern erzählen würde.« Flehend sah Jack seine Mutter an. »Ich habe getan, worum du mich gebeten hast, und mich um ihn gekümmert. Aber mehr kann ich nicht ertragen. Wo ist Smithers? Ist er schon startbereit?«
»Du kannst ihn jetzt nicht hinausschicken, Jack. Die Straßen sind noch vereist, es ist zu gefährlich«, sagte sein Vater, der gerade im Hausrock hereingeschlendert kam, das Hauptbuch in der Hand. »Übrigens, dieses Gerede über Löwen hört sich an, als wäre es genau das Richtige für unsere Zeitungsleser. Vielleicht holst du die Geschichte aus ihm heraus, bevor unsere Gäste eintreffen, was meinst du? Du hast doch gesagt, dass du es leid bist, Nachrufe zu schreiben.«
»Fantasiegeschichten über wilde Tiere sind nicht gerade das, was mir vorschwebte«, entgegnete Jack.
»Also wirklich, Jack, ich bin sicher, du übertreibst«, meinte Mary Grant und beendete damit das Wortgefecht zwischen Vater und Sohn. »Löwen, hier in Kanada? Der arme Mann muss wirklich etwas abbekommen haben. Vielleicht sollte ich selbst mal nach ihm sehen?« Sie ließ ein letztes Mal ihren Blick über den Tisch schweifen und ging mit Jack im Schlepptau zur Sommerküche.
***
Trotz der chaotischen Umstände an diesem Nachmittag musste Mary bei dem Anblick, der sich ihr beim Betreten der wohlig warmen Sommerküche bot, unwillkürlich lächeln: Robert saß mit großen Augen wie gebannt auf einer alten Holztruhe, die er herbeigezerrt hatte, damit er sich dem alten Mann gegenübersetzen konnte. Der Besucher wiederum, auf dessen Schoß das abgenutzte Lederbuch lag, hatte die Decken abgeschüttelt und beschrieb mit einer Energie und einer Lebhaftigkeit, die seinen geschwächten Zustand Lügen straften, unglaubliche Szenen.
»… und wenn du glaubst, dass sie ein Bad nehmen, nimm dich in Acht, denn sie laufen unter Wasser genauso schnell wie an Land! Oh, und dann sind da noch die Giftpfeile … Doch warte, ich muss mit dem Anfang beginnen. Mal überlegen, es war im Jahr 1772. Ach du meine Güte, ist das wirklich schon dreiunddreißig Jahre her? Es stimmt, nicht wahr? Wie schnell doch die Zeit vergeht.«
Masson hatte nicht gehört, dass sie hereingekommen waren. Jack blieb neben seiner Mutter an der Tür stehen und unterdrückte theatralisch ein Gähnen. Mit einem stummen Nicken und einem Stirnrunzeln forderte sie ihn auf, einzutreten. Zögernd gehorchte er.
Zufrieden, dass der alte Mann nicht wie ein Verrückter durchs Haus rannte und ihre sorgfältig durchgeführten Vorbereitungen durcheinanderbrachte, warf Mary einen letzten Blick durch den Raum, bevor sie sich zurückzog und leise die Tür hinter sich zumachte.
Masson hob den Kopf, als er hörte, wie die Tür geschlossen wurde, und warf der alten Frau, die sich immer noch in ihrer eigenen Welt zu befinden schien, einen Blick zu. Nach einer kurzen Pause wandte er sich wieder Robert zu, lächelte wehmütig und begann mit seiner Erzählung.
»Es war an einem heißen Sommertag in London – ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Alles begann mit einem Missverständnis.«
4. KAPITEL
MAI 1772, LONDON
Es gab keine Möglichkeit, der Sonne zu entrinnen, die erbarmungslos auf Ian Boulton und James Simmons herunterbrannte. Die beiden Männer standen am Ende des Crane Court, einer schmalen Sackgasse, die von der Fleet Street abzweigte. Dort befand sich der Sitz der Royal Society. Vor den Männern stand ein kleiner Tisch, den man neben den Haupteingang gestellt hatte, um das Kommen und Gehen der berühmten Mitglieder der Wissenschaftsgesellschaft nicht zu behindern. An dem gusseisernen Gitter hinter ihnen hing ein kleines Schild, auf dem mithilfe einer Schablone säuberlich in schwarzer Schrift die Worte Botanische Expedition geschrieben worden waren.
»Bestimmt herrscht viel Verkehr«, sagte Simmons und blinzelte mit zusammengekniffenen Augen unter seinem Dreispitz hervor in die Sonne. »Sie werden schon noch kommen.«
»Es ist bereits fünfundzwanzig Minuten nach zehn«, beklagte sich Boulton und ließ den Deckel seiner Uhr wieder zuschnappen, bevor er sie in die Tasche zurückschob und ein Taschentuch hervorzog. »Hatten Sie nicht geschrieben, um zehn Uhr am Südeingang? Zeigen Sie mir diese Anzeige noch einmal.« Er zerrte an seiner gestärkten Halsbinde und wischte sich über die Stirn. Während er die Zeitung betrachtete, die Simmons hastig auf dem Tisch ausbreitete, achtete er darauf, dass seine Perücke nicht verrutschte. Die Anzeige war mit Bleistift eingekreist, und während Boulton sie zum siebten Mal an diesem Vormittag durchlas, konnte er sich nicht vorstellen, wie sie es noch deutlicher hätten ausdrücken sollen, dass sich alle Bewerber am 1. Mai spätestens um zehn Uhr am Südeingang der Royal Society einzufinden hatten. Die Anzeige endete mit den Worten: »Nach diesem Zeitpunkt werden keine Bewerbungen mehr angenommen. Sämtliche Anfragen sind an Mr Boulton, Sekretär von Sir Joseph Banks, zu richten.«
Boulton schnaubte frustriert, nachdem er den Text zu Ende gelesen hatte. »Ist es denn überhaupt offensichtlich, dass das hier der Südeingang ist?«, fragte er in besorgtem Ton. »Vielleicht hätten Sie ein größeres Schild aufhängen sollen.«
»Das Schild wurde nach Ihren Vorgaben gefertigt, Sir. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Käme ein Gentleman, der nicht in der Lage ist, den Südeingang zu finden, denn überhaupt in Betracht? Schließlich sollte jemand, der sich um den Posten eines Pflanzenforschers bewirbt, Norden von Süden unterscheiden können.« Simmons grinste über seinen eigenen Scherz, während er die Zeitung wieder zusammenfaltete.
»Und darf ich Sie darauf aufmerksam machen, Simmons, dass Ihre Aufgabe als mein Assistent darin besteht, mich zu unterstützen? Sie können sich sicher sein, dass Sir Joseph sehr wohl in der Lage wäre, uns vor die Tür zu setzen, sollten wir mit leeren Händen zurückkehren. Dabei spielt es nicht die geringste Rolle, ob es sich nun um Süden oder um Norden handelt!«
In der Ferne schlugen die Bow-Glocken zur halben Stunde. Boulton fluchte leise und beobachtete hilflos, wie die Fußgänger, die in der Fleet Street unterwegs waren, allesamt an der Abzweigung zum Crane Court vorbeigingen, ohne auch nur das geringste Interesse zu zeigen. Immer hektischer tupfte er sich die Stirn ab, bis seine Perücke herunterzurutschen drohte.
»Nun denn, das war’s dann wohl, Simmons. Sie haben nicht zufällig einen Verwandten, der über die erforderlichen Qualifikationen verfügt, oder?« Boultons Ton klang fast schon hysterisch.
»Leider sind meine Leute allesamt in den Kolonien, Sir, wohingegen die Familie meiner Frau«, er schnaubte verächtlich, »bemerkenswerte Navigationsfähigkeiten bewiesen hat, um den Weg in mein Haus aufzuspüren, während sie jetzt anscheinend nicht mehr in der Lage sind, den Rückweg zu finden.«
Boulton starrte zu seinem kleinen Assistenten hinab und verstand nicht, wie dieser verdammte Mann den Ernst der Lage derart verkennen konnte. »Was schlagen Sie vor, was ich ihm erzählen soll? Hmm? Und was ist mit der Admiralität? Und dem König? O mein Gott!« Mittlerweile schwitzte Boulton so heftig und war so aufgelöst, dass Simmons nicht mehr unterscheiden konnte, ob ihm Schweißtropfen oder Tränen die Wangen hinunterliefen.
»Warten Sie einen Augenblick, Sir.« Simmons sah an Boulton vorbei auf einen Mann, der sich ihnen näherte. »Vielleicht hat uns das Glück doch noch nicht verlassen.«
Boulton folgte Simmons Blick und sah, wie ein Mann von der Fleet Street in den Crane Court einbog. Er trug einen ramponierten Holzkasten von der Größe einer Hutschachtel unter dem Arm.
Die grünen Augen des Mannes funkelten und standen im Widerspruch zu seinem ernsten Gesicht, das nicht jünger als dreißig Jahre wirkte. Er war kräftig gebaut und zupfte und zerrte beim Gehen an seiner sauberen und gepflegten Kleidung herum, als wäre sie ihm nicht richtig bequem. Die Sachen erweckten den Anschein, neu oder nur für eine spezielle Gelegenheit gekauft worden zu sein. Obwohl er glatt rasiert war, trug er sein Haar lang. Offenbar war es von derselben Sonne, die auch seine Haut gebräunt hatte, zu einem helleren Braunton gebleicht worden. Augenscheinlich in Eile hatte er es zu einem Pferdeschwanz gebunden, der unter einem Dreispitz hervorlugte, welcher im Gegensatz zum Rest seiner Kleidung abgenutzt und verschlissen wirkte.
Der junge Mann war groß und streckte die Brust heraus, jedoch nicht auf eine wichtigtuerische oder aggressive Weise. Seine aufrechte Haltung ließ lediglich auf eine gewisse Sicherheit und Zielstrebigkeit schließen, die – in Verbindung mit seiner Größe und seiner Statur – anderen die unterschwellige Botschaft übermittelte, dass es besser wäre, Platz zu machen, statt ihm den Weg zu versperren oder ihn zu behindern.
Doch Boulton war nicht in der Stimmung für solche Feinheiten. Er griff Simmons am Ellbogen und eilte mit ihm zusammen geradewegs auf den Mann zu. Als dieser das Paar auf sich zukommen sah, witterte er eine Konfrontation und zog den Holzkasten instinktiv mit dem linken Arm an die Brust, um den rechten frei zu haben. Dann wechselte er nach rechts, um ihnen aus dem Weg zu gehen, doch auch die beiden anderen Männer änderten ihren Kurs. Als ein Zusammenstoß fast unvermeidbar zu sein schien, schenkte Boulton dem Mann das überzeugendste Lächeln, zu dem er fähig war, breitete die Arme weit aus und blockierte so die Straße. »Wir dachten schon, Sie würden niemals kommen! Bitte beeilen Sie sich, Sir Joseph wartet schon.«
Der Mann ließ seinen Kasten sinken und fragte mit einem leichten Lowland-Akzent: »Sir Joseph Banks? Er wartet auf mich?«
»Allerdings«, antwortete Boulton eilig, und sein Lächeln wurde noch breiter, obwohl das kaum möglich schien. »Er ist gerade mit Vertretern der Admiralität zusammen und entscheidet darüber, wer an der Expedition teilnehmen wird. Wir müssen uns beeilen.«
»Ich fürchte, es handelt sich um ein Missverständnis«, sagte der Mann nachdrücklich. »Ich bin hier, um Samen und ein Musterexemplar der Paeonia albiflora auszuliefern.« Boulton warf Simmons einen Blick zu, doch der zuckte lediglich mit den Schultern.
»Aus China«, fügte der Mann hinzu und hielt den Kasten hoch. »Sie sind für Mr Solander von Mr Aiton.«
»Samen?«, fragte Boulton, der zwischen Verwirrung und Enttäuschung schwankte.
»Ja, Samen. Mein Name ist Francis Masson. Ich bin Gärtner im Dienste seiner Majestät des Königs in seinen Gärten in Kew.«
»Samen«, wiederholte Boulton ausdruckslos. »Also … kein Forscher.« Sein Blick schweifte ab.
Doch auf Simmons’ schlauem Gesicht breitete sich allmählich ein Lächeln aus. »Haben Sie Gärtner gesagt, Sir?«
»Ein einfacher Gärtner, um genau zu sein. Ich …«, setzte Masson an.
Doch Simmons schnitt ihm mit einem Anflug von Erregung in der Stimme das Wort ab. »Sie verfügen doch bestimmt über hervorragende Kenntnisse von Blumen und Pflanzen, oder?«
Simmons warf Boulton einen kurzen Seitenblick zu, der daraufhin sofort begeistert nickte. Da streckte Simmons die Arme aus, legte Masson die Hände auf die breiten Schultern, auch wenn er kaum hinaufreichte, und sah dem größeren Mann fest in die Augen. »Mr Masson, Sir, ich gehe davon aus, dass Sie sich guter Gesundheit erfreuen?«, fragte er und klopfte ihm dabei kräftig auf die Schulter, als wollte er dies überprüfen.
»Ja, schon«, antwortete Masson, während er versuchte, den erstaunlich festen Griff des kleinen Mannes abzuschütteln. »Allerdings fürchte ich, dass ich schon spät dran bin, und Mr Aiton wäre äußerst verärgert …«
»Können Sie Nord und Süd unterscheiden?«
»Selbstverständlich. Doch wenn Sie jetzt bitte zur Seite treten würden«, erwiderte Masson, der allmählich die Geduld verlor.
»Dann, Sir, sind Sie genau der Mann, den wir suchen! Ist es nicht so, Mr Boulton?«
Boulton musterte Masson gründlich und drehte sich wieder zu Simmons hin. Langsam wich seine besorgte Miene einem Lächeln. Überrascht von der Gewissheit, die er auf einmal verspürte, konnte er nur ein einziges Wort hervorbringen:
»Absolut.«
5. KAPITEL
Da sie keine Zeit mehr zu verlieren hatten, zerrten Simmons und Boulton den immer noch protestierenden Masson durch die Eingangstür und führten ihn vertäfelte, nach Tabak und alten Büchern riechende Gänge entlang.
Sir Christopher Wren, Samuel Pepys, der Earl of Halifax, Isaac Newton – kein einziger von ihnen lächelte. Vielmehr blickten sie freudlos unter wallenden Perücken hervor, für die Nachwelt auf Leinwänden festgehalten, welche die Wände der Korridore säumten, die die drei Männer nun entlanghasteten. Nach Auffassung der Royal Society verdienten diese Männer einen Platz in der ersten Reihe der aufgeklärten Welt. Masson konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass die Herren mit ihren starren Blicken eine unverhüllte Verachtung ausdrückten, während er an ihnen vorbeigezerrt wurde.
Allerdings war Boulton nicht in der Stimmung, eine Führung zu veranstalten oder die Geister der Verstorbenen zu beschwichtigen. Auch um die noch lebenden Mitglieder der Royal Society machte er sich wenig Gedanken, die entweder zu langsam gingen oder in bedeutungsvolle Grübeleien versunken waren und nun von dem Trio, das die Räume von Sir Joseph im ersten Stock schleunigst erreichen wollte, einfach zur Seite geschoben wurden.
»Blumen sind das neue Gold, Mr Masson«, keuchte Boulton, während seine mit silbernen Schließen versehenen Schuhe laut auf die soliden Eichenstufen einhämmerten. »Wissenschaftler wollen sie genau untersuchen, Händler wollen mit ihnen Geschäfte machen, und kein herrschaftliches Anwesen gilt als vollständig ohne eine eigene Sammlung exotischer Pflanzen. Wir brauchen kühne Männer, die nach diesen Kostbarkeiten suchen. Sir Joseph wird Ihnen Ihre mutige Entscheidung, sich freiwillig zu melden, großzügig belohnen.«
Oben auf der Treppe versuchte Boulton mit der wenigen Luft, die er noch in der Lunge hatte, Masson auf sein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. »Also denken Sie daran«, keuchte er, »Sir Joseph ist auch nur ein Mensch wie wir anderen alle auch. Er atmet die gleiche Luft und liebt einen guten Scherz wie alle anderen. Also beantworten Sie einfach seine Fragen. Solange Sie nicht schwafeln, stottern oder zaudern, ist alles in Ordnung. Es gibt nicht den geringsten Grund, nervös zu sein. Ist das klar, Mr MacMasterton?«
»Er heißt Masson, Sir, Francis Masson«, berichtigte Simmons ihn, während Boulton bereits zum zweiten Mal an die große Eichentür geklopft hatte.
Als er ein knappes, gebelltes »Herein!« von drinnen vernahm, zog Boulton seine Weste zurecht, lockerte die Halsbinde, rief schweigend den Himmel um Beistand an und öffnete die zweiflügelige Tür.
»Nein, warten Sie«, flüsterte Masson eindringlich und versuchte, Boulton am Arm festzuhalten, doch es war schon zu spät.
Die geöffnete Tür gab den Blick in ein großes, lichtdurchflutetes Arbeitszimmer frei. Die Schiebefenster an beiden Seiten standen offen und sorgten dafür, dass jeder Luftzug eingefangen wurde, um den Raum zu kühlen. Damit die zahlreichen Papierstapel, die im ganzen Raum verteilt waren, nicht durcheinander gerieten, waren Fossilien von Krustentieren, ausgestopfte Tiere, vielfarbige Kristalle und zahlreiche seltsame und wunderliche Gegenstände als Briefbeschwerer zweckentfremdet worden.
Mitten im Raum stand Sir Joseph Banks: Naturforscher, Forschungsreisender, Ritter des Königreichs und im Alter von dreißig Jahren schon zu Lebzeiten eine Legende.
Masson hatte schon mehrfach gehört, dass Menschen, wenn sie eine bedeutende Persönlichkeit trafen, oftmals enttäuscht oder überrascht waren, weil die betreffende Person nicht so großartig wirkte wie der Ruf, der ihr vorauseilte. Banks allerdings enttäuschte Massons Erwartungen nicht.
Nachdem Banks erfahren hatte, dass die HMS Endeavour rund um die Welt segeln würde, um den Lauf der Venus zu beobachten, hatte er sich sein ererbtes Vermögen und sämtliche Beziehungen seiner Familie zunutze gemacht, um einen Platz auf dem Schiff zu ergattern. Als der Marineminister sich ihm in den Weg gestellt hatte, hatte er die Admiralität umgangen und sich stattdessen die Genehmigung der Regierung für seine Teilnahme gesichert. Außerdem hatte er eine Summe zu der Expedition beigesteuert, die mehr als doppelt so hoch war wie der Beitrag des Königs und hundertmal so hoch wie das Jahresgehalt des Kapitäns des Schiffes, Kapitän James Cook.
Cook, der jetzt schräg hinter Banks stand, sah aus wie jemand, der gerade eine Komödie verfolgte, aber nicht laut lachen durfte. Er war fast zwei Jahrzehnte älter als Banks und trug die Uniform eines Kapitäns der königlichen Marine.
Es war Cook gewesen, der das Schiff während der dreijährigen Weltumseglung kommandiert hatte, doch bei ihrer triumphalen Rückkehr im vorangegangenen Sommer war es Banks gelungen, den Kurs durch die widrigen Winde der öffentlichen Meinung zu halten und Anspruch auf den Titel des Expeditionshelden anzumelden.
Banks hatte den angesehenen Botaniker Daniel Solander mit auf die Reise genommen, und gemeinsam war es ihnen geglückt, über dreitausend Pflanzenarten zu finden und mit nach Hause zu bringen. Die meisten davon waren zuvor noch nicht wissenschaftlich erfasst worden. Banks’ Erfolg hatte England an die Spitze der botanischen Forschung katapultiert und außerdem die Bedeutung der Gärten in Kew immens gesteigert und viel zu der dortigen Arbeit beigetragen. Auch wenn William Aiton offiziell der Direktor der Gärten war, so galt es doch als offenes Geheimnis, dass Banks seine neue Freundschaft zum König genutzt hatte, um Kew von einem königlichen Lustgarten in eine botanische Sammlung zu verwandeln. Wenn Banks nicht gewesen wäre, hätte Masson wahrscheinlich immer noch Buchsbaumhecken zurechtgestutzt, statt an der Katalogisierung der umfassendsten Pflanzensammlung der Welt mitzuwirken.
Zwar waren sie beide groß und im selben Alter, doch während Massons Gesichtszüge eher grob und unkultiviert wirkten, sah Banks bemerkenswert gut aus. Massons Gesellschaftsschicht und Erziehung hatten ihn eine reflexartige Unterwürfigkeit und Ehrerbietung gelehrt, die Banks nicht besaß, am allerwenigsten gegenüber Lord Sandwich, der ihm jetzt gegenüberstand. Der korpulente Marineminister, der sich ständig Stirn und Oberlippe mit einem Seidentaschentuch abtupfte, beugte sich über die zahlreichen technischen Zeichnungen und Pläne, die auf dem Tisch zwischen ihnen ausgebreitet waren.
Boulton räusperte sich. »Lord Sandwich, Sir Joseph, Kapitän Cook, darf ich vorstellen …«
»Ah, Mr Boulton!«, unterbrach ihn Banks. »Sie kommen wie gerufen! Das muss unser Mann sein.« Banks richtete sich auf und sprach Masson direkt an. »Sagen Sie, Sir, Sie reisen mit wenig Gepäck?«
Fragend blickte Masson in Boultons Richtung, doch der rundliche Assistent schloss einfach nur die Augen und schwitzte weiter vor sich hin.
»Nun?«, wiederholte Banks. »Wenn Sie eine ziemlich lange und anstrengende Seereise unternehmen, würden Sie dann sparsam packen?«
Ein ironisches Lächeln huschte über Cooks Gesicht, während der alte Lord entweder taub war oder sich nicht zu einer Reaktion hinreißen lassen wollte. Vielmehr brütete er weiterhin über den Unterlagen, die vor ihm lagen.
»Ich … Vermutlich wäre ich bestrebt, sparsam zu packen, Sir«, antwortete Masson schließlich.
»Ausgezeichnet«, rief Banks so laut, dass der alte Lord neben ihm zusammenzuckte.
Also doch nicht taub, dachte Masson.
»Glückwunsch, Sie haben die Stelle!«, brüllte Banks, bevor er mit übertrieben feierlicher Stimme fortfuhr: »Eine gründliche Überprüfung hat ergeben, dass Sie die außerordentlich anspruchsvollen Auswahlkriterien offiziell erfüllen, welche die Admiralität festgelegt hat.«
Der alte Lord hatte sein Vergrößerungsglas mit gequältem Blick sinken lassen, wohingegen Cook die Hand unters Kinn legte und sichtlich gegen einen Lachanfall ankämpfte.
»Auf der Grundlage Ihrer Fähigkeit, mit sehr wenig Gepäck zu reisen«, führte Banks ungerührt weiter aus, »werden Sie an dieser äußerst wichtigen Entdeckungsreise teilnehmen und mit Kapitän Cook zum Kap der Guten Hoffnung segeln. Sie werden, was für mich beträchtliche Kosten nach sich ziehen wird, einige Jahre in der niederländischen Kolonie in der Kapregion verbringen und unzivilisierte und bis dato unkartierte Gebiete erkunden. Sie werden Tausende von Pflanzenarten identifizieren und sammeln, die die Wissenschaft noch nie gesehen hat, und damit die Pracht und die Bedeutung des Botanischen Gartens unseres Königs in Kew steigern. Neben Ihrem Beitrag, den Neid der weltweiten Wissenschaft auf uns zu ziehen, wird Ihre Arbeit der Krone mit Sicherheit neue Einkünfte bescheren, und das zu einer Zeit, in der sie so dringend benötigt werden.«
»Verzeihung, Sir, aber haben Sie Kap der Guten Hoffnung gesagt?«, fragte Masson mit einem Anflug von Panik in der Stimme, als Banks eine Atempause einlegte.
»Das reicht jetzt, Sir Joseph«, stieß der alte Lord hervor, wobei seine einstudierte, verärgerte Miene allmählich von etwas wesentlich Finstererem abgelöst wurde.
»Mr Boulton«, fuhr Banks ungerührt fort und ignorierte damit sowohl Masson als auch Lord Sandwich, »hat Sie zweifellos wegen Ihrer fundierten Kenntnisse im Bereich der Naturwissenschaften, Ihrer hervorragenden Leistungen als Botaniker und Ihrer nachweislichen Erfahrungen in der Forschung im Ausland ausgewählt. Das sind die Maßstäbe, auf denen sich mein Ruf gründet.« Erneut nahm Masson Blickkontakt zu Boulton auf und suchte nach einer Bestätigung, dass es sich um eine Art Scherz handelte. Doch er sah lediglich, dass Boulton offensichtlich einer Ohnmacht nahe war.
»Dem Marineministerium jedoch wird all das bedeutungslos erscheinen im Vergleich zu der ungewöhnlichsten aller Begabungen, die mir ihrer Meinung nach so sehr fehlt: die Fähigkeit, mit wenig Gepäck zu reisen!«
»Also wirklich, Sir Joseph«, grollte der alte Lord und knüpfte an der Stelle an, an der man ihn unterbrochen hatte: »Es handelt sich um eine Expedition der Marine, die für die Krone beträchtliche Kosten und ein großes Risiko mit sich bringt. Sie sind immer unsere erste Wahl als Expeditionsleiter gewesen, insbesondere vor dem Hintergrund Ihres letzten Erfolgs, doch wir können uns Sie einfach nicht leisten. Wir sind bereit, die notwendigen Änderungen am Schiff vorzunehmen, um einen angemessenen Platz für Werkzeug, Ausrüstung und Bedienstete zu schaffen, allerdings nicht, wenn dafür ein zusätzliches Oberdeck gebaut werden soll!«
»Wenn wir die Welt mit nach Hause bringen sollen, können wir sie nicht im Lagerraum des Schreiners unterbringen, Mylord. Doch vermutlich müssten Sie ein Mann der Wissenschaft sein, um das zu verstehen«, erwiderte Banks vernichtend.
»Ein persönliches Orchester, bestehend aus vier Musikern mit Platz für Gepäck und Instrumente«, las Lord Sandwich aus den Unterlagen vor, die auf dem Tisch lagen. »Stauraum und Futter für ein Dutzend Jagdhunde?«
Er hielt inne und warf das Papier auf den Tisch. »Man muss kein Mann der Wissenschaft sein, um zu erkennen, dass Sie nicht die Welt nach Hause bringen wollen, sondern vielmehr die Welt mit auf Ihre Reise zu nehmen wünschen!«
»Bei der Probefahrt ist das Schiff beinahe gekentert, Joseph«, warf Cook mit freundlicher Nachsicht ein.
»Und wie oft sind wir mit der Endeavour mitten auf dem Ozean beinahe gekentert?«, konterte Banks, einerseits stolz auf die Leistung, andererseits empört.
»Ja, allerdings war das mitten in einem Taifun auf einem der tiefsten Meere der Welt, nicht an einem schönen Sommertag bei einer leichten Brise auf der Themse, zudem noch bei Ebbe.«
»Sie wissen, dass die Expedition ohnehin schon mit genügend Problemen zu kämpfen hat«, fuhr Lord Sandwich in einem Ton fort, der darauf schließen ließ, dass er die Angelegenheit bald zu einem Ende zu bringen wünschte. »Hoffen wir bloß, dass wir im nächsten Monat planmäßig auslaufen können. Ich bin sicher, dass Mr Forster und sein Sohn in Ihrer Abwesenheit hervorragende Arbeit leisten werden.«
Banks stieß einen letzten, verärgerten Seufzer aus und gab sich geschlagen, als Lord Sandwich unerbittlich blieb.
»Nichtsdestotrotz bin ich in Anerkennung Ihrer bisherigen Dienste und Leistungen sehr gern bereit, die Schiffsreise zum Kap für …?« Lord Sandwich hing in der Luft, als er Masson zum ersten Mal musterte.
»Francis Masson, zu Euren Diensten, Mylord«, antwortete Masson, der noch immer fassungslos war.
»Genau. Nun, ich denke, damit ist meine Aufgabe hier erledigt, und ich wünsche allen einen guten Tag. Sir Joseph, Kapitän Cook.« Damit nahm Lord Sandwich seinen Gehstock und seinen Hut und verließ den Raum.
Kapitulierend ging Banks zum Fenster und beobachtete, wie Lord Sandwichs Kutsche aus dem Crane Court fuhr und in die Fleet Street einbog. Das Klappern der Hufe und die Anfeuerungsrufe des Kutschers waren in der düsteren Stille des Raumes deutlich zu hören. Banks’ Miene brachte Masson dazu, sich zu fragen, ob dieser die Kutsche nicht mit bloßer Willenskraft explodieren lassen konnte. Und er kam zu dem Schluss, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, die Dinge klarzustellen, auch wenn ihm sehr daran gelegen war.
»Mr Boulton«, sagte Banks schließlich und richtete seine Wut auf seinen korpulenten Assistenten, »würde es Ihnen etwas ausmachen, mich darüber aufzuklären, auf welcher Grundlage Sie Mr Masson ausgewählt haben?«
»Durch ein Ausschlussverfahren, Sir.«
»Zweifelsohne. Doch auf welcher Grundlage haben Sie die anderen ausgeschlossen?«
»Auf der Grundlage, dass sie den Weg zum Vorstellungsgespräch nicht gefunden haben, Sir.« Boultons Gesicht hatte mittlerweile die gleiche Farbe wie seine Halsbinde angenommen. Banks’ einzige sichtbare Reaktion bestand darin, eine Augenbraue hochzuziehen, während Cook leise lachend den Kopf schüttelte.
Banks drehte sich um, ging auf Masson zu und musterte ihn prüfend, als wolle er ihn wissenschaftlich klassifizieren. Nachdem er zweimal um ihn herumspaziert war, sah er Masson direkt ins Gesicht und fragte: »Können Sie eine Pflanze zerlegen und ihre Samen sammeln?«
»Mit Verlaub, Sir«, setzte Masson an und hielt dann inne, weil Boulton heftig hustete. Als Masson sich umdrehte, erkannte er einen Ausdruck blinder Panik in Boultons Gesicht, woraufhin seine Entschlossenheit ins Wanken geriet. Als er sich wieder umwandte, stellte er fest, dass Banks ihn erwartungsvoll ansah.
»Ja, Sir, das kann ich.«
»Sind Sie mit den Methoden von Linné vertraut?«
»Ja, Sir.«
»Haben Sie schon viele Reisen unternommen?«