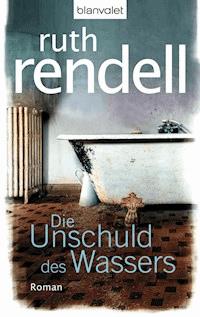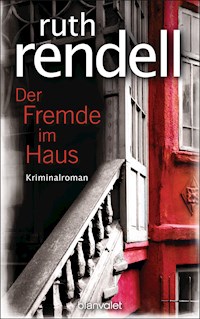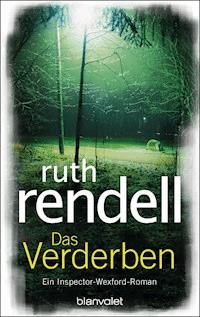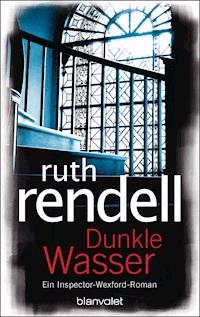2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In Tancred House, einem prachtvollen Anwesen mit ausgedehntem Waldbesitz, hat sich ein unvorstellbares Massaker ereignet. Während des Abendessens wurden Davina Flory, die Eigentümerin, ihr zweiter Ehemann Harvey Copeland sowie Davinas Tochter Naomi Jones erschossen. Einzige Überlebende des Blutbades ist Davinas Enkelin Daisy Jones. Alles spricht für einen Raubmord. Vor allem um Daisy zu schonen, setzt Inspector Wexford alles daran, den Fall möglichst schnell und ohne großen Presserummel zu lösen. Doch sehr zum Ärger der vorgesetzten Dienststelle ziehen die Ermittlungen sich hin – denn je genauer Wexford hinter die Kulissen dieser merkwürdigen Familie in Tancred House blickt, desto verwirrender erscheinen ihm die Verhältnisse …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ruth Rendell
Eine entwaffnende Frau
Buch
In Tancred House, einem prachtvollen Anwesen mit ausgedehntem Waldbesitz, hat sich ein unvorstellbares Massaker ereignet. Während des Abendessens wurden Davina Flory, die Eigentümerin, ihr zweiter Ehemann Harvey Copeland sowie Davinas Tochter Naomi Jones erschossen. Einzige Überlebende des Blutbades ist Davinas Enkelin Daisy Jones. Alles spricht für einen Raubmord. Vor allem um Daisy zu schonen, setzt Inspector Wexford alles daran, den Fall möglichst schnell und ohne großen Presserummel zu lösen. Doch sehr zum Ärger der vorgesetzten Dienststelle ziehen die Ermittlungen sich hin – denn je genauer Wexford hinter die Kulissen dieser merkwürdigen Familie in Tancred House blickt, desto verwirrender erscheinen ihm die Verhältnisse …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writer‘s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Sie hier.
Ruth Rendell
Eine entwaffnende Frau
Ein Inspector-Wexford-Roman
Aus dem Englischen von Christian Spiel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Kissing the Gunner’s Daughter bei Hutchinson, London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © der Originalausgabe 1991 by Kingsmarkham Enterprises Ldt.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1993 by Blanvalet Verlag, München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangel Images/Stephen Mulcahey
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-15136-2V002
www.blanvalet.de
Zum Andenken an Eleanor Sullivan
(1928–1991),
eine enge Freundin.
1
_____
Der 13. Mai ist der Unglückstag des Jahres. Und noch viel, viel schlimmer wird die Sache, wenn er zufällig auf einen Freitag fällt. In diesem Jahr war es allerdings ein Montag, trotzdem schlimm genug,obwohl Martin alles Abergläubische verachtete und am 13. Mai jedes wichtige Vorhaben ohne Bedenken in Angriff genommen und ebenso bedenkenlos ein Flugzeug bestiegen hätte.
Am Morgen entdeckte er in der Schultasche seines Sohnes eine Waffe. Zu seiner Zeit hatte so etwas Ranzen geheißen, aber inzwischen war es eine Aktentasche. Das Schießeisen steckte in einem Wirrwarr von Lehrbüchern, Schulheften mit Eselsohren, zerknülltem Papier und einem Paar Fußballsocken, und für einen kurzen, angsterfüllten Augenblick hielt Martin es für echt. Ungefähr fünfzehn Sekunden lang dachte er, Kevin besitze tatsächlich den größten Revolver, den er, sein Vater, jemals gesehen hatte, noch dazu ein Modell, das zu identifizieren er nicht in der Lage war.
Dann erkannte er, dass es sich um eine Nachbildung handelte. Es hielt ihn aber nicht davon ab, das Ding zu konfiszieren.
»Du kannst dich von dieser Waffe verabschieden, verlass dich drauf«, sagte er zu seinem Sohn.
Diese Entdeckung machte Martin in seinem Wagen kurz vor neun Uhr morgens, am Montag, dem 13. Mai, auf der Fahrt zur Gesamtschule in Kingsmarkham. Kevins Aktentasche war nicht richtig verschlossen gewesen, und als sie vom Rücksitz glitt, war ein Teil des Inhalts auf den Wagenboden gerutscht. Kevin sah trübselig und stumm zu, wie die Revolverkopie in einer Regenmanteltasche seines Vaters verschwand. Vor dem Eingang der Schule stieg er aus, murmelte noch ein Abschiedswort und warf dann keinen Blick mehr zurück.
Das war das erste Glied in einer Kette von Ereignissen, die schließlich dazu führen sollten, dass fünf Menschen ums Leben kamen. Hätte Martin den Revolver früher gefunden, ehe er und Kevin das Haus verließen, wäre nichts von alledem passiert. Es sei denn, man glaubt, unsere Erdentage seien uns im Voraus zugemessen. Wenn man sie in umgekehrter Reihenfolge zählte, vom Tod zur Geburt, hatte Martin den Tag eins erreicht.
Montag, den 13. Mai.
Es war sein freier Tag, dieser Tag eins im Leben von Detective Sergeant Martin. Er hatte früh das Haus verlassen, nicht nur um seinen Sohn zur Schule zu bringen das ergab sich noch nebenher, wenn er bereits um zehn vor neun aufbrach –, sondern auch, um die Scheibenwischer seines Wagens erneuern zu lassen. Es war ein schöner Morgen, die Sonne schien an einem klaren Himmel, und die Wettervorhersage war verheißungsvoll, aber er wollte es trotzdem nicht riskieren, zusammen mit seiner Frau mit defekten Scheibenwischern für einen Tag nach Eastbourne hinauszufahren.
Die Leute in der Autowerkstatt verhielten sich, wie eigentlich nicht anders zu erwarten gewesen war. Martin hatte den Termin zwei Tage zuvor telefonisch vereinbart, aber das hinderte die Sekretärin nicht daran, sich aufzuführen, als hätte sie noch nie etwas von ihm gehört. Ebenso wenig hielt es den einzigen verfügbaren Mechaniker davon ab, kopfschüttelnd zu sagen, es sei schon möglich, es ließe sich gerade so machen, aber der Kollege sei unerwartet zu einer Unfallstelle gerufen worden, und es wäre besser, wenn Martin zu Hause auf ihren Anruf wartete. Immerhin konnte Martin dem Mann das fragwürdige Versprechen abnötigen, dass die Sache bis halb elf geregelt sein werde.
Er ging durch die Queen Street zurück. Die meisten Läden hatten noch nicht geöffnet. Die Leute, an denen er vorüberging, waren Pendler auf dem Weg zum Bahnhof. Martin spürte den Revolver in seiner Tasche, seine Form und sein Gewicht, das ihn auf der rechten Seite ein wenig nach unten zog. Es war ein großes, schweres Schießeisen mit einem gut neun Zentimeter langen Lauf. Sollten die britischen Polizeibeamten schließlich doch einmal Waffen tragen, würden sie genau dieses Gefühl empfinden. Tag für Tag. Martin fand, dass ebenso viel dafür wie dagegen spräche, aber eigentlich konnte er sich nicht vorstellen, dass eine solche Neuerung das Parlament passieren würde.
Er überlegte, ob er seiner Frau von dem Revolver erzählen oder gar Chief Inspector Wexford davon berichten solle. Was fängt ein Dreizehnjähriger mit der Nachbildung einer Waffe an, die vermutlich dem Dienstrevolver eines Polizisten aus Los Angeles nachempfunden war? Eigentlich war er schon zu alt für einen Spielzeugrevolver, aber was konnte eine Nachbildung für einen anderen Zweck haben, als andere zu bedrohen und glauben zu machen, das Ding sei echt? Und konnte sich damit etwas anderes als eine kriminelle Absicht verbinden?
Im Augenblick konnte Martin nichts unternehmen. Aber abends musste er sich Kevin vorknöpfen. Er bog in die High Street ein, von wo aus er die blaugoldene Uhr am Turm von St. Peter sehen konnte. Die Zeiger näherten sich halb zehn. Er schlug die Richtung zur Bank ein, wo er so viel abheben wollte, dass er die Reparatur sowie eine Tankfüllung, Lunch für zwei Personen und ein paar kleinere Ausgaben in Eastbourne bezahlen konnte und trotzdem noch etwas Bargeld für die nächsten Tage hatte. Martin hielt nichts von Kreditkarten; er besaß zwar eine, benutzte sie aber nur höchst selten.
Nicht anders dachte er über Geldautomaten. Die Bank hatte noch nicht geöffnet, die schwere Eingangstür aus Eiche war fest verschlossen. Er hätte sich des Automaten bedienen können, der, Dienst am Kunden, in die Granitfassade eingelassen war. In seiner Brieftasche steckte die Karte, die er immerhin herauszog und ansah. Irgendwo hatte er sich die Geheimzahl notiert. Er versuchte sie sich ins Gedächtnis zu rufen. 5053? 5305? Doch dann hörte er, wie die Riegel zurückgeschoben wurden. Die Eingangstür öffnete sich und gab den Blick auf die innere Glastür frei. Die Bankkunden, die schon vor ihm wartend dagestanden hatten, schoben sich hinein.
Martin ging zu einem der Schalter, wo für die Kunden eine Schreibunterlage und ein Kugelschreiber auslagen, der durch eine Kette mit einem imitierten Tintenfass verbunden war. Er zog sein Scheckheft heraus. Hier brauchte er sich nicht eigens auszuweisen, da er sein Konto in dieser Filiale hatte und allgemein bekannt war. Schon hatte er den Blick einer der Leute hinter den Kassenschaltern aufgefangen und sagte guten Morgen.
Selbst unter seinen Freunden kannte kaum einer Martins Vornamen. Alle Welt nannte ihn Martin, so war es schon immer gewesen. Sogar seine Frau redete ihn mit Martin an. Wexford musste den Vornamen kennen und natürlich auch die Bank. Er hatte ihn bei seiner Trauung ausgesprochen, und seine Frau hatte ihn wiederholt. Und doch glaubten nicht wenige, Martin sei sein Vorname. Die Wahrheit war ein Geheimnis, das er soweit wie möglich für sich behielt, und als er jetzt den Scheck ausstellte, unterschrieb er ihn wie immer mit »C. Martin«.
Hinter ihren Glasscheiben zahlten zwei Kassierer Bargeld aus und nahmen Einzahlungen entgegen: Sharon Fraser und Ram Gopal. Beide hatten an der Scheibe ein Schildchen mit ihren Namen und oben eine Leuchte, die aufblinkte, wenn sie frei waren. In dem Bereich, der seit kurzem mit verchromten Pfosten und türkisblauen Schnüren für wartende Kunden abgetrennt worden war, hatte sich eine Schlange gebildet.
»Als wären wir Vieh auf einem Markt«, sagte ärgerlich eine Frau vor ihm.
»Es ist aber fairer so«, sagte Martin, der viel auf Gerechtigkeit und Ordnung hielt. »Auf diese Weise kann sich niemand vordrängen.«
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, spürte er, dass irgendeine Störung eingetreten war. Das Innere einer Bank zeichnet sich durch eine gleichsam sakrale Atmosphäre aus. Geld ist etwas Ernstes, etwas Stilles. Leichtfertigkeit, Heiterkeit, rasche Bewegungen haben an diesem heiligen Ort des Geldhandels nichts zu suchen. So macht sich die leiseste Stimmungsänderung sofort bemerkbar. Eine erhobene Stimme erregt Aufsehen, das Fallen einer Nadel wird zu einem Klappern. Jede Störung, und sei sie noch so gering, lässt die wartenden Kunden zusammenfahren. Martin spürte einen Luftzug, als die Glastür ungewöhnlich jäh geöffnet wurde. Er bemerkte, wie ein Schatten herabsank, während irgendjemand die Eingangstür, die während der Öffnungszeiten immer an der Wand eingehängt war, sorgfältig und beinahe lautlos schloss.
Er drehte sich um.
Nun ging alles sehr rasch. Der Mann, der die Eingangstür geschlossen und die Riegel vorgeschoben hatte, sagte im Befehlston: »Alle zurück an die Wand! Und schnell, wenn ich bitten darf!«
Martin registrierte den Akzent, unverkennbar aus Birmingham. Als der Mann zu sprechen begann, schrie jemand auf.
Der Mann, der die Waffe in der Hand hielt, sagte in seinem ausdruckslosen, nasalen Ton: »Es passiert Ihnen nichts, wenn Sie tun, was ich sage.«
Sein Komplize, eigentlich noch ein Junge, der gleichfalls bewaffnet war, ging zwischen den türkisfarbenen Schnüren und den verchromten Pfosten auf die beiden Kassenschalter zu. Hinter dem linken Schalter saß Sharon Fraser und hinter dem rechten Ram Gopal. Martin trat, vom Revolver des Mannes in Schach gehalten, zusammen mit allen anderen, die angestanden hatten, zurück an die Wand zur Linken.
Martin war sich ziemlich sicher, dass die Waffe in der Hand des Jungen, der einen Handschuh übergestreift hatte, eine Spielzeugwaffe war. Keine Nachbildung wie die in seiner eigenen Manteltasche, sondern ein Spielzeug. Der Typ wirkte sehr jung, wie siebzehn oder achtzehn, aber Martin wusste;dass er, obwohl selbst noch nicht alt, bereits so alt war, dass er nicht mehr unterscheiden konnte, ob jemand achtzehn war oder vierundzwanzig.
Er prägte sich jedes Detail an dem jungen Burschen ein, aber er konnte nicht ahnen, dass alles, was er sich in diesen Augenblicken merken würde, umsonst war. Mit gleicher Sorgfalt registrierte er die Details an dem anderen. Der Junge hatte einen seltsamen Ausschlag im Gesicht, möglicherweise Akne. Martin hatte noch nie etwas Derartiges gesehen. Der Ältere war dunkelhaarig und hatte tätowierte Hände. Er trug keine Handschuhe. Die Waffe in der Hand des Mannes war vielleicht auch nicht echt. Es ließ sich unmöglich sagen. Während Martin den jungen Typen beobachtete, dachte er an seinen eigenen Sohn. Hatte Kevin etwas Derartiges im Sinn gehabt? Martin tastete nach dem Revolver in seiner Tasche und begegnete den Augen des Mannes, die ihn fixierten. Er zog die Hand heraus, hob sie und umklammerte die andere.
Der Junge hatte etwas zu der Kassiererin, Sharon Fraser, gesagt, aber was, das hatte Martin nicht mitbekommen. Sie mussten hier doch eine Alarmanlage haben. Er musste sich eingestehen, dass er nicht wusste, wie sie beschaffen sein könnte. Ein Knopf, der auf Fußdruck reagierte? Wurde vielleicht jetzt, just in diesem Augenblick, im Polizeirevier Alarm ausgelöst?
Er kam nicht auf die Idee, sich irgendwelche äußeren Merkmale an seinen Schicksalsgenossen einzuprägen, den Leuten, die sich da zusammen mit ihm geduckt an die Wand pressten. Wie die Sache dann ausging, hätte es auch nichts genützt. Er hätte lediglich sagen können, dass keiner von ihnen alt, aber alle bis auf eine einzige Ausnahme erwachsen waren. Die Ausnahme war das Baby in einer Schlinge an der Brust seiner Mutter. Die Leute waren Schatten für ihn, ein namen- und gesichtsloses Publikum.
In seinem Innern stieg der Drang auf, irgendetwas zu unternehmen, zu handeln. Eine gewaltige Empörung hatte sich seiner bemächtigt, wie er sie, angesichts eines Verbrechens, immer empfand. Wie konnten sie es wagen? Was erdreisteten sie sich? Mit welchem Recht kamen sie hier herein, um sich zu nehmen, was ihnen nicht gehörte? Es war der gleiche Zorn, der ihn ergriff, wenn irgendein Land ein anderes überfiel. Wie konnten sie es wagen, etwas so Empörendes zu tun?
Die Kassiererin gab Geldscheine heraus. Martin glaubte nicht, dass Ram Gopal Alarm ausgelöst hatte. Gopal sah dem ganzen Geschehen starr zu, vor Schreck versteinert oder auch nur mit einer unergründlichen Gelassenheit. Er beobachtete Sharon Fraser, wie sie auf die Tasten des automatischen Kassentresors neben sich tippte, aus dem dann Geldscheine, bereits zu Fünfzigern und Hunderten gebündelt, herausfielen. Mit unverwandtem Blick verfolgte er, wie Bündel um Bündel unter der gläsernen Trennscheibe durch die metallene Furche in die gierige handschuhbekleidete Hand geschoben wurde.
Der junge Typ nahm das Geld mit der Linken, schob es zu einem Häufchen zusammen und verstaute es in einer Leinentasche, die er um die Taille hängen hatte.
Dabei zielte er mit der Waffe, dem Spielzeugrevolver, auf Sharon Fraser. Der Ältere hielt währenddessen die anderen Anwesenden, einschließlich Ram Gopals, in Schach. Von der Stelle aus, wo er stand, war dies ein leichtes, da der Schalterraum klein war und die Bankkunden dicht nebeneinander standen. Martin hörte das Weinen einer Frau, leise Schluchzer, ein unterdrücktes Wimmern.
Seine Empörung drohte ihn zu übermannen. Aber noch war es nicht soweit, nicht ganz. Wenn die Polizei ermächtigt worden wäre, Waffen zu tragen, wäre er inzwischen vielleicht schon so daran gewöhnt, dass er einen echten Revolver von einem unechten unterscheiden könnte. Der Bursche stand jetzt vor Ram Gopal. Sharon Fraser, eine pummelige junge Frau, deren Familie Martin flüchtig kannte, da ihre Mutter mit seiner Frau zur Schule gegangen war, saß mit geballten Fäusten da, und die langen, roten Fingernägel gruben sich ihr in die Handflächen. Ram Gopal hatte unterdessen seinerseits begonnen, unter der gläsernen Trennscheibe Bündel von Geldscheinen durchzuschieben. Im nächsten Augenblick würde alles vorbei sein, und er, Martin, hatte nichts unternommen.
Er beobachtete, wie der dunkelhaarige, untersetzte Mann sich in Richtung Tür zurückzog. Das besagte nicht viel, denn seine Waffe hielt alle nach wie vor in Schach. Martin schob vorsichtig die Hand hinab zur Manteltasche und spürte dort Kevins riesige Knarre. Der Mann sah die Bewegung, reagierte aber nicht. Er musste die Eingangstür öffnen, damit sie das Weite suchen konnten.
Martin hatte angenommen, dass Kevins Waffe nicht echt war. Genauso kam er durch Beobachtung nun zu dem Schluss, dass das Schießeisen dieses Burschen ebenfalls eine Imitation war. Die Uhr an der Wand über den Kassenschaltern, hinter dem Kopf des Jungen, zeigte 9.42 Uhr an. Wie rasch das alles gegangen war! Erst eine halbe Stunde vorher war er in der Autowerkstatt gewesen. Erst vierzig Minuten vorher hatte er den nachgemachten Revolver in Kevins Schultasche entdeckt und konfisziert.
Er fuhr mit der Hand in die Tasche, packte Kevins Revolver und brüllte: »Lasst eure Knarren fallen!«
Der Mann hatte sich für einen Sekundenbruchteil umgedreht, um die Eingangstür zu entriegeln. Er stellte sich rasch mit dem Rücken dagegen und packte seine Waffe mit beiden Händen wie ein Filmgangster. Der Junge nahm den letzten Packen Geldscheine und fegte ihn in seine Tasche.
Martin wiederholte: »Lasst eure Knarren fallen!« Der junge Bursche drehte langsam den Kopf zu ihm hin und sah ihn an. Eine Frau gab einen erstickten, wimmernden Laut von sich. Die lächerliche, kleine Waffe in der Hand des Jungen schien zu zittern. Martin hörte, wie die Eingangstür krachend gegen die Wand schlug. Er hörte den Mann zwar nicht hinausgehen, den mit dem echten Revolver, aber er wusste, dass er fort war. Ein Windstoß fuhr durch die Schalterhalle. Die Glastür fiel laut ins Schloss. Der junge Typ stand da und starrte Martin mit einem merkwürdig unergründlichen Blick an. Vielleicht stand er unter Drogeneinfluss. Er hielt seine Waffe so, als könnte er sie jeden Augenblick fallen lassen, als wollte er testen, wie weit er den Griff lockern konnte, ehe sie zu Boden fiel.
Jemand betrat die Bank. Die Glastüre schwenkte nach innen. Martin brüllte: »Zurück! Rufen Sie die Polizei! Sofort! Hier findet ein Bankraub statt.«
Er machte einen Schritt nach vorne, auf den Jungen zu. Es ist bestimmt einfach, sagte er sich, es ist einfach, die wirkliche Gefahr ist vorüber. Seine »Waffe« war auf den Burschen gerichtet, und dieser zitterte. Martin dachte: Mein Gott, gleich hab ich’s geschafft, ich ganz allein!
Da drückte der Junge ab und traf ihn mitten ins Herz. Martin stürzte. Er kippte nicht nach vorne, sondern sank zu Boden, da seine Knie einknickten. Aus seinem Mund kam Blut. Außer einem schwachen Husten gab er keinen Ton von sich. Sein Körper krümmte sich wie in Zeitlupe zusammen, die Hände griffen in die Luft, aber mit schwachen, anmutigen Bewegungen. Langsam sackte er zusammen, bis er regungslos dalag, die Augen nach oben gerichtet, blicklos zu der gewölbten Decke der Bank hinaufstarrend.
Einen Augenblick lang war es ganz still gewesen, dann brach Lärm los – Rufe, schrille Schreie. Die Leute drängten sich um den Sterbenden. Brian Price, der Filialleiter, eilte aus dem Büro im Hintergrund, gefolgt von Mitarbeitern. Ram Gopal war bereits am Telefon. Das Baby begann herzzerreißend zu schreien, als seine Mutter aufkreischte, unverständliche Worte von sich gab und die Arme um das Tragetuch mit dem kleinen Körper schlang. Sharon Fraser, die Martin gekannt hatte, rannte in die Schalterhalle und kniete sich neben ihn auf den Boden. Händeringend schrie sie nach Gerechtigkeit und Vergeltung.
»Großer Gott im Himmel, was haben sie mit ihm gemacht? Was ist mit ihm passiert? Helfen Sie, irgendjemand, lassen Sie ihn doch nicht sterben …«
Doch mittlerweile war Martin tot.
2
_____
Martins Vorname erschien in den Zeitungen. Er wurde noch am selben Tag in den frühen Abendnachrichten der BBC und dann noch einmal um 21.00 Uhr laut erwähnt: Detective Sergeant Caleb Martin, neununddreißig Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes.
»Es ist sonderbar«, sagte Inspector Burden. »Sie werden es mir nicht abnehmen, aber ich höre zum ersten Mal, dass er so geheißen hat. Dachte immer, John oder Bill oder weiß Gott was. Wir haben ihn immer Martin genannt, als wär’s sein Vorname gewesen. Ich frag mich,warum er sich eingemischt hat. Was ist denn in ihn gefahren?«
»Es war Mut«, sagte Wexford. »Der arme Kerl.«
»Übermut.« Burden sagte es wehmütig, nicht unfreundlich.
»Mut hat wohl nie viel mit Intelligenz zu tun, oder? Nicht viel mit vernünftigem Überlegen oder mit Logik. Der Gedanke mit seiner Blässe hatte bei ihm keine Chance.«
Er war einer von ihnen, einer ihresgleichen gewesen. Außerdem ist für einen Polizeibeamten der Mord an einem Kollegen besonders grauenvoll.
Chief Inspector Wexford ging bei der Fahndung nach Martins Mörder mit derselben Routine wie bei der Jagd auf jeden anderen Killer, aber er spürte, dass er betroffener war als sonst. Dabei hatte er Martin nicht einmal besonders geschätzt, da ihn dessen beflissener, humorloser Diensteifer irritiert hatte. Doch all das zählte nicht mehr, nun da Martin tot war.
»Mir ist schon oft durch den Kopf gegangen«, sagte Wexford zu Burden, »Was für ein schlechter Psychologe Shakespeare doch war, als er schrieb, dass das Üble, das Menschen anrichten, sie häufig überlebt, das Gute aber gewöhnlich zusammen mit ihren Gebeinen bestattet wird. Nicht, dass der arme Martin ein übler Kerl gewesen wäre, aber Sie wissen, was ich meine. Das Gute an Menschen, das behalten wir im Gedächtnis, nicht das Schlechte. Ich erinnere mich, wie peinlich genau er war und wie gründlich und – na schön, verbissen. Ich denke mit viel Empfindung an ihn, wenn mich nicht der Zorn packt. Aber, mein Gott, ich bin so voller Zorn, dass ich kaum aus den Augen schauen kann, wenn ich an dieses Bürschchen mit dem Ausschlag denke, das ihn kaltblütig abgeknallt hat.«
Sie hatten damit begonnen, Brian Prince, den Filialleiter, Sharon Fraser und Ram Gopal aufs sorgfältigste und eingehendste zu verhören. Als nächstes wurden die Kunden aufgesucht, die in der Bank gewesen waren – genauer gesagt, diejenigen, die sich gemeldet hatten oder ausfindig gemacht werden konnten. Niemand vermochte exakt anzugeben, wie viele Leute sich zu dem fraglichen Zeitpunkt in der Schalterhalle aufgehalten hatten.
»Der arme, alte Martin hätte es uns sagen können«, sagte Burden. »Da bin ich mir sicher. Er wusste, wie viele es waren, aber er ist ja tot, und wenn er nicht tot wäre, hätte das alles keinerlei Bedeutung.«
Brian Prince hatte nichts gesehen. Er hatte von dem Überfall überhaupt erst erfahren, als er den jungen Burschen den Schuss abfeuern hörte, der Martin tötete. Rarn Copal, Mitglied der winzigen Gemeinschaft indischer Einwanderer in Kingsmarkham und Angehöriger der pandschabischen Brahmanenkaste, gab Wexford die beste und umfassendste Beschreibung der beiden Männer. Angesichts solcher Täterbeschreibungen, sagte Wexford hinterher, wäre es ein Verbrechen, die beiden nicht aufzuspüren.
»Ich habe sie sehr genau beobachtet. Ich saß ganz ruhig da und konzentrierte mich darauf, wie sie aussahen. Es war mir klar, wissen Sie, dass ich nichts machen konnte, das aber konnte ich tun, und das habe ich getan.«
Michelle Weaver, zu der fraglichen Zeit auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz im Reisebüro zwei Häuser weiter, gab an, der jüngereder beiden sei zwischen zweiundzwanzig und fünfundzwanzig Jahre alt, blond, nicht sehr groß und mit einer schlimmen Akne geschlagen gewesen. Die Mutter des Babys, Mrs. Wendy Gould, erklärte ebenfalls, der junge Typ sei blond gewesen, meinte aber auch, dass es sich um einen hochgewachsenen Burschen gehandelt habe, mindestens 1,85 Meter groß. Sharon Fraser glaubte sich zu erinnern, dass er blond und groß gewesen sei; besonders aber seien ihr seine hellblauen Augen aufgefallen. Alle drei Männer gaben an, der Junge sei klein oder allenfalls mittelgroß, mager und vielleicht zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig gewesen. Wendy Gould erklärte, er habe krank gewirkt. Die andere Frau, Mrs. Margaret Watkin, sagte, der Bursche sei dunkelhaarig und klein gewesen und habe dunkle Augen gehabt. Alle waren sich darin einig, dass er einen Ausschlag im Gesicht gehabt habe, aber Margaret Watkin bezweifelte, dass es sich um Akne handelte. Mehr wie eine Menge kleiner Muttermale, meinte sie.
Der Komplize des jungen Mannes wurde einhellig als zehn oder, so Mrs. Watkin, zwanzig Jahre älter als der Bursche beschrieben. Er sei dunkelhaarig, ein paar sagten, dunkelhäutig gewesen und habe behaarte Hände gehabt. Als einzige gab Michelle Weaver an, dass er an der linken Wange einen Leberfleck gehabt habe. Sharon Fraser meinte, er sei sehr groß gewesen, während einer der Männer ihn als »Zwerg« bezeichnete und ein anderer erklärte, er sei »nicht größer als ein Jugendlicher« gewesen.
Ram Copals Konzentration und die Bestimmtheit seiner Aussage flößten Wexford Vertrauen ein. Der Inder beschrieb den jungen Burschen als knapp 1,75 Meter groß, sehr mager, blauäugig, blond und mit Aknepusteln im Gesicht. Er habe Blue Jeans, ein dunkles T-Shirt beziehungsweise einen dunklen Pullover und eine schwarze Lederjacke getragen. Die Hände hätten in Handschuhen gesteckt, was keinem der anderen Zeugen zu erwähnen einfiel.
Der Mann habe keine Handschuhe getragen. Seine Hände seien von dunklen Haaren bedeckt gewesen. Sein Kopfhaar sei dunkel, beinahe schwarz gewesen, der Ansatz schon weit zurückgetreten, er habe sozusagen eine »Denkerstirn« gehabt. Er sei mindestens fünfunddreißig Jahre alt und ähnlich wie der Bursche angezogen gewesen, abgesehen davon, dass seine Jeans dunkel gewesen sei, dunkelgrau oder dunkelbraun. Dazu habe er einen braunen Pullover angehabt.
Der junge Typ habe nur ein einziges Mal gesprochen: Als er Sharon Fraser anwies, ihm das Geld auszuhändigen. Sharon Fraser war nicht imstande, seine Stimme zu beschreiben. Nach Ram Copals Meinung sprach der Junge weder Cockney noch ein gehobenes Englisch, sondern vermutlich einen Südlondoner Akzent. Er kannte sich allerdings mit englischen Akzenten nicht genau aus, wie Wexford entdeckte, als er ihn auf die Probe stellte und feststellte, dass der Inder einen Devonshire-Akzent mit einem aus Yorkshire verwechselte.
Und wie viele Leute waren in der Bank gewesen? Ram Copal sagte, die Angestellten eingeschlossen, seien es fünfzehn gewesen. Sharon Fraser sprach von sechzehn Personen. Von den Bankkunden nannte einer die Zahl zwölf, ein anderer achtzehn.
Gleichgültig, wie viele oder wie wenige Personen sich in der Bank aufgehalten hatten, klar war, dass sich nicht alle auf die Appelle der Polizei hin gemeldet hatten. Von dem Moment an, als die Bankräuber den Tatort verließen, bis zum Eintreffen der Polizei hatten vielleicht nicht weniger als fünf Personen unauffällig die Bank verlassen, während sich die übrigen um den toten Martin drängten.
Sie hatten sich bei der erstbesten Gelegenheit verdrückt, und wer konnte es ihnen verdenken, zumal wenn sie nichts Taterhellendes beobachtet hatten? Wer wollte schon unnötig in polizeiliche Ermittlungen hineingezogen werden?
Die Polizei in Kingsmarkham musste sich also damit abfinden, dass sich vier oder fünf Personen nicht gemeldet hatten, Leute, die vielleicht etwas wussten oder auch nicht, jedenfalls aber schwiegen und sich abseits hielten. Bei der Polizei wusste man lediglich, dass das Bankpersonal keinen der Betreffenden, vier oder fünf oder vielleicht auch nur drei, vom Sehen kannte. Soweit die Angestellten sich erinnern konnten. Weder Brian Price noch Ram Copal oder Sharon Fraser konnten sich entsinnen, in der Schlange vor dem Schalter ein bekanntes Gesicht gesehen zu haben, abgesehen von den Stammkunden, die nach Martins Tod alle in der Bank geblieben waren.
Martin selbst hatten sie natürlich gekannt. Ebenso, unter anderen, Michelle Weaver und Wendy Gould. Sharon Fraser konnte nur eines sagen: Sie habe den Eindruck, dass die Bankkunden, die sich nicht gemeldet hatten, sämtlich Männer gewesen seien. Die sensationellste Aussage von einem der Zeugen kam von Michelle Weaver. Sie erklärte, gesehen zu haben, wie der Junge mit dem von Akne entstellten Gesicht im letzten Augenblick, ehe er türmte, seine Waffe fallen ließ. Er habe sie auf den Boden geworfen und sei davongerannt.
Burden konnte zunächst kaum glauben, dass sie von ihm erwartete, diese Aussage ernst zu nehmen. Sie erschien ihm bizarr. Von dem Vorgang, den Michelle Weaver beschrieb, hatte er irgendwo gelesen oder während seiner Ausbildung gehört. Es war eine klassische Mafia-Technik. Er meinte sogar, dass sie beide das gleiche Buch gelesen haben müssten.
Doch Michelle Weaver blieb dabei. Sie habe gesehen, wie die Waffe über den Fußboden geschliddert sei. Die anderen seien alle zu Martin hingestürzt, aber als letzte in der Reihe der Personen, die sich auf Geheiß des Gangsters hatten an die Wand stellen müssen, sei sie am weitesten von Martin entfernt gewesen, der ganz vorne gestanden habe.
Caleb Martin hatte die »Waffe« fallen lassen, mit der er seinen tapferen Versuch unternommen hatte. Sein Sohn Kevin identifizierte sie später als sein Eigentum; sein Vater habe sie ihm am Morgen im Auto weggenommen. Es war ein Spielzeug, die unpräzise, mehrere äußerliche Ungenauigkeiten aufweisende Nachbildung eines Militär – und Polizeirevolvers, Smith & Wesson Modell 10, mit einem neun Zentimeter langen Lauf.
Mehrere Zeugen hatten gesehen, wie Martins Waffe auf den Boden fiel. Ein Bauunternehmer namens Peter Kemp hatte neben ihm gestanden und sagte aus, Martin habe das Schießeisen im selben Augenblick fallen lassen, in dem ihn die Kugel traf.
»Könnte es Detective Sergeant Martins Waffe gewesen sein, die Sie gesehen haben, Mrs. Weaver?«
»Wie bitte?«
»Detective Sergeant Martin ließ die Waffe fallen, die er in der Hand hatte. Sie schlidderte zwischen den Füßen der Leute über den Fußboden. Könnten Sie sich getäuscht haben? Könnte das die Waffe gewesen sein, die Sie sahen?«
»Ich habe gesehen, wie der Junge sie auf den Boden warf.«
»Sie sagten, Sie hätten sie über den Boden schliddern sehen. Martins Revolver ist über den Boden geschliddert. Sind also zwei Revolver über den Boden geschliddert?«
»Das weiß ich nicht. Ich habe nur einen gesehen.«
»In der Hand des Burschen? Und dann haben Sie gesehen, wie er über den Boden geglitten ist? Haben Sie tatsächlich beobachtet, wie der Revolver aus der Hand des Jungen fiel?«
Sie war sich ihrer Sache nicht mehr sicher. Sie glaubte, es gesehen zu haben. Sie habe bestimmt den Revolver in der Hand des jungen Burschen und dann einen auf dem Fußboden gesehen, wie er zwischen den Füßen der Leute über den glänzenden Marmor glitt. Dann kam ihr ein Gedanke, der sie einen Augenblick lang verstummen ließ. Sie sah Burden mit einem festen Blick an.
»Vor Gericht würde ich nicht beschwören, dass ich es gesehen habe«, sagte sie.
In den folgenden Monaten wurde die Jagd auf die beiden Bankräuber auf das ganze Land ausgedehnt. Nach und nach tauchten sämtliche geraubten Geldscheine auf. Einer der beiden Männer kaufte einen Wagen, ehe die Nummern der betreffenden Banknoten öffentlich bekanntgegeben wurden, und zahlte einem ahnungslosen Gebrauchtwagenhändler sechstausend Pfund bar auf die Hand. Dies war der ältere, dunklere Typ. Der Autohändler gab eine detaillierte Beschreibung von ihm und nannte den Namen des Mannes. Beziehungsweise den Namen, den der Mann ihm angegeben hatte – George Brown. Fortan war er für die Polizei in Kingsmarkham George Brown.
Vom übrigen Geld kamen knapp zweitausend Pfund, eingewickelt in Zeitungspapier, auf einer städtischen Müllkippe zum Vorschein. Die anderen sechstausend Pfund wurden nie gefunden. Vermutlich waren sie in Kleckerbeträgen ausgegeben worden. Damit war kein großes Risiko verbunden. Wenn man dem Mädchen an der Supermarktkasse zwei Zehner gibt, meinte Wexford, macht sie keine Stichprobe. Man muss sich nur davor hüten, ein zweites Mal reinzugehen.
Kurz vor Weihnachten fuhr Wexford nach Lancashire, um dort einen Mann zu vernehmen, der in Untersuchungshaft saß. Es war das Übliche. Wenn er sich kooperativ zeigte und nützliche Hinweise gab, könnte sich das bei seinem Prozess durchaus positiv für ihn auswirken. Wie die Dinge lagen, musste er damit rechnen, zu sieben Jahren Knast verdonnert zu werden.
Der Mann hieß James Walley, und er erzählte Wexford, dass er mit einem Typen, der George Brown hieß – sein richtiger Name –, ein Ding gedreht habe. Es war eine seiner früheren Straftaten, die er zu gestehen gedachte, um vor Gericht glimpflicher davonzukommen. Wexford suchte den richtigen George Brown in dessen Heim in Warrington auf. Er war schon vorgerückten Alters, wenn auch vermutlich jünger, als er wirkte, und er hinkte, da er einige Jahre zuvor bei einem Einbruchsversuch in einem mehrstöckigen Mietshaus von einem Gerüst gestürzt war.
Danach begann man bei der Polizei in Kingsmarkham von dem gesuchten Mann als dem a. (alias) George Brown zu sprechen. Von dem jungen Burschen mit der Akne gab es kein Zeichen, nicht einmal einen gemurmelten Hinweis. Er hätte so gut wie tot sein können, so wenig war über ihn zu erfahren.
A. George Brown tauchte im Januar wieder auf. Er war in Wirklichkeit ein gewisser George Thomas Lee und wurde im Verlauf eines Raubüberfalls in Leeds verhaftet. Diesmal übernahm es Burden, den Mann im Untersuchungsgefängnis aufzusuchen. Es war ein kleiner Mann, der schielte und einen karottenroten Bürstenhaarschnitt trug. Bei der Geschichte, die er Burden auftischte, ging es um einen pickeligen jungen Mann, den er in einem Pub kennengelernt und der sich dort gebrüstet habe, irgendwo in Südengland einen Polizisten umgebracht zu haben. Er nannte ein bestimmtes Pub, vergaß es dann wieder und gab ein anderes an, aber er kannte den vollen Namen und die Adresse des Burschen. Burden, bereits überzeugt, dass sich als Motiv hinter alledem nur Rachegelüste wegen irgendeiner läppischen Kränkung verbargen, fand den jungen Mann. Er war dunkelhaarig und hochgewachsen, ein arbeitsloser Laborant mit einem Leumund, der ebenso fleckenlos war wie sein Gesicht. Der junge Mann konnte sich nicht daran erinnern, A. George Brown in einem Pub kennengelernt zu haben, entsann sich aber, dass er die Polizei benachrichtigt hatte, als er an seiner letzten Arbeitsstätte einen Einbrecher entdeckte.
Martin war durch einen Schuss aus einem 357er oder 38er Kaliber getötet worden. Mit welchem der beiden Typen ließ sich nicht sagen, weil die Patrone zwar eine 38er war, für den 357er Colt Magnum aber Patronen beider Kaliber benützt werden können. Manchmal grübelte Wexford über diesen Revolver nach, und einmal träumte er, er sei in einer Bank und beobachte zwei Revolver, die über den Marmorboden glitten, während die Bankkunden wie Zuschauer im Eisstadion irgendeiner Darbietung zuschauten. Magnums on Ice.
Er suchte selbst Michelle Weaver auf, um sich mit ihr zu unterhalten. Sie war sehr entgegenkommend, nur zu willig, Auskunft zu geben, und ließ sich keinerlei Ungeduld anmerken. Doch inzwischen waren fünf Monate ins Land gegangen, und die Erinnerung an das, was sie an jenem Morgen, als Caleb Martin starb, gesehen hatte, war unvermeidlich verblasst.
»Ich kann nicht gesehen haben, wie er die Waffe wegwarf, oder? Ich muss mir das wohl eingebildet haben. Wenn er sie auf den Boden geworfen hätte, wäre sie dort gelegen, und das war sie nicht, nur die, die der Polizeibeamte fallen ließ.«
»Es war zweifellos nur ein einziger Revolver da, als die Polizei eintraf.« Wexford sprach zu ihr im Plauderton, als verfügten sie beide über das gleiche Wissen, die gleichen Insider-Informationen. Sie taute auf und wurde selbstsicher. »Wir haben nichts außer dem Spielzeugrevolver gefunden, den Detective Sergeant Martin an diesem Morgen seinem Sohn weggenommen hatte. Keine Kopie, keine Nachbildung, ein Kinderspielzeug.« »Dann war das wirklich ein Spielzeug, was ich gesehen habe?« sagte sie verwundert. »Sie machen sie täuschend echt nach.«
Eine andere Vernehmung im Plauderton, diesmal mit Barbara Watkin, förderte nicht viel mehr als ihren Eigensinn zutage. Halsstarrig hielt sie an ihrer Beschreibung des jungen Burschen fest.
»Ich erkenne Akne auf den ersten Blick. Mein ältester Sohn hatte schreckliche Akne. Das, was der Junge hatte, war was anderes. Ich hab Ihnen ja gesagt, es sah mehr aus wie Muttermale.«
»Vielleicht vernarbte Akneknötchen?«
»Ganz und gar nicht. Sie müssen sich diese erdbeerfarbenen Flecken vorstellen, die Leute so haben, nur dass sie bei ihm dunkelrot und alle klecksig waren, Dutzende davon.«
Wexford fragte daraufhin bei Dr. Crocker nach, und dieser sagte, niemand habe Muttermale, auf die diese Beschreibung passten. Damit war der Fall erledigt.
Es gab nicht viel mehr zu sagen, nichts mehr zu fragen. Es war Ende Februar, als er sich mit Michelle Weaver unterhielt, und Anfang März, als Sharon Fraser mit etwas daherkam, was ihr an einem der Männer unter den Bankkunden, die sich nicht gemeldet hatten, aufgefallen war. Er habe in der Hand einen Packen Geldscheine gehalten, grüne Scheine. Es gab keine grünen britischen Banknoten, seit die Pfundnote mehrere Jahre zuvor durch eine Münze ersetzt worden war. Sonst sei ihr an dem Mann nichts aufgefallen, woran sie sich erinnere. »Hilft Ihnen das weiter?«
Wexford konnte nicht sagen, ob es ihm viel weiterhelfen werde. Aber Leute, die solchen Gemeinsinn an den Tag legen, soll man nicht entmutigen.
Sonst passierte nicht viel bis zum 11. März, als der Notruf kam.
3
_____
»Sie sind alle tot.« Es war eine weibliche Stimme, und sie war jung, sehr jung. Sie sagte es noch einmal: »Sie sind alle tot.« Und dann: »Ich verblute.«
Die Telefonistin in der Notrufzentrale, obwohl kein Neuling in ihrem Job, sagte hinterher, es sei ihr bei diesen Worten kalt über den Rücken gelaufen. Sie hatte bereits routinemäßig die Frage gestellt, ob die Anrufende die Polizei, die Feuerwehr oder einen Krankenwagen wolle.
»Wo sind Sie?« fragte sie.
»Helfen Sie mir. Ich verblute.«
»Sagen Sie mir, wo Sie sind, die Adresse …«
Die Stimme begann eine Telefonnummer anzugeben.
»Die Adresse bitte …«
»Tancred House, Cheriton. Helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir … Sorgen Sie dafür, dass sie rasch kommen …«
Es war 20.22 Uhr.
Der Forst, überwiegend mit Nadelbaumbestand, erstreckt sich über ein ungefähr hundertfünfzig Quadratkilometer großes Gebiet. Doch südlich davon hat sich ein Überrest des uralten Waldes von Cheriton erhalten, einer von sechs, die es im Mittelalter in der Grafschaft Sussex gab – außerdem die Wälder von Arundel, St Leonard’s, Worth, Ashdown, Waterdown und Dallington. Von Arundel abgesehen, bildeten sie alle ein geschlossenes Waldgebiet von neuntausend Quadratkilometern, das sich der Angelsächsischen Chronik zufolge von Kent bis Hampshire erstreckte. Hier war Rotwild zu Hause, und im Herzen des Waldes lebten sogar Wildschweine.
Das kleine Gebiet, das sich davon erhalten hat, ist Mischwald mit Eichen, Eschen, Ross- und Edelkastanien, Birken und erlenblättrigem Schneebaum, das an den südlichen Hängen und der Umgrenzung eines privaten Landgutes steht. Hier, wo bis Anfang der dreißiger Jahre eine Parklandschaft gewesen war, in der Douglasien, Zedern und der seltenere Mammutbaum wuchsen und hin und wieder ein Wäldchen zu sehen war, war vom neuen Eigentümer des Guts ein neuer Wald angepflanzt worden. Die Straßen zum Herrenhaus, eine davon nicht mehr als ein breiter Pfad, winden sich durch den Forst, an manchen Stellen zwischen steile Böschungen gezwängt, an anderen durch Rhododendron-Gehölze, vorüber an hohem und gesundem Baumbestand.
Manchmal kann man zwischen den Bäumen Wild erblicken, hin und wieder auch rote Eichhörnchen. Der Birkhahn und im Winter die Kornweihen sind eine Seltenheit, die Dartford-Grasmücke dagegen kommt häufig vor. Im Spätfrühling, wenn der Rhododendron zu blühen beginnt, zeigen sich die langen Baumreihen in einem leuchtenden Hellrosa unter dem lichten Grün der ausschlagenden Birken. Die Nachtigall singt. Im März dagegen sind die Wälder noch dunkel, doch beginnt das junge Leben schon zu sprießen, und der Boden unter den Füßen ist von einem üppigen Ingwergold der Bucheckern verfärbt. Die Stämme der Buchen schimmern, als wäre die Rinde von Silber durchzogen. Doch nachts herrschen hier Dunkel und Schweigen. Eine tiefe abweisende Stille erfüllt den Wald.
Der Grund ist nicht von einem Zaun begrenzt, sondern von einer Hecke mit Toren aus rotem Zedernholz. Die meisten führen nur zu einfachen Pfaden, die nicht befahrbar sind, doch das Haupttor steht an einer Straße, die in nördlicher Richtung von der B 2428 abbiegt und Kingsmarkham mit Cambery Ashes verbindet. An einem Pfosten links vom Tor ist ein Wegweiser befestigt, eine einfache Holztafel mit der Aufschrift TANCRED HOUSE, PRIVATSTRASSE, BITTE DAS TOR SCHLIESSEN.
An diesem Dienstagabend, dem Abend des 11. März, 20.51 Uhr, war das Tor geschlossen. Detective Sergeant Vine stieg aus dem ersten Wagen und öffnete es, obwohl er einen höheren Rang bekleidete als die meisten anderen Beamten in den beiden Autos. Er war als Ersatzmann für Caleb Martin nach Kingsmarkham gekommen. Der Konvoi bestand aus drei Fahrzeugen – das letzte war der Krankenwagen. Vine ließ alle die Einfahrt passieren und schloss dann das Tor. Man konnte hier nicht sehr schnell fahren, doch Pemberton tat sein Möglichstes.
Später erfuhren sie, dass diese Straße, die sie von da an täglich benutzten, immer schon als Hauptzufahrt diente.
Es war dunkel, zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Die letzte Straßenlaterne war achtzig Meter vom Tor entfernt an der B 2428. Schwaden grünlichen Nebels zogen umher. Die Baumstämme bildeten graue Pfeilerkolonnaden, die von dem Dunst eingehüllt wurden.
Niemand sprach ein Wort. Der letzte, der etwas geäußert hatte, war Barry Vine gewesen, als er erklärte, dass er aussteigen und das Tor öffnen werde. Detective Inspector Burden schwieg. Er überlegte, was sie in Tancred House vorfinden mochten, dachte sich dann aber, dass es sinnlos sei, Spekulationen anzustellen. Pemberton hatte nichts zu sagen und fand auch, dass es nicht ihm zustände, eine Unterhaltung zu beginnen.
In dem Transporter hinter ihnen saßen der Fahrer, Gerry Hinde, ein Mann von der Spurensicherung namens Archbold, ein Fotograf, Milson mit Namen, und eine Polizeibeamtin, Detective Constable Karen Malahyde. In dem Rettungswagen folgten eine Frau und ein Mann, die Frau saß am Steuer.
Der Konvoi fuhr, abgesehen von dem Motorengeräusch der drei Fahrzeuge, lautlos dahin. Er wand sich zwischen hohen baumbestandenen Böschungen dahin und dann wieder über ebene, sandbedeckte Flächen. Warum die Straße diese Windungen beschrieb, war ein Geheimnis, denn der Hügel stieg nur flach an, ohne jedes Hindernis, außer vielleicht vereinzelten Baumriesen, von denen in der Dunkelheit freilich nichts zu sehen war.
Die Marotte eines »Waldbegründers«, dachte Burden. Er versuchte sich zu erinnern, ob er schon einmal in diesen Wäldern gewesen war, aber er kannte die Gegend nicht sehr gut. Natürlich wusste er, wer der derzeitige Eigentümer war, jeder in Kingsmarkham wusste das. Dann beschäftigte ihn der Gedanke, ob Wexford die Nachricht bereits erhalten hatte, die sie ihm hinterlassen hatten; ob der Chief Inspector ihnen vielleicht schon folgte.
Vine blickte angestrengt zum Seitenfenster hinaus. Er drückte die Nase an die Scheibe, als gäbe es draußen etwas zu sehen außer der Dunkelheit, dem Dunst und den Straßenrändern vor ihnen, die gelblich glänzten und im Scheinwerferlicht nass wirkten. Keine Augen schauten aus der Tiefe des Waldes, keine Zwillingspunkte, grün oder golden, und kein Vogel, kein anderes Tier regte sich. Selbst der Himmel war hier nicht zu erkennen. Die Baumkronen schienen eine geschlossene Decke zu bilden.
Burden hatte gehört, dass es auf dem Gut Cottages gab, Häuschen, in denen das Personal von Davina Flory untergebracht war. Sie befanden sich inzwischen sicher in der Nähe von Tancred House, nicht weiter als fünf Minuten Fußmarsch davon entfernt, aber sie kamen an keinem Tor vorüber, kein Pfad zweigte ab, und nirgends war ein Licht zu sehen. London lag nur achtzig Kilometer entfernt, und trotzdem hatte man den Eindruck, im Norden Kanadas oder in Sibirien zu sein. Der Wald schien kein Ende zu nehmen. Baumreihe folgte auf Baumreihe, manche Bäume an die fünfzehn Meter hoch, andere erst bis zur Hälfte ausgewachsen. Nach jeder Biegung meinte man, dass hinter der nächsten Tancred House auftauchen musste, und sah sich dann doch getäuscht.
Burden beugte sich nach vorne und sagte zu Pemberton mit einer Stimme, die in der Stille laut klang: »Wie weit liegt das Tor jetzt schon hinter uns?«
Pemberton schaute nach. »Fast vier Kilometer, Sir.«
»Verdammt weit, nicht?«
»Fünf Kilometer nach der Karte«, sagte Vine. Er hatte eine weißliche Druckstelle an der Nase, dort, wo er sie gegen die Scheibe gepresst hatte.
»Es kommt mir vor wie Stunden«, knurrte Burden vor sich hin und spähte hinaus, auf die Bäume, die kein Ende nehmen wollten, als das Herrenhaus in Sicht kam. Der Anblick ließ es den Männern kalt den Rücken hinunterlaufen.
Der Wald trat plötzlich zurück, als würde ein Vorhang geöffnet, und da stand Tancred House, beleuchtet wie ein Bühnenbild, im grünlichen, kalten Mondlicht. Das Ganze hatte eine dramatische Wirkung. Das Haus schien in einem strahlenden Licht aus einem dunklen Abgrund aufzusteigen. Die Fassade selbst war mit orangefarbenen Lichtflecken gesprenkelt: den Quadraten und Rechtecken erleuchteter Fenster.
Nicht Licht hatte Burden erwartet, sondern trostloses Dunkel. Die Szene vor seinen Augen war wie die einleitende Aufnahme von einem Märchen, das auf einem abgelegenen Schloss spielte, einem Film über Dornröschen. Musik hätte dazu gehört, eine sanfte, aber unheimliche Melodie mit Hörnern und Pauken. Die Stille gab einem das Gefühl, dass etwas ganz Wesentliches fehlte, dass irgendetwas schrecklich fehlgeschlagen war. Der Ton war weg, ohne dass die Lampensicherungen durchbrannten. Burden sah, wie der Wald wieder näher herantrat, als die Straße noch eine weitere Kurve beschrieb. Ungeduld ergriff ihn. Am liebsten wäre er hinausgesprungen und auf das Haus zu gerannt, um sich gewaltsam Zugang zu verschaffen und das Grauen vor sich zu sehen, um zu sehen, was dieses Grauenvolle war, doch er blieb verdrossen auf seinem Platz sitzen.
Dieser erste kurze Blick war aber nur ein Vorgeschmack gewesen. Die Straße führte jetzt über ein grasbewachsenes Stück flachen Geländes, auf dem einpaar große Bäume standen. Die Insassen der Fahrzeuge fühlten sich sehr exponiert, als wären sie die Vorhut einer Invasionsstreitmacht, die einem Hinterhalt entgegenfährt. Das Haus vor ihnen war nun in aller Klarheit zu sehen, ein ländliches Herrenhaus, anscheinend georgianisch, abgesehen von dem steil aufsteigenden Dach und den Kaminen, die wie Kerzenleuchter wirkten. Alles in allem machte Tancred House einen weitläufigen und imposanten, aber auch bedrohlichen Eindruck.
Eine niedrige Mauer trennte den Vorhof des Hauses vom übrigen Gutsgelände. Die Straße, auf der sie kamen, führte direkt auf die Mauer zu. Kurz bevor sie diese passierten, zweigte links noch einSträßchen ab, das wahrscheinlich zu einem der Seitenflügel oder an dieRückseite von Tancred House führte. Die Mauer selbst verbarg die Flutlichter.
»Fahren Sie geradeaus weiter«, sagte Burden.
Hinter zwei steinernen Mauerpfosten mit Glockenkapitellen öffnete sich eine weite Fläche, die mit Portlandsteinen gepflastert war. Die goldbraunen Steine waren so dicht gefügt, dass nicht einmal Moos zwischen ihnen hätte sprießen können. Genau in der Mitte dieses Vorhofs befand sich ein großes, rundes Becken, in dessen Mitte sich ein Inselchen mit einer Statuengruppe erhob – ein Mann, ein Baum, ein Mädchen in grauem Marmor –, die von Blumen und großblättrigen Pflanzen aus verschiedenfarbigem Marmor umrankt war. Vielleicht diente das Ganze als Springbrunnen. Im Augenblick war die Wasserfläche jedoch glatt und unbewegt.
Geformt wie ein »E« ohne Querbalken oder wie ein Rechteck, dem eine Langseite fehlt, stand das Haus ohne jeden Zierrat am Ende dieser weiten Steinfläche. Keine Kletterpflanze rankte sich an der verputzten Fassade hoch, kein Strauch wuchs so nahe, dass er das Rustika-Mauerwerk beeinträchtigen konnte. Die Bogenlampen auf dieser Seite der Mauer tauchten jede zarte Linie und jede winzige Vertiefung in der Oberfläche in helles Licht.
Überall brannten die Lampen, in den beiden Seitenflügeln, im Haupttrakt und in der Galerie darüber. Sie glühten hinter zugezogenen Vorhängen, rosig, orangefarben oder grün, entsprechend der Vorhangfarbe. Das Licht der Bogenlampen konkurrierte mit diesen weicheren, wärmeren Farben, konnte sie aber nicht ganz überstrahlen. Alles war absolut regungslos, kein Windhauch wehte, so dass man glaubte, nicht nur die Luft, sondern auch die Zeit selbst wäre zum Stillstand gekommen.
Der Konvoi fuhr links an dem Becken vorbei auf den Eingang zu. Burden und Vine stießen die Wagentüren auf. Vine war als erster am Eingang, den man über zwei breite, flache Stufen erreichte. Sollte es jemals einen Vorbau gegeben haben, war er inzwischen verschwunden, und zu beiden Seiten der Türe waren nur ein paar nicht kannellierte, in die Mauer eingelassene Säulen geblieben. Die Flügel der Haustüre selbst waren schimmernd weiß und glänzten im grellen Licht der Bogenlampen so stark, als wäre die Farbe noch feucht. Um die Klingel zu betätigen, musste man an einem schmiedeeisernen Stab ziehen, der an eine Zuckerstange erinnerte. Der Ton, der darauf entstand, musste durch das Haus gehallt haben, denn er war selbst für die Sanitäter, die beinahe zwanzig Meter weiter weg aus ihrem Rettungswagen stiegen, deutlich zu vernehmen. Vine zog ein zweites und drittes Mal und griff dann nach dem schweren Türklopfer aus Messing. In Gedanken bei der Stimme, die so dringend um Hilfe gefleht hatte, warteten sie auf ein Geräusch. Aber es tat sich nichts. Kein Wimmern, kein Flüstern. Stille. Burden ließ den Türklopfer auf die Platte knallen und drückte mehrmals die Klappe des Briefeinwurfs nach innen, so dass sie laut zurückschlug.
»Wir werden uns mit Gewalt Zugang verschaffen müssen«, sagte Burden.
Niemand kam im Augenblick auf die Idee, dass es einen Hintereingang oder vielleicht sogar mehrere unverschlossene Türen auf der Rückseite des Hauses geben mochte.
Aber wo? Vier breite Fenster flankierten den Vordereingang, zwei auf jeder Seite. Wenn man durchspähte, sah man eine Art Vorhalle mit Lorbeerbäumen und Lilien in Kübeln auf einem gesprenkelten weißen Marmorboden. Die Blumen schimmerten im Licht zweier Kandelaber. Was sich hinter einem gemauerten Bogen verbarg, war nicht zu erkennen. Es sah warm und friedlich aus da drinnen, es wirkte kultiviert, ein wohl ausgestatteter, vornehmer Wohnsitz, das Zuhause reicher, luxusliebender Menschen. In der Vorhalle stand an einer Wand eine zum Teil vergoldete Mahagonikonsole, daneben nachlässig hingestellt ein zerbrechlich wirkender Stuhl mit einem roten Samtpolster. Aus einem chinesischen Topf auf dem Tisch quollen lange Triebe einer kriechenden Pflanze.
Burden entfernte sich vom Hauseingang und trat auf den weiten Vorhof. Die Beleuchtung war so grell, als hätte sich der Mond in einem Spiegel am Himmel verdoppelt. Hinterher meinte Burden zu Wexford, die Helligkeit habe alles noch schlimmer gemacht. Dunkelheit wäre passender gewesen, damit wäre er besser zurechtgekommen.
Er näherte sich dem Westflügel, wo ein schwach gerundetes Erkerfenster nur ein paar Fuß über dem Boden begann. Von innen drang gedämpftes grünes Licht ins Freie. Die Vorhänge waren zugezogen, ihr blasses Futter der Fensterscheibe zugekehrt, doch Burden vermutete, dass sie auf der Sichtseite aus grünem Samt waren. Später sollte er sich fragen, welcher Instinkt ihn zu diesem Fenster geführt und veranlasst hatte, es nicht mit einem der Fenster neben dem Eingang zu probieren.
Ein dunkles Vorgefühl hatte ihm gesagt, dass er hier richtig sei. Dort drinnen war, was es zu entdecken galt. Er versuchte durch den messerrückenschmalen, vom Licht erhellten Spalt zwischen den Vorhängen zu schauen, erkannte aber nichts, weil ihn die Helligkeit blendete. Die anderen standen stumm dicht hinter ihm.
»Schlagen Sie das Fenster ein!« wies er Pemberton an. Pemberton machte sich gelassen ans Werk und schlug mit einem Schraubenschlüssel aus dem Wagen eine der ziemlich großen, rechteckigen Scheiben in der Mitte des Erkerfensters ein. Mit der Hand fuhr er durch die Öffnung, schob den Vorhang beiseite, öffnete den Verschluss am unteren Teil des Schiebefensters und schob ihn nach oben. Burden zog den Kopf ein und kletterte als erster hinein, gefolgt von Vine. Schwerer, dicker Stoff umgab ihre Köpfe. Entschlossen schoben sie den Vorhang zur Seite, so dass die Ringe mit einem schwachen Klingeln über die Stange glitten.
Sie standen vielleicht einen Meter von dem Fenster entfernt, auf einem dicken Teppich, und sahen, was zu sehen sie gekommen waren. Vine sog mit einem scharfen Geräusch die Luft ein. Niemand sonst gab einen Ton von sich. Pemberton stieg durch das Fenster und nach ihm Karen Malahyde. Burden trat beiseite, um ihnen Platz zu machen. Er stieß keinen Schrei aus. Er schaute geradeaus. Fünfzehn Sekunden vergingen. Seine Augen begegneten Vines starrem, leerem Blick. Er drehte sogar den Kopf um und registrierte – als wäre er in einer anderen Welt –, dass die Vorhänge tatsächlich aus grünem Samt waren. Dann blickte er wieder zu dem Esstisch hin.
Es war ein großer Tisch, beinahe drei Meter lang, bedeckt mit einem Tischtuch und darauf Gläser und Silber. Speisen waren aufgetragen, und das Tischtuch war rot. Es sah aus, als wäre es rot gedacht, aus scharlachfarbenem Damast, nur war das dem Fenster nächst gelegene Stück weiß. Die rote Flut war nicht so weit vorgedrungen.
Auf der Stelle mit dem tiefsten Scharlachrot lag jemand vornüber zusammengebrochen, eine Frau, die an dem Tisch gesessen oder gestanden hatte. Gegenüber der Körper einer anderen Frau, gegen die Stuhllehne zurückgeworfen. Der Kopf hing ihr im Genick, das lange schwarze Haar floss herab, und ihr Kleid hatte die gleiche rote Farbe wie die Tischdecke, als hätte sie es passend dazu gewählt.
Diese beiden Frauen hatten exakt in der Tischmitte einander gegenübergesessen. Die Gedecke zeigten, dass zwei weitere Personen am Kopf- und am Fußende gesessen hatten. Doch nur die beiden Frauenkörper waren zu sehen und die scharlachrote Fläche zwischen ihnen.
Es stand außer Frage, dass die beiden Frauen tot waren. Dieältere, deren Blut das Tischtuch rot gefärbt hatte, hatte eine Schusswunde an einer Schläfe. Man konnte es feststellen, ohne sie zu berühren. Die Hälfte des Kopfes und des Gesichts waren grausig zugerichtet. Die andere war in den Hals geschossen worden. Ihr seltsamerweise unversehrtes Gesicht war weiß wie Wachs. Die Augen standen weit offen und starrten zur Decke, wo ein paar dunkle Spritzer, vielleicht Blut, zu sehen waren. Blut war an den dunkelgrün tapezierten Wänden, den goldgrünen Lampenschirmen zu erkennen, hatte auf dem dunkelgrünen Teppich schwarze Flecke hinterlassen. Ein roter Tropfen hatte ein Bild an der Wand getroffen, war über die grob aufgetragene fahle Ölfarbe gelaufen und getrocknet.
Auf dem Tisch standen drei Teller mit Speisen. Auf zweien davon war das Essen, wenn auch kalt geworden und etwas eingetrocknet, als Essen erkennbar. Der dritte war mit Blut überschwemmt, als hätte jemand eine ganze Flasche Soße für irgendeine Horrormahlzeit darüber entleert.
Zweifellos stand auf dem Tisch noch ein vierter Teller. Der zerschossene Kopf der Frau, deren Körper nach vorne gesackt war, war darauf gesunken. Ihr dunkles, von grauen Strähnen durchzogenes Haar hatte sich aus dem Knoten im Nacken gelöst und lag zwischen einem Salzstreuer, einem umgestürzten Glas und einer zerknüllten Serviette ausgebreitet. Eine zweite blutgetränkte Serviette lag auf dem Teppich.
Ein Servierwagen mit Speisen war dicht zu dem Platz gezogen worden, den die jüngere Frau einnahm, die, deren Haar über die Stuhllehne hing. Auch hier war alles mit Blut besudelt.
Es war eine Ewigkeit her, dass es Burden bei einem derartigen Bild übel geworden war. Andererseits: Hatte er jemals schon einmal eine solche Szene gesehen? Er empfand ein Gefühl der Leere im Kopf, als hätte es ihm die Sprache verschlagen, als wären angesichts dessen alle Worte sinnlos. Und obwohl es in dem Haus warm war, empfand er plötzlich eine eisige Kälte. Er legte die Finger der linken Hand in die rechte und spürte, dass sie kalt waren wie Eis.
Burden stellte sich den Krach, das Getöse vor, mit dem sich der Lauf der Waffe entleert haben musste – einer Flinte, eines Jagdgewehrs oder eines noch schwereren Kalibers? Den Lärm, der die Ruhe in diesem friedlichen, warmen Raum brutal unterbrach. Und diese Menschen, wie sie plaudernd dasaßen, das Essen halb verzehrt, und auf schreckliche Weise aus der Ruhe gerissen wurden … Er drehte sich um und tauschte mit Barry Vine einen kurzen Blick. Beiden war bewusst, dass aus ihren Augen Bestürzung, Übelkeit am Rande des Erbrechens sprachen. Sie starrten fassungslos auf das Bild, das sich ihnen darbot.
Burden merkte, dass er sich steif bewegte, als hätte er bleierne Gewichte an Füßen und Händen. Seine Kehle war wie zugeschnürt, während er durch die offenstehende Speisezimmertür langsam in das Innere des Hauses ging. Hinterher, mehrere Stunden später, fiel ihm ein, dass er währenddessen den Anruf der Frau ganz vergessen hatte. Der Anblick der Toten hatte bewirkt, dass er die Lebenden vergaß, die möglicherweise noch Lebenden …
Er trat in eine imposante Halle, deren Decke den Blick auf die Lichtkuppel hoch oben in der Mitte des Daches freigab und die gleichfalls von mehreren Lampen, allerdings weniger hell, erleuchtet war. In diesem Raum standen Lampen mit silbernen Sockeln und Lampen mit Sockeln aus Glas und Keramik, die Schirme aprikosen- oder elfenbeinfarben. Der Boden bestand aus blankpoliertem Holz, auf dem kleine Teppiche verteilt waren, die Burden orientalisch vorkamen, Läufer und Brücken mit fliederfarbenen, roten, braunen und goldenen Mustern. Aus dieser Halle führte eine Treppe nach oben, die sich im ersten Stock zweiteilte und von einer Galerie mit ionischen Geländersäulen weiter nach oben führte. Am Fuß der Treppe lag quer über den untersten Stufen die Leiche eines Mannes.
Auch er war erschossen worden – in die Brust getroffen. Der Treppenläufer war rot, und das Blut, das ihn befleckt hatte, erinnerte an dunkle Weinflecken. Burden holte tief Luft, merkte, dass er sich die Hand vor den Mund hielt, und senkte sie energisch. Er blickte langsam und konzentriert um sich und bemerkte, dass sich in einer Ecke am anderen Ende der Halle etwas regte.
Das scheppernde, klappemde Geräusch, das plötzlich zu hören war, bewirkte, dass sich seine Stimme löste. Diesmal stieß er doch einen Schrei aus.
»Großer Gott!« Seine Stimme kam gequält heraus, als umklammere eine Hand seine Kehle.
Er hatte einen Telefonapparat entdeckt, der durch irgendeine unfreiwillige, heftige Bewegung auf den Boden gerissen worden war. Aus der dunkelsten Ecke der Halle, wo keine Lampe stand, kroch etwas auf ihn zu. Es gab ein Stöhnen von sich. Es hatte sich in der Telefonschnur verheddert, und dahinter rutschte und tanzte der Apparat über das polierte Eichenholz. Er tanzte und hüpfte wie ein Spielzeug, das von einem Kind an einer Schnur gezogen wird.
Sie war kein Kind mehr, allerdings, wie sich zeigte, nicht viel älter – ein Mädchen, das auf allen vieren auf ihn zu kroch und mit den bestürzten, unartikulierten Jammerlauten eines verwundeten Tieres zu seinen Füßen zusammenbrach. Sie war über und über mit Blut bedeckt, das ihr langes Haar verklebt, ihre Kleider durchtränkt, an ihren Armen rote Streifen hinterlassen hatte. Sie hob das Gesicht, das mit Blut verschmiert war, als hätte sie die Finger hineingetaucht und sich die Haut damit bemalt.
Zu seinem Entsetzen bemerkte Burden, dass aus einer Wunde links oben an ihrer Brust noch immer Blut quoll. Er ließ sich vor dem Mädchen auf die Knie fallen.
Sie begann zu sprechen. Die Worte kamen in einem halb erstickten Flüsterton. »Helfen Sie mir, helfen Sie mir …«
4
_____
Bereits zwei Minuten später war der Rettungswagen unterwegs zum Krankenhaus in Stowerton. Diesmal war das Blaulicht eingeschaltet, und die Sirene kreischte durch die dunklen stillen Wälder.
Der Wagen fuhr so schnell, dass der Fahrer scharf bremsen und ausweichen musste, um nicht mit Wexford zusammenzustoßen, der fünf Minuten nach neun Uhr von der B 2428 Richtung Tancred House abbog.
Die Nachricht hatte ihn erreicht, als er mit seiner Frau, seiner Tochter und deren Freund in einem neuen italienischen Restaurant in Kingsmarkham, das den Namen La Primavera trug, beim Abendessen saß. Sie waren mitten im Hauptgang gewesen, als sein Portable zu wimmern begann und ihn, wie er hinterher dachte, auf eine seltsam abrupte Art davor bewahrte, etwas zu tun, was er vielleicht bereut hätte. Ein rasches Wort zu Dora und ein recht beiläufiger Abschied von den anderen, und schon war er zur Tür hinaus. Sein Marsala Schnitzel blieb ungegessen auf dem Teller zurück.
Dreimal hatte er versucht, Tancred House zu erreichen, aber jedes Mal war besetzt gewesen. Als der von Donaldson gesteuerte Wagen die erste Biegung der schmalen Straße durch den Wald passiert hatte, versuchte er es noch einmal. Diesmal war der Anschluss frei, und am Apparat meldete sich Burden.
»Der Hörer war nicht auf der Gabel. Er war auf den Boden gefallen. Drei Tote. Erschossen. Sie müssen dem Rettungswagen mit dem Mädchen begegnet sein.«
»In welcher Verfassung ist sie?«
»Kann ich nicht sagen. Sie war bei Bewusstsein, aber ziemlich schlimm zugerichtet.«
»Haben Sie mit ihr gesprochen?«
»Natürlich«, sagte Burden. »Es ging nicht anders. Sie sind zu zweit ins Haus gekommen, aber sie hat nur einen gesehen. Sie sagt, es war acht Uhr, als es passiert ist, oder kurz danach, ein, zwei Minuten nach acht. Mehr brachte sie nicht heraus.«
Wexford schob das Telefon wieder in die Tasche. Die Uhr am Armaturenbrett zeigte ihm, dass es zwölf Minuten nach neun war. Als ihn der Anruf erreichte, war er nicht so sehr missgelaunt als irritiert gewesen und in einer niedergeschlagenen Stimmung, die immer ärger wurde. An dem Tisch im La Primavera hatte er gegen Antipathie, ja, richtiggehenden Abscheu anzukämpfen begonnen. Und dann, als er zum dritten- oder vierten Mal eine scharfe Bemerkung zurückhielt, die ihm auf der Zunge lag, und sich um Sheilas willen zusammenriss, hatte sein Telefon geklingelt. Dann schob er die Erinnerung an den quälenden Abend beiseite; jetzt musste alles vor dem Massaker in Tancred House zurücktreten.
Das beleuchtete Herrenhaus tauchte zwischen den Bäumen auf, wurde von der Dunkelheit verschluckt und erschien wieder, als Donaldson den Wagen auf den Vorhof steuerte und zwischen den anderen Fahrzeugen zum Stehen brachte.
Der Eingang stand offen. Wenn man das Haus durch die Vorhalle betrat, gelangte man von dort direkt in die große Halle, wo Blut auf dem Boden und auf den Teppichbrücken zu sehen war. Blut bildete einen Archipel von Inseln auf dem blassen Eichenboden. Als Barry Vine zu ihm herauskam, erblickte Wexford die Leiche eines Mannes auf den unteren Treppenstufen.
Wexford trat näher und sah sie sich an. Es war ein etwa sechzigjähriger, großer, schlanker Mann. Er hatte ein einnehmendes Gesicht mit feinen Zügen, des Typus’, der gewöhnlich sensibel genannt wird. Das Gesicht war jetzt wächsern und gelblich. Der Unterkiefer hing herab. Die blauen Augen standen offen und blickten starr. Blut hatte sein weißes Hemd scharlachrot gefärbt und auf seiner dunklen Jacke noch dunklere Flecke hinterlassen. Er war für den Abend gekleidet, in Anzug und Krawatte, und der Killer hatte ihn von vorne aus kurzem Abstand in Brust und Kopf geschossen. Der Kopf war eine blutige Masse, das dichte, weiße Haar bräunlich verklebt.
»Wissen Sie, wer das ist?«
Vine schüttelte den Kopf. »Müsste ich es wissen, Sir? Ich nehme an, der Typ, dem das Haus hier gehört.«
»Es ist Harvey Copeland, ehemaliger Abgeordneter für die Southern Boroughs und Ehemann von Davina Flory. Sie sind ja noch nicht lange hier, aber von Davina Flory haben Sie wohl schon gehört, nicht?«
»Ja, Sir, natürlich.«
Bei Vine wusste man nie, wie man dran war. Hatte er schon von ihr gehört oder nicht? Dieses völlig ausdruckslose Gesicht, die ruhige Art, die unerschütterliche Gelassenheit.