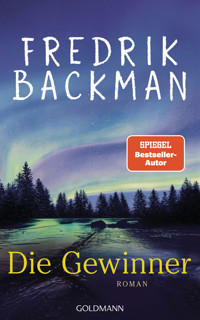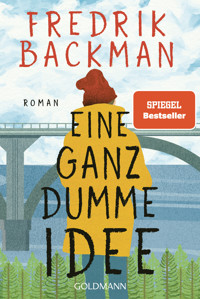
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Kleinstadt in Schweden kurz vor dem Jahreswechsel: An einem grauen Tag findet sich eine Gruppe von Fremden zu einer Wohnungsbesichtigung zusammen. Sie alle stehen an einem Wendepunkt, sie alle wollen einen Neuanfang wagen. Doch dieser Neuanfang verläuft turbulenter als gedacht. Denn wegen der ziemlich dummen Idee eines stümperhaften Bankräubers werden auf einmal alle Beteiligten zu Geiseln. Auch wenn davon niemand überraschter ist als der Geiselnehmer selbst. Es folgt ein Tag voller verrückter Wendungen und ungeahnter Ereignisse, der die Pläne aller auf den Kopf stellt – und ihnen zeigt, was wirklich wichtig im Leben ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
In einem Mietshaus mitten in einer schwedischen Kleinstadt versammelt sich eine Gruppe von Fremden: Sie alle wollen am 30. Dezember nur noch schnell diese eine Wohnung besichtigen, bevor das Jahr vorbei ist. Vielleicht ist das hier ja die Traumwohnung, mit der alle Sorgen und Nöte ein Ende nehmen. Doch dann stolpert mit vorgehaltener Waffe ein gescheiterter Bankräuber durch die Tür, und aus der harmlosen Besichtigung wird auf einmal eine Geiselnahme. Mit der übrigens niemand überforderter ist als der Bankräuber und frischgebackene Geiselnehmer selbst.
Denn der muss nun erst einmal wild improvisieren. Zusammen mit seinen Geiseln setzt er dadurch eine turbulente Kette von Ereignissen in Gang. Während sich draußen vor dem Haus Polizei und Journalisten versammeln und die ganze Kleinstadt in Aufruhr gerät, lernt sich dabei im Inneren die wild zusammengewürfelte Gruppe völlig Fremder allmählich näher kennen: Lang verschwiegene Geheimnisse kommen ebenso ans Tageslicht wie verborgene Träume, zusammen mit so manch überraschender Wahrheit. Und so bleiben am Ende eines turbulenten Nachmittags nicht nur eine völlig überforderte Polizei zurück, sondern auch eine Handvoll Menschen, die erkannt haben, was wirklich zählt im Leben …
Weitere Informationen zu Fredrik Backman finden Sie am Ende des Buches.
Fredrik Backman
Eine ganz dumme Idee
Roman
Aus dem Schwedischen
von Antje Rieck-Blankenburg
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
»Folk med Ångest« bei Bokförlaget Forum, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2021
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Fredrik Backman
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by agreement with Salomonsson Agency
Redaktion: Julie Hübner
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Th · Herstellung: Han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-26065-1V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Dieses Buch ist den Stimmen in meinem Kopf gewidmet, meinen verrücktesten Freunden.
Und meiner Frau, die es mit uns aushalten muss.
Kapitel 1
Ein Bankraub. Ein Geiseldrama. Ein Pistolenschuss. Ein Treppenhaus voller Polizisten, die gerade eine Wohnung stürmen. In diese Situation zu geraten war ein Leichtes gewesen, viel leichter, als man hätte meinen können. Man musste eigentlich nur auf eine einzige richtig, richtig dumme Idee kommen.
In dieser Geschichte geht es um vieles, aber hauptsächlich um Idioten. Deshalb muss gleich von Anfang an klargestellt werden, wie einfach es ist, andere Menschen als Idioten abzustempeln, jedenfalls dann, wenn man vergisst, wie idiotisch schwer es meistens ist, ein Mensch zu sein. Insbesondere wenn man anderen ein einigermaßen guter Mitmensch sein möchte.
Jedem Menschen wird heutzutage pausenlos unfassbar viel abverlangt. Man muss eine Arbeit haben, und man muss eine Wohnung und eine Familie haben, und man muss Steuern zahlen und jeden Tag frische Unterwäsche anziehen und sich obendrein auch noch das Passwort für sein verfluchtes WLAN merken. Einigen von uns gelingt es nicht, die Kontrolle über dieses ganze Chaos zu erlangen, und dann lassen wir das Leben einfach so laufen, die Erde rauscht mit zwei Millionen Stundenkilometern durchs Weltall, und wir irren panikartig auf der Oberfläche umher wie verloren gegangene einzelne Socken. Unsere Herzen sind wie glitschige Seifenstücke, die uns aus den Händen gleiten, sobald wir auch nur für eine Millisekunde den Griff lockern. Sie flattern davon und verlieben und entlieben sich einfach wieder. Wir verlieren den Überblick. Deshalb lernen wir, die ganze Zeit einfach nur etwas vorzugeben, im Job, in unserer Ehe, mit unseren Kindern und mit allem anderen auch. Vorzugeben, wir seien normal, wir hätten alles auf dem Schirm, wir wüssten, was Begriffe wie ›Abschreibungsquote‹ und ›Inflationsrate‹ bedeuten. Wir tun so, als wüssten wir, wie Sex funktioniert. Doch die Wahrheit lautet, dass wir genauso wenig über Sex wissen wie über USB-Sticks, und mit diesen kleinen miesen Teufeln benötigen wir jedes Mal vier Anläufe (Falsches Loch, falsches Loch, falsches Loch, JETZT passt er rein!). Wir tun so, als seien wir gute Eltern, während wir unsere Kinder eigentlich nur mit Kleidung und Essen versorgen und sie anmotzen, wenn sie ein Kaugummi in den Mund nehmen, das sie vom Boden aufgelesen haben. Wir hatten einmal Zierfische im Aquarium, die sind alle eingegangen. Und eigentlich wissen wir kein bisschen mehr über Kinder als über Aquariumsfische, was zur Folge hat, dass uns die Verantwortung für diese kleinen Wesen jeden Morgen fast erdrückt. Wir haben keinen Plan, wir versuchen nur irgendwie durch den Tag zu kommen, denn morgen erwartet uns schon wieder ein neuer Tag.
Manchmal haben wir Schmerzen, entsetzliche Schmerzen, und zwar nur deswegen, weil sich unsere Haut nicht wie unsere eigene anfühlt. Manchmal verfallen wir in Panik, weil irgendwelche Rechnungen bezahlt werden und wir erwachsen sein müssen, aber nicht wissen, wie wir es anstellen sollen, da es so verdammt schwer ist, am Erwachsensein nicht zu scheitern.
Alle Menschen lieben irgendwen, und alle, die irgendwen lieben, haben nachts schon verzweifelt wach gelegen und versucht herauszufinden, wie sie es schaffen sollen, Mensch zu bleiben. Manchmal bringt uns das sogar dazu, Dinge zu tun, die im Nachhinein zwar völlig unbegreiflich sind, uns aber in dem Moment als der einzige Ausweg erscheinen.
Eine einzige richtig, richtig dumme Idee. Das ist alles, was erforderlich ist.
Eines Morgens verließ zum Beispiel eine neununddreißigjährige Person ihre Wohnung mit einer Pistole in der Hand, was im Nachhinein betrachtet wirklich äußerst idiotisch war. Denn diese Geschichte handelt von einem Geiseldrama, allerdings einem unbeabsichtigten. Oder besser gesagt, ein Drama sollte es schon werden, aber eben kein Geiseldrama. Eigentlich hätte es ein simpler Bankraub werden sollen. Doch dann ging alles ein wenig den Bach runter, was bei Banküberfällen schon mal vorkommt. Der neununddreißigjährige Bankräuber flüchtete also, allerdings ohne einen Fluchtplan zu haben. Und mit Fluchtplänen verhält es sich genauso wie mit den mütterlichen Sprüchen, die der Bankräuber als kleines Kind immer zu hören bekam, wenn er die Eiswürfel und Zitronenscheiben in der Küche vergessen hatte und noch einmal zurücklaufen musste: »Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben!« (Hier sollte ergänzend erwähnt werden, dass die Mutter des Bankräubers zum Zeitpunkt ihres Todes so viele Gin Tonics intus hatte, dass man sich wegen der Explosionsgefahr nicht traute, ihre Leiche einzuäschern. Da war guter Rat teuer.) Nach dem Bankraub, der letztendlich gar keiner war, rückte natürlich die Polizei an, und da rannte der Bankräuber, so schnell ihn seine Beine trugen, hinaus auf den Bürgersteig und quer über die Straße, wo er die erstbeste Haustür aufstieß. Vielleicht scheint es etwas übertrieben, den Bankräuber nur deswegen einen Idioten zu schimpfen, aber … na ja, du weißt schon. Superschlau war es jedenfalls nicht. Die Tür führte nämlich in ein Treppenhaus ohne weitere Ausgänge, sodass dem Bankräuber nichts anderes übrig blieb, als die Treppen hinaufzurennen.
Hinzu kommt, dass der Bankräuber die Kondition einer ganz gewöhnlichen neununddreißigjährigen Person hatte. Der Bankräuber war also keiner dieser neununddreißigjährigen Großstadt-Fitnessjunkies, die versuchen, ihre Vierziger-Krisen zu überwinden, indem sie sich sauteure Radlerhosen und Schwimmkappen zulegen, weil sie ein schwarzes Loch in ihrer Seele haben, das Instagram-Fotos verschlingt, sondern eher der Typ Neununddreißigjähriger, der täglich Kohlenhydrate und Fette in einer Menge konsumiert, die rein medizinisch betrachtet eher als Hilferuf denn als Diät eingestuft werden müsste. Der Bankräuber erreichte das Obergeschoss also schweißgebadet und mit einer Atemfrequenz, die man normalerweise eher mit der Art von Klubs in Verbindung bringt, an deren Eingangstür man ein geheimes Codewort durch eine Luke flüstern muss, um Zugang zu erhalten. Seine Chancen, der Polizei zu entkommen, waren in dieser Situation also, gelinde ausgedrückt, gleich null.
Doch zufällig wandte der Bankräuber genau in diesem Moment den Kopf und erblickte eine offen stehende Wohnungstür. Die betreffende Wohnung wurde nämlich gerade zum Verkauf angeboten, und drinnen fand eine Besichtigung mit einigen Kaufinteressenten statt. Dort stolperte der Bankräuber also mit gezogener Pistole hinein, keuchend und völlig verschwitzt. So wurde daraus ein Geiseldrama.
Nun ja, und dann kam es, wie es kommen musste: Die Polizei umstellte das Gebäude, Journalisten tauchten auf, sogar das Fernsehen kam. Das Ganze dauerte mehrere Stunden, bis der Geiselnehmer schließlich aufgab. Letztendlich blieb ihm keine andere Wahl. Alle acht Personen, die er als Geiseln genommen hatte, sieben Kaufinteressenten und eine Maklerin, wurden freigelassen. Wenige Minuten später stürmte die Polizei die Wohnung. Doch zu diesem Zeitpunkt war sie leer.
Niemand weiß, wo der Geiselnehmer abgeblieben ist.
Das ist eigentlich schon alles, was du vorab wissen solltest. Und jetzt beginnt die Geschichte.
Kapitel 2
Vor zehn Jahren stand ein Mann auf einer Brücke. Diese Geschichte handelt allerdings nicht von diesem Mann. Du brauchst ihn also im Augenblick nicht weiter zu beachten. Tja, jetzt kannst du natürlich nicht mehr aufhören, an ihn zu denken, und es ist genau so, als hätte ich gesagt, »Denk jetzt nicht an Schokolade«, da musst du unweigerlich an Schokolade denken. Denk also nicht an Schokolade!
Du brauchst nur zu wissen, dass vor zehn Jahren ein Mann auf einer Brücke stand. Ganz oben auf dem Geländer, weit oberhalb des Wassers, am Ende seines Lebens. Aber denk jetzt nicht mehr daran. Denk einfach an irgendwas Schöneres.
Denk zum Beispiel an Schokolade.
Kapitel 3
Wir haben den Tag vor Silvester und befinden uns in einer nicht sonderlich großen Stadt. In einem Vernehmungsraum der Polizeiwache sitzen ein Polizist und eine Immobilienmaklerin. Der Polizist sieht zwar aus, als sei er noch keine zwanzig Jahre alt, ist aber vermutlich älter. Die Maklerin sieht aus, als hätte sie die vierzig schon überschritten, ist aber schätzungsweise jünger. Der Polizist trägt eine Uniform, die ihm etwas zu klein ist, die Maklerin trägt einen Blazer, der ihr etwas zu groß ist. Die Maklerin sieht aus, als wäre sie lieber irgendwo anders, und der Polizist sieht nach der bereits fünfzehn Minuten dauernden Unterredung mit ihr ebenfalls aus, als wünschte er, die Maklerin wäre irgendwo anders. Als die Frau nervös lächelt und den Mund öffnet, um etwas zu sagen, atmet der Polizist auf eine Art und Weise ein und aus, dass sich kaum ausmachen lässt, ob er seufzt oder schnaubt.
»Beantworten Sie einfach meine Frage«, bittet er sie.
Die Maklerin nickt rasch und ruft aus:
»Beste Lage!«
»Beantworten Sie meine Frage, habe ich gesagt!«, wiederholt der Polizist mit einem Gesichtsausdruck, den erwachsene Männer aufsetzen, wenn sie irgendwann in frühester Kindheit einmal vom Leben enttäuscht wurden und dieses Gefühl nie ganz abschütteln konnten.
»Sie haben gefragt, wie mein Immobilienbüro heißt!«, sagt die Maklerin mit Nachdruck und trommelt ungeduldig mit den Fingern auf die Tischplatte, was den Polizisten zu dem Wunsch verleitet, mit spitzen Gegenständen nach ihr zu werfen.
»Nein, das habe ich nicht. Ich habe gefragt, ob der Täter, der Sie als Geisel genommen hat …«
»Es heißt ›Beste Lage‹! Kapiert? Wenn Sie eine Wohnung kaufen, wollen Sie doch die BESTE LAGE, oder? Also melde ich mich am Telefon folgendermaßen: Hallo, hier spricht das ›Immobilienbüro Beste Lage‹! Wie ist die LAGE?«
Die Maklerin hat gerade erst ein traumatisches Erlebnis hinter sich, sie wurde mit einer Pistole bedroht und als Geisel genommen, was selbst die abgeklärteste Person dazu bringen kann, Blödsinn zu reden. Deshalb bemüht sich der Polizist um Geduld. Er presst seine Daumen fest auf beide Augenbrauen, als hoffe er, dass es zwei Reset-Knöpfe wären, mit denen sich die Wirklichkeit zurücksetzen ließe, sozusagen auf Werkseinstellung, wenn er sie nur zehn Sekunden lang gleichzeitig gedrückt hielte.
»O…kay. Aber jetzt muss ich Ihnen einige Fragen zur Wohnung und zum Täter stellen«, stöhnt er.
Auch er hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Die Polizeiwache ist klein, und die Ressourcen sind gering, doch an Kompetenz mangelt es hier nicht. So hatte er es irgendeinem Vorgesetzten eines Vorgesetzten seines Chefs unmittelbar nach Beginn des Geiseldramas am Telefon zu erklären versucht, aber es war natürlich vergebens. Jetzt werden sie irgendeine Sonderermittlungsgruppe aus Stockholm schicken, die den Fall übernehmen soll. Als der betreffende Vorgesetzte ihm dies mitteilte, betonte er nicht das Wort »Sonderermittlungsgruppe«, sondern »Stockholm«, als ginge von der Hauptstadt eine geheime Superkraft aus. Stattdessen handelt es sich dabei ja wohl verflucht noch mal eher um eine Krankheit, denkt der Polizist. Er hält die Daumen weiter auf die Augenbrauen gepresst. Dies ist seine letzte Chance, all seinen Vorgesetzten zu beweisen, dass er den Fall selbst lösen kann. Nur wie, wenn man es mit lauter Zeugen zu tun hat wie dieser Maklertussi?
»Okidoki!«, zwitschert die Maklerin, als sei es ein ganz normales Wort.
Der Polizist schaut mit zusammengekniffenen Augen in seine Unterlagen.
»Ist heute nicht ein etwas ungünstiger Tag für eine Wohnungsbesichtigung? Einen Tag vor Silvester?«
Die Maklerin schüttelt den Kopf und grinst.
»Für das ›Immobilienbüro Beste Lage‹ gibt es keine ungünstigen Tage!«
Der Polizist atmet mehrmals tief durch.
»Okay. Dann machen wir weiter: Als Sie den Täter erblickten, wie war da Ihre erste Reak…«
»Wollten Sie nicht zuerst Fragen zur Wohnung stellen? Sie sagten, ›zur Wohnung und zum Täter‹, also dachte ich, dass die Wohnung zuerst …«
»Okay!«, brummt der Polizist.
»Okay!«, zwitschert die Maklerin.
»Also dann zur Wohnung: Sind Sie mit den Räumlichkeiten vertraut?«
»Selbstverständlich, ich bin schließlich die Maklerin!«, antwortet die Maklerin, wobei es ihr gelingt, den Zusatz »vom ›Immobilienbüro Beste Lage‹! Wie ist die LAGE?« wegzulassen, da der Polizist bereits den geheimen Wunsch zu hegen scheint, dass sich die Munition in seiner Dienstwaffe nicht so leicht zurückverfolgen ließe.
»Können Sie sie mir beschreiben?«
Die Miene der Maklerin hellt sich auf.
»Die Wohnung ist ein Traum! Wir sprechen hier von einer einzigartigen Möglichkeit, ein exklusives Appartement in einer ruhigen Wohngegend zu erwerben, das dennoch nah am Puls der Großstadt liegt. Offene Raumgestaltung! Großzügiger Lichteinfall!«
Der Polizist unterbricht sie.
»Ich meine, gibt es einen Speicher oder irgendwelche Stauräume, etwas in der Art …?«
»Sie mögen keine offene Raumgestaltung? Sie mögen lieber Wände? An Wänden ist ja auch nichts auszusetzen!«, entgegnet die Maklerin aufmunternd, aber dennoch mit einem Unterton, der besagt, dass Leute, die Wände mögen, ihrer Erfahrung nach Leute sind, die auch Mauern mögen.
»Gibt es zum Beispiel irgendwelche Wandschränke, die nicht …«
»Hatte ich den großzügigen Lichteinfall schon erwähnt?«
»Ja.«
»Es existieren nämlich wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass Licht uns glücklich macht! Wussten Sie das?«
Der Polizist sieht nicht so aus, als wolle er sich unbedingt Licht aufzwingen lassen. Manche Menschen möchten eben schlicht und einfach selbst entscheiden, wie glücklich sie sein wollen.
»Könnten wir wieder zur Sache kommen?«
»Okidoki!«
»Gibt es irgendwelche Stauräume in der Wohnung, die im Grundriss nicht eingezeichnet sind?«
»Und übrigens, die Gegend ist unglaublich kinderfreundlich!«
»Was hat das mit der Sache zu tun?«
»Ich wollte es nur noch mal betonen. Die LAGE, Sie wissen schon. Unglaublich kinderfreundlich! Oder, nun ja … natürlich einmal abgesehen von dem Überfall heute. Aber ansonsten: eine unglaublich kinderfreundliche Gegend! Und Kinder lieben Polizeiautos! Das ist ja klar.«
Die Maklerin lässt freudestrahlend einen Arm in der Luft kreisen, um eine Polizeisirene nachzuahmen.
»Ich glaube, das ist eher die Melodie des Eiswagens«, bemerkt der Polizist.
»Na ja, Sie wissen schon, was ich meine«, beharrt die Maklerin.
»Ich muss Sie bitten, nur auf meine Fragen zu antworten.«
»Sorry, aber wie lauteten die Fragen noch mal?«
»Wie groß ist die Wohnung genau?«
Die Maklerin lächelt irritiert.
»Wollten Sie nicht eigentlich nach dem Geiselnehmer fragen? Ich dachte, wir würden über die Geiselnahme sprechen, oder?«
Der Polizist presst seine Kieferknochen so fest aufeinander, dass es aussieht wie ein Versuch, durch die Zehennägel zu atmen.
»Natürlich. Okay. Erzählen Sie mir etwas über den Täter. Wie war Ihre erste Reaktion, als …«
Die Maklerin unterbricht ihn beflissen: »Der Geiselnehmer? Ja! Der Geiselnehmer ist also mitten in die Besichtigung reingeplatzt und hat mit seiner Pistole auf uns alle gezielt! Und wissen Sie auch, warum?«
»Nein.«
»Die offene Raumgestaltung! Sonst hätte er nicht auf uns alle gleichzeitig zielen können!«
Der Polizist massiert seine Augenbrauen.
»Okay, versuchen wir es so: Gibt es irgendwelche guten Verstecke in der Wohnung?«
Die Maklerin blinzelt wie in Zeitlupe, als hätte sie es gerade erst gelernt.
»Verstecke?«
Der Polizist legt den Kopf in den Nacken und starrt mit verbissener Miene an die Decke.
Seine Mutter hat früher immer behauptet, dass alle Polizisten im Grunde kleine Jungs seien, die sich nie von ihren Kindheitsträumen verabschiedet hätten. Jeder Junge wird irgendwann einmal gefragt »Was möchtest du werden, wenn du groß bist?«, und fast jeder antwortet »Polizist!«, doch die meisten von ihnen kommen im Laufe des Heranwachsens auf bessere Ideen. Jetzt wünscht er sich einen Augenblick lang, ihm wäre auch etwas Besseres eingefallen, denn dann wäre sein Leben vielleicht nicht ganz so kompliziert geworden und seine familiären Beziehungen unter Umständen auch nicht. Seine Mutter war immer stolz auf ihn, das muss er zugeben, und keineswegs unzufrieden mit seiner Berufswahl. Sie arbeitete als Pastorin, ebenfalls ein Beruf, der mehr ist als nur ein Broterwerb, deswegen konnte sie ihn verstehen. Aber sein Vater wollte nie, dass er eine Uniform trug. Und die Enttäuschung darüber belastet den jungen Polizisten vermutlich noch immer, denn als er die Maklerin jetzt anblickt, wirkt er erschöpft.
»Ja. Ich habe es Ihnen doch gerade versucht zu erklären: Wir glauben, dass der Täter noch in der Wohnung ist.«
Kapitel 4
Tatsache ist, dass alle Geiseln gemeinsam freigelassen wurden, als der Geiselnehmer aufgab. Die Maklerin und alle Kaufinteressenten. Als sie aus der Wohnung kamen, stand ein Polizist Wache vor der Tür, die sie sorgfältig hinter sich schlossen, bevor sie gefasst die Treppen hinuntergingen und auf die Straße hinaustraten, wo sie in bereitstehende Streifenwagen stiegen und auf die Wache gebracht wurden. Der Polizist wartete dort, bis seine Kollegen die Treppen hinaufkamen und ein Sonderermittler beim Geiselnehmer anrief. Kurz darauf stürmte die Polizei die Wohnung, nur um festzustellen, dass sie leer war. Die Balkontür war verschlossen, alle Fenster waren zu, und es gab ganz offensichtlich keine anderen Möglichkeiten hinauszugelangen.
Man musste verflucht noch mal nicht aus Stockholm kommen, um ziemlich schnell zu begreifen, dass entweder eine der Geiseln dem Geiselnehmer zur Flucht verholfen hatte oder der Geiselnehmer gar nicht geflohen war.
Kapitel 5
Okay. Ein Mann stand auf einer Brücke. Jetzt kannst du an ihn denken.
Er hatte einen Brief geschrieben und ihn abgeschickt. Anschließend hatte er seine Kinder zur Schule gebracht und kurz darauf das Brückengeländer erklommen, sich aufgerichtet und hinuntergeblickt. Zehn Jahre später nahm ein gescheiterter Bankräuber während einer Wohnungsbesichtigung acht Personen als Geiseln. Von der Brücke aus kann man in einiger Entfernung den Balkon jener Wohnung sehen.
All das hat natürlich nichts mit dir zu tun. Na ja, ein wenig schon. Denn du bist doch ein ganz normaler guter Mensch, oder? Was hättest du getan, wenn du jemanden dort auf dem Brückengeländer hättest stehen sehen? In einer Situation wie dieser kann man weder etwas Richtiges noch etwas Falsches sagen, oder? Du hättest einfach alles getan, um diesen Mann davon abzuhalten zu springen, auch wenn du ihn gar nicht gekannt hättest. Denn aus einem angeborenen Instinkt heraus können wir es noch nicht einmal bei einem Fremden zulassen, dass er sich das Leben nimmt.
Du hättest also versucht, mit ihm zu reden, sein Vertrauen zu gewinnen und ihn zu überzeugen, es nicht zu tun. Denn auch du hast bestimmt schon irgendwann einmal Angst gehabt. Hast Tage erlebt, an denen du unsägliche Schmerzen hattest, ohne dass der Grund dafür auf irgendwelchen Röntgenbildern sichtbar gewesen wäre oder du Worte gefunden hättest, um das, was dich bedrückt, wenigstens jenen Menschen anzuvertrauen, die dich lieben. Tief im Inneren, dort, wo jene Erinnerungen gespeichert sind, die wir gern vor uns selbst verstecken, wissen viele von uns, dass der Unterschied zwischen diesem Mann auf der Brücke und uns selbst geringer ist, als uns lieb ist. Die meisten Erwachsenen haben irgendwann schon rabenschwarze Momente erlebt, und selbst besonders glückliche Menschen sind nicht ausnahmslos glücklich, das weißt du sicher. Du hättest also versucht, ihn zu retten. Denn man kann sein Leben durchaus auch aus Versehen beenden, aber zu springen ist eine bewusste Entscheidung. Man muss erst irgendwo hinaufklettern und dann einen Schritt ins Nichts machen.
Du bist ein guter Mensch. Du hättest nicht einfach nur zugeschaut.
Kapitel 6
Der junge Polizist befühlt mit den Fingerspitzen seine Stirn. Dort prangt eine Beule von der Größe einer Babyfaust.
»Wo haben Sie sich die denn geholt?«, fragt die Maklerin und sieht definitiv so aus, als wolle sie ein weiteres ›Wie ist die LAGE?‹ hinterherschieben.
»Ach, ich hab irgendwas an den Kopf gekriegt«, grummelt der Polizist, bevor er auf seine Papiere hinunterschaut und fragt: »Wirkte der Täter auf Sie vertraut im Umgang mit Schusswaffen?«
Die Maklerin lächelt überrascht.
»Ach, Sie meinen … die Pistole?«
»Ja. Wirkte er nervös oder eher so, als hätte er schon öfter eine Pistole in der Hand gehalten?«
Der Polizist will mit seiner Frage herausfinden, ob der Geiselnehmer gegebenenfalls eine militärische Ausbildung hat. Doch die Maklerin antwortet stattdessen fröhlich: »Oh nein, also die Pistole war gar nicht echt!«
Der Polizist blickt sie prüfend an, scheint aber nicht ausmachen zu können, ob dies ein Witz sein soll oder ob sie wirklich so naiv ist.
»Und wie kommen Sie darauf?«
»Man hat doch gesehen, dass es ’ne Spielzeugpistole war! Ich dachte, das wüssten alle.«
Der Polizist mustert die Maklerin lange. Es sollte also kein Witz sein. In seinen Blick schleicht sich ein Funken Sympathie.
»Sie hatten also … keine Angst?«
Die Maklerin schüttelt den Kopf.
»Nein, nein, nein. Ich hab gleich gecheckt, dass keinerlei Gefahr von ihm ausging. Der Geiselnehmer hätte nie im Leben irgendwen verletzen können!«
Der Polizist schaut in seine Unterlagen. Ihm wird klar, dass sie es nicht begriffen hat.
»Möchten Sie etwas trinken?«, fragt er mitfühlend.
»Nein, danke. Das haben Sie übrigens schon mal gefragt«, bemerkt die Maklerin unbekümmert.
Der Polizist beschließt, ihr trotzdem ein Glas Wasser zu holen.
Kapitel 7
Zugegebenermaßen wusste keine der Geiseln, was in der Zeitspanne geschah, nachdem sie selbst freigelassen worden waren und bevor die Polizei die Wohnung stürmte. Alle Geiseln waren bereits in die auf der Straße wartenden Polizeiwagen gestiegen und aufs Revier gebracht worden, als sich die Polizisten im Treppenhaus einfanden. Dann rief der extra einbestellte Sonderermittler in der Wohnung an, in der Hoffnung, dass sich der Geiselnehmer freiwillig ergeben und unbewaffnet herauskommen würde (der Vorgesetzte der Vorgesetzten der örtlichen Polizisten hatte den Sonderermittler aus Stockholm angefordert, da Stockholmer nach eigener Überzeugung offenbar die Einzigen sind, die telefonieren können). Doch der Geiselnehmer reagierte nicht. Stattdessen hörten sie einen Pistolenschuss. Als die Polizisten daraufhin die Wohnungstür aufbrachen, war es bereits zu spät. Beim Betreten des Wohnzimmers tappten sie geradeswegs in eine Blutlache.
Kapitel 8
Im Pausenraum der Polizeiwache trifft der junge Polizist auf einen älteren Kollegen. Der junge holt ein Glas Wasser, der ältere trinkt gerade Kaffee. Ihre Beziehung ist kompliziert, wie es bei Polizisten verschiedener Generationen häufig der Fall ist. Am Ende seiner Karriere sucht man nach einem Sinn, während man am Anfang eher nach einem Ziel sucht.
»Hallihallo!«, ruft der ältere erfreut aus.
»Hallo«, entgegnet der jüngere abweisend.
»Ich würde dir ja gern einen Kaffee anbieten, aber du trinkst wahrscheinlich immer noch keinen, oder?«, fragt der ältere Polizist grinsend, als handele es sich um den Grund für eine Berufsunfähigkeit.
»Nein«, antwortet der jüngere schroff, als sei ihm Menschenfleisch angeboten worden.
Der ältere und der jüngere haben bezüglich ihrer Ess- und Trinkgewohnheiten nicht gerade viel gemeinsam, aber eigentlich trifft das auch auf alles andere zu, was zu wiederkehrenden Konflikten führt, wenn sie um die Mittagszeit zusammen im Streifenwagen sitzen. Die Leibgerichte des älteren Polizisten sind Bratwurst mit Tüten-Kartoffelpüree von der Tankstelle und das freitägliche Mittagsbuffet im Restaurant um die Ecke. Wenn die Bedienung am All-you-can-eat-Freitag irgendwann Anstalten macht, seinen leergegessenen Teller abzuräumen, hält er ihn entrüstet mit beiden Händen fest und ruft: »Fertig? Ist heute nicht Buffet-Tag? Ich bin erst fertig, wenn ich unterm Tisch liege und mich nicht mehr rühren kann! Das wissen Sie doch!« Das Lieblingsgericht des jüngeren Polizisten ist nach Auskunft des älteren »irgend so ’n künstlicher Pseudofraß wie Algen, Seegras und roher Fisch. Er glaubt nämlich verflucht noch mal, dass er ’n Einsiedlerkrebs ist.« Der eine liebt Kaffee, der andere Tee. Der eine guckt während der Arbeit auf die Uhr, um zu sehen, ob schon bald Mittagspause ist, der andere guckt während der Mittagspause auf die Uhr, um zu sehen, ob er nicht endlich weiterarbeiten kann. Der ältere hält es für das Wichtigste, als Polizist das Richtige zu tun, der jüngere hält es für wichtiger, sich korrekt zu verhalten.
»Sicher? Ich könnte dir so ’nen Frappuccino machen, oder wie das heißt. Ich hab sogar Sojamilch gekauft, aber ich will lieber nicht wissen, wen zum Teufel sie dafür gemolken haben!«, scherzt der ältere polternd, während er den jüngeren allerdings beunruhigt mustert.
»Mmh«, meint der jüngere, ohne zugehört zu haben.
»Und, wie läuft die Vernehmung der Maklertussi?«, fragt der ältere betont lässig, um nicht zu zeigen, dass er es eigentlich aus Fürsorglichkeit tut.
»Super!«, versichert der jüngere, der seine Irritation kaum noch verbergen kann, und steuert auf die Tür zu.
»Und sonst, alles in Ordnung?«, fragt der ältere.
»Ja, ja, alles in Ordnung!«, stöhnt der jüngere.
»Ich mein ja nur, nach allem, was passiert ist, ob du vielleicht reden …«
»Alles in Ordnung«, beharrt der jüngere.
»Sicher?«
»Sicher!«
»Und wie geht’s damit …?«, fragt der ältere und deutet nickend auf die Beule an der Stirn des jüngeren.
»Alles gut, kein Problem. Ich muss jetzt los.«
»Ja, ja natürlich. Ach übrigens, wenn du Hilfe bei der Vernehmung dieser Maklertussi brauchst …«, meint der ältere und versucht zu lächeln, wobei er sich einen sorgenvollen Blick auf die Schuhe des jüngeren Polizisten verkneift.
»Ich komm allein zurecht.«
»Aber ich helfe dir gern.«
»Nein, danke!«
»Sicher?«, ruft ihm der ältere hinterher, erntet jedoch nur entschlossenes Schweigen.
Nachdem der jüngere hinausgegangen ist, steht der ältere allein im Pausenraum und trinkt seinen Kaffee. Ältere Männer wissen nur selten, wie sie jüngeren Männern vermitteln sollen, dass diese ihnen nicht egal sind. Und außerdem fällt es ihnen unsäglich schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn sie eigentlich nur sagen wollen: »Ich sehe doch, wie sehr es dich belastet.«
An der Stelle, wo der jüngere Polizist gestanden hat, zeichnen sich jetzt blasse rotbraune Sohlenabdrücke auf dem Fußboden ab. An seinen Schuhen klebt also noch immer Blut, ohne dass er es gemerkt hat. Der ältere Polizist befeuchtet einen Wischlappen und reinigt behutsam den Boden. Seine Finger zittern. Mag sein, dass der jüngere tatsächlich die Wahrheit sagt und er wirklich okay ist. Was auf den älteren allerdings nicht zutrifft.
Kapitel 9
Der junge Polizist kehrt zurück in den Vernehmungsraum und stellt das Wasserglas auf den Tisch. Die Maklerin schaut auf. Er erinnert sie an Typen, die ihre Bierflaschen mittels Schnupftabaksdosen öffnen. Was nicht unbedingt verkehrt sein muss.
»Danke«, sagt sie zögerlich mit Blick auf das Wasserglas, um das sie nicht gebeten hat.
»Ich muss Ihnen leider noch ein paar weitere Fragen stellen«, entschuldigt sich der junge Polizist und entfaltet ein zerknittertes Blatt Papier. Es sieht aus wie eine Kinderzeichnung.
Die Maklerin nickt, kommt jedoch nicht dazu, etwas zu entgegnen, denn genau in diesem Augenblick wird die Tür behutsam geöffnet, und der ältere Polizist betritt leise den Raum. Die Maklerin stellt fest, dass seine Arme im Vergleich zu seinem Oberkörper etwas zu lang sind, und denkt, dass er sich die Haut seiner Unterschenkel verbrennen würde, wenn er jetzt seinen Kaffee verschüttete.
»Hallo … guten Tag! Ich wollte nur sehen, ob ich hier drinnen irgendwas helfen kann …«, sagt der ältere Polizist.
Der jüngere Polizist verdreht die Augen.
»Nein! Danke! Wie schon gerade eben gesagt hab ich alles unter Kontrolle.«
»Aha. Aha. Ich wollte ja nur meine Hilfe anbieten«, versucht es der ältere weiter.
»Nein, nein, verflucht noch mal … nein! Das ist wirklich unprofessionell! Du kannst hier nicht einfach mitten in die Vernehmung reinplatzen!«, schnauzt ihn der jüngere an.
»Mmh, tut mir leid, ich wollte ja nur fragen, wie weit du gekommen bist«, flüstert der ältere jetzt verlegen, unfähig, seine Fürsorglichkeit zu verbergen.
»Ich wollte gerade nach dem Bild fragen!«, antwortet der jüngere verächtlich, als wäre er beim heimlichen Rauchen erwischt worden und hätte sich damit gerechtfertigt, die Zigarette nur kurz für einen Freund gehalten zu haben.
»Wen fragen?«, will der ältere wissen.
»Die Maklerin!«, ruft der jüngere genervt aus und deutet auf die Frau.
Das wiederum inspiriert die Maklerin dazu, augenblicklich von ihrem Stuhl aufzuspringen und die Hand auszustrecken.
»Ich bin die Maklerin! Vom ›Immobilienbüro Beste Lage‹!«
Sie grinst und macht eine Kunstpause. Sie wirkt unglaublich selbstzufrieden.
»Oh mein Gott, nicht schon wieder …«, seufzt der jüngere Polizist, während die Maklerin Luft holt und trällert:
»Wie ist die LAGE?«
Der ältere Polizist blickt den jüngeren Polizisten fragend an.
»Das macht sie schon die ganze Zeit«, verkündet der jüngere, die Daumen auf die Augenbrauen gepresst.
Der ältere Polizist mustert die Maklerin mit zusammengekniffenen Augen. Diesen Blick setzt er immer dann auf, wenn er es mit unergründlichen Menschen zu tun hat. Und nach einem langen Berufsleben mit fast ausnahmslos zusammengekniffenen Augen hat die Haut darunter die Konsistenz von Softeis angenommen. Die Maklerin, offenbar überzeugt davon, beim ersten Mal überhört worden zu sein, verdeutlicht ungebeten: »Kapieren Sie? ›Immobilienbüro Beste Lage‹, wie ist die LAGE? Kapieren Sie? Man möchte ja schließlich die beste La…«
Der ältere Polizist kapiert es und lächelt sogar anerkennend. Doch der jüngere deutet mit dem Zeigefinger streng auf die Maklerin und bewegt ihn zwischen ihr und ihrem Stuhl auf und ab.
»Setzen!«, sagt er in einem Ton, den man nur bei Kindern, Hunden oder eben Maklern anschlägt.
Die Maklerin verkneift sich das Grinsen und setzt sich unbeholfen. Sie schaut abwechselnd vom einen Polizisten zum anderen.
»Entschuldigung. Das ist mein allererstes Polizeiverhör überhaupt. Sie werden doch jetzt wohl nicht … na, Sie wissen schon … dieses good cop/bad cop-Spiel mit mir spielen wollen, so wie im Film, oder? Dass einer von Ihnen rausgeht und Kaffee holt, während der andere mit dem Telefonbuch auf mich eindrischt und brüllt WO HABEN SIE DIE LEICHE VERSTECKT?, oder?«
Die Maklerin lacht nervös. Der ältere Polizist lächelt ebenfalls, während der jüngere keine Miene verzieht, sodass die Maklerin noch etwas nervöser hinzufügt: »Also das war natürlich ein Scherz. Heutzutage gibt es ja gar keine Telefonbücher mehr, und was sollten Sie denn sonst nehmen? Mich etwa mit Ihrem iPad verprügeln?«
Sie holt mit beiden Armen aus, um diese Art der Misshandlung zu simulieren, und verstellt ihre Stimme, anscheinend um den Tonfall der Polizisten nachzuahmen: »Oh nein, Scheiße auch, jetzt hab ich auf Instagram aus Versehen meine Ex gelikt! Unlike! Unlike!«
Der jüngere Polizist wirkt ganz und gar nicht amüsiert, was die Maklerin nachdenklich stimmt. Unterdessen beugt sich der ältere Polizist über die Aufzeichnungen des jüngeren und fragt ihn, als befände sich die Maklerin gar nicht im Raum: »Und, was hat sie zur Zeichnung gesagt?«
»Ich hab sie noch nicht fragen können, weil du reingekommen bist und mich unterbrochen hast!«, kontert der jüngere.
»Was ist denn mit dieser Zeichnung?«, fragt die Maklerin.
»Na ja, ich wollte es Ihnen gerade erklären, bevor wir unterbrochen wurden: Wir haben diese Zeichnung im Treppenhaus gefunden und glauben, dass der Täter sie verloren haben könnte. Wir hätten gerne, dass Sie …«, beginnt der jüngere Polizist, wird jedoch vom älteren unterbrochen.
»Hast du mit ihr eigentlich schon über die Pistole gesprochen?«
»Jetzt hör endlich auf, dich einzumischen!«, raunzt ihn der jüngere an.
Woraufhin der ältere hilflos die Arme ausbreitet und murmelt: »Ja, ja. Sorry, dass es mich überhaupt gibt.«
»Aber es war ja gar keine echte! Also die Pistole! Es war eine Spielzeugpistole!«, erklärt die Maklerin rasch.
Der ältere Polizist wirft erst ihr und dann dem jüngeren Polizisten einen befremdeten Blick zu, bevor er in einer Lautstärke flüstert, die nur Männer ab einem gewissen Alter für ein Flüstern halten: »Hast du es ihr denn … nicht erzählt?«
»Was denn erzählt?«, fragt die Maklerin.
Der jüngere Polizist seufzt und faltet die Zeichnung sorgfältig wieder zusammen, als sei es das Gesicht seines älteren Kollegen. Dann wendet er sich an die Maklerin.
»Na ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen … Sie verstehen, also nachdem der Täter Sie und die anderen Geiseln freigelassen hat und wir Sie alle aufs Revier gefahren haben …«
Der ältere Polizist unterbricht ihn hilfsbereit: »Der Täter, also der Geiselnehmer! Er hat sich erschossen!«
Der jüngere Polizist verschränkt die Hände fest ineinander, um sie daran zu hindern, den älteren zu erwürgen. Er sagt etwas, aber die Maklerin hört nichts mehr: In ihren Gehörgängen breitet sich bereits ein monotones Brummen aus, das zu einem lauten Rauschen anschwillt, während der Schock Kontrolle über ihr Nervensystem erlangt. Noch lange Zeit später wird sie schwören, dass Regen gegen das Fenster im Vernehmungsraum geprasselt sei, als sie darin saß, obwohl er fensterlos war. Sie starrt die beiden Polizisten mit offenem Mund an.
»Die … Pistole … war also …«, bringt sie hervor.
»Es war eine echte Pistole«, bestätigt der ältere Polizist.
»Ich …«, beginnt die Maklerin, doch ihr Mund ist wie ausgetrocknet.
»Hier! Trinken Sie einen Schluck Wasser!«, fordert der ältere Polizist sie auf, als hätte er das Glas eigenhändig geholt.
»Danke … ich … aber wenn die Pistole echt war, hätten wir ja alle … tot sein können!«, flüstert sie und trinkt, während der Schock sie endgültig einholt. Der ältere Polizist nickt zustimmend, nimmt die Aufzeichnungen des jüngeren an sich und notiert mit seinem Kugelschreiber etwas darauf.
»Vielleicht sollten wir diese Vernehmung noch einmal ganz von vorn anfangen«, meint der ältere zuvorkommend, woraufhin der jüngere um eine kurze Pause bittet und aus dem Raum stürmt, um draußen im Korridor mehrfach seine Stirn gegen die Wand zu rammen.
Als die Tür hinter ihm zuknallt, zuckt der ältere zusammen. Wenn man älter ist, fehlen einem oftmals die Worte, selbst wenn man einem jüngeren Kollegen nur sagen will: »Ich sehe doch, dass dir das Ganze zusetzt, und es tut mir in der Seele weh.« Die Schuhe des jüngeren Polizisten haben auf dem Fußboden unter seinem Stuhl blasse rotbraune Abdrücke eingetrockneten Bluts hinterlassen. Der ältere betrachtet sie bestürzt. Genau dies war der Grund für seine ablehnende Haltung gegenüber der Berufswahl seines Sohnes.
Kapitel 10
Der Erste, der den Mann auf der Brücke vor zehn Jahren erblickte, war ein Teenager, dessen Vater den Wunsch hegte, der Sohn würde sich von seinen Kindheitsträumen verabschieden. Der Junge hätte vielleicht Hilfe holen können, aber hättest du das getan? Wenn deine Mutter Pastorin und dein Vater Polizist gewesen wären und du mit der Selbstverständlichkeit aufgewachsen wärest, dass man Leuten hilft, wenn man kann, und niemanden im Stich lässt, wenn es nicht unbedingt nötig ist?
Nein.
Der Teenager rannte auf die Brücke und rief dem Mann etwas zu, woraufhin dieser innehielt. Der Teenager wusste nicht recht, was er tun sollte, und redete deshalb einfach drauflos. Er versuchte das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. Ihn dazu zu bringen, zwei Schritte zurück statt einen vor zu machen. Der Wind ließ ihre Jacken leise knattern, Regen lag in der Luft, und auf der Haut konnte man schon den Winter erahnen. Der Junge versuchte Worte für all die schönen Dinge zu finden, die das Leben eigentlich lebenswert machen, auch wenn es einem nicht immer so vorkam.
Der Mann auf dem Geländer hatte zwei Kinder und erzählte dem Teenager von ihnen. Wahrscheinlich, weil ihn der Junge an sie erinnerte. Der Junge rief panisch und jede einzelne Silbe betonend: »Bitte, springen Sie nicht!«
Der Mann schaute ihn ruhig, fast mitleidig an und entgegnete: »Weißt du, was das Schlimmste am Elternsein ist? Dass man immer nach seinen schlechtesten Augenblicken beurteilt wird. Man kann eine Million Dinge richtig machen und nur eine einzige Sache falsch. Trotzdem ist und bleibt man immer der Vater, der gerade auf sein Handy geschaut hat, als das eigene Kind im Park eine Schaukel gegen den Kopf gekriegt hat. Wir lassen unsere Kinder tagelang nicht aus den Augen, doch dann lesen wir eine einzige SMS, und damit sind all unsere guten Augenblicke vergessen. Niemand geht zum Psychologen, um über all die Male zu sprechen, bei denen er als Kind keine Schaukel an den Kopf gekriegt hat. Eltern werden nur an ihren Unzulänglichkeiten gemessen.«
Der Teenager erfasste den Sinn der Worte nicht, aber als er übers Brückengeländer hinunterlinste und dort unten geradewegs dem Tod ins Auge blickte, zitterten seine Hände. Der Mann lächelte schwach und machte einen halben Schritt auf ihn zu. In diesem Augenblick hätte der Teenager die ganze Welt umarmen können.
Dann erzählte ihm der Mann, dass er einmal einen ziemlich lukrativen Job gehabt, ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen gegründet und darüber hinaus eine ziemlich exklusive Wohnung besessen hätte. Dass er all sein Erspartes in Aktien von Immobiliengesellschaften investiert hätte, damit sich seine Kinder später einmal noch lukrativere Jobs würden suchen und noch exklusivere Wohnungen würden leisten können, um sorgenfrei zu leben, anstatt jede Nacht völlig erschöpft mit dem Taschenrechner in der Hand einzuschlafen. Denn das ist die Aufgabe eines Vaters: seinen Kindern eine Schulter zu bieten. Auf der sie sitzen können, wenn sie klein sind, um von dort aus die Welt zu sehen. Auf der sie stehen können, wenn sie groß sind, um nach den Wolken zu greifen. Und an die sie sich anlehnen können, wenn sie ins Wanken geraten oder von Zweifeln geplagt werden. Sie vertrauen auf uns, was eine erdrückende Verantwortung mit sich bringt, denn sie begreifen noch nicht, dass wir eigentlich gar keinen Überblick haben.
Der Mann tat also, was wir alle tun: Er gab vor, den Überblick zu haben. Zum Beispiel, wenn seine Kinder ihn fragten, warum Scheiße ausgerechnet braun ist und was nach dem Tod geschieht oder warum Eisbären keine Pinguine fressen. Bis sie größer wurden. Manchmal vergaß er dies für einen Augenblick und wollte sie wieder an die Hand nehmen wie früher. Großer Gott, wie peinlich ihnen das war. Ihm übrigens auch. Es ist schwierig, einem Zwölfjährigen zu erklären, dass die schönsten Augenblicke im eigenen Leben die waren, in denen der Sohn als kleines Kind losrannte, um den vor ihm gehenden Vater einzuholen und dessen Hand zu ergreifen. Die Wärme seiner kurzen Fingerchen in der eigenen Handfläche. Lange bevor dem Sohn bewusst geworden war, wie viel der Vater falsch gemacht hatte.
Der Mann tat in allen Belangen so, als kenne er sich aus. Zudem versicherten ihm alle Wirtschaftsexperten, dass Aktien von Immobiliengesellschaften eine sichere Investition seien. Und schließlich wissen alle, dass Immobilien nie an Wert verlieren. Bis sie es eines Tages eben doch taten.
Draußen in der großen weiten Welt kam es zur Finanzkrise, und eine Bank in New York ging in Konkurs, woraufhin in einer Kleinstadt in einem ganz anderen Land ein Mann alles verlor. Als er nach dem Telefonat mit seinem Anwalt den Hörer auf die Gabel legte, konnte er die Brücke von seinem Bürofenster aus sehen. Es war noch früh am Morgen, das Wetter windig und trocken, allerdings lag Regen in der Luft. Der Mann fuhr seine Kinder zur Schule, als sei nichts geschehen. Jedenfalls tat er so. Er flüsterte ihnen ins Ohr, dass er sie liebte, und als sie daraufhin die Augen verdrehten, brach es ihm das Herz. Dann fuhr er ans Wasser. Stellte seinen Wagen ins Parkverbot, ließ die Schlüssel stecken, betrat die Brücke und erklomm das Geländer.
All das erzählte er dem Teenager, und von da an wusste der Teenager, dass sich alles zum Guten wenden würde. Denn wenn ein Mann, der auf einem Brückengeländer steht, sich die Zeit nimmt, einem Fremden anzuvertrauen, wie sehr er seine Kinder liebt, weiß man, dass er eigentlich gar nicht beabsichtigt zu springen.
Und dann sprang er.
Kapitel 11
Zehn Jahre später steht der junge Polizist im Korridor vor dem Vernehmungsraum. Sein Vater befindet sich zusammen mit der Maklerin noch immer im Zimmer, und seine Mutter hatte natürlich recht gehabt: Er hätte nie mit seinem Vater zusammenarbeiten dürfen, es führte nur zu Streit. Aber er hat nicht auf sie gehört, hatte es noch nie getan. Die Mutter schaute ihren Sohn mitunter, wenn sie müde war oder nach zwei Gläsern Wein in Melancholie verfiel, an und sagte: »Manchmal hab ich das Gefühl, dass du nie wieder ganz von dieser Brücke zurückgekommen bist, mein Junge. Und dass du noch immer versuchst, diesen Mann auf dem Geländer zu retten, auch wenn es heute genauso unmöglich ist wie damals.« Vielleicht stimmt das ja, doch ihm fehlt die Kraft, in sich hineinzuspüren. Zehn Jahre nach dem Erlebnis wird er noch immer von denselben Albträumen geplagt. Zehn Jahre, in denen er seine Ausbildung an der Polizeihochschule und sein Examen gemacht hat, in denen er all die Früh-, Spät- und Nachtschichten und die viele Büroarbeit auf dem Revier erledigt hat, für die er von allen Kollegen außer seinem Vater so viel Lob erhielt. Zehn Jahre mit noch mehr langen Nächten und einem derart hohen Arbeitsaufkommen, dass er jegliche Freizeit zu hassen gelernt hat. Mit erschöpftem Nachhausewanken in der Morgendämmerung, wo ihn schon im Flur haufenweise Rechnungen und im Schlafzimmer ein leeres Bett sowie Schlaftabletten oder Alkohol erwarteten. In jenen Nächten, in denen es unerträglich war, verließ er die Wohnung und joggte Kilometer um Kilometer in der Dunkelheit und Kälte, umgeben von beängstigender Stille, und obwohl seine Füße in immer rascherer Abfolge auf den Asphalt trommelten, wollte er weder ein Ziel erreichen noch irgendeinen Nutzen daraus ziehen. Manche Männer joggen wie Jäger, aber er rannte, als sei er selbst die Beute. Völlig ermattet taumelte er schließlich wieder nach Hause, um sich am nächsten Tag erneut zur Arbeit zu schleppen, wo das Ganze von vorne begann. Manchmal genügten abends ein paar Gläser Whisky, um einschlafen zu können, und wenn er einen besonders guten Morgen erwischt hatte, reichte eine eiskalte Dusche aus, um wach zu werden, während er nachts alles Menschenmögliche unternahm, um die Schmerzempfindlichkeit seiner Haut herabzusetzen. Er unterdrückte die Tränen bereits im Brustkorb, lange bevor sie seinen Hals oder gar die Tränenkanäle erreichten. Doch die Albträume ließen sich einfach nicht abschütteln. Vom leisen Knattern der Jacke des Mannes im Wind, vom dumpfen Schaben, das seine vom Geländer hinabgleitenden Schuhsohlen erzeugten, von seinem eigenen entsetzten Aufschrei, der übers Wasser hallte, aber weder so klang noch sich so anfühlte wie sein eigener. Er war kaum zu hören gewesen, denn der Schock hatte ihn regelrecht übermannt und betäubt, tut es noch immer.
Nach der Befreiung aller Geiseln und dem Knall des Schusses hatte er die Wohnung heute als Erster betreten. Er war über den blutbesudelten Teppich quer durchs Wohnzimmer gestürmt und hatte unverzüglich die Balkontür aufgerissen, um letztlich dort draußen innezuhalten und verzweifelt übers Geländer hinwegzustarren. So unlogisch es seinen Kollegen auch erscheinen mochte, aber ihm hatte sich ganz automatisch ein einziger angsteinflößender Gedanke aufgedrängt: »Er ist auch gesprungen.« Unten auf der Straße konnte er außer einigen Journalisten und neugierigen Nachbarn, die alle durch ihre Handykameras zu ihm hinauflinsten, allerdings niemanden erblicken. Der Geiselnehmer war spurlos verschwunden, und der Polizist stand ganz allein auf dem Balkon. Von dort aus konnte er in der Ferne die Brücke sehen.
Jetzt steht er wie gelähmt im Korridor der Polizeiwache und kann sich noch nicht einmal aufraffen, das an seinen Schuhen klebende Blut abzuwischen.
Kapitel 12
Der Atem des älteren Polizisten ächzt wie ein schweres Möbelstück, das über einen unebenen Holzfußboden geschleift wird. Er atmet durch die Nase, sodass es in seiner Mundhöhle widerhallt. Ab einem bestimmten Alter und einem gewissen Gewicht hat es angefangen, bei ihm so zu klingen. Als seien alte Atemzüge zwangsläufig schwerer. Er lächelt der Maklerin schuldbewusst zu.
»Mein Kollege, er … er ist mein Sohn.«
»Oh!«, nickt die Maklerin, als wolle sie sagen, dass sie ebenfalls Kinder hat, oder vielmehr, dass sie zwar keine hat, aber während ihrer Ausbildung in irgendeinem Handbuch durchaus etwas über Kinder gelesen hat. Ihre Lieblingskinder sind jedenfalls die mit Spielzeug in Naturtönen, weil sie überall hineinpassen.
»Meine Frau meinte immer, dass es keine gute Idee wäre, wenn wir beide zusammenarbeiten«, gesteht der Polizist.
»Ich verstehe«, schwindelt die Maklerin.
»Sie sagte, dass ich ihn zu sehr verhätschele. Und dass ich ihr vorkomme wie einer dieser Pinguine, die auf einem Stein brüten, weil sie einfach nicht akzeptieren wollen, dass das Ei verschwunden ist. Sie fand, dass man seine Kinder nicht vor dem Leben schützen kann und das Leben sowieso unvorhersehbar ist.«
Die Maklerin erwägt, so zu tun, als begreife sie, fragt aber stattdessen ehrlich:
»Und was meinte sie damit?«
Der Polizist errötet.
»Ach, ich wollte nicht … es ist natürlich dumm von mir, hier zu sitzen und Ihnen mein Leid zu klagen, aber ich war schon immer dagegen, dass mein Sohn Polizist wird. Er ist viel zu sensibel. Sozusagen zu gut für diese Welt. Verstehen Sie? Er ist vor zehn Jahren einmal auf eine Brücke gerannt, um einen Selbstmörder davon abzuhalten runterzuspringen. Er hat alles getan, was in seiner Macht stand, wirklich alles! Aber der Mann ist trotzdem gesprungen. Verstehen Sie, was das mit einem Menschen macht? Mein Sohn … er will immer alle retten. Ich hatte gehofft, dass er nach dem Erlebnis vielleicht Abstand von seinem Berufswunsch nehmen würde, doch das Gegenteil war der Fall. Plötzlich wollte er mehr denn je Polizist werden. Er will unbedingt alle Menschen retten. Sogar Verbrecher.«
Der Brustkorb der Maklerin hebt und senkt sich fast unmerklich.
»Sie meinen, auch den Geiselnehmer?«
Der ältere Polizist nickt.
»Ja. Als wir die Wohnung stürmten, war der Fußboden blutüberströmt, und mein Sohn meinte, dass der Geiselnehmer sterben könnte, wenn wir ihn nicht rechtzeitig finden würden.«
Die Maklerin erkennt am traurigen Blinzeln des Polizisten, was dies in ihm auslöst. Er fährt mit den Fingernägeln über die Tischplatte und fügt mit erzwungener Förmlichkeit hinzu:
»Ich muss Sie übrigens daran erinnern, dass alles, was Sie während dieser Vernehmung aussagen, aufgezeichnet wird.«
»Capito«, beteuert die Maklerin.
»Es ist wichtig, dass Sie das verstehen. Alles, worüber wir jetzt sprechen, wird protokolliert und kann von all meinen Kollegen gelesen werden«, betont er.
»Alle können es lesen. Okay, verstanden.«
Dann entfaltet der ältere Polizist vorsichtig das Blatt Papier, das der jüngere Polizist auf dem Tisch liegen gelassen hat. Es ist ein Bild, gezeichnet von einem Kind, das entweder sehr talentiert oder auch völlig untalentiert ist, abhängig vom Alter. Es stellt offenbar drei Tiere dar.
»Sagt Ihnen dieses Bild etwas? Wir haben es wie gesagt im Treppenhaus gefunden.«
»Nein, tut mir leid«, antwortet die Maklerin und erweckt tatsächlich den Eindruck, als täte es ihr leid.
Der Polizist ringt sich ein Lächeln ab.
»Meine Kollegen meinen, dass es ein Affe, ein Frosch und ein Pferd sind. Aber ich finde, das hier sieht eher aus wie eine Giraffe als wie ein Pferd. Es hat ja gar keinen Schweif! Und Giraffen haben doch keinen, oder? Ich glaube jedenfalls, dass es eine Giraffe ist.«
Die Maklerin holt tief Luft und sagt dann etwas, das Frauen häufig im Gespräch mit jenen Männern äußern, denen scheinbar nicht bewusst ist, dass Wissensdefizite oftmals zu voreiligen Schlüssen führen.
»Sie haben wahrscheinlich recht.«
Kapitel 13
In Wahrheit war es nicht der Mann auf der Brücke, der den Teenager dazu verleitet hat, Polizist zu werden, sondern ein junges Mädchen, das eine Woche später auf demselben Geländer stand. Aber eben nicht sprang.
Kapitel 14
Der fliegende Kaffeebecher ist Ausdruck eines Wutanfalls. Er wird geradewegs über zwei Schreibtische hinweg durch die Luft geschleudert, wobei entgegen jeglicher Gesetzmäßigkeiten der Zentrifugalkraft in unergründlicher Weise fast sämtliche Flüssigkeit darin enthalten bleibt, bevor er beim heftigen Aufprall auf eine danach cappuccinofarbene Wand dahinter zersplittert.
Die beiden Polizisten starren einander an, der eine beschämt, der andere erschrocken. Der ältere Polizist heißt Jim. Der jüngere, sein Sohn, heißt Jack. Dieses Polizeirevier ist zu klein, um sich aus dem Weg gehen zu können, deshalb landeten die beiden Männer an zwei zusammengeschobenen Schreibtischen, wo sie sich gegenübersitzen, nur mäßig verborgen hinter ihrem jeweiligen Computerbildschirm. Denn Polizeiarbeit besteht heutzutage nur zu einem Zehntel aus echter Polizeiarbeit, der restliche Anteil umfasst das minutiöse Protokollieren dieser Polizeiarbeit.
Jim wurde in eine Generation hineingeboren, die Computer noch als Zauberei ansah, Jack in eine, die Computer von Kindesbeinen an als Selbstverständlichkeit betrachtete. Als Jim klein war, bestrafte man Kinder, indem man sie in ihr Zimmer schickte, heutzutage versucht man sie wieder herauszulocken. Eine Generation wurde dafür gerügt, dass sie nicht stillsitzen konnte, die nächste wird dafür gerügt, dass sie sich nicht bewegt. Wenn Jim einen Bericht schreibt, drückt er entschlossen jede Taste, um anschließend sofort auf dem Bildschirm zu kontrollieren, ob der Computer ihn auch nicht getäuscht hat, erst danach betätigt er die nächste Taste. Denn Jim lässt sich nicht so leicht täuschen. Jack schreibt im Gegenzug so wie alle jungen Männer, die nie in einer Welt ohne Internet gelebt haben. Er könnte es sogar mit verbundenen Augen tun, denn seine Finger fliegen förmlich über die Tasten, sodass nicht einmal ein verfluchtes forensisches Labor würde beweisen können, dass diese sie überhaupt berührt haben.
Beide Männer treiben einander schon mit den kleinsten Dingen in den Wahnsinn. Wenn der Sohn irgendetwas im Internet sucht, nennt er es schlicht und einfach googeln. Wenn sein Vater dasselbe tut, sagt der: »Das werde ich bei Google nachschlagen.« Wenn sie sich in irgendeiner Sache uneinig sind, behauptet der Vater »Doch, das ist so, ich hab es bei Google gelesen!«, woraufhin der Sohn aufbraust: »Man liest keine Infos bei Google, Papa, mansucht sie …«
Der Sohn regt sich gar nicht unbedingt über die Tatsache auf, dass sein Vater nicht begreift, wie man die moderne Technik anwendet, sondern eher darüber, dass der Vater es eben nur fast begreift. Jim weiß zum Beispiel nicht, wie man einen Screenshot ausführt, deshalb fotografiert er mit seinem Handy den Bildschirm, wenn er ein Foto von einer Abbildung machen möchte. Und wenn er ein Foto von einer Abbildung auf seinem Handydisplay ausdrucken möchte, legt er das Gerät auf den Kopierer. Ihren letzten heftigen Streit hatten Jim und Jack, als irgendein Vorgesetzter ihres Chefs auf die Idee kam, dass das Polizeikorps der Stadt zukünftig ›in den sozialen Medien präsenter‹ sein sollte (denn in Stockholm sind offenbar alle Polizisten rund um die Uhr wahnsinnig präsent), und sie bat, während eines gewöhnlichen Arbeitstages Fotos voneinander zu machen. Also fotografierte Jim seinen Sohn Jack am Steuer des Streifenwagens. In voller Fahrt. Mit Blitzlicht.
Jetzt sitzen sie einander gegenüber auf der Wache und tippen in jeweils unterschiedlicher Geschwindigkeit. Jim umständlich, Jack effizient. Jim erzählt eine Geschichte, Jack verfasst einen Bericht. Jim löscht und korrigiert, überdenkt das Geschriebene und formuliert es um, während Jack ungerührt drauflostextet, als ließe sich nichts auf der Welt in mehr als nur einer Weise beschreiben. Jim träumte in seiner Jugend immer davon, Schriftsteller zu werden. Übrigens noch bis weit in Jacks Jugend hinein. Doch irgendwann begann er schließlich davon zu träumen, dass statt seiner Jack Schriftsteller werden würde. Väter können allerdings vor lauter Scham nicht zugeben, eigentlich weder den Wunsch zu hegen, dass die Kinder ihre eigenen Träume leben, noch, dass sie in die Fußstapfen der Väter treten, was wiederum Söhne unmöglich verstehen können. Stattdessen wollen Väter vielmehr in die Fußstapfen ihrer Kinder treten, während diese die Träume der Väter leben.
Beide haben ein Foto von derselben Frau auf ihrem Schreibtisch stehen. Des einen Mutter, des anderen Ehefrau. Auf Jims Schreibtisch steht noch ein weiteres Foto, das einer jungen Frau, die sieben Jahre älter ist als Jack. Vater und Sohn sprechen nur selten von ihr, und sie lässt auch nur von sich hören, wenn sie Geld braucht. Jedes Jahr zu Beginn des Winters sagt Jim hoffnungsvoll »Vielleicht kommt deine Schwester ja an Weihnachten nach Hause«, und Jack entgegnet: »Ja, Papa, wir werden sehen.« Der Sohn wirft dem Vater nie vor, naiv zu sein, sondern erweist ihm stattdessen einen Liebesdienst. Dem Vater lastet eine unsichtbare Bürde auf den Schultern, wenn er jedes Jahr am späten Weihnachtsabend erklärt »Es ist nicht ihre Schuld, Jack, sie ist …«, und Jack vollendet jedes Mal seinen Satz: »… krank. Ich weiß, Papa. Sie ist krank. Möchtest du noch ein Bier?«
Mittlerweile steht so vieles zwischen dem älteren und dem jüngeren Polizisten, unabhängig davon, wie nah sie beieinander leben. Denn Jack hat im Unterschied zu seinem Vater irgendwann aufgehört, seiner Schwester hinterherzulaufen. Als Jims Tochter noch ein Teenager war, verglich Jim Kinder immer mit Papierdrachen. Und obwohl er die Schnur mit aller Kraft festhielt, trug der Wind seine Tochter irgendwann davon. Sie riss sich einfach los und flog gen Himmel. Man kann nie genau ausmachen, wann und wo Abhängigkeiten anfangen, deshalb belügen sich auch alle Betroffenen, wenn sie sagen »Ich hab es unter Kontrolle«. Drogen versetzen uns in einen Dämmerzustand, der uns die Illusion vermittelt, dass wir diejenigen sind, die entscheiden, wann das Licht ausgeht. Aber diese Macht besitzen wir gar nicht, denn die Dunkelheit übermannt uns, wann sie es will.
Vor einigen Jahren erfuhr Jim, dass Jack sein gesamtes Erspartes, von dem er eigentlich eine Eigentumswohnung hatte kaufen wollen, für die Aufnahme seiner Schwester in eine exklusive Entzugsklinik investiert hatte. Er brachte sie auch selbst dorthin, von wo sie jedoch nach zwei Wochen wieder türmte, zu spät, um das Geld zurückfordern zu können. Dann ließ sie ein halbes Jahr nichts mehr von sich hören, bis sie eines Nachts unvermittelt bei Jack anrief, als sei nichts geschehen, und fragte, ob er ihr »ein paar Tausender« leihen könne. Für ein Flugticket nach Hause, wie sie erklärte. Jack schickte ihr das Geld, aber sie kam nicht.
Ihr Vater läuft noch immer durch die Straßen, den Blick gen Himmel gerichtet, um den Drachen dort oben nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist der Unterschied zwischen ihrem Vater und ihrem Bruder. Nächstes Weihnachten wird der eine wieder erklären »Sie ist …«, woraufhin der andere flüstern wird »Ich weiß, Papa« und ihm ein weiteres Bier holt.
Sie schaffen es sogar, sich über Bier zu streiten. Jack ist einer dieser Youngster, die neugierig auf Biere sind, die nach Grapefruit, Pfefferkuchen, Marshmallows oder allem möglichen anderen schmecken. Jim hingegen bevorzugt Bier, das nach Bier schmeckt. Mitunter bezeichnet er all diese neumodischen Sorten als »Stockholmbiere«, ohne es dabei jedoch zu übertreiben, weil sein Sohn sonst so wütend wird, dass Jim sein verfluchtes Bier wochenlang selbst kaufen muss. Manchmal kommt ihm der Gedanke, dass man unmöglich wissen kann, ob Kinder sich trotz ihres gemeinsamen Aufwachsens unterschiedlich entwickeln oder gerade deswegen. Jetzt linst er über seinen Bildschirm hinweg und verfolgt die Fingerkuppen seines Sohnes, die über die Tastatur fliegen. Das kleine Polizeirevier in ihrer nicht besonders großen Stadt ist eigentlich ein ziemlich ruhiger Ort. Hier passiert nicht viel, hier spielen sich normalerweise weder Geiseldramen noch sonst irgendwelche Dramen ab. Und Jim weiß, dass diese Geiselnahme Jacks große Chance ist, um seinen Vorgesetzten zu beweisen, was er kann und welches Potenzial in ihm steckt. Bevor die Kollegen aus Stockholm eintreffen.
Jacks Frust legt sich auf die Augenbrauen, und in seinem Inneren brodelt Rastlosigkeit. Schon seit der Wohnungsstürmung vorhin droht er vor Wut jeden Augenblick zu platzen. Er hat lange versucht sich zu beherrschen, aber nach der letzten Vernehmung kam er in die Kaffeeküche der Wache gepoltert und explodierte förmlich: »Irgendeiner von diesen Zeugen weiß genau, was passiert ist! Irgendeiner weiß es und lügt uns schamlos an! Kapieren die denn nicht, dass sich der Täter irgendwo versteckt hat und langsam, aber sicher verblutet? Wie zum Teufel kann man die Polizei nur so anlügen, während jemand anderes stirbt?«
Als er sich später wieder an seinen Computer setzte, sagte Jim kein Wort. Und als schließlich der Kaffeebecher gegen die Wand knallte, war nicht Jack derjenige, der ihn geworfen hatte. Obwohl sein Sohn wütend war, weil er den Täter offensichtlich nicht retten konnte, und noch dazu sauer, weil die verfluchten Stockholmer bald eintreffen und ihm die Ermittlungen aus den Händen reißen würden, war er nicht annähernd so frustriert wie sein Vater, der das alles hilflos mit ansehen musste.
Hinterher schweigen sie lange. Werfen einander verstohlene finstere Blicke zu, um dann die Augen rasch wieder hinunter auf ihre Tastaturen zu richten. Zu guter Letzt bringt Jim hervor: »Sorry. Ich wische das gleich weg. Ich wollte doch nur … ich verstehe ja, dass dich das Ganze in den Wahnsinn treibt. Aber eigentlich wollte ich dir nur zeigen, dass es mich genauso in den Wahnsinn treibt.«
Sowohl Jim als auch Jack sind den Grundriss der Wohnung Zentimeter für Zentimeter durchgegangen. Dort gibt es keinerlei Verstecke und auch keine weiteren Ausgänge. Jack betrachtet erst seinen Vater und dann die Scherben des Kaffeebechers auf dem Fußboden hinter sich, bevor er mit leiser Stimme sagt: »Irgendwer muss ihm geholfen haben. Wir haben irgendwas übersehen.«
Jim starrt auf die Protokolle der Zeugenvernehmungen.
»Wir können nur unser Bestes geben, mein Junge.«
Wenn einem die Worte für alles andere im Leben fehlen, ist es leichter, über die Arbeit zu reden. Aber diese Worte beziehen sich natürlich auch auf alles andere. Jack muss seit der Geiselnahme unablässig an die Brücke denken, denn in seinen besten Nächten träumt er noch immer davon, dass der Mann nicht gesprungen ist und er ihn hat retten können. Jim muss ebenfalls ununterbrochen an dieselbe Brücke denken, denn in seinen schlimmsten Nächten träumt er, dass stattdessen Jack gesprungen ist.
»Entweder lügt einer der Zeugen, oder sie lügen alle miteinander. Irgendwer weiß, wo sich der Täter versteckt hat«, sagt Jack mechanisch und eher zu sich selbst.
Jim richtet den Blick auf den Zeigefinger seines Sohnes, der nervös auf die Tischplatte trommelt. Genau das hat auch seine Frau nach einer anstrengenden Nacht im Krankenhaus oder im Gefängnis immer getan. Doch inzwischen ist zu viel Zeit vergangen, um seinen Sohn noch darauf ansprechen zu können, wie es ihm eigentlich geht. Und auch für den Sohn, um es dem Vater erklären zu können. Der Abstand zwischen ihnen ist zu groß geworden, wird es vielleicht sogar für immer bleiben.
Als Jim mühsam von seinem Stuhl aufsteht, um die Wand abzuwischen und die Scherben seines Kaffeebechers aufzusammeln, übrigens begleitet von einer ganzen Symphonie aus den Ächz- und Stöhngeräuschen eines Mannes in fortgeschrittenen Jahren, springt Jack ebenfalls auf und geht in die Küche. Er kommt mit zwei frischen Kaffeebechern zurück. Nicht, dass Jack Kaffee trinken würde, aber mittlerweile hat er begriffen, dass es seinem Vater in manchen Situationen viel bedeutet, seinen nicht allein trinken zu müssen.
»Ich hätte mich nicht in deine Vernehmung einmischen dürfen«, gesteht Jim leise.
»Ist schon in Ordnung, Papa«, entgegnet Jack.
Allerdings meint keiner von beiden seine Worte ernst. Wir belügen diejenigen, die wir lieben. Beide beugen sich wieder über ihre Tastaturen, schreiben ihre Zeugenvernehmungsprotokolle ins Reine und lesen sie auf der Jagd nach irgendwelchen Hinweisen noch einmal durch.
Sie haben recht, beide. Die Zeugen sagen nicht die Wahrheit. Jedenfalls nicht die ganze. Zumindest nicht alle.
Kapitel 15
Zeugenvernehmung
Datum: 30. Dezember
Name der Zeugin: London
Jack: Vielleicht wäre es etwas bequemer, wenn Sie sich auf den Stuhl setzen würden statt auf den Boden.
London: Haben Sie grauen Star, oder was? Sie sehen doch, dass mein Handykabel nicht bis zum Stuhl reicht, oder?
Jack: Den Stuhl zu verschieben ist natürlich ausgeschlossen.
London: Hä?
Jack: Ach nichts.
London: Ihr habt hier drinnen übrigens ’nen Scheiß-Empfang. Nur ein Balken.
Jack: Ich hätte es sowieso gern, dass Sie Ihr Handy ausschalten, damit ich meine Fragen stellen kann.
London: Hindere ich Sie etwa daran? Stellen Sie doch einfach Ihre Fragen. Sind Sie übrigens wirklich ’n Bulle? Sie sehen viel zu jung aus dafür.
Jack: Sie heißen also London, ist das korrekt?
London:Korrekt. Wer redet denn so? Sie klingen ja wie ’n Typ in ’nem Rollenspiel, der auf Buchhalter steht.
Jack: Es wäre schön, wenn Sie versuchen würden, das Ganze etwas ernster zu nehmen. Sie heißen also L-o-n-d-o-n?
London: Ja, verflucht!
Jack: Ziemlich ungewöhnlicher Name, muss ich schon sagen. Na ja, vielleicht nicht unbedingt ungewöhnlich, aber interessant. Woher kommt er?
London: England.
Jack: Ja, das habe ich begriffen. Aber ich meinte eigentlich eher, ob es irgendeinen besonderen Grund dafür gibt, dass Sie so heißen.
London: Meine Eltern haben mich so genannt. Haben Sie was geraucht oder so?
Jack: Wissen Sie was? Wir vergessen das Ganze einfach und machen weiter.
London: Sind Sie jetzt etwa sauer?
Jack: Nein, ich bin nicht sauer.
London: Nee, Sie klingen ja auch kein bisschen sauer.
Jack: Konzentrieren wir uns auf folgende Fragen: Sie arbeiten in der Bank, ist das korrekt? Und Sie standen an der Kasse, als der Täter hereinkam?
London: Der Täter?
Jack: Na ja, der Bankräuber.
London: