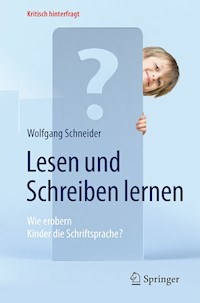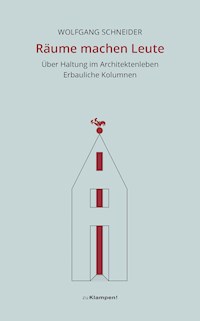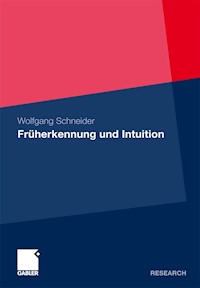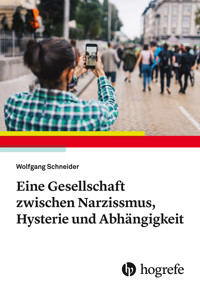
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verunsicherung und Dramatisierung angemessen begegnen Das Buch beschäftigt sich mit den immer komplexer werdenden Lebensbedingungen und -verhältnissen in der globalisierten Welt. Klimakrise, Armut, Pandemien, Kriege, Migration, nationale Egoismen, technischer Fortschritt und soziale Medien, wirtschaftliche Umorientierung oder Wertewandel sind einige Schlagworte dazu. Doch wie wirken sie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wie auf das Individuum? In der Bevölkerung sind kognitive Überforderung, zunehmende psychische Verunsicherung und soziale Deprivation, Identitätsverlust sowie die Häufung psychischer und psychosomatischer Gesundheitsstörungen auffallend. Im Kontext dieser Probleme beschreibt der Autor die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen und individuellen Entwicklungen unter Rückgriff auf aktuelle, authentische Fallbeispiele. So analysiert und diskutiert er etwa die Gründe für das Anwachsen autoritärer Tendenzen wie auch die zunehmende Irritation in Bezug auf demokratisch-freiheitliche Haltungen. Für die Darlegung seiner Beobachtungen greift der Autor auf seine umfangreichen Erfahrungen aus Wissenschaft und ärztlicher Praxis im Bereich der Psychosomatik und Psychotherapie sowie aus seiner sozialmedizinischen Gutachtertätigkeit zurück. Insbesondere auch denjenigen, die in ihrem beruflichen Umfeld beratend oder therapeutisch tätig sind, ermöglicht dieses Buch wertvolle Einblicke in die Herausforderungen unserer Zeit. Zusammenfassend werden Ideen und Lösungsansätze auf der Ebene der Politik sowie des medizinischen Versorgungssystems mit speziellem Fokus auf die Psychotherapie skizziert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wolfgang Schneider
Eine Gesellschaft zwischen Narzissmus, Hysterie und Abhängigkeit
Eine Gesellschaft zwischen Narzissmus, Hysterie und Abhängigkeit
Wolfgang Schneider
Programmbereich Psychiatrie und Psychotherapie
Prof. Dr. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider
Homepage: https://wolf-g-schneider.com
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Medizin/Psychiatrie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Susanne Ristea
Bearbeitung: Prof. Dr. Katharina Meyer, Rheinfelden
Herstellung: René Tschirren
Umschlag: Getty Images/Vasil Dimitrov
Umschlaggestaltung: Claude Borer, Riehen
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
1. Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96217-7)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76217-3)
ISBN 978-3-456-86217-0
https://doi.org/10.1024/86217-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
1.1 Die besonderen psychosozialen Herausforderungen unserer Zeit
1.2 Die Entwicklung in der Arbeitswelt
1.3 Individuen in prekären Lebens- und Arbeitssituationen
1.4 Das gesellschaftliche Leitbild des erfolgreichen Individuums
1.5 Zur individuellen psychologischen Dynamik der aktuellen gesellschaftlichen Situation
1.6 Wo steht die Gesellschaft heute?
1.7 Die gesellschaftlichen Einflussfaktoren
2 Psychische Entwicklung
2.1 Akzentuierung der psychischen Entwicklung in der Postmoderne
2.2 Persönlichkeitsentwicklung und Identität
2.3 Aktuelle Identitätskonzepte für die Spätmoderne
2.4 Zum Verhältnis von individueller (personaler) Identität und Kultur
2.5 Von der Angst zur Hysterie
3 Krankheit und Medikalisierungsprozesse
3.1 Chronifizierung – Arbeitsunfähigkeitsschreibungen und Frühberentungen
3.2 Die Medikalisierung sozialer Probleme
3.3 Gründe für die Medikalisierung der Gesellschaft
3.4 Ökonomisierung der Medizin
3.5 Die Orientierung an Maßnahmen der Qualitätssicherung
3.6 Medikalisierung durch institutionelle Rahmenbedingungen der Finanzierung
3.7 Sonstige Effekte der Medikalisierung
4 Psychische Erkrankungen und Medikalisierung
4.1 Die Bedeutung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen
4.2 Die Ausweitung des Krankheitsbegriffs und die Schaffung neuer Krankheiten in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
4.3 Die medizinische Versorgung
4.4 Der Umgang der „Psychoexperten“ mit dem sozialen Faktor
4.5 Medikalisierungstendenzen in den Fächern der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
4.6 Chronifizierungsprozesse
5 Moderne Krankheiten
5.1 Burn-out
5.2 Mobbing
5.3 Posttraumatische Belastungsstörung
6 Sind rechtsextremistische Gewalttaten Ausdruck einer psychischen Erkrankung?
7 Was ist wo und wie zu tun?
7.1 Die politische Perspektive
7.2 Coronaleugner und Anhänger von Verschwörungstheorien
7.3 Was folgt aus Corona in der Zukunft?
7.4 Was sollte in der Medizin geschehen?
7.5 Prävention und psychosoziale Entwicklung
7.6 Welchen Beitrag kann die Psychotherapie zu einer menschenfreundlicheren Gesellschaft leisten?
8 Resümee
Epilog
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Sachwortverzeichnis
|7|Vorwort
Die Frage, ob unsere Gesellschaft den Einzelnen „krank“ macht, beschäftigt uns seit vielen Jahren intensiv. Die globalisierte Welt mit ihren Risiken des Klimawandels, den unkontrollierbaren Finanzmärkten, den zunehmenden kriegerischen Auseinandersetzungen, Terrorismus und Flüchtlingsströme ist für viele Menschen immer unüberschaubarer und bedrängender geworden. Alle diese Manifestationen werden als ein Ausdruck des Machtstrebens, der unerschöpflichen Gier und Rücksichtslosigkeit des westlichen Kapitalismus, aber auch anderer Staaten wie z. B. Russland und China, angesehen. Die Reaktionen auf diese Entwicklung sind vielfältig und widersprüchlich, reichen von kritischem Widerstand bis hin zu ängstlichem Rückzug und Anpassung oder Tendenzen zum Autoritarismus. Eine Lösung aus dem Dilemma zeichnet sich noch nicht ab! Dazu kommen erschwerend die Unsicherheiten und die Ängste hinzu, die aus der Coronapandemie mit ihren Folgen resultieren.
Als Experte für psychosoziale Themen werde ich nur eingeschränkt in der Lage sein, die relevanten politischen Linien kompetent und erschöpfend zu diskutieren und die wirklichen Probleme umfassend nachzuzeichnen. Aber ich möchte mir die Freiheit nehmen, als Arzt für Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Psychologe sowie als politisch interessierter Bürger jene mir wichtigen Gedanken und Wertungen vorzustellen, die bei der Diskussion dieser Fragestellungen oft zu kurz kommen. Dabei bin ich mir bewusst, hierbei Gefahr zu laufen, als zu psychologisierend gewertet zu werden. Jedoch hat unsere Gesellschaft das Problem, auf viele substanzielle Fragen aus vielerlei Gründen vorrangig ideologische Antworten unterschiedlicher Couleur zu geben. Dies betrifft sowohl die aktuellen Regierungsparteien als auch die Oppositionsparteien, wobei ich sowohl die Linke als auch die AfD einbeziehe.
Zu fragen ist primär, in welche Situation der Einzelne in dieser Gesellschaft eingebunden ist und wie diese aus den unterschiedlichen ideologischen Perspek|8|tiven gewertet wird. Es ist so leicht, alle individuellen Probleme auf die Gesellschaft zu schieben, weil es den Einzelnen entlastet und ihm so Orientierung und Sicherheit gibt.
Die Dynamik und Komplexität, die Vielgestaltigkeit und Widersprüchlichkeit durch die Globalisierung, die Digitalisierung und die demografische Entwicklung in Deutschland und Europa schaffen gesellschaftliche Irritationen und Hitzigkeit, die durch die digitalen Medien noch hochgeschaukelt werden. Wir sind eine hysterische Gesellschaft, die alles hochkocht und dramatisiert. Welche Resultate für die einzelnen Individuen daraus folgen, möchte ich in diesem Buch diskutieren.
Als Psychotherapeut und ehemaliger Leiter einer Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin kann ich die individuelle Perspektive recht gut beurteilen. Mein tieferer Einblick in diese Thematik stammt aus der jahrelangen Behandlung von Patienten als auch aus der Begutachtung von Rentenbewerbern, aus meiner Tätigkeit als Leiter von Weiterbildungsseminaren und -curricula für diverse Berufsgruppen, insbesondere Ärzte und Diplompsychologen, und ferner aus intensiven Erfahrungen in der Weiterbildung von Institutionen und Firmen zu den Themen der psychosozialen Gesundheit und Arbeit.
Da ich bereits als Jugendlicher ein großes Interesse an gesellschaftspolitischen Fragen hatte und in meiner Tätigkeit als Psychiater und Psychosomatiker mehr oder weniger oft direkt mit der sozial- und gesellschaftspolitischen Dimension konfrontiert war, werde ich auch zu grundlegenderen gesellschaftspolitischen Fragen Stellung nehmen. Dabei interessieren mich die Art und Weise der gesellschaftlichen Selbstreflexion in ihren Auswirkungen auf die Individuen, der sozioökonomische Aspekt in Bezug auf die Langzeitarbeitslosigkeit sowie die sozial prekären Lagen sowie deren Management in unserer Gesellschaft. Ich gehe davon aus, dass diese Aspekte in Bezug auf viele aktuell brennende Fragen von Bedeutung sind. Die Gesellschaft weist eine starke Tendenz zur Pathologisierung sozialer Problemstellungen auf. Dafür eignen sich sowohl psychische als auch psychosomatische Erkrankungen in hervorragender Weise.
Ein besonderes Interesse lege ich auf die Aspekte der ökonomischen Entwicklung im Gesundheitssektor, da ich meine, dass hieraus ein großes gesellschaftspolitisches Problem resultiert. Ich sehe es als eine Pflicht für VertreterInnen meiner Profession an, darauf hinzuweisen, dass die Individuen in gewissem Ausmaß ihr Schicksal selbst in der Hand haben. Unsere Gesellschaft jedoch betreibt aus unterschiedlichen bewussten und unbewussten Motiven Prozesse der Medikalisierung von sozialen Problemen – unterstützt durch Politik, Gewerkschaften und öffentliche Medien –, bei denen Ärzte und Psychotherapeuten oftmals hilflos und unreflektiert mitspielen. Dieser Entwicklung möchte ich mit meinem Beitrag ge|9|gensteuern. Die jüngste Situation der Coronapandemie scheint dieser Sichtweise entgegenzulaufen. Denn die Gefährdung durch das Virus ist real und erfordert entsprechend somatisch orientierte Behandlungsmaßnahmen sowie präventiv motivierte Verhaltensregeln im Sinne von Hygiene- und Abstandsmaßnahmen. Ferner sind auch vielfältige Restriktionen, die sich sowohl auf die Bewegungsfreiheit, die Kontaktmöglichkeiten, die Mobilität und die berufliche Tätigkeit sowie den Schulbesuch auswirken, zu nennen. Die mit der Coronakrise verbundenen Entwicklungen haben nicht nur Konsequenzen für die körperliche Gesundheit der Individuen, sondern auch gravierende Folgen für die psychischen und sozialen Dimensionen des Einzelnen als auch der gesamten Gesellschaft.
|11|Einleitung
Die globalisierte und digitalisierte Welt ist gekennzeichnet durch eine rasante, komplexe und widersprüchliche Entwicklung sowie die Tendenz zur Dramatisierung und Emotionalisierung sowohl auf der Ebene der Gesellschaft als auch der Individuen. Die Verschränkung von psychischen und sozialen Faktoren in ihren Auswirkungen auf den Einzelnen und auf die Gesellschaft wird vor diesem Hintergrund aufgezeigt.
Die relevanten psychosozialen Themen sind der Verlust oder die Bedrohung der Identität, depressive Probleme gepaart mit Unsicherheit sowie narzisstische Persönlichkeitsakzentuierungen. Die Dramatisierung und Emotionalisierung aller Ereignisse in der Politik sowie in den Medien erinnern an hysterische Phänomene, die durch Unechtheit sowie Oberflächlichkeit beschrieben werden. Und wenn wir uns die Frage der Gültigkeit von Wahrheit, wie sie unter dem Trumpschen Diktum der Fake-News relativiert worden ist, vor Augen führen, scheint diese Interpretation zuzutreffen. Gerade die jüngste Erfahrung mit der Coronakrise legt einen besonderen Fokus auf diese Sichtweise. Die Unsicherheit über die reale Gefährdung durch das Virus und die damit verbundene Prognose für die Gesundheit der Menschen sowie der Gesellschaften führt dazu, dass entweder vorsichtige Haltungen seitens der Politik in Gang gesetzt und restriktive Einengungen auf allen möglichen Ebenen umgesetzt werden oder diese in machiavellistischer Art konsequent geleugnet werden. Mit den Motiven der unterschiedlichen politischen Vorgehensweisen werde ich mich in Kapitel 7 und 8 befassen. Die Individuen zeigen Reaktionen, die von Ängstlichkeit über Anpassungsbereitschaft bis hin zu Protesten gegen die Einschränkungen und hysterisch anmutenden Verhaltensweisen sowie zu wahnhaft erscheinenden Verschwörungstheorien reichen. Die Emotionalisierung erschwert oftmals eine Distanzierung auf einer rationalen Ebene und bewirkt aufgeregte Reaktionen auf unterschiedlichen ge|12|sellschaftlichen Ebenen; diese machen eine kritische Bewertung von Ereignissen unmöglich bzw. erschweren sie. Unterstützt wird diese durch die Dramatisierung und den Alarmismus in den öffentlichen Medien und noch stärker in den sozialen Medien.
Aus dem Wunsch nach Sicherheit angesichts der vielfältigen Verunsicherungen zeigen viele Menschen eine Orientierung an rechtspopulistischen Positionen sowie oftmals eine passive Versorgungshaltung. Die haltgebende äußere Struktur soll den Mangel an eigener innerer Struktur ersetzen. Ergänzend kommen Maßnahmen des Gesundheitsversorgungssystems zum Tragen, die den Anspruch der Individuen nach Entlastung von den Alltagsanforderungen im Beruf oder im Privatleben durch z. B. Krankschreibungen, diagnostische und therapeutische Interventionen befriedigen. In diesem Prozess der Medikalisierung wird „normales“ Erleben und Verhalten unter die Handlungsmaxime der Medizin und Psychotherapie subsummiert.
Die psychosozialen Hintergründe von Medikalisierungsprozessen sind gesellschaftlich durch ökonomische und technologisch-wissenschaftliche Interessen sowie durch einen hohen Anspruch an die Gesundheit begründet. Auf der individuellen Ebene stellen passive Grundhaltungen und Versorgungsansprüche die Hintergrundmatrix für derartige Entwicklungen dar. Die Rollen der Politik, der Medien sowie des medizinischen Versorgungssystems werden in Kapitel 3 systematisch herausgearbeitet.
Im zweiten Teil des Buches werden Lösungsansätze sowohl auf der Ebene der Politik, des medizinischen Versorgungssystems mit dem speziellen Fokus auf die Psychotherapie als auch auf die Individuen diskutiert. Anhand von Beispielen soll der Leser eine andere Perspektive auf die Sicht von psychischen Problemen und den Umgang mit diesen in unserer Gesellschaft erfahren. Das Ziel des Buches liegt darin, dem Leser zu verdeutlichen, dass eine Suche nach den Gründen für Störungen des seelischen und körperlichen Wohlbefindens sinnvoll und möglich ist. Die Lösungen liegen oftmals weniger in speziellen Unterstützungen durch Experten, sondern oftmals eher in der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse sowie der Umorientierung des eigenen Wertesystems.
|13|1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
1.1 Die besonderen psychosozialen Herausforderungen unserer Zeit
Die aktuelle politische Situation hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren in einer rasanten Weise verschlechtert, nachdem wir mit dem Ende der Sowjetrepublik und den ihr eng verbundenen Staaten eine relativ komfortable Zeit hatten. Während dieser Phase, die mit dem Ende des „kalten Krieges“ verbunden war, hatten viele Menschen das Gefühl und die Hoffnung, dass die Gefahren von erneuten kriegerischen Auseinandersetzungen über regionale Dimension hinaus nahezu gebannt seien. Die Finanzkrise im Jahr 2008 mit ihren Folgen brachte weltweit einen massiven Einbruch der ökonomischen Entwicklung mit sich, die mit einer hohen Zahl an Arbeitslosen und politischen Problemen in verschiedenen Ländern verbunden war. In Deutschland entwickelte sich die Wirtschaft positiv, was mit einem drastischen Rückgang der Arbeitslosigkeit verbunden war und ein erhebliches Gefühl der Sicherheit auf finanzieller und auf persönlicher Ebene hätte vermitteln können. Jedoch ist dies nicht oder nur zum Teil eingetroffen. Relevante Teile der Bevölkerung sind weiter sehr unsicher über die gesellschaftliche Situation, sie sehen sich gefährdet in ihrer existenziellen und allgemeinen psychosozialen Lage.
Der französische Sozialwissenschaftler Wieviorka (2003) hat formuliert, dass mit der Globalisierung und den modernen Kommunikationstechnologien die verschiedenen Kulturen immer mehr zusammenrücken. Deshalb würden sich die Unterschiede zwischen den ursprünglich entfernten Kulturen mittlerweile auch innerhalb komplexer Gesellschaften zeigen, da diese eine Vielfalt von Kulturen aufweisen. Die Begegnung kultureller Differenzen bedeute eine immense Herausforderung für multikulturelle Gesellschaften und Individuen, diese politisch und sozial zu integrieren. Die Alternativen würden nach Wievior|14|ka darin bestehen, sich entweder in der tradierten Gesellschaft politisch, kulturell und wirtschaftlich abzuschotten (z. B. deutsche Leitkultur) oder etwas Neues zu schaffen. Das Neue müsste die Erfahrungen aus der Konfrontation mit den kulturellen und individuellen Differenzen auf der Grundlage komplexer Gesellschaften mit ihren soziökonomischen und multi-kulturellen Werten und Normen integrieren.
Diese gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung sei durch Auf- oder Zerbrechen von traditionellen Werten, Normen und Institutionen (Religion, Kirche, Politik und Gewerkschaften) gekennzeichnet. Vorgezeichnete Lebensentwürfe würden wegbrechen oder zu fragmentieren drohen. Gefordert sei in dieser Lage Individualismus und Kreativität; die Perspektive der Selbstwirksamkeit und die „Freiheit der Wahl“. Diese Situation stelle sich für den Einzelnen unter unsicheren, widersprüchlichen und sozial herausfordernden Bedingungen.
Die politische Situation hat sich in den letzten zehn Jahren u. a. durch die Zunahme des Terrorismus gravierend akzentuiert. Das Fremde und die Ausländer werden seit dem massiven Anschwellen der Migrationsbewegungen insbesondere nach der Öffnung der Grenzen durch die Bundeskanzlerin Merkel im Jahr 2015 als brisant oder gefährlich erlebt. Die Tendenz zu Ausgrenzung von sowie Angriffen auf Ausländer und auch gegen Einrichtungen, in denen sie leben, ist erheblich angestiegen.
Unter dem Eindruck der vielfältigen kriegerischen Auseinandersetzungen (z. B. Syrien, Afghanistan oder die Ostukraine) sowie dem massiven Anstieg der Flüchtlingsbewegungen ist die gefühlte Sicherheit scheinbar weltweit erschüttert worden. Die Politik zeigt unter dieser Entwicklung eine Tendenz zu autokratischen Systemen. Dies sowohl in einigen Ländern der Europäischen Union (z. B. Ungarn, Polen sowie Tschechien) als auch aktuell in Russland unter Putin, das Anfang 2021 nach Rückkehr des Kremlkritikers Nawalny und dessen Verhaftung mit äußerster Härte und einer Vielzahl an Verhaftungen auf die zunehmenden Solidaritätsdemonstrationen reagiert.
Besonders kritisch und ausgesprochen beängstigend war die Entwicklung in den USA seit der Wahl von Donald Trump. Dieser hatte in den vier Jahren seiner Präsidentschaft nahezu auf allen innen- und außenpolitischen Feldern mit seiner Politik des „America First“ eine dramatische Verunsicherung sowie massive Konflikte ausgelöst. Trumps Haltung, alle ihm nicht passenden Ereignisse und Berichte als Fake News zu bewerten, hat vielerorts Anhänger gefunden. Besonders nachhaltig sah man diese starke Emotionalisierung und hysterisch anmutende Tendenz bei der Anhängerschaft von Trump nach der verlorene US-Präsidentenwahl. Sehr nachdenklich macht in diesem Zusammenhängen der Einfluss |15|von sozialen Medien auf ihre Mitglieder sowie deren Radikalisierung, wie es sich am 6. Januar 2021 in dem Sturm auf das Capitol gezeigt hat. Mit Trump haben die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien und Lügen eine Bedeutung erfahren, wie es weitgehend unvorstellbar war. Weiterhin haben die Vereinigten Staaten eine politische Polarisierung erfahren, die einerseits rechte und rassistische, andererseits eher liberal-demokratische Perspektiven aufweisen. Erschreckend ist jedenfalls die Unterstützung, die Donald Trump selbst nach dem Verlust der Präsidentschaft noch unter seinen Anhängern findet. Interessant wird die Entwicklung der politischen Atmosphäre unter der neuen US-Regierung sein. Inwieweit wird es ihr gelingen, die politische Spaltung des Landes aufzuheben? Innerhalb der EU wie der Nato ist doch ein grundlegender Optimismus eingekehrt, dass die besonders kritischen politischen Entscheidungen von Trump so nicht weiter stehen bleiben würden. Diese sind vielfältig und betreffen sowohl die Fragen des Klima- und Gesundheitsschutzes, militärische Themen wie z. B. seine Politik in Syrien und Afghanistan, die Quittierung von Atomwaffenabkommen aber auch die Rassen- und Migrationspolitik innerhalb der Vereinigten Staaten. Und die neue Regierung hat bereits nachhaltig Hoffnungen in Richtung auf eine gravierende Änderung in wichtigen Positionen gegenüber der Politik Donald Trumps aufkommen lassen, in dem Joe Biden sofort nach seinem Amtsantritt einige der besonders prekären Entscheidungen rückgängig gemacht hat. Dazu zählen sowohl das Pariser Klimaabkommen als auch der Austritt der USA aus der WHO. Hinzu kommt die für Deutschland bedeutsame Verschiebung des Truppenabzuges der US-Soldaten bis auf eine später zu fällende Entscheidung; diese soll auf der Grundlage einer gesonderten Prüfung, inwieweit der Truppenabzug im Interesse der USA sein würde, erfolgen.
Auch die Türkei hat mit Erdogan einen autoritären Führer, der alle Gegner einsperrt und seine Macht auf lange Zeit durch entsprechende Gesetzesänderungen festschreibt. Mit der Präsidialgesetzgebung im Jahr 2018 hat Erdogan die Möglichkeit per Dekret zu regieren, was zu einer Schwächung des Parlamentes und der Justiz geführt hat. Die jüngste Gesetzesänderung vom Dezember 2020 verschafft der türkischen Regierung die Grundlage, die Arbeit von zivilrechtlichen Organisationen jeder Art massiv zu behindern, einzuschränken oder gänzlich unmöglich zu machen (Schneider, A.-S., 2020).
Eine rechtspopulistische Argumentation und Politik, die nationalstaatlich Ideale hochhält, war und ist noch in vielen Ländern zu sehen, so zum Beispiel in Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, Schweden und Dänemark. In den letzten Jahren haben Italien und Österreich nationalstaatliche und massiv fremdenfeindliche Regierungen gebildet, die jedoch zurzeit nicht mehr an der Macht |16|sind. Mit diesen Themen werde mich aus sozialpsychologischer Sicht später befassen.
Die vorherrschenden Charakterisierungen unserer gesellschaftlichen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung und Digitalisierung sind aktuell: Hohe Komplexität, Schnelligkeit, Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit auf allen Ebenen. Daraus resultiert ein hoher Druck auf den Einzelnen, sich in dieser Situation zurecht zu finden.
So stellt sich die Frage, welche Zukunft in dieser unübersichtlichen Gemengelage die Weltpolitik aufnehmen wird. Szenarien wie die substanzielle Zerstörung der Erde durch den Klimawandel, aber auch die Bevölkerungszunahme und Hungersnöte werden uns allenthalben als Drohungen vorgehalten. Interessant ist jedoch die Frage, wie wir mit dieser Situation umgehen bzw. welche Auswirkungen diese auf den übergeordneten gesellschaftlichen Rahmen haben und welche Folgen auf der Ebene der psychosozialen Befindlichkeit für die Individuen resultieren. Dieser individuellen Perspektive werde ich als Psychotherapeut in diesem Buch nachgehen. Dabei ist die Art und Weise der gesellschaftlichen Selbstreflexion in ihren Auswirkungen auf die Individuen, aber auch der sozioökonomische Aspekt in Bezug auf die Arbeitswelt, die Langzeitarbeitslosigkeit und deren Management in unserer Gesellschaft von Interesse. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Aspekte der ökonomischen Entwicklung im Gesundheitssektor gelegt werden, da meines Erachtens hieraus ein großes gesellschaftspolitisches Problem resultiert. Die Privatisierung im Gesundheitssystem bringt große finanzielle Nachteile für die Gesundheitsversorgung mit sich. Die Steuergelder werden via Krankenversicherung in einem erheblichen Ausmaß für die Renditen der Aktionäre der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ähnlicher Einrichtungen ausgegeben. Krankheiten bzw. Therapien oder Rehabilitationsmaßnahmen werden immer mehr unter dem ökonomischen Gesichtspunkt indiziert. Die in der Regel gemeinnützigen Wohlfahrtsinstitutionen dürfen keine Gewinne machen und müssen deshalb das überschüssige Geld in neue Gebäude und Einrichtungen inklusive Versorgungsangebote reinvestieren. Dies bedeutet, dass sich der Gesundheitssektor und die sozial engagierten Institutionen und Verbände immer mehr und fantasievoller neue „Kunden“ schaffen.
Im Folgenden werde ich mich mit den grundsätzlichen Herausforderungen der Gesellschaft befassen. In unserer Erwerbsgesellschaft spielt die Arbeitswelt eine zentrale Rolle für den Einzelnen, da sie eine wichtige existentielle Basis für das Individuum sowie seine Familie darstellt. Über den finanziellen Aspekt hinaus weist die Arbeitswelt im günstigen Fall für die Entwicklung des Einzelnen und seine Familie – soweit vorhanden – wichtige psychosoziale Funktionen auf.
|17|1.2 Die Entwicklung in der Arbeitswelt
Die traditionelle Erwerbsbiografie gehört unter dem schnellen Wandel der Anforderungen an die Arbeitnehmer der Vergangenheit an. Der einzelne muss in der Regel die Bereitschaft und Fähigkeit aufweisen, immer wieder neue Arbeitsverhältnisse einzugehen, die mit neuen arbeitsbezogenen inhaltlichen und sozialen Aufgaben sowie der Bereitschaft zur Fortbildung verbunden sind. Auf den Wechsel der Arbeitsstelle folgt oftmals ein Wohnortswechsel sowie das Aufgeben von vertrauten und stabilen sozialen Netzen.
Die moderne Arbeitswelt ist durch eine zunehmende Technologisierung, Digitalisierung und Verwissenschaftlichung sowie durch das Anwachsen des Dienstleistungssektors gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang wird beschrieben, dass die Arbeitsbedingungen durch Intensivierung und Verdichtung der Arbeitsaufgaben, erhöhte psychosoziale Komplexität durch Digitalisierung und technologische Erneuerungen (Robotik) sowie steigende interaktive Anforderungen im Dienstleistungssektor immer belastender werden. Zudem stellt die Verwischung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatem (Work-Life-Balance) immer höhere psychosoziale Herausforderungen an die Bewältigungsfähigkeit des Individuums.
In den letzten Jahren spielen Ansätze der Künstlichen Intelligenz im Alltag und in den Arbeitsprozessen eine zunehmende Rolle. Dabei sind die selbstlernenden Maschinen mehr und mehr in den Fokus der Entwickler, der Anwender in der Industrie oder anderen Bereichen der Wirtschaft sowie in die Verwaltung und das Privatleben gerückt. Mit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz hat die Kritik an ihr und mit ihnen verbundene ethische Fragen an Bedeutung gewonnen (Harari, 2018; Precht, 2020). Vereinfacht formuliert geht es dabei um die Frage, ob diese Maschinen oder Computer über ihre Fähigkeit zum selbstständigen Lernen nicht irgendwann aus der Kontrolle ihrer Entwickler und der Menschen geraten können und dann gefährliche Aktivitäten entfalten könnten, die dem Menschen oder der Menschheit schaden könnten. Es wird beklagt, dass die Künstliche Intelligenz keine Gefühle oder sinnhaltige Motive entwickeln könne. Nichts, was den Menschen als ein besonderes Wesen auszeichnet, würden die Computer oder Roboter herausbilden. Dazu gehören das seelische Erleben, Empathie, Mitgefühl, Kreativität, Spontanität sowie soziale Verantwortung und damit verbunden auch eine soziale oder emotionale Intelligenz. Hier handelt sich um Kompetenzen oder Fähigkeiten, die Menschen vor dem Hintergrund ihrer bio-psycho-sozialen Einflussfaktoren herausgebildet haben. Gerade bei der psychischen Entwicklung geht es vielfach um komplexe Interaktionen zwischen genetischen und psychoso|18|zialen Bedingungen, wobei sich Merkmale in Bezug auf ihre genetische Determinierung durchaus unterscheiden.
Mit der Coronapandemie und den damit verbundenen Restriktionen auf den Ebenen der Kontakte sowie der Mobilität ist eine gravierende Zunahme an Homeoffice-Aktivitäten eingetreten. Die Voraussetzung dafür war eine gute und angemessene Infrastruktur digitaler Medien. Diese ermöglichte, dass vielfach die Arbeiten und die Besprechungen online abliefen und dies nicht nur im dualen Setting, sondern auch in größeren Meetings. Letztere können mit der modernen Technik weltweit umgesetzt werden, was z. B. viele Reiseaktivitäten überflüssig macht. Neben den finanziellen Vorteilen sind Einsparungen auf der Mobilitätsebene auch unter umweltpolitischen Gesichtspunkten begrüßenswert, wenn wir uns vergegenwärtigen, wieviel Reduktion von CO2- Emissionen durch den gravierenden Rückgang des berufsbedingten Flugverkehrs oder des Auto- bzw. Bahnverkehrs auf nationaler oder internationaler Ebene resultieren. Diese Perspektive wird im Rahmen der Coronapandemie zunehmend diskutiert, und vielfach werden folgende Szenarien dargelegt: Da Organisationen und Firmen realisiert hätten, dass Arbeit im Homeoffice durchaus funktionieren würde und effizient sei, würden zukünftig Büroräume überflüssig und entsprechend erfolge aus finanziellen Gründen eine Reduzierung der Büroflächen. Und auch die Durchführung von Online-Konferenzen würden sich als weniger umweltbelastend und weniger zeit- und kostenaufwendig herausstellen und daher diese Art des Austausches sowie der Teamprozesse beibehalten werden.
Inwieweit dies tatsächlich so sein wird, ist aus heutiger Sicht nicht final zu beurteilen. Online-Interaktionen lassen vielfältige Merkmale der direkten Kommunikation und Interaktion, die gerade emotionale Dimensionen berühren, nicht zu. Es ist niemals nur ein zweidimensionales Bild, was wir in den direkten Beziehungen wahrnehmen, sondern es sind komplexe Muster, die unterschiedlichste Sinneserfahrungen wie die optische, auditive, taktile und die olfaktorische Wahrnehmung beinhalten. Wir Menschen sind Wesen, die sehen, hören, riechen und tasten können. Alle diese Sinne machen unser Erleben und unsere Wünsche, Abneigungen, Neugier und Motivation aus. Wir erschließen damit unsere Welt und strukturieren unsere Beziehungen. In der direkten Interaktion kommen die räumlichen Erfahrungen ins Spiel, z. B., wie dicht oder fern ein Gegenüber ist und wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Raum bewegen. Dies kann von vielerlei Faktoren abhängen, z. B. von der Größe und Art des Raumes, der Hierarchie der Teilnehmenden oder den emotionalen Beziehungen der Teilnehmenden untereinander. All das macht das Szenische oder Atmosphärische aus, welches letztlich die emotionale Seite, das Erleben der Besprechung, des Meetings oder der |19|Konferenz entscheidend beeinflusst. Die emotionalen Prozesse spielen eine herausragende Rolle auf unterschiedlichen Ebenen. So lernen wir besser und effektiver, wenn wir emotional involviert sind. Auch die Motivation steht in einem engen Zusammenhang zu emotionalen Faktoren. So kann das Finden von Problemlösungen, die Entwicklung von Konzepten oder Projekten beschleunigt werden, wenn die emotionalen Beziehungen und die Motivation im Team passen. Auch eine gewisse kompetitive Haltung von Mitarbeitern, die ja auch durch Emotionen charakterisiert ist, kann bei der Entwicklung neuer Konzepte oder Produkte förderlich sein. Konkurrenz nicht nur negativ ist, sondern kann auch ein Ansporn bei der Entwicklung und Umsetzung von Aufgaben sein.
Auch ist zu bedenken, dass der soziale Austausch im Arbeitsprozess eine wichtige Variable für die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation ist. Arbeit sollte zu mehr als nur zum Gelderwerb dienen, sie erfüllt auch vielfältige andere wichtige psychosoziale Funktionen für das Individuum. Sie kann das Selbstwertgefühl positiv oder negativ beeinflussen, der Kontakt zu Kollegen und Chefs kann uns Freude oder Kummer bereiten. Unser Identitätsgefühl wird durch die Erfahrungen in der Arbeitswelt beeinflusst. Alle diese Aspekte werden durch die diskutierte Änderung in den Arbeitsprozessen infolge wachsender Digitalisierung beeinflusst. Welche Auswirkungen es für die einzelnen Individuen hat, wird bei den Menschen unterschiedlich sein. Der Aspekt des emotionalen Erlebens über die direkte Kommunikation und Interaktion bei der Zusammenarbeit wird für viele Individuen einen positiven Antrieb für die Identifikation mit der Aufgabe sowie für die Bindung an die Firma oder Organisation bedeuten. Der Besuch von Kongressen oder Seminaren, v. a. wenn sie an attraktiven Orten stattfinden, wird vielfach als Gratifikation aufgefasst, weil ein professioneller und privater Austausch mit Kolleginnen und Kollegen möglich ist.
Die hier angeführten Argumente werden die beschriebenen Vorzüge der digitalisierten Arbeitswelt mit ihren Möglichkeiten des Homeoffice und der Onlinemeetings relativieren. Wie sich die Entwicklung darstellen wird, muss abgewartet werden. Solange wir diese Perspektive beeinflussen können, sollte mit der Umstellung auf verstärktes digitalisiertes Tun und Handeln reflektiert vorgegangen und auch das Benefit und die Nachteile für die Individuen im Auge behalten werden.
Durch die Digitalisierung wird die Arbeitswelt inhaltlich im Prozess sowie in der Organisation gravierend verändert. Durch die Hereinnahme von intelligenten Tools, Automatisierung und Robotik sowie die zunehmende Vernetzung von Technologien und die Einführung Künstlicher Intelligenz verändern sich traditionelle Berufsbilder gravierend. Durch das Internet ist das Marktpotenzial an Wis|20|senstransfer und Produktivität enorm gestiegen. Nach Picot und Neuhäuser (2013) lassen sich durch die Digitalisierung der Arbeitswelt insbesondere folgende Entwicklungen charakterisieren:
Ein Durchdringungseffekt, bei dem durch den Einsatz intelligenter Tools und Technologien bestehende Arbeitsprozesse schneller und effektiver organisiert oder diese durch die neuen digitalen Technologien anders gestaltet werden. Diese Entwicklung führt in die „Smart Factory“; wobei es nicht mehr um die Mensch-Maschine-Interaktion geht, weil Computer-Roboter nahezu autonom die Prozesse steuern. Mit dieser Entwicklung ist oft ein hohes Ausmaß an Aufgabenvielfalt und eine Zunahme von Multitasking verbunden. Daraus resultieren eine Intensivierung und Verdichtung von Arbeit sowie die Unterbrechung von Aktivitäten und Phasen der Aufmerksamkeit. Die Zuwendung zu einer Aufgabe und auch notwendige Ruhepausen werden oftmals gestört. Des Weiteren könnte eine permanente Kontrolle der Arbeitstätigkeit und ihrer Effekte erfolgen. Für die Gruppe von Facharbeitern oder der einfachen Arbeiter ändert sich durch die Automatisierung und Robotik die sinnliche Beziehung zum Arbeitsgegenstand; das Material wird nicht mehr direkt gefühlt oder gespürt.
Diese Faktoren weisen die Tendenz auf, die Mitarbeiter kognitiv und emotional stark zu fordern bzw. zu überfordern. Dadurch kann die Arbeitseffektivität, aber auch die Möglichkeit zur Stressreduktion eingeengt werden. Aus der Stressforschung ist bekannt, dass für die Bewältigung von Stressoren passende Erholungszeiten unbedingt angezeigt sind (McEwen, 2007).
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine besondere Qualifizierung bzw. Weiterbildung der Mitarbeiter angezeigt. In einer Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (2014) wurden Firmen mit einem hohen Ausmaß an Digitalisierung befragt, welche Kompetenzen ihre Mitarbeiter benötigen würden. Folgende Aspekte wurden dabei herausgearbeitet: Planung und Organisationsfähigkeit, Kommunikation und Kooperationsfähigkeit, betriebliches und berufliches Erfahrungswissen sowie technisches Fachwissen und IT-Kompetenzen.
Mit der Digitalisierung ist eine Flexibilisierung der Arbeit in Bezug auf Zeit und Ort, aber auch der Inhalte verbunden. Dies gilt sowohl für den Einzelnen als auch für die Organisationen. Daraus können sich neue Arbeitsformen ergeben, die tendenziell zu einer Entgrenzung der Arbeit führen (Flexibilisierungseffekt).
Aus dieser Entwicklung bilden sich neue oder veränderte Berufsbilder heraus. In diesem Zusammenhang wird vielfach befürchtet, dass mit der Digitalisierung ein erheblicher Rückgang an Arbeitskräften verbunden sei. Die Autoren Picot und Neuhäuser (2013) gehen davon aus, dass die wachsende Automatisierung und Rationalisierung zum Wegfall von Berufen mit mittlerem Qualifikationsniveau füh|21|ren könnte. Hingegen würden die beruflichen Tätigkeiten im oberen und unteren Qualifikationsniveau, die weniger automatisiert und stärker erfahrungsgeleitet seien, an Bedeutung zunehmen bzw. es würden neue berufliche Qualifikationsprofile (Polarisierungseffekt) entstehen.
Die Diskussion über den Wegfall von Arbeitsplätzen bzw. von Berufen durch die Digitalisierung wird vielfach geführt. Für Zimmermann (2015) besteht die Tendenz der gravierenden Veränderung bzw. des Wegfalls von Berufen selbst für Richter, Piloten und Ärzte, wenn viele genuine Aufgaben dieser Berufe weitestgehend automatisiert vollzogen werden könnten. Aus soziologischer Sicht (Boes et al., 2014) übernimmt das Internet die Rolle eines Informationsraumes, der einen starken sozialen Aspekt aufweist, und eine Plattform zur Rationalisierung der Produktion. In diesem Kontext würden die Unternehmen stärker die Subjektpotenziale Ihrer Mitarbeiter nutzen, um neue Qualitäten im Arbeitsprozess zu erreichen.
Die Mitarbeiter würden ein höheres Ausmaß an Freiheitsgraden und Autonomiespielräumen erhalten. Dies habe es bereits in der Vergangenheit für höher qualifizierte Experten häufiger gegeben. Neu sei allerdings, dass in den letzten Jahren zunehmend die Subjektleistung systematisch genutzt werden würde. Unternehmen würden auf der Grundlage des Informationsraumes des Internets die „Kopfarbeit“ kultivieren. Dadurch seien sie weniger von der Leistung einzelner Mitarbeiter oder Teams abhängig. Mit dieser Entwicklung verbunden sei eine starke Tendenz zur Standardisierung und Prozessorientierung, die sich zum Beispiel in den Bereichen IT-Services oder auch der Finanzdienstleistungen finden würde. Diese neue Form der Arbeitsorganisation bedeute für den Einzelnen einen permanenten Bewährungsdruck, der als eine relevante Ursache für das gehäufte Auftreten von „Burn-out-Prozessen“ anzusehen sei.
In der Folge der demographischen Entwicklung einer „alternden“ Gesellschaft sind ältere Arbeitnehmer prinzipiell gefordert, länger erwerbstätig zu sein, was für sie mit gesundheitlichen und psychosozialen Adaptationsprozessen verbunden ist. Aber auch für die Betriebe stellen sich neue Anforderungen an die inhaltliche Strukturierung und die Organisation von Arbeit sowie an deren Bereitschaft und Kompetenz, eine effektive und angemessene Abstimmung zwischen den Interessen, Kompetenzen und Stärken von jüngeren und älteren Arbeitnehmern vorzunehmen. Der Arbeitskräftemangel verschärft diese Problemlage weiter.
Dabei sind die Besonderheiten der psychischen und sozialen Belastungen in der Arbeitswelt von Interesse. Diese sind einerseits durch die steigenden mentalen und kognitiven Anforderungen über die Art der Aufgabenstellungen und Arbeitsverdichtung in einer technisierten Arbeitswelt gekennzeichnet, andererseits durch die besonderen interaktiven Anforderungen in einer Wissens- und Dienst|22|leistungsgesellschaft. Die Abnahme des klassischen industriellen Arbeitssektors und der damit verbundenen Gefahrenpotentiale auf der Ebene von physikalischen und biochemischen Faktoren stellt sich wie folgt dar:
Ausweitung des Dienstleistungs- und Wissenschaftssektors; damit verbunden ein höherer Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften und ein sinkender Bedarf an niedrig qualifizierter Arbeit. Die zunehmende Digitalisierung sowie die Einführung neuer Technologien und Organisationsformen der Arbeit erfordern mehr Flexibilität und Mobilität seitens der Arbeitnehmer (z. B. die Bereitschaft zur lebenslangen Fortbildung, Bereitschaft zum Wechsel von Arbeitstätigkeiten).
Anwachsen psychosozialer Belastungen sowie höhere Anforderungen an kommunikative und interaktionelle Kompetenzen für die Individuen.
Wachsende Anforderungen an die Selbstregulation des einzelnen Mitarbeiters durch neue Arbeits- und Lebensformen (z. B. erhöhte Autonomie bzw. Eigenverantwortung).
Zunehmende Vermischung von Arbeit und Freizeit mit den Problemen für eine ausgewogene Work-Life-Balance (Kastner, 2004).
Die Arbeitsprozesse sind oftmals belastet durch einen fehlenden oder mangelnden Sinnzusammenhang, Unter- bzw. Überforderung, Gratifikationskrisen (Siegrist, 2009), Veränderungen der Hierarchien (z. B. flache Hierarchie) und damit verbundenem kritischem Führungsverhalten sowie den wachsenden Anforderungen an Kooperation, Kommunikation und Zeitdruck.
Besondere Probleme für das Individuum resultieren aus unregelmäßigen Arbeitszeiten, befristeten und unsicheren Arbeitsverhältnissen sowie aus dem damit verbundenen hohen Anspruch an Flexibilität und Mobilität. Das im Mai 2019 verkündete Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) zur Arbeitszeiterfassung passt eigentlich gar nicht zu dieser Entwicklung (Workwise, 2020).
Gefordert ist weiter die Bereitschaft zur lebenslangen Fort- und Weiterbildung; die demographische Entwicklung und die politisch gewollte Erhöhung des Alters bei Renteneintritt verschärfen diesen Druck noch weiter. Unter prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen leben mittlerweile nicht nur Individuen mit einer niedrigen beruflichen Qualifikation, sondern auch gut ausgebildete Individuen, für die ihre Zukunft alles beinhalten kann: beruflichen und materiellen Erfolg oder diesbezüglich erhebliche Verunsicherung bzw. Ängste des Versagens. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aktuell die Debatte um die Erhöhung des Rentenalters eine Polarisierung erfährt. Die eine Sichtweise, z. B. die Gewerkschaften und einige politische Parteien (SPD und Linke), verteufelt die Er|23|hebung des Altersrentenzugangsalters auf demnächst 67 Jahre. Gleichzeitig zeigt die demographische Entwicklung eine Zunahme der durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen sowohl bei den Frauen und den Männern und dies bei oftmals fortbestehender kognitiver Leistungsfähigkeit sowie guten Fach- und Sozialkompetenzen. Die hier skizzierte Entwicklung des Arbeitssektors zeigt, dass in den Arbeitsprozessen zunehmend Soft-Skills verlangt und weniger körperliche Anforderungen gestellt werden.
1.3 Individuen in prekären Lebens- und Arbeitssituationen
Im Folgenden sollen die besonderen psychosozialen Belastungen, die sich aus den gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen ergeben, akzentuiert herausgearbeitet werden. Dafür ist es hilfreich, sich zu verdeutlichen, welche psychosozialen Funktionen die Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft traditionell aufweist. Grundsätzlich sollte Erwerbsarbeit sinnhaft sowie sozial anerkannt sein und dem Individuum materielle und soziale Sicherheit bieten. Darüber hinaus weist sie potenziell eine wichtige Funktion für die (soziale) Identitätsbildung des Individuums sowie eine selbstwertfördernde und -stützende Bedeutung auf. Die Teilhabe am Arbeitsprozess kann dem Individuum ein grundlegendes Gefühl der Selbstwirksamkeit geben, d. h., das Individuum entwickelt das Konzept oder die Gewissheit, sein Leben konstruktiv und unabhängig für sich und für seine Familie zu gestalten. Auf dieser Grundlage kann der Einzelne ein grundlegendes Selbstwertgefühl sowie ein Erleben psychosozialer Autonomie und Gestaltungsmöglichkeit entwickeln. Aus einer radikal gesellschaftskritischen Sicht sind diese Ansprüche wenig treffend, sondern dienen insbesondere dem Erhalt der neoliberalen Wirtschaftslogik. Auch die Merkmale wie Autonomie bzw. Selbstwirksamkeit sind aus dieser Sichtweise wenig einladend, denn die Annahme dieser Eigenschaften würde nur die Eingliederung in die kapitalistische Wirtschaftslogik bedeuten.
Die oben beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen und Bedingungen in der Arbeitswelt führen für eine große Zahl von Arbeitnehmern in unsichere, wenig sinnstiftende und sozial integrierende Arbeitsprozesse, sondern tendenziell in kritische Prozesse der Identitätsbildung. Wechselnde Arbeitsplätze, Entgrenzung der Arbeit sowie die oftmals geforderte örtliche Mobilität und Flexibilität erfordern vom Individuum ein hohes Ausmaß an Fähigkeit zur Selbstregulation|24|sowie emotionale, affektive und handlungsbezogene Kompetenz. Diese ist relativ unabhängig von stabilen und kontinuierlich bestehenden sozialen Netzwerken, seinen persönlichen Weg für sich konstruktiv und zufriedenstellend zu gestalten. Bestimmte Berufe oder berufliche Positionen verführen dazu, sich selbst in seinem Engagement zu verlieren (Selbstausbeutung) und den Blick für alternative Erlebens- und Handlungsfelder außerhalb des Arbeitssektors zu verlieren. Die veränderten gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen haben wohl auch einen entscheidenden Beitrag zu der Veränderung von Beziehungsformen beigetragen. Die traditionelle Familie hat ihre zahlenmäßige und wohl auch soziale Bedeutung verloren. Durch unterschiedliche Formen der Arbeitsorganisation (z. B. Homework) und die Intensivierung bzw. Verdichtung der Arbeit ist eine psychosozial konstruktiv wirkende klare Abgrenzung von Arbeit- und Privatleben zunehmend unscharf geworden. Im Kontext der Coronapandemie haben sich grundlegend andere Tendenzen entwickelt.
Arbeit und Privates vermischen sich, und diese Entwicklung fördert Prozesse der Verausgabung infolge mangelnder Phasen der Erholung und kreativen Beschäftigung mit privat und persönlich wertvollen Erfahrungen außerhalb des Arbeitssektors. Das heute „hoch im Kurs“ stehende Burn-out-Syndrom stellt wohl eine Folge dieses ungünstigen Verhältnisses zwischen Arbeitsanforderungen und psychosozial förderlichem Privatleben dar.
Unter den Bedingungen von Langzeitarbeitslosigkeit und prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen verschärft sich die Problematik nachhaltig. Bis etwa 2010 lag eine hohe Arbeitslosenzahl in weiten Regionen Deutschlands vor. Die individuell und sozial positiven Faktoren der Arbeit, die eine gute und menschenfreundliche Arbeit durchaus aufweisen könnten, gehen dann verloren. Es resultieren massive finanzielle Einschränkungen und damit verbundene Alltagssorgen. Familiäre Strukturen, Abläufe und Rollen lösen sich auf; dies betrifft entscheidend die Rolle der Eltern, die nicht mehr für die Familien eigenverantwortlich sorgen können und damit auch tendenziell ihre Vorbildfunktion für die Kinder verlieren. Tagesstrukturen und Teilhabe an unterschiedlichen Lebensbereichen, die eine individuelle und soziale Orientierung fördern, brechen weg und führen zu individuellen und sozialen Desintegrationsprozessen. Dies gilt umso mehr für Familien, in denen mehr als eine Generation arbeitslos ist. Die soziale Kontrolle ist für Familien in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen oftmals ausgesprochen hoch (z. B. ARGE, Bundesanstalt für Arbeit, Jugendamt etc.). Dazu kommen gesellschaftliche und allzu oft alltägliche erfahrbare Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozesse. Der Versuch von Betroffenen, unter den Bedingungen der Arbeitslosigkeit ein befriedigendes Leben zu führen, wird gesell|25|schaftlich oft als „Sozialschmarotzertum“ diffamiert. Dies betrifft z. B. ein Engagement in ehrenamtlichen Sport- und Jugendaktivitäten; es folgen Kommentare wie „der soll doch lieber arbeiten“. So ist ein konstruktives Bewältigungsverhalten oftmals öffentlich nicht erwünscht, obwohl es den Individuen in Bezug auf ihre psychosoziale Integrität und Gesundheit durchaus nützen könnte. Aus dieser Konstellation resultieren häufig Krisen des Selbstwertgefühls, Gefühle der Selbstunwirksamkeit, Hilflosigkeit und Ohnmacht, die nicht selten in depressiven Entwicklungen münden. Dazu können die Betroffenen existenzielle Ängste, aber auch Zustände von Resignation und Ärger oder Aggressionen entwickeln. Letztlich führen derartige Entwicklungen häufig zu einer Minderung individueller Aktivitäten und zu sozialem Rückzug. Diese Prozesse münden im Wechselspiel mit medizinischen und sozialen Institutionen und deren Akteuren oftmals in die Chronifizierung von psychischen, psychosomatischen, aber auch organischen Krankheitsprozessen, die durch psycho-soziale Faktoren überlagert werden. Die Bedeutung von psychischen und psychosomatischen Krankheiten bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit belegt diese These, die weiter unten ausführlich diskutiert werden wird.
Das Erleben von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, unabhängig davon, wie berechtigt oder unberechtigt dies sein mag, ist neben den existenziellen Ängsten vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen als medizinischer Gutachter bei Rentenverfahren wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ein wichtiger motivationaler Faktor für den „Rentenwunsch“. Gesellschaftlich ist die Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit als ein soziales Regulationsinstrument, in der Vergangenheit jedoch auch als ein arbeitsmarktregulierender Faktor anzusehen. Unter dem Eindruck des Mangels an Arbeitskräften geht die Diskussion heute in eine andere Richtung. Über Vorruhestandsregelungen wird nur noch im Rahmen von betrieblich notwendigen Entlassungen gesprochen (z. B. bei der bevorstehenden Schließung der Braunkohlegruben im Rahmen der Energiepolitik). Die Erhöhung des Rentenalters ist längst Realität geworden. Von Seiten der Unternehmer und insbesondere der Politik wird von der Notwendigkeit der Qualifizierung und Integration von ausländischen Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt gesprochen.
Studien zu den gesundheitlichen Folgen der Arbeitslosigkeit (Kieselbach & Beelmann, 2006; Weber et al., 2007) zeigen eine deutliche Belastung von Arbeitslosen in Bezug auf ihre somatische und psychosoziale Gesundheit und Integrität. Auch wenn anzunehmen ist, dass Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein höheres Risiko aufweisen, den Arbeitsplatz (Selektionshypothese, Weber et al., 2007) zu verlieren, spricht doch vieles dafür, dass die mit der Arbeitslosigkeit verbundenen individuellen, sozialen und finanziellen Belastungen |26|das Gesundheitsverhalten und die Gesundheit entscheidend beeinflussen. Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit erreichen jedoch auch Menschen, die noch im Arbeitsprozess – allerdings unter einer unsicheren Perspektive – integriert sind. Die psychosoziale Situation von Arbeitslosen haben Kieselbach und Beelmann (2006) wie folgt charakterisiert:
Verlust der positiven Funktionen von Arbeit (soziale Einbettung, Sinnhaftigkeit, Vermittlung von Selbstwertgefühl und existentieller Autonomie bzw. Selbstkontrolle).
Finanzielle Einschränkungen.
Veränderte familiäre Strukturen und Rollen.
Zunehmende Alltagssorgen, Unzufriedenheit mit der Lebenssituation.
Erfahrung von Kontrolle durch soziale Institutionen.
Einsamkeit, Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung.
Aufgrund des Fehlens persönlicher Ressourcen (Bewältigungskompetenzen) und sozialer Ressourcen (soziale Unterstützung) resultieren Einschränkungen der Selbstwirksamkeit und Reaktionen von Hilflosigkeit.
Psychische und psychosomatische Beeinträchtigungen wie z. B. depressive Verstimmungen, Ängste, Selbstwertverlust, Somatisierung und schädlicher Substanzgebrauch (Alkohol und Drogenabhängigkeit).
Diese Faktoren können in ihrem Zusammenspiel die Entstehung und Chronifizierung von körperlichen und psychischen Erkrankungen fördern. Arbeitslosigkeit ist also mit drängenden sozialen Existenzfragen, sozialer Kontrolle und gesellschaftlicher Exklusion verbunden und wird häufig als stigmatisierend erlebt. Allerdings ist davon auszugehen, dass das Stigmatisierungspotential einen engen Bezug zu den jeweils konkreten sozialen Kontexten aufweist, in denen das betroffene Individuum und ggf. seine Familie lebt. Wenn Arbeitslosigkeit oder drohende Arbeitslosigkeit zu einem breiten gesellschaftlichen Phänomen werden, verliert sie tendenziell ihr Stigmatisierungspotential, sie wird zur „Normalität“. Eine entsprechende Entwicklung zeigt sich m. E. vor allem in Regionen in Ostdeutschland, die durch eine hohe Arbeitslosigkeit charakterisiert sind. Meine Annahmen leiten sich aus einer großen Zahl von systematischen Interviews im Rahmen von Rentenbegutachtungen im Rahmen von Rentenanträgen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ab. Diese werden mittlerweile vor dem Sozialgericht im Widerspruchsverfahren verhandelt, in denen ich mit einer Vielzahl von zu Begutachtenden über ihre Lebens- und Arbeitssituation vor und nach der Wende gesprochen habe. Sozialpsychologisch spielen dabei die gesellschaftlichen – und insbesondere die psychosozialen Folgen der Wende eine wichtige Rolle. Mit dem Zusammen|27|bruch der DDR sind wichtige identitätsstiftende oder kontrollierende soziale Institutionen, aber auch Wert- und Normorientierungen weggebrochen, die für die Individuen – bei allen sonstigen individuellen Einschränkungen Halt, Orientierung und Sicherheit bedeutet haben. Die Nachwendezeiten sind für eine große Gruppe von Individuen mit einem hohen Ausmaß an sozialer Verunsicherung, Vereinzelung, finanzieller Unsicherheit und der Konfrontation mit unbekannten und flüchtigen Werten verbunden; diese überfordern oft die Anpassungsfähigkeit, aber auch die Anpassungsbereitschaft dieser Menschen. Auf der individuellen Ebene spielen psychologische Entwicklungscharakteristika eine wichtige Rolle, die als eine Folge der spezifischen Sozialisationsbedingungen in der DDR anzusehen sind. Zu diesen zählen m. E. ein hohes Ausmaß an Passivität und Abhängigkeit sowie eine relativ stark ausgeprägte Gruppenorientierung, die ihre unbewussten, aber auch bewusstseinsnahen Auswirkungen auf die Adaptationsfähigkeit der von arbeitsbezogener und sozialer Perspektivlosigkeit bedrohten Individuen aufweist. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich dann regressive Tendenzen, die oft in die Herausbildung von chronischen psychischen und psychosomatischen Krankheiten und letztlich in die Beantragung einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit münden. Daneben spielt auch eine emotionale Verarbeitung der Nachwendeerfahrungen eine Rolle, die durch Gefühle der „Verbitterung“ (Linden, 2017, S. 22) oder der Hilf- und Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet ist und auf deren Grundlage der Rentenanspruch als gerechte Wiedergutmachung erlebt wird. Ergänzt wird diese Dynamik vielleicht auch durch das Empfinden, dass die „neue“ Gesellschaft ungerecht und sozial benachteiligend sei. Dieses ist wahrscheinlich sowohl in der politischen Biografie der ehemaligen DDR-Bürger als auch in dem aktuellen Erleben ihrer sozialen Position begründet. Ferner spielt die öffentliche Meinung, wie sie in den Massenmedien, insbesondere in den neuen Bundesländern formuliert wird, eine Rolle.
Erfahrungsbericht
„Der Herausgemobbte“
Der Patient wurde von uns stationär wegen einer chronischen Depression aufgenommen; er wurde er mir vor einer Visite von der behandelnden Ärztin vorgestellt. Sie berichtete, dass er nach der Wende vielfach aus Arbeitsstellen herausgemobbt worden sei. Bei der Visite berichtete er auf meine Frage, was ihn zu uns in die Behandlung gebracht hätte, in einem recht verbitterten und wütenden Ton, dass er seit der Wende etwa 15-mal ohne seine Schuld herausgemobbt worden sei. Das sei doch wohl schrecklich, oder? Selbst aus einer ehren|28|amtlichen Tätigkeit hätte man ihn herausgemobbt. Wie man sich denken könne, wäre seine Situation doch wohl nicht zu akzeptieren. Wenn man sich vorstelle, wie er sich fühlen müsse, dass er mit Mitte 50 von seiner Frau „leben“ müsste, die arbeitstätig sei und nur wenig Geld verdienen würde. Aber zu viel, so dass er kein Harz-IV bekommen könne. Dies alles berichtete er sehr langatmig und mit einer hoch ärgerlichen und vorwurfsvollen Stimme und ausladenden Gesten. Ich habe ihm darauf gesagt, dass ich seine schwierige Situation gut verstehen könne, jedoch nicht den Eindruck habe, dass er eine Depression haben würde, sondern ihn als verbittert erleben würde, was ich durchaus nachvollziehen könne. Der Patient war dann völlig aufgebracht und sagte zu mir, dass ich wohl der unfähigste Psychiater sei und warum sein Psychiater ihm wohl seit fünf Jahren Antidepressiva verschreiben würde. Ich fragte ihn dann, ob diese denn geholfen hätten. Nach der Visite war der Patient noch voller Ärger und wollte die Station eigentlich umgehend verlassen. Er blieb dann doch und zeigte sich im Umgang mit den Mitpatienten und Patientinnen immer wieder provozierend und entwertend. Einige Patientinnen reagierten aufgrund seiner offensiv-aggressiven Art ängstlich und versuchten außerhalb der Therapien den Kontakt zu ihm zu vermeiden. Nach etwa 8 Wochen Therapie sagte mir der Patient in einer Visite: „Herr Professor, was ich Ihnen einmal sagen möchte. Sie hatten ganz am Anfang meiner Therapie zu mir gesagt, dass ich Ihrer Meinung nach keine Depression hätte, sondern verbittert und ärgerlich sei. Und da hatten Sie recht, ich bin wirklich verbittert und oftmals aggressiv. Jetzt hat mir sogar meine Frau gesagt, dass Sie sich von mir trennen würde, wenn ich nicht meine aggressive Art ändern würde…“
Erfahrungsbericht
Der Bürgermeister
Etwa im Jahr 2005 begutachteten wir im Auftrag eines Sozialgerichtes Mecklenburg-Vorpommerns einen Antragssteller auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Dieser Mann – von Beruf Handwerker – hatte vor der Wende eine Funktion als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde gehabt und nach der Wende überhaupt nicht mehr gearbeitet, weil er sehr lange wegen unklarer Schmerzen und Bewegungsbeeinträchtigungen arbeitsunfähig geschrieben worden war. Er war von verschiedenen Fachärzten mit unterschiedlichsten diagnostischen Prozeduren und Therapien behandelt worden und auch mindestens einmal in einer stationären Rehabilitationsmaßnahme gewesen. Nachdem er seine Leistungsfähigkeit einige Male im Rahmen des Rentenverfahrens von Gutachtern unterschiedlicher Fachrichtungen als nicht so gravierend |29|eingeschätzt wurde, dass die Erwerbsunfähigkeitsrente seitens des Gerichtes hätte festgestellt werden können, kam er nun zu uns zur Begutachtung. Im Rahmen der Begutachtung, in der wir zu zwei Terminen sehr ausführlich mit dem zu Begutachtenden sprachen, um uns einen profunden Eindruck von ihm machen zu können, sagte er plötzlich: „Und nach der Wende habe ich mir gesagt, dass ich in dieser Schweinegesellschaft nicht arbeiten werde…“. Über so viel Ehrlichkeit waren wir Gutachter, ein Oberarzt und ich, doch erstaunt und sprachlos.
Die jüngste Entwicklung von ausländerfeindlichen Demonstrationen und Protesten von besorgten „normalen“ Bürgern und rechtspopulistischen oder gar faschistischen Gruppierungen in den neuen Bundesländern (Pegida; Demonstrationen von Chemnitz im Herbst 2018 und an anderen Orten) stellt einen plastischen Ausdruck dieser Verarbeitung dar.
Anlässlich des 28. Jahrestag der deutschen Vereinigung wurden die Themen der nach wie vor bestehenden soziokulturellen Unterschiede zwischen West und Ost wieder nachhaltig diskutiert. Am Tag der Deutschen Einheit wurde erneut betont, dass die Lebensverhältnisse zwischen West und Ost noch immer gravierende Unterschiede aufweisen würden. Dazu würde das Gefühl vorherrschen, dass die offizielle Politik sich nicht um die Belange der Bürger kümmern würde und der Westen sich gegenüber den Neuen Bundesländern wenig integrativ zeigen würde. Bundesfamilienministerin Giffey führt in einem Interview mit den Lübecker Nachrichten vom 3.10.2018 an, dass, obwohl die Menschen in den neuen Bundesländern einen Bevölkerungsanteil von 17 % aufweisen würden, weniger als 2 % eine Führungsposition auf der Bundesebene innehätten. Auch im Jahr 2019 kommt eine Studie des IWH-Institutes-Leibniz (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, 2019) zu der Feststellung, dass die Wirtschaft im Osten gegenüber der im Westen weiter hinterherhinkt. Dies auf verschiedenen Ebenen: Nur 7 Prozent der Konzerne würden ihre Zentralen in Ostdeutschland haben und bezogen auf die Produktivität würden Firmen verschiedener Betriebsgrößen und Branchen im Schnitt eine mindestens um 20 Prozent niedrigere Produktivität aufweisen. Der Hauptgrund für die eingeschränkte Produktivität würde jedoch mit der deutlich kleineren Betriebsgröße in den neuen Bundesländern begründet sein. Als positiv zu bewerten sei ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Dieser betrug im Februar 2019 Westdeutschland (4,9 %) und in Ostdeutschland (7,0 %).
Weiterhin als positiv zu bewerten sei der Sachverhalt, dass die Abwanderung von Ost nach West zum Stillstand gekommen ist. Dies sei auf eine Verbesserung der Arbeitsmarktlage zurückzuführen.
|30|Ein großes Problem seien die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Ost und West. Diese seien in weiten ländlichen Regionen in den neuen Bundesländern nicht gleichwertig in Bezug auf die öffentliche Daseinsvorsorge z. B. die öffentliche Sicherheit, die Gesundheitsversorgung, Mobilität, die Netzinfrastruktur, kulturelle Angebote und Freizeiteinrichtungen.
Erfahrungsbericht
Die Landarztpraxis als Ersatz für fehlende Cafés/Kneipen oder Freizeiteinrichtungen
In meinen Weiterbildungsseminaren für niedergelassene Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen zum Thema Psychosomatik nehmen auch vielfach Ärztinnen und Ärzte aus dem ländlichen Raum teil. Diese berichten dann über die Situation ihrer Patienten in Gebieten, in denen nahezu jede Infrastruktur für Freizeitaktivitäten wie z. B. Cafés, Kneipen, Kinos oder Vereine, Volkshochschulen und Jugendzentren weggebrochen seien. Besonders schlimm sei die Situation für Jugendliche, die auf der Straße oder im Internet herumhängen würden. Aber auch ihre Patienten, von denen doch eine größere Zahl bereits eine lange Zeit arbeitslos seien, hätten wenig außerhäuslich zu tun. So seien diese überhaupt nicht böse oder verärgert, wenn sie beim Arzt, den sie doch regelmäßig besuchen würden, länger warten müssten. So hätten sie wenigstens Gespräche und etwas Abwechslung zur Situation zuhause. Es würde auch häufig vorkommen, dass sich Patienten für den nächsten Arztbesuch verabreden würden, im Wartezimmer miteinander sprechen würden und, soweit im Dorf vorhanden, nach dem Arztbesuch gemeinsam in ein Café oder ein Gasthaus gehen würden. Wir haben schon daran gedacht, im Wartebereich einen Kaffeeautomaten aufzustellen, so ein wiederholt gefallener Kommentar. Im Rahmen unserer Begutachtungen fordern wir zwischen dem ersten und zweiten Gutachtentermin (meist im Abstand von einer Woche) die Begutachteten immer wieder auf, ein Tagesaktivitätenprotokoll zu führen. Hier sahen wir wiederholt, dass die regelmäßigen Arztbesuche häufig die einzigen außerhäuslichen Aktivitäten darstellen. Hier zeichnet sich die besondere psychosoziale