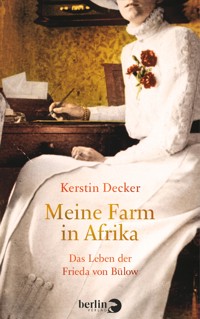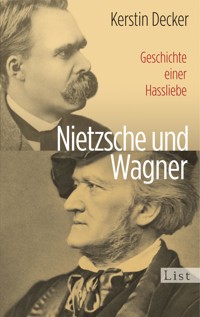21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Woher der Wind weht Am Anfang war das Wort? Am Anfang war der Wind! Wir können uns weigern zu essen und zu trinken, aber wir können uns nicht weigern zu atmen. Wind ist bewegte Luft, vom Atem bis zum Tropensturm. Auch was wir Seele nennen, meint ursprünglich nichts anderes als Hauch. Und ist es nicht Glück, den Wind in den Bäumen zu hören? Eine unkonventionelle Entdeckungsreise Kerstin Decker führt uns auf eine ebenso informative wie unterhaltsame Reise ins Reich der Natur- und Kulturgewalt. Sie erklärt die Geburt der europäischen Demokratie aus dem Geist des Windes. Auch, was wir Globalisierung nennen, ist windursprünglich: Gefangen in den Segeln der Schiffe, ließ er uns die Welt umrunden. Vom ersten Segel geht es über die Erfindung der Windmühlen bis hin zu Windrädern, hoch wie der Berliner Fernsehturm und fliegenden Windturbinen. Die Rückkehr der Segelwagen, der Segel-Frachtschiffe und Luftschiffe steht kurz bevor. Dieses Buch segelt mit allen Winden. Eine besondere Kulturgeschichte – charmant erzählt und inspiriert illustriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung:
Covermotiv:
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Woher der Wind weht
1 Urkommunist Wind
Ein Misslaut
Am Äquator
Sieben Namen für den Wind
Die Hadley-Zelle
Die Dschinn und der Südwind
Von allen guten Geistern verlassen
2 Wer den Wind erntet I
Die Faulheit als Erfinder
50 Mühlen gegen einen See
Great American Plains statt Great American Desert
Die erste Windkraftanlage der Welt
Gefangen im Packeis – aber gut beleuchtet
3 Atmen lernen
20 000 Mal oder Der Orkan aus der Nase
Ruach, der göttliche Hauch
Dichterin und Schmetterling
Die Windrichtung der Seele
Haben Frauen eine Seele?
Der Wind als Stifter der menschlichen Kultur
4 Das erste Segel, Sonnen- und Windgötter
Segeln lernen
500 Tonnen
Amun, Quetzalcoatl-Ehecatl, Njörd, Odin, Jahwe
Segeln oder rudern?
5 Der Westwind – meteorologisch und kulturell betrachtet
»A popular treatise on the winds«
Am Nordpol
Der Jetstream I
Die erste Interkontinental-Waffe 風船爆弾, die Windschiff-Bombe
Arktische Kälte in Berlin und die Flut im Ahrtal
Höhenwind und das Beinahe-Ende der Menschheit
Vom Tempelhofer Feld in die Stratosphäre!
Westwindzone und bürgerliche Gesellschaft
6 Wer den Wind erntet II
Eine Windturbine an der Avus, 430 Meter hoch, fünf Räder
Windkraft für Wehrbauern?
7 Globalisierung, windursprünglich
Segeln statt Rudern
Fünf Nussschalen und eine schwimmende Stadt
Wie teilt man die Welt?
Sklavenhändler Wind
Die Kalmen oder Wer hat den Oberbefehl?
Sturm in der schönsten Bucht der Welt
Meuterei in Patagonien
Der Paso
Am Strand von Fatu Hiva oder Kon Tiki
8 Der Nordwind, die Engel und der Pesthauch
Der Gründungswind der europäischen Demokratie
»Eine heftige Bora« oder Duineser Elegien
Wie fliegen die Engel?
Aer Corruptus – Die Pest in Europa
Der gute Nordwind
9 Heiße Luft unter Röcken oder Die Erfindung der Luftfahrt
Heiße Luft unter Röcken
Wasserstoff! Die Charlière
Hahn im Korb
Verbrecher als erste Menschen im Himmel?
Sonnenuntergang. Zwei Mal an einem Tag
Ballons über Daressalam
Der Dümmste aller Süddeutschen
Ei im Wind
Die Fortbewegungsweise der Luftschiffe
Delfine am Himmel
10 Wer den Wind erntet III oder Der deutsche Staat und eine kleine dänische Aussteigerkommune bauen das größte Windrad der Welt
Growian – das größte Windrad der Welt
Noch einmal das größte Windrad der Welt: Tvind
11 Ein windiger Typ
Blatt im Wind
Fortuna
Resilienz. Die Windstille der Seele
Den Sturm umleiten: Risikomanagement
Vom Winde verweht oder Wind of Change?
Die Verwehbaren
12 Blowin’ in the wind
Die im Himmel wohnen – von Albatrossen und Mauerseglern
Der Ekranoplan
Nach Süden? Nicht ohne Mitfluggelegenheit!
Wanderfalken in Manhattan
Spinnen besuchen die Stratosphäre
Nachrichtendienst Wind
Der Beginn des 20. Jahrhunderts und der Feuersturm
Landwirt Wind
13 Sturm und die größte Flaute der Weltliteratur
Rungholt
Sturm und Stille
Von New York nach Kalifornien? Immer außen rum
Die Rückkehr der Segelschiffe
14 Wer den Wind erntet IV
Das HBX300
Der Windleib oder die freie Sprache
Bildnachweis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Woher der Wind weht
… mit kleinen Wellen an jedem
Blattrand (wie eines Windes Lächeln)
Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien
Morgens aus dem Haus treten, und der Ozean liegt dem Tagesanfänger zu Füßen. Nein, falsches Bild, der Ozean liegt nicht, hier liegt er fast nie – nur opportunistische Gewässer wie das Mittelmeer flegeln friedfertig in der Sonne. Der Alltag des Ozeans ist der weißgeschäumte Aufstand, und die Azoren sind nichts als neun Blumentöpfe in seiner Mitte, schon fast auf halbem Weg nach Amerika. Neun windumtoste Stecknadeln im Wasserhaufen. Wer nicht aufpasst, dem weht noch vor Erreichen des Gartentors ein Morgengruß aus weißer Gischt ins Gesicht. Eine Welt aus Wind.
Die Straßenbäume auf dem Weg nach Horta ignorieren die stürmischen Güsse, so gut sie können. Die Obstbäume im Garten experimentieren mit der Fruchtart Salzzitrone. Bleibt bloß eine Frage: Wo ist das Hoch, das sprichwörtliche Azoren-Hoch?
Denn eigentlich bin ich der Theorie wegen da. Wo ließe sich besser ein Buch über den Wind beginnen als hier? Über den Azoren das im Augenblick unauffindbare Azoren-Hoch, über Island das typische Island-Tief, und je stärker beide sind, desto windiger wird es auf dem Atlantik Richtung Europa, und ein kleines Tief nach dem anderen fliegt dorthin. So wird unser Wetter gemacht, normalerweise. Man nennt das auch »nordatlantische Oszillation«.
Aber ohne das Hoch? Es ist wohl weiter oben, sagen die Leute von Faial, oder: Es hält sich meist etwas weiter südlich auf. Und da etwas weiter südlich nichts ist, nichts als Wasser, heißt es das »Azoren-Hoch«. Ich schließe mich vorerst ihrer Auffassung an, gewöhnliche Hochdruckgebiete sind mehr etwas für Pauschaltouristen. Den Rest klären wir später.
Aber eines gibt schon jetzt zu denken: Auf den Azoren wächst fast alles, was irgendwo auf der Welt Wurzeln schlagen kann. Das örtliche Hauptkriterium der Auswahl jedoch lautet nicht: Wer trägt die schönsten Früchte ?, sondern: Wer bietet den besten Windschutz? Viele Gewächse haben aufgrund dieser Qualifikation schon eine ständige Aufenthaltserlaubnis erworben, unangefochtener Favorit ist die Kamelie, die Dekadenz-Blume der europäischen Lungenkranken des 19. Jahrhunderts. Als Windshield-Hecke!
Da hätte ich auch gleich nach Adélieland fahren können, das liegt in der Antarktis und ist der zugigste Ort auf Erden. Hier herrscht immer Wind, durchschnittlich weht er mit 80 Kilometern pro Stunde. Und Wellington in Neuseeland, auch Windy Wellington genannt, ist die bestgelüftete Stadt der Welt, an 173 Tagen weht der Wind mit über 59 Stundenkilometern, oft schafft er mehr. Auf dem Brocken, dem windigsten Ort Deutschlands, wurden schon 263 Stundenkilometer gemessen: am 24. November 1984.
Am Anfang war das Wort? Oder doch die Tat? Dieses Buch behauptet: Am Anfang war der Wind!
Wir können uns weigern zu essen und zu trinken, aber wir können uns nicht weigern zu atmen. Auch Atem ist Wind, er ist der belebende Hauch. Um ihn zu prüfen, hat man Todkranken früher manchmal ein Blatt vor das Gesicht gehalten: Ist noch Leben in ihm? War das Blatt schon der erste Windfänger, das erste Segel? Und wer erfand die Windmühle? In ihr steckte schon fast das ganze Windrad. Bis auf den Generator natürlich.
Luft. Wir können sie nicht sehen, nicht riechen, nicht greifen. Ein Nichts also ist unser Lebenselixier? Das Nichts, souffliert die Logik, wiegt auch nichts. Die alltägliche Wahrnehmung stimmt zu. Aber wer je in einem Orkan stand, weiß, wie sehr sie trügt. Pro Quadratmeter lastet die Luft mit dem Gewicht von zwei großen Elefanten auf dem Erdboden. Wind ist, wenn die Elefanten zu laufen beginnen, die zwei von dem einen Quadratmeter und die von den übrigen gleich mit. Was für eine Herde! Wind ist bewegte Luft, vom Atemhauch bis zum Tropensturm.
Die Luft ist die letzte Allmende, das Einzige, was noch allen gehört. Den Wind in den Bäumen zu hören ist für manche ein anderes Wort für Glück. Glück ist Da-Sein. Und woher rührt andererseits der tiefste Schrecken, das ganz und gar Unannehmbare bei dem Gedanken, einmal nicht mehr zu sein? Ist es nur, weil die Welt unvollständig wäre ohne mich? So verschieden wie die Menschen sind wohl ihre Antworten. Aber fast immer werden sie ins scheinbar Nebensächlichste und doch Elementare zielen: nie mehr den Wind im Gesicht spüren.
Nach einer langen Geschichte wird der Mensch seine Sache buchstäblich wieder auf den Wind stellen. Um des zweiten Lebensatems willen, der Energie. Es ist nicht das Windrad allein. Auch das Luftschiff kehrt zurück, das Segelschiff gar.
Doch »Auf den Wind stellen« ist schon wieder das ganz falsche Bild. Der Wind hat kein Gegenüber. Vielleicht darum sagen wir: »Frei wie der Wind.« So schnell, wie er umschlägt, wechseln auch hier die Perspektiven. Dieses Buch segelt mit allen Winden.
1 Urkommunist Wind
Ein Misslaut
Wer erinnert sich nicht an den Beginn des Western Spiel mir das Lied vom Tod? Ein paar Männer warten auf den Zug. Jeder kennt das, Warten ist leere Zeit. Und nun anderen dabei zuschauen? Doch nie war das Warten von so zerreißender Spannung. Es geschieht nichts, rein gar nichts. Nur der Wind weht. Der Wind ist der eigentliche Regisseur dieses furiosen Beginns, er ist der Meister des Suspense. Eine Haarsträhne, kurz von einer Minimalböe emporgehoben und gleich wieder abgelegt, ein unmerklich geblähter Mantel: Das, nichts anderes, ist Action! Und in diese kolossale Bahnhofs-Warte-Stille dringt der monoton wiederkehrende Misslaut des sich drehenden Windrads. Wer könnte es je wieder vergessen?
Das war eine Westernmill. Westernmills besaßen bald statt Holzflügeln Metallbleche, daher die fatalen Dissonanzen. Und da ist noch etwas: Ein Enthusiast kleidete seine einzige Kritik an dem Avantgarde-Windrad seiner Zeit in die zartfühlenden Worte, dass »selbst unter sorgfältigster Pflege« alsbald »ein mehr oder minder bedeutendes Spielen in den Scharnieren«[1] zu beklagen sei. Das war der große Nachteil des großen Vorteils beweglich gelagerter Flügel. Verantwortlich für den Soundtrack von Spiel mir das Lied vom Tod waren demnach Ennio Morricone und ein Windrad.
Bei dem Wort Windmühle denken wir gewöhnlich an gemahlenes Getreide, aber so, wie es aussah am Set von Sergio Leone, war klar: Hier wächst nichts. Eine Welt aus Staub. Umso wichtiger war die Mühle, denn Westernmills förderten meist Wasser, sie waren Windpumpen, keine Windmühlen. Und den größten Durst hier hatte die Eisenbahn. Keine Dampflok ohne Dampf, darum stand das Rad auch gleich neben dem Gleis.
Dem Wind ist es egal, ob man mit seiner Kraft Getreide mahlt, Wasser fördert, Sägewerke betreibt oder Stoffe walkt. Die Windmühle – das Windrad – war die erste Kraftmaschine der Menschheit.
Am Äquator
Der Wind ist Kommunist. Wer das begriffen hat, weiß schon fast alles. Der Wind hasst ungleiche Verteilungsverhältnisse, nur darum weht er. Er will, dass überall gleich viel ist, also gleich viel Luftdruck. Ist das geschafft, herrscht vollkommene Windstille. Friede im Äther.
Würde die Erde sich nicht bewegen, gäbe es auf der Nordhalbkugel nur Südwind, auf der Südhalbkugel nur Nordwind: vom Äquator zu den Polen.
Am Äquator scheint die Sonne am stärksten, die Moleküle der Luft beginnen zu tanzen und lassen bald luxuriöse Ich-Du-Abstände frei, statt frierend aneinanderzuhocken – man könnte auch von einer spezifischen Leichtigkeit des In-der-Luft-Seins sprechen. Und so fliegt die ganze Sache bald auf: Die warme Luft strömt nach oben, immer höher, gewöhnlich einige Zentimeter pro Sekunde. Aber die Heizung der Luft ist nicht direkt die Sonne, sondern der erwärmte Boden, darum kühlt sie wieder ab, je höher sie steigt. In etwa 18 Kilometern Höhe – wir befinden uns nun schon in der Tropopause – ist bei nun recht hohem Druck ein Grenzwert erreicht, sodass sie beginnt, allmählich seitlich gen Norden und Süden abzufließen, wenn dies das richtige Wort sein sollte. Denn was da fließt, ist nichts anderes als Wind.
Wir unterstellen dem Wind gemeinhin eine gewisse Orientierungslosigkeit, einen durch und durch windigen Charakter, aber das ist falsch. Der Wind weiß genau, wohin er will, dorthin, wohin gewöhnliche Menschen nie wollen: zum Pol. Immer zum Pol.
Doch solche Geradlinigkeiten gelingen nicht einmal Winden, was noch zu erklären ist. Trotzdem, ohne störende Einflüsse hätten wir, es sei wiederholt, auf der Nordhalbkugel nur Südwind und auf der Südhalbkugel nur Nordwind.
Sieben Namen für den Wind
Vor ein paar Jahren verbrachte ich den Sommer in der Wohnung eines italienischen Mathematikprofessors in Venedig. An einer Wand hing, so groß wie diese, ein riesiger Kupferstich der Stadt von 1530. Mag sein, den Professor hat die sagenhafte Präzision des Stichs fasziniert und dass man in dieser unwahrscheinlichsten der Städte noch immer fast alles genau an der Stelle wiederfindet, an der es damals inventarisiert wurde. Und doch war Venedig keineswegs die Hauptsache. Die Hauptsache waren die Winde. Sie kamen aus allen Bildecken und von allen Seiten: Obgleich wie vor dem Angesicht der Ewigkeit erbaut, war diese Stadt also verwehbar, nichts als ein Blatt im Wind.
Dickbackige Engelsgesichter bliesen aus Leibeskräften. Von oben rechts, aus Nordosten blies die bora, von der Lagune die salsa. Aus Südwesten kam der garbin. Der Garbin, da kann man sagen, was man will, ist ein überaus charmanter Wind, das wusste schon der heilige Bernardino von Siena. 1427 fragte er einen Bischof: »Wart Ihr je in Venedig? Manchmal erhebt sich des Abends ein leichter Wind, der über die Oberfläche der Wellen hinwegstreicht und dabei einen Klang macht, den man die Stimme des Wassers nennt.« Und Bernardino von Siena vermutete, es handle sich näherhin um den Atem Gottes.
Der berühmteste Wind Venedigs aber kommt nicht aus Südwesten, sondern aus Südosten: der scirocco, und er ist eher kein Atem Gottes.
Die Germanisten mögen etwas anderes sagen, aber in Thomas Manns Tod in Venedig geht es eigentlich nur darum, woher der Wind weht. Gustav von Aschenbach wäre der Tod in Venedig erspart geblieben, hätte er den Vorsatz vom Tag seiner Ankunft befolgt: »… wenn der Wind nicht umschlug, war seines Bleibens hier nicht.« Dabei war Thomas Mann der Unterschied zwischen dem scirocco di levante und dem scirocco di ponente und dem scirochetto gewiss nur ungenügend bewusst. Doch schon in den Zeiten der Pest hatte der Scirocco keinen besseren Ruf, ganz im Gegensatz zur bora. Wer die Pest überleben wollte, musste ein Nordfenster besitzen und niemand anderen hereinlassen als die klare, kühlende bora.
Hält man die Hand in den Luftzug, der über die Lagune von Venedig streicht, und murmelt in Gegenwart Einheimischer etwas von »bora« oder »scirocco di ponente«, kann ein plötzliches Leuchten in ihren Gesichtern erscheinen. Endlich einmal kein Tourist!
Vielleicht kann man den Grad der Kultiviertheit eines Volkes daran ablesen, wie viele Namen es für Wind hat. Die Deutschen kennen gewöhnlich nur Nord-, West-, Süd- und Ostwind, es ist ein sehr barbarisches Volk. Es hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, diesen vieren Namen zu geben, geschweige denn ihren Geschwistern. Wenn sie einen Nordostwind meinen, sagen sie »Nordnordost«.
Nur für einen Wind haben sie einen Namen, es ist ein Südwind: Föhn. Obwohl auch das kein wirklicher Name ist, schon gar kein eigener. Föhn kommt wohl von favonius, bei den Römern war das ein lauer Westwind. Entscheidend ist, dass dieser Wind, wenn er von der Lee-Seite eines Gebirges herabweht, zugleich trockener und wärmer wird. Lee ist ein Elementarbegriff der Windsprache, er meint die windabgewandte Seite. Und kaum Schwebstoffe sind in der Luft.
Föhn herrscht also, wenn München aussieht, als läge es direkt vor den Alpen. Was für eine Fernsicht! Wenn die Luft in Basel aber mitten am Tag magisch orange scheint wie von surrealen Schleiern verhangen und auf den Autodächern manchmal schon im März statt Schnee ein feiner Sand liegt, dann ist das garantiert kein Föhn, sondern der Scirocco. Original Sahara-Sand, ein Gruß aus der Wüste. Wie aber kommt die Sahara nach Basel?
Die Hadley-Zelle
Und wieso weht der Wind in Basel überhaupt aus der Sahara? Müsste er nicht direkt vom Äquator kommen?
Im Prinzip schon, nur wird das nie was. Und gewöhnlich schafft es ein Wüstenwind ohnehin nicht bis nach Basel. Das wusste auch ein junger Mann, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Vereinigten Königreich Rechtsanwalt wurde und sich für nichts so sehr interessierte wie für die Frage, woher, wie weit und wie lange der Wind weht. Dass alle Winde auf der Nordhalbkugel nach Norden wollen, ist begründbar, aber warum wehen sie dann auch nach Süden? Und das, soweit es die Passatwinde betrifft, sogar recht zuverlässig. Schon Kolumbus wusste das, aber begründen konnte es keiner.
Auf solch windige Fragen ließ sich schon damals keine Existenz gründen – anders als auf unverwehbare Paragrafen. Das Leben des Rechtsanwalts George Hadley begann noch einmal neu, als er am 20. Februar 1735 zum Fellow der Royal Society gewählt wurde. Schon zwei Monate später veröffentlichte er in den Philosophical Transactions of the Royal Society die Untersuchung Concerning the cause of the general trade winds. Fünf revolutionäre Seiten.
Es war eine Theorie der Passatwinde, das Modell eines geschlossenen Windkreislaufs. Er erklärt in nuce, warum ein Höhenwind vom Äquator einmal wieder heruntermuss. Und zwar nicht erst am Pol, sondern gewöhnlich schon bei 30 Grad nördlicher und südlicher Breite. Da ist Basel noch fern.
Hadleys Schrift blieb lange recht unbeachtet, Zweit- und Drittentdecker traten auf den Plan, bis ein Drittentdecker wiederum den Erstentdecker entdeckte. Heute trägt der geschlossene Windkreislauf zwischen Äquator und subtropischem Gebiet Hadleys Namen. Die besondere Pointe seiner Theorie, die erklärt, warum reine Südwinde so selten sind, sparen wir an dieser Stelle noch aus.
Wer sich unter »Zelle« etwas besonders Kleines vorstellt, sollte an dieser Stelle umdenken und sich etwas besonders Großes, nämlich ein erdumspannendes Luftgebilde vor Augen führen. Und dies ist die Hadley-Zelle, statt am Nordpol also mitten in der Sahara endend.
Die gen Norden ziehende Höhenluft vom Äquator kühlt sich allmählich ab und verliert bei zunehmender Dichte auch an Höhe. Unterwegs bildet sich ob der, sagen wir, gestapelten Luftmassen der subtropische Hochdruckgürtel, und doch geht es nun mit dem Druckgefälle immer weiter abwärts, sodass der einstige Höhenwind schließlich recht bodennah als Monsun zurückfließt in die äquatoriale Tiefdruckrinne. Die bildet sich – erdumspannend – in der Ausgangsszenerie: Unter dem unaufhörlich aufsteigenden Äquatorial-Pneuma entsteht eine Luft-Lücke, die die einstigen Höhenwinde, nun bodennah als Monsun zurückkehrend, umgehend füllen.
Das ist die Hälfte des Wegs. Damit haben wir noch nicht erklärt, wie es der Südwind von der Sahara bis nach Basel schafft oder im Spätherbst 2022 sogar bis Berlin. Da haben wir die Hadley-Zelle endgültig verlassen und befinden uns bereits in der Ferrel-Zelle. William Ferrel war ein Junge von der amerikanischen Ostküste, der den amerikanischen Traum im 19. Jahrhundert auf seine Weise verwirklicht hat: vom Tellerwäscher, nein, vom armen Farmersjungen zum größten Meteorologen der damaligen Welt.
In der Ferrel-Zelle herrscht meist Westwind. Ohnehin hält man den Westwind für den Primärwind der Erde. Er weht aus dieser Richtung meteorologisch, kulturell, zivilisationsgeschichtlich und ökonomisch gleichermaßen, meist sehr stark und latent unumkehrbar bis in die letzte Ecke der Welt. Schieben wir die Betrachtung dieses anmaßenden Hochbeschleunigungs-Pneumas mitsamt der Ferrel-Zelle also ein wenig auf und bleiben noch beim Südwind und der Sahara.
Die Dschinn und der Südwind
Die Welt ist alles, was vom Wind umweht wird! Also leben wir folgerichtig in ein und derselben? Nein, die globale Windkommune täuscht. Menschen bewohnen sehr verschiedene, ganz unterschiedlich bevölkerte Welten. Gewöhnliche Europäer glauben, ihre nächsten Nachbarn seien wiederum Menschen. Viele Muslime lächeln an dieser Stelle voller Nachsicht: Wir wohnen unter Menschen und Dschinn! Und Letztere kommen uns im Zweifel viel näher. Niemand weiß, wie viele er oder sie gerade im eigenen Haus hat, wem man gerade auf die Füße tritt. Dschinn sind Geister.
Der Prophet Mohammed richtete den Koran keineswegs bloß an Menschen, sondern ausdrücklich an Menschen und Dschinn. Beide mögen sich bessern! Beide können zur Hölle fahren oder aufsteigen ins Himmelreich. Auch für Dschinn gilt dem Islam zufolge die Scharia. Schon möglich, mag der ungeduldige Leser sagen, aber was haben die Dschinn in einem Buch über den Wind verloren?
Nicht wenig, denn Menschen und Dschinn unterscheiden sich nicht zuletzt durch ihre Fortbewegungsweisen. Die einen gehen zu Fuß, die anderen reisen mit allen Winden. Für die einen ist Fortbewegung Mühsal – zumindest, bis sie sich alle nur erdenklichen Hilfsmittel schufen und die vornehmlich sitzende Existenzform auch des Reisens erfanden –, für die anderen war sie seit je eine lustvolle Flugstunde. Schon daraus mag man schließen, wem die ursprünglichen Sympathien des Schöpfers galten. Aber es ist mehr.
Die Dschinn dürfen als die weitaus exklusivere Lebensform gelten, weil der Höchste sie noch vor den Menschen (und nach den Engeln) erschaffen hat. Man nennt das eine präadamitische Lebensform.
Menschen sind bloß aus Lehm gemacht. »Aus trockenem Ton«, sagt der Herr im Bericht seines Propheten, um mit leichtem Hang zum Unguten fortzufahren: und »aus fauligem schwarzem Schlamm« (Koran, 15. Sure, 28). Das Alte Testament wusste davon noch nichts, und so auch nicht das Neue. Aber egal, wie viel Lehm, wie viel übel riechender Schlamm: Die Dschinn schuf der Herr aus Feuer und Wind, genauer, aus dem Glutwind des rauchlosen Feuers. Ihre Hauptfortbewegungsweise ist die Windeseile. Allerdings schätzen sie auch den Müßiggang, diesen letzten Abglanz vom Paradiese her, das heißt für das Volk der Dschinn: Es flegelt in den Winden, zumindest tagsüber, es lässt sich wehen, wobei es dem Südwind den Vorzug gibt. Weshalb die Menschen meist vom Südwind erfahren, was die Geister ihnen zu sagen haben.
Gewöhnlich sind die Dschinn unsichtbar, den Wind sieht schließlich auch niemand, aber wer einen plötzlichen Hauch im Zimmer spürt bei geschlossenen Fenstern, darf vermuten, dass er nicht allein ist.
Nicht jeder hat das Glück wie Aladin, einen Dschinn in wohlverschlossener Flasche zu finden. Da weiß man immer, wo er ist. Und dazu noch einen gutmütigen, hilfreichen Dschinn! Die sind relativ selten. Das Verhältnis von Menschen und Dschinn muss von alters her als angespannt gelten. Allein die Tatsache, dass der Herr es für nötig hielt, nach den Dschinn noch einmal ans Schöpfungswerk zu gehen und einen Nachfolger zu schaffen, kommt der tiefsten Kränkung ihrer feurigen Windseele gleich. Der Sure 2,30 des Koran zufolge teilte Gott seinen neuen kreativen Plan zuerst den Engeln mit, worauf eine ganze Armee von Engeln unter dem Oberbefehl von Iblis die Dschinn von der Erdoberfläche vertrieb, um Platz zu machen für ihre Nachfolger, die Menschen. Die Dschinn sind also ein Volk von Vertriebenen.
Das sind schwierige Voraussetzungen für gutes Einvernehmen. Trotzdem soll es immer wieder Ehen zwischen Menschen und Dschinn geben und gegeben haben, auch glückliche, für orthodoxe Muslime ist das gar keine Frage.
Unter diesen Umständen ist es sehr begreiflich, dass sich die Dschinn schon immer dafür interessiert haben, was die Engel sagen, denn alle schlechten Nachrichten von oben empfangen diese zuerst. So war die Bestürzung groß, als die feurigen Windseelen irgendwann – zu Zeiten des Propheten – feststellten, dass sie die Stimmen der Engel nicht mehr hören konnten. Und die vornehme präadamitische Existenzform der Dschinn zögerte nicht, eine Abordnung auszusenden, die sich dem Erdling Mohammed ratsuchend näherte – Sure 72 – mit folgender Frage: Was tun bei dieser plötzlichen Taubheit?
Mohammed las nach Art vieler Autoren gerade mit Genuss in dem Buch, das er selbst geschrieben hatte, und wies ihnen den Weg zum neuen auditiven Erlebnis. Auch sie seien berufene Diener Gottes, und je genauer sie das verstünden, desto besser würden sie wieder hören! So konvertierten die Dschinn zum Islam, aber nicht alle erfolgreich, weshalb die ungläubigen in die Hölle kommen.
Die Dschinn haben auch viel mehr Möglichkeiten als Menschen, unbemerkt großen Schaden anzurichten, und das liegt wiederum an ihrer autogenen Windnatur. Sie fahren, wenn man nicht gut aufpasst, unbemerkt in die Körper der Menschen und errichten dort ihr eigenes Regiment. Man sagt dann, der Betroffene sei besessen oder einfach nur depressiv.
Von der Unsichtbarkeit des Nächsten, und sei dieser ein Geist, auf seine Nichtanwesenheit zu schließen, scheint allen ursprünglicheren Mentalitäten im höchsten Maße fahrlässig. Eher glauben sie das Gegenteil. Aber die Dschinn, die Windgeister, sind nicht immer da. Sie wohnen nicht in den Lüften, auch nicht in den Leibern der Menschen. Als ein Volk von Vertriebenen durch Engelshand bevorzugen sie zur nächtlichen Ruhe Orte, wo die Menschen nicht hinkommen, das kann allerdings bereits ein nächtlich verlassener Hamam sein. Meist handelt es sich jedoch um noch entlegenere Plätze. Auf dem Meeresgrund soll es ganze Dschinn-Staaten geben.
Oder in Wüsten und auf Bergkuppen. Das Volk der Tuareg in der Sahara weiß Näheres über die Umstände einer Wohnungsnahme der Dschinn: Die obdachlosen Windseelen erklärten einem mächtigen Berggott in ihrer Nähe, dass der Südwind sein scheinbar felsenfestes Gebirge abtragen würde, sollte er ihnen das Wohnrecht verweigern. Nach dem Einzug der Geisterschar – Dschinn haben Familien wie die Menschen – umgaben diese ihre neue Heimstatt mit einem Wolkenturban, und der Südwind mitsamt seiner Staublast durfte ihn fortan nicht mehr anfliegen.
Von allen guten Geistern verlassen
Wir erzählen das alles, um das den Menschen einst Nächstliegende zu vergegenwärtigen, das uns das Fernstliegende geworden ist: Auch der Wind war einmal bewohnt. Geister aller Art – die meisten Luftwesen per se – reisen vorzugsweise im Wind. Und es ist noch nicht lange her, da sahen auch Nordeuropäer zur Zeit der Herbststürme Wotan in wilder Jagd über den Himmel reiten, ihm folgend das Heer der Verstorbenen.
Obwohl wir uns auf einem dramatisch übervölkerten Stern[2] befinden, leben zumindest die modernen Europäer doch in einer entvölkerten Welt, was sie gewöhnlich keineswegs bemerken: Die meisten unserer einstigen Begleiter haben uns verlassen. Götter, Engel und Teufel. Und zuvor schon die Geister, die immer um uns waren.
Am 8. November 392 wurden in Rom alle heidnischen Kulte unter Androhung der Todesstrafe verboten. Im Grunde war nun auch die Verehrung der Laren und Penaten untersagt. Laren und Penaten waren die römischen Hausgeister, denen jetzt keine Opfer mehr gebracht werden sollten, was natürlich schwer zu kontrollieren war. Und doch verwaisten sie fortan still in ihren eigenen Häusern, genau wie die Menschen, wenn auch erst die Nachfolger mit dem Verbot des Kaisers Theodosius I. vollends Ernst machten.
Man muss es wohl so sagen: Der Einzug des Christentums kam einer häuslichen Klimakatastrophe gleich. An den Wegkreuzungen grüßte irgendwann keiner mehr den Genius des Ortes, bat niemand mehr um Sicherheit auf der Reise. Und an den Brunnen blieb der Dank aus für den entnommenen Krug Wasser. Man sieht, nicht zuletzt die Elementargeister stifteten das Band des Menschen zur Natur, das fortan zerriss. Derart übersehen, blieb den Hausgeistern, den Wassergeistern und ihren Gefährten irgendwann nur, ihre Existenz einzustellen: Wer übersehen wird, den gibt es nicht mehr, das gilt für Geister wie für Menschen.
Man hat den Untergang des Römischen Reiches zu Recht aus einem ganzen Geflecht von Ursachen erklärt und auch nie den vertrauten griechisch-römischen Götterhimmel vergessen, der im Namen des neuen christlichen Herrn auch in Westrom von einem Tag auf den nächsten eingerollt wurde. Aber Götter sind gewöhnlich Gestalten der Ferne, nur dem christlichen ist es gelungen, sich als fernster zugleich den Ruf von jedermanns Nächstem zu erwerben, der eigentlich nie wegschaut. Hat man je daran gedacht, dass das tausendjährige Römische Reich nicht zuletzt am Entzug des Lebensatems der elementarsten, weil alltäglichsten Sphäre zugrunde gegangen ist, an der Demoralisierung der Menschen und Geister?
Symbolische Mitte des Römischen Reichs, der Stadt wie jedes einzelnen Hauses, war das Herdfeuer, so wie sich die Menschen seit Anbeginn der Zeiten um die gemeinschaftsstiftende Glut in ihrer Mitte versammelt hatten. Das Herdfeuer des Reichs im Vesta-Tempel in der Mitte Roms wurde von den Vestalinnen gehütet, immerhin brannte es auch noch nach dem 8. November 392. Doch nur zwei Jahre später, nach der gescheiterten konservativen Revolution des weströmischen Kaisers Flavius Eugenius, gab das siegreiche Ostrom den Befehl, auch dieses Feuer zu löschen. Es muss den alten Römern wie vorsätzliche Selbstlöschung erschienen sein, wie ein symbolischer Tod zu Lebzeiten, keine hundert Jahre vor dem wirklichen Ende, das kaum einer mehr bemerkte.
Geister bevorzugen die pneumatische Fortbewegung, aber die Hausgeister, Laren und Penaten, bleiben schon ihrer Zuständigkeit halber lieber zu Hause: Sie mögen keinen Wind. Denn ein Haus, durch das der Wind weht, ist kein Haus mehr, es ist auf dem besten Weg zur Ruine. Ein Haus ist das, worum der Wind weht, nicht das, in dem der Wind weht. Wir pflegen die Windstille im Haus gewöhnlich nicht zu bemerken, quittieren ihre unvermittelte Abwesenheit höchstens mit einem vorwurfsvollen »Es ziiiehiiiet!«, aber wir haben dennoch einen Namen dafür: häuslicher Friede. Der lässt sich auch pneumatologisch fassen. Ein Haus ist geteilter Atemraum. Zu seiner Gemeinschaft gehören die, die die gleiche Luft miteinander teilen.
2 Wer den Wind erntet I
Die Faulheit als Erfinder
Der Genius der meisten Erfindungen der Menschheit ist die Faulheit. Und der Wind war ihr erster großer Komplize. Ein Freund des amerikanischen Maschinenschlossers Daniel Halladay reparierte Mitte des 19. Jahrhunderts Wasserpumpen in Connecticut. Halladay sah es mit großer Nachdenklichkeit. Selber pumpen, muss das sein? Kann das nicht ein anderer machen? Genauso fragten schon die frühen Tibeter vor ihren Gebetsmühlen. Kann die nicht jemand anders drehen?
Den Tibetern gebührt das Privileg, als Erste die autonom arbeitende Gebetshilfe erfunden zu haben, die Windgebetsmühle. Halladay baute ein selbstregulierendes Windrad, um Wasser zu pumpen. 1854 meldete er sein erstes Patent Improved Governor for Windmills an. Das war die Geburt der Westernmill, mitverantwortlich für den Soundtrack zu Spiel mir das Lied vom Tod.
Wie die Tibeter beim Beten, so ließen sich auch die frühen Perser und Chinesen gern helfen. Die Perser suchten vor allem Beistand beim Getreidemahlen, die Chinesen wollten wie Daniel Halladay Wasser pumpen. Frühe Windmühlen drehten sich allerorten um eine aufrecht stehende Achse. Um sie herum an sternförmigen Gestängen hatten die Chinesen Dschunkensegel gespannt.
Europa wusste von solchen Erleichterungen sehr lange nichts, und auch Rom und die Windmühle wurden nie im selben Atemzug genannt. Das Imperium, sonst offen für technische Neuerungen aller Art, war offenbar nicht interessiert. Auf die Frage »Kann das nicht jemand anders machen?« hatten die alten Großreiche ohnehin schon immer eine vollkommen wind- und wetterunabhängige Antwort: »Unsere Sklaven natürlich.«
Ende der Leseprobe