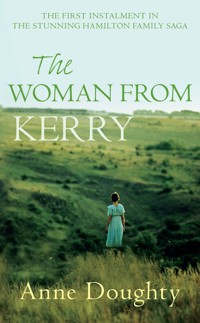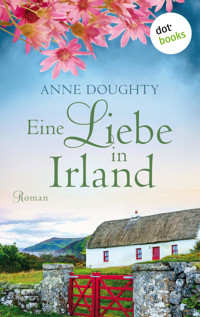
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Liebe schenkt uns Kraft in jeder noch so aussichtslosen Lage: der gefühlvolle Roman »Eine Liebe in Irland« von Anne Doughty als eBook bei dotbooks. Belfast, 1968. Die junge Lehrerin Jenny McKinstry bekommt einen verantwortungsvollen Posten an ihrer Schule angeboten. Doch ihrem Mann Colin und seiner Familie passt das gar nicht – sie wollen Jenny als Hausfrau sehen, die später einmal die Kinder aufzieht, während er als Geschäftsmann Karriere macht. Eine Vorstellung, die der selbstständigen Jenny ganz und gar nicht behagt. Als dann noch Jennys Jugendliebe Alan aus Schottland zurückkehrt, muss sie plötzlich mit diesem verräterischen Flattern in ihrer Brust kämpfen … Muss sie sich den Erwartungen der anderen fügen – oder gibt es doch einen Weg, wie sie ihrem Herzen folgen kann? »Anne Doughty ist eine Meisterin im Schreiben von irischen Historienromanen!« Belfast Telegraph Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Roman »Eine Liebe in Irland« von Anne Doughty. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Belfast, 1968. Die junge Lehrerin Jenny McKinstry bekommt einen verantwortungsvollen Posten an ihrer Schule angeboten. Doch ihrem Mann Colin und seiner Familie passt das gar nicht – sie wollen Jenny als Hausfrau sehen, die später einmal die Kinder aufzieht, während er als Geschäftsmann Karriere macht. Eine Vorstellung, die der selbstständigen Jenny ganz und gar nicht behagt. Als dann noch Jennys Jugendliebe Alan aus Schottland zurückkehrt, muss sie plötzlich mit diesem verräterischen Flattern in ihrer Brust kämpfen … Muss sie sich den Erwartungen der anderen fügen – oder gibt es doch einen Weg, wie sie ihrem Herzen folgen kann?
»Anne Doughty ist eine Meisterin im Schreiben von irischen Historienromanen!« Belfast Telegraph
Über die Autorin:
Anne Doughty wurde in Nordirland geboren und studierte in Belfast. Sie war als Lehrerin tätig, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Ihr Roman »Eine Liebe in Irland« war für den Irish Times Fiction Prize nominiert.
Anne Doughty veröffentlichte bei dotbooks bereits »Das Cottage unter den Sternen«.
***
eBook-Neuausgabe November 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »A Few Late Roses« bei Headline, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Die letzten Rosen dieses Sommers« bei Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Anne Doughty
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Nella und AdobeStock/drimafilm
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-180-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eine Liebe in Irland« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anne Doughty
Eine Liebe in Irland
Roman
Aus dem Englischen von Grace Pampus
dotbooks.
Prolog
OKTOBER 1990
Meine Mutter sprach nie über die Vergangenheit. Für sie war das, was vor langer Zeit geschah, aus und vorbei – Schwamm drüber. Welch ein Irrtum! Man kann die Vergangenheit nicht einfach aus seinem Leben streichen. Sie ist Teil der Gegenwart und der Zukunft. Wer versucht, die Vergangenheit zu ignorieren, wird wie sie: verbittert, enttäuscht, lebt ohne Liebe für sich und die Welt und wirft dunkle Schatten auf seine Umgebung. Auf diese Weise hätte sie fast mein Leben ruiniert.
Noch auf dem Sterbebett konnte sie nicht auf einen letzten verbitterten Auftritt verzichten. Am Morgen nach ihrem Tod erinnerte sich mein Bruder an den versiegelten Umschlag, den sie ihm vor Jahren zur Aufbewahrung gegeben hatte. Er nahm an, es sei eine Abschrift ihres Letzten Willens, Anweisungen, die sie so oft zitiert hatte, daß wir sie schon auswendig kannten. Es war tatsächlich ihr Letzter Wille. Doch es lag ein Dokument bei, mit dem er nicht gerechnet hatte, eine handschriftliche Anweisung in ihrer eigenwilligen, gestochenen Handschrift.
»Jenny, meine Liebe, was in Gottes Namen sollen wir tun? Natürlich habe ich schon alles mit dem Beerdigungsinstitut abgesprochen, so wie sie es wollte. Hat sie jetzt schon wieder meine Pläne über den Haufen geworfen?«
Ich stand im Schlafzimmer und packte gerade meine Sachen. Als ich ihn hörte, wußte ich sofort, daß er tief bewegt war. Seine gleichbleibende, wohlklingende Stimme, die auf die Patienten seiner Belfaster Praxis so beruhigend wirkte, war wie weggeblasen. Seit unserer Kindheit hatte Harvey nicht mehr so verstört geklungen.
»Was sagst du dazu, Schwesterchen?«
Es überraschte mich nicht, daß er für die Beerdigung schon alles arrangiert hatte. Schon seit zwei Jahren war sie bettlägerig und nahezu bewegungsunfähig gewesen. Der Tod hatte schon so oft an ihre Tür geklopft, daß es den Angestellten des Pflegeheims schon peinlich war, uns wieder einmal an ihr Bett zu rufen.
»Was steht denn in dem Schreiben, Harvey?« fragte ich.
»Ich wünsche, bei meiner eigenen Familie im Familiengrab der Hughes auf dem Friedhof in Ballydrennan, Grafschaft Antrim, beigesetzt zu werden und nicht neben meinem verstorbenen Mann auf dem Friedhof der Balmoral Presbyterian Kirche an der Lisburn Road.«
Er las es langsam und deutlich vor, so daß ich mir vorstellen konnte, wie sie es mit verkniffenem Mund und zusammengezogenen Schultern geschrieben hatte. Je ärgerlicher und verbitterter sie war, um so förmlicher wurde ihre Sprache. War sie wirklich schlechter Laune, redete sie wie ein Rechtsanwalt und betonte jedes Wort, um ihrem Willen Nachdruck zu verleihen. Konsequent bis zum bitteren Ende, dachte ich.
»Und da steht auch etwas über Blumen«, fügte er hinzu.
»Oh, was schreibt sie denn?«
»Sie will Blumen. Sie schreibt, daß die Idee, Leute zu bitten, das Geld für die Blumen einem wohltätigen Zweck zu spenden, Unsinn sei. Sie halte es für unangemessen.«
»Das sieht ihr ähnlich, nicht wahr?« Ich lachte nur müde. »Sollen wir ein Kissen aus roten Rosen schicken, Harvey, oder einen großen Kranz mit einer Schleife, auf der ›Mami‹ steht, wie die Brüder Kray, als sie zur Beerdigung ihrer Mutter das Gefängnis verlassen durften?«
Er protestierte, ich nahm mich zusammen.
»Entschuldige, Harvey, ich bin im Augenblick nicht ich selbst. Ich kann noch nicht glauben, daß sie gestorben ist. Sie hätte gesagt, ich sei völlig durch den Wind. Als du angerufen hast, stand ich immer noch mit hängenden Armen da, obwohl ich doch unbedingt packen muß.«
Er lachte beruhigt.
»Du entscheidest, was wir tun, Harvey. Du hast mir auch beigestanden, als Daddy starb«, sagte ich freundlich. »Wenn du sie in der Lisborn Road begraben lassen willst, habe ich nichts dagegen. Es ist allein unsere Angelegenheit.«
»Bist du sicher, Jenny?« Die Erleichterung in seiner Stimme war deutlich zu hören.
Ich sah mich in dem unordentlichen Zimmer um: zwei offene Koffer und stapelweise Unterwäsche, T-Shirts und Blusen. Ich mußte mich setzen, Schweiß stand mir auf der Stirn.
»Nein, nein, Harvey, ich bin nicht sicher«, erwiderte ich weinerlich. »Als ich die Worte ausgesprochen hatte, wußte ich, daß es falsch wäre. Ist das nicht verrückt? Können wir selbst nach ihrem Tod nicht frei entscheiden, was geschehen soll?«
Unter anderen Umständen wäre die Bitte einer Frau vom Lande, bei ihrer Familie begraben zu werden, eine reine Sentimentalität. Aber nicht für meine Mutter. Nach dem Tode ihres Vaters war sie niemals mehr in Ballydrennan gewesen, nicht einmal, um ihre Schwester zu besuchen, die mit ihrer Familie ganz in der Nähe ihres Elternhauses lebte. Außerdem ließ sie zu Lebzeiten nie ein gutes Haar an ihrer Heimat. Nein, es war keine Frage des Gefühls, sondern reine Bosheit.
Mein Vater hat sein ganzes Leben lang versucht, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Als er starb, hinterließ er ihr ein Haus, ein Auto und eine gute Rente. Nun wies sie ihn ein letztes Mal in aller Öffentlichkeit zurück. Aber eine innere Stimme sagte mir, daß wir diesen Wunsch respektieren mußten.
»Harvey, es tut mir leid, ich glaube, wir müssen es tun, auch wenn es keinen ersichtlichen Grund dafür gibt. Ich möchte nicht unaufrichtig sein«, gestand ich. »Ich bin dir leider keine große Hilfe, fürchte ich.«
»Doch, das bist du, Jenny. Ehrlichkeit ist der einzige Weg. Ich habe lange gebraucht, bis ich eingesehen habe, daß du und Mavis recht hattet. Und dafür hin ich euch sehr dankbar«, fügte er mit einem verlegenen Lachen hinzu.
»Es ist das letzte Mal, Harvey«, sagte ich schnell. »Aber es bedeutet mehr Mühe für dich.«
»Mach dir deswegen keine Sorgen, Jenny. Ruf mich an, wenn du weißt, wann dein Flugzeug landet. Ich hole dich in Aldergrove ab.«
Zwei Tage später nahm ich in der überfüllten Küche einem der McBride-Cousins, unseren einzigen noch lebenden Verwandten, ein großes Glas Whisky aus der groben Hand und fragte mich, wie ich das Glas unbemerkt mit Wasser auffüllen könnte. Aber noch bevor ich mich umdrehen konnte, umarmte mich ein großer Mann.
»Ah, meine kleine Cousine.«
Jamsey McBride war schon immer sehr groß gewesen. Wenn er mich als Kind auf seinen Schultern trug, wirkte er mit seiner unglaublichen Kraft und seinem erstaunlichen Sanftmut wie ein großer Bär.
»Jamsey!« rief ich aus. Mein Whiskyglas schwappte über.
»Jenny, wie geht es dir? Mein Gott, seit dem Tod deines armen Vaters habe ich dich nicht mehr gesehen. Friede seiner Asche! Er war der beste, der allerbeste. Das muß jetzt fast zwanzig Jahre hersein. Seit deinem letzten Besuch hat sich hier einiges verändert, zum Guten, aber auch zum Schlechten.«
Seine Augen wurden trüb, und ich schaute auf mein Glas, um ihm Zeit zu geben, sich zu fassen. Jamseys ältester Sohn war in den achtziger Jahren von paramilitärischen Soldaten getötet worden, und er konnte immer noch nicht ohne Trauer darüber sprechen.
»Nun wärme dich mit einem Schluck, meine Kleine«, drängte er mich. »Du hast es bestimmt nötig. Dein Vater sagte immer, daß der Hügel, auf dem die Kirche steht, der kälteste Ort der neun Täler sei.«
Also trank ich gehorsam wie ein Kind meinen Whisky, lauschte dem Klingeln der Eiswürfel in seinem Ulster Scotch und versuchte, meine Tränen zu unterdrücken. Nein, ich empfand keinen Schmerz. Es waren keine Tränen um meine Mutter oder Jamseys Sohn, den ich kaum gekannt hatte. Meine Tränen galten der Welt, die mir einst so vertraut war, den Menschen und Orten meiner Kindheit.
Ich stand in dem großen, modernen Haus, das die niedrige, strohgedeckte Hütte ersetzte, in der meine Tante und mein Onkel ihr gemeinsames Leben begonnen hatten, und trauerte um meine Bindung zu diesem Land und zu dem Teil meiner Familie, der immer noch hier lebte. Für diese Menschen hatte meine Mutter nie Zeit gefunden, Menschen, über deren hartes Leben sie gespottet, deren Erfolge und Mißerfolge sie mit Gleichgültigkeit und Verachtung zur Kenntnis genommen hatte.
Ein rotes Gesicht tauchte vor mir auf und zielte mit einer Flasche Whisky auf mein Glas.
»Nein, Patrick, nein«, protestierte ich lachend. »Wenn ich noch mehr trinke, kann ich in der Kirche nicht mehr stehen, geschweige denn niederknien.«
Er lachte laut, umklammerte meinen Arm und drehte mich um, damit ich die Küche überblicken konnte.
»Jenny, ist das Mädchen, das dort vor dem gutaussehenden, dunkelhaarigen jungen Mann steht, etwa deine Tochter?«
»Ja, das sind Claire und ihr Bruder Stephen«, antwortete ich und nickte. Er zwinkerte mir zu und bahnte sich einen Weg zum nächsten leeren Glas.
Jamsey blickte seinem Bruder nach und schwieg einen Augenblick.
»Mein Gott, Jenny, wir werden alt«, begann er traurig. »Aber deine Tochter ist genauso entschlossen wie ihre Großmutter. Jedenfalls sieht sie so aus«, fügte er schnell hinzu.
»Danke, daß du das noch hinzugefügt hast, Jamsey«, sagte ich lachend. »Meine Mutter konnte sehr hart sein.«
»Nun ja, das mußt du mir nicht erzählen«, murmelte er hastig. »Sicher, jeder weiß, daß sie für unsereins keine Zeit hatte. Dein Daddy war ganz anders. Du bist wie er, Jenny. Weißt du das?«
»Es sind nur die grauen Haare, Jamsey. Wie ich sehe, ist das hier auch schon Mode geworden.«
»Du warst lange weg.« Er lachte und legte mir seine schwere Hand auf die Schulter. »Du hast ja nur ein oder zwei Strähnen auf der Stirn, aber ich habe gar keine Haare mehr. Sag, Jenny, lebst du gern in England? Ist es dir nicht zu hektisch? Ich fahre jedes Jahr zur Smithfield-Show, und der Verkehr wird immer schlimmer. Sie fahren dich einfach über den Haufen, wenn du nicht aufpaßt!«
Nach der Wärme und dem Lärm in der Küche raubte mir die kalte Luft des Oktobertags fast den Atem. Ich zitterte so stark, daß Claire ihren Arm unter meinen schob. »Hol Daddy«, rief sie Stephen zu, als sich die Gruppe auf den kurzen Weg durchs Tal machte. Wenig später gingen wir zusammen den steinigen Pfad zu der großen grauen Kirche hinunter. Unten am Tor parkten überall Autos auf dem Randstreifen der Nebenstraße, als seien ihre Besitzer beim Fischen oder bei einem Fußballspiel.
Hinter den zusammengeballten Wolken, die den ganzen Tag schon mit Regen drohten, kam plötzlich die Sonne zum Vorschein. Die eine Seite des tiefen Tals lag völlig im Schatten, so daß sich die weißen Häuser wie Leuchtfeuer abhoben. Die Kirche erstrahlte im vollen Sonnenschein. Hinter dem flachen Hügel und der kurvenreichen Küstenstraße, auf der am Samstagnachmittag wie immer reger Verkehr herrschte, brachen sich die schaumgekrönten Wellen an der felsigen Küste. Wir folgten dem Sarg in die leere Kirche. Das Sonnenlicht, das durch die hohen, schmucklosen Fenster fiel, zeichnete Muster auf die blassen Wände, deren Farbe an vielen Stellen abblätterte. Wir besetzten die erste Reihe der dunklen Kirchenbänke. Die Sargträger setzten den schweren Eichensarg auf die dafür vorgesehenen Böcke unter der Kanzel, so dicht vor uns, daß ich ihn mit ausgestreckter Hand berühren konnte.
Endlich erschien der Pfarrer und stieg auf die Kanzel. Es wurde totenstill, die Kälte kroch mir in die Knochen. Aber als er die Arme hob und die Gemeinde begrüßte, vergaß ich die naßkalte Luft und die eiskalten Bänke. Er begann seine Predigt mit der Ermahnung, daß wir alle zum Sterben geboren seien. Aber ich hörte seine Worte nicht. Sein starker Akzent, der härter und ganz anders war als Jamseys gedehnter Dialekt, versetzte mich zurück in die Kindheit.
Ich gab mir Mühe, dem Pfarrer auf der Kanzel zuzuhören, aber ich hörte nur Stimmen aus der Vergangenheit, die sich Geschichten erzählten. Tränen verschleierten meinen Blick. Ich wischte sie verstohlen ab, während ich so tat, als müßte ich mir die Nase putzen.
Sie hat mir auch das genommen, dachte ich.
Ich starrte ungläubig auf den hölzernen Sarg. Ja, es stimmte. Soweit ich zurückdenken konnte, hatte sie mich immer davon abzuhalten versucht, meine Verwandten in den anderen Tälern zu besuchen. Wenn mein Vater nicht gewesen wäre, hätte ich nicht einmal gewußt, daß sie existierten.
Ich fröstelte, bemühte mich wieder, der Predigt zuzuhören, und betrachtete die Schnitzereien auf der Kanzel und den abgenutzten Holzdeckel des unbesetzten Harmoniums. Ich tat alles, um mich von dem abzulenken, was sie mir angetan hatte. Am liebsten hätte ich wie ein Kind hemmungslos geweint.
»Brüder und Schwestern, laßt uns beten.«
Ich seufzte vor Erleichterung, als wir demütig unsere Köpfe und Augen senkten, und vergaß niederzuknien, denn ich hatte schon lange nicht mehr an einer presbyterianischen Messe teilgenommen. Claire und Stephen fanden sich zurecht, obwohl ich sie nicht darauf vorbereitet hatte. Ich sah Claire von der Seite an. Ihre grauen Augen unter den dunklen Augenbrauen beobachteten mich, aufmunternd lächelte sie mir zu.
Ich hatte keine Ahnung, wie sie und Stephen die Totenmesse aufnahmen, in der viel Wert auf Reue und Sterblichkeit nach einem kurzen Leben gelegt wurde. Ihre Großmutter hatte meines Wissens nie etwas bereut und starb im reifen Alter von achtundachtzig Jahren.
Wir standen auf, um den Segen zu empfangen, und blieben stehen, als die schwarzgekleideten Männer ihre Last aufhoben, den Eichensarg mit Messinggriffen, den sich Edna Erwin, Verstorbene dieser Gemeinde, laut ihrem Letzten Willen gewünscht hatte.
Während wir in der Kirche der Messe beiwohnten, hatte sich draußen der Wind gelegt. Die kleine Trauergemeinde trat ins Freie und mußte die Augen gegen die Sonne schützen. Die beiden McBrides in ihren dunklen Anzügen und blankgeputzten Schuhen, einige ältere Damen, die von Söhnen oder Enkelsöhnen gestützt wurden, ein paar Mitglieder des presbyterianischen Kirchenrats, diskret in Dunkelblau oder Grau gekleidet, sie alle versammelten sich vor dem Eingang der Kirche und fühlten plötzlich die Wärme der tiefstehenden Sonne.
Auf den kräftigen Schultern der Träger glänzte der Sarg im Sonnenlicht. Der kleine Zug bewegte sich knirschend über den Kies entlang der Südseite der Kirche, marschierte über den grünen Rasen an frischen Gräbern vorbei und trat vorsichtig auf den neu angelegten Pfad, der sich durch die verwilderten Hügel unbekannter Gräber und hohes Gras, in dem immer noch wilde Blumen blühten, schlängelte.
Hier, im ältesten Teil des Friedhofs, an einer Grabstelle, die älter war als die Kirche, warteten wir nun, bis sich alle Trauernden um das offene Grab versammelt hatten. Neben meiner eigenen kleinen Familie standen Harvey und Mavis, ihr Sohn Peter und ihre jüngere Tochter Susie, dahinter die dunklen Gestalten von Jamsey und Patrick McBride mit ihren Frauen Loreta und Norah. Insgesamt vielleicht ein Dutzend Menschen. Die meisten hatte sie nicht geliebt.
Es wurden Reden gehalten, und die erste Schaufel Erde von dem kalkigen Hügel, der hinter dem feuchten Erdloch aufgeschüttet worden war, fiel auf den Eichensarg. Plötzlich füllte sich die Luft mit dem schweren Duft des Herbstes. Die warmen Sonnenstrahlen hatten den zahlreichen Blumengebinden ein süßes, würziges Parfüm entlockt.
Ich stand am offenen Grab, und eine Woge purer Freude erfaßte mich. Freude über den Glanz des Himmels und das Schimmern des Meeres, Freude über mein Wiedersehen mit dem Ort, der mir einst so vertraut war, und Freude über die drei Menschen, die ich über alles liebte und die an meiner Seite standen, um mich zu trösten, so wie ich sie schon oft getröstet hatte.
Dieser Augenblick unerwarteten Wohlbefindens wird mir immer in Erinnerung bleiben. Während die Erde und die kleinen Kieselsteine auf den Sarg fielen und die bekannten Worte »Asche zu Asche, Staub zu Staub« gesprochen wurden, dachte ich an das Glück meines Lebens, an mein Heim, meine Familie, den Erfolg in meiner Arbeit, die Freude, gute Freunde zu haben, und an die zahlreichen Probleme und Schwierigkeiten, die ich bewältigt hatte. Unter der feuchten Erde verschwand allmählich die glänzende Plakette, auf der die Lebensspanne meiner Mutter, »Edna Erwin 1902-1990«, eingraviert war. Ich dachte wieder einmal daran, daß ich diesen Augenblick der Freude wahrscheinlich nicht erlebt hätte, wäre es ihr damals gelungen, ihren Willen durchzusetzen. Die glücklichsten Jahre meines Lebens wären dann unter meiner Vergangenheit verschüttet worden.
Ich stand in der Sonne, die rhythmische Brandung der Wellen und der gebieterische Ruf der Dohlen drangen in mein Bewußtsein. Das Wochenende, das mein Leben verändert hatte, lag fast auf den Tag genau zweiundzwanzig Jahre zurück. Nun war es an der Zeit, einmal darüber nachzudenken, was an diesem Wochenende wirklich passiert war.
Kapitel 1
BELFAST 1968
Die Tür fiel ins Schloß. Als die Schritte der Primaner auf der Holztreppe verhallten, schlug ich die Hände vors Gesicht und seufzte vor Erleichterung. Ich hatte Kopfschmerzen. Dieses rhythmische Pochen, das schlimmer wurde, wenn in Hörweite eine Fliege summte oder zwei Stockwerke höher eine Tür zuschlug, machte mich wahnsinnig. Ich hatte Aspirin in der Handtasche, aber der nächste Wasserhahn befand sich im untersten Stockwerk. Mir meinen Weg die Treppe hinunter durch den Lärm und die überfüllte Garderobe bahnen zu müssen war mehr, als ich ertragen konnte. Ich schrieb eine Bemerkung an den Rand meines Shakespeares und schloß müde das Buch. Ich mochte die historischen Theaterstücke und versuchte im Unterricht immer, sie spannend darzustellen. Aber heute wirkten meine Bemühungen mit Richard III. und seinen politischen Machenschaften flach und schal. Kein Wunder nach der kurzen Nacht. Ich hatte schon früh aufstehen und auch noch völlig unerwartet zur Mittagszeit bei der Direktorin erscheinen müssen. Nach all dem konnte ich wirklich nicht erwarten, in Hochform zu sein, aber ich war dennoch enttäuscht.
Ich dehnte meine schmerzenden Schultern, massierte mir den Nacken und erinnerte mich, daß heute Freitag war. Freitagnachmittags ging es unten immer besonders laut zu, aber der Lärm hörte auch schneller wieder auf als an anderen Tagen. Gleich würde es in den Klassenzimmern wieder still werden, dann könnte ich auch wieder klar denken.
Ich sah mich in dem Zimmer um, in dem ich die meisten meiner Oberprimaner unterrichtete. Einst ein Bedienstetenzimmer des großen Herrschaftshauses aus der Zeit König Eduards, war das kleine Zimmer nun der letzte Aufbewahrungsort für Dinge, die nicht mehr gebraucht wurden. Alte Lehrbücher, Noten für längst vergessene Konzerte, Programme für Schultheaterstücke und alte Prüfungsunterlagen waren in großen Bücherkisten an zwei Wänden gestapelt. In der Ecke, genau gegenüber des einzigen, blinden Fensters, lag ein Haufen nutzloser Gegenstände: ein Globus mit verblichenen, roten Flecken, die das British Empire darstellten; ein ausgebeulter, lederner Koffer mit dem Aufkleber »Drama«; eine Schachtel mit der Aufschrift »Vogeleier«; eine zerbrochene Staffelei und ein Ofenschirm mit einem verblaßten, gestickten Pfau.
Darunter lagen gerahmte und ungerahmte vergilbte Fotos. Vor den Nebengebäuden des Queen's-Crescent-Gymnasiums drängten sich Mädchen mit ihren schweren Schulkitteln in dichten Reihen, daneben furchteinflößende, vollbusige Damen mit Hüten – die Mütter und Großmütter der Mädchen.
Ich wunderte mich wieder einmal, warum Zeugen der Vergangenheit so oft vernachlässigt wurden, unsortiert herumlagen und weder weggeworfen noch gebührend um ihrer Schönheit oder Brauchbarkeit willen gewürdigt wurden. Ich dachte an meine kleine Sammlung alter Fotografien, die irgendwie die rigorosen Aufräumaktionen meiner Mutter überlebt hatten: Oma und Opa Hughes mit Mutter vor der Schmiede; Vater im Overall mit seinem ersten Auto vor der Werkstatt in Ballymena; eine Studioaufnahme meiner Großmutter, Ellen Erwin, im Alter von sechzehn Jahren, mit strahlenden Augen, langen Haaren und sehnsüchtigem Blick. Dieses Bild war mein kostbarster Besitz.
Mein Mann Colin sagte immer, ich wäre sentimental und er fände das sehr liebenswert. Aber ich dachte, daß es überhaupt nichts mit Sentimentalität zu tun hatte. Ich glaubte, daß das Leben, lange bevor man geboren wird, anfängt und daß Menschen, die man vielleicht niemals kennenlernt, die Welt formen und verändern. Sollte ich jemals die Geschichte meines Lebens schreiben, müßte sie weit vor dem Datum meiner Geburtsurkunde beginnen. Das wäre jedoch nicht möglich ohne die Fragmente, die die meisten Menschen unbeachtet lassen oder wegwerfen, wie zum Beispiel die verblaßten Bilder im Queen's-Crescent-Gymnasium.
Als der Geräuschpegel um vier Uhr heftig anstieg und nach dem Höhepunkt um fünf nach vier wieder sank, wurde das Pochen in meinem Kopf ein wenig leiser. Nach ein paar Minuten könnte ich tatsächlich aufstehen und meinen lädierten Verstand sortieren.
Ich starrte durch das staubige Fenster auf das gegenüberliegende Gebäude. In dem Zimmer, das ein Spiegelbild meines Zimmers war, standen Aktenschränke und Regale. Ein junger Mann in Hemdsärmeln beugte sich unter grellem Neonlicht über ein Zeichenbrett. Jedes Fenster des Stockwerks darunter umrahmte ein anderes Bild. Schicke Mädchen saßen auf Designermöbeln in neu eingerichteten Büros mit glänzenden Grünpflanzen. Sie telefonierten, machten Fotokopien, schenkten Kaffee ein und verschwanden mit den Tassen in den vorderen Teil des Gebäudes, in dem ihre Chefs in eleganten Räumen mit Blick auf den breiten Gehweg des nächsten Straßenzuges saßen.
Colin würde wohl schon im Hotel beim Tee sitzen. In der Lobby mit den dicken Teppichen servierten um diese Zeit immer die Kellnerinnen in ihren gestärkten Kleidern Tee in Silberkannen und winzige Sandwiches für die Herren, die ihre Aktentaschen auf die Stühle fallen ließen und sich mit freundlichem Händedruck begrüßten. Jenseits der klimatisierten Räume des bunt beflaggten Hotels stellte ich mir die geschäftigen Straßen Londons vor und den ständigen Verkehr, der ununterbrochen um die grünen Inseln mit dem beruhigenden Gesang der Amseln kreiste.
Daddy war wahrscheinlich im Garten und jätete auf den Rosenbeeten Unkraut, ausdauernd und methodisch, als könnte er den ganzen Tag arbeiten, ohne müde zu werden. Vielleicht sprach er gerade mit der zahmen Amsel, die jede Bewegung seiner schmächtigen Gestalt aufmerksam verfolgte. »Nur Geduld, Jenny«, sagte er immer, wenn er mir zeigte, wie man Unkraut aus der Erde zieht. »Es bringt nichts, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Es braucht alles seine Zeit, nur nichts überstürzen.«
Er hatte natürlich recht, wie immer. Es war kaum zwei Stunden her, daß ich in Miss Braidwoods Arbeitszimmer gerufen wurde. Obwohl ich ein ganzes Wochenende lang überlegen konnte, regte ich mich über das Gespräch so auf, daß ich davon Kopfschmerzen bekam. Ich blickte auf die Uhr und dachte an die vielen Dinge, die ich noch zu erledigen hatte. Aber ich rührte mich noch immer nicht. Meine Gedanken kehrten zu der Besprechung zurück. Ich sah mich wieder im Zimmer um. Hier arbeitete ich, verbrachte meine einsamen Mittagspausen, hier konnte ich nachdenken und träumen. Es spielte keine Rolle, ob mir das kleine Zimmer gefiel, es war mir einfach wichtig, diese Zuflucht zu haben.
Hier oben konnte ich sogar den scharfen Grat der Antrimberge sehen, die sich vor der Stadt erhoben. Die Wohnsiedlungen und Straßen, die sich vom breiten Flachland an der Spitze der Meerzunge den Berg hinaufschlängelten, hoben sich kaum vor diesem Hintergrund ab.
Beim Gedanken an die Berge überfiel mich Sehnsucht. Einfach aus der Stadt hinausfahren! Ich schloß die Augen, vor mir lag die Straße, eingebettet in dicke, sommergrüne Hecken, Butterblumen glänzten in der Sonne. Daddy und ich wollten ältere Verwandte in ihren kleinen Hütten am Meer besuchen und erlaubten uns einen kurzen Abstecher in eines der neun Antrimtäler, deren Namen ich noch heute wie ein Gedicht aufsagen konnte. Der frische Meereswind milderte die Sommerhitze, wir wanderten unter strahlend blauem Himmel durch Wiesen und Moore hinauf zu einem mächtigen Felsmassiv aus Granit.
»Wir sind da, Jenny. Es muß ganz schön schwer gewesen sein, hier oben Schafe zu hüten. Ziemlich zugig im Winter, sogar für einen Heiligen. Was meinst du, wollen wir dort hinauf?«
»O ja, bitte. Von dort oben können wir viel weiter sehen.«
Meine Füße verfingen sich in Farngestrüpp, Schafe blökten traurig, die Sonne brannte mir auf den Schultern, als wir im Zickzack vorbei an verstreuten Felsblöcken nach oben kletterten. Ein Rotdorn, der glaubte, es sei immer noch Hochsommer, blühte und stand schützend an einer Quelle, die aus dem Felsen sprudelte. Wir hielten an und tranken das frische Quellwasser aus der hohlen Hand. Keine Menschenseele weit und breit, und außer unserem parkte kein einziges Auto unten am steinigen Straßenrand. Während wir hinaufkletterten, entfaltete sich fast die ganze Provinz Ulster vor uns. Wir standen im Wind und betrachteten am fernen Horizont die Küste von Schottland und weit im Westen sogar die blauen, etwas verhangenen Berge von Donegal.
»Ist das nicht das Vorgebirge von Kintyre, Daddy?«
»Ja, mein Liebling. Das ist das Vorgebirge von Kintyre«, antwortete er, in Gedanken ebenso weit weg wie die hellen Konturen auf der anderen Seite des schimmernden Meeres.
Nur zögernd stand ich auf. Tagträumen würde Mutter es nennen, und der Ton in ihrer Stimme machte die Schwäche zu einem Verbrechen, wenn sie mich dabei erwischte.
»Jennifer, du mußt jetzt endlich in diese Buchhandlung gehen«, befahl ich mir aufmunternd. Außerdem mußte ich auch noch einkaufen und unbedingt um halb sechs am Rathmore Drive sein.
Die Tür des Lehrerzimmers war nur angelehnt. Dankbar stieß ich sie mit dem Ellbogen weit auf, ließ die Schulhefte auf den nächstbesten Tisch fallen und seufzte erleichtert. Die Bänke an den langen Tischen mit ihren Plastiktischdecken waren leer. Es saß auch niemand am Marmorkamin und studierte den Stundenplan an der verschlissenen grünen Pinnwand über dem Kaminsims. Selbst vor dem Schrank in der Ecke, in dem es ein breites Fach mit der Aufschrift »J. McKinstry – Englisch« gab, stand niemand.
Als das Neonlicht den Raum überflutete, zuckte ich zusammen. Gnadenlos enthüllte es die abgeblätterte Farbe der Schränke und die Staubschicht auf dem Efeumuster des Putzes. Es zeigte auch ein schmutziges Stück Papier, eine Weltkarte, im Nachrichtenfach. Quer über Asien stand in ordentlichen Druckbuchstaben mein Name. Hastig las ich die Notiz:
»Ich würde gern mit Ihnen über Millicent Blackwood sprechen. Würden Sie bitte um 13.00 Uhr in die Bücherei kommen, bevor ich diese Angelegenheit mit Miss Braidwood erörtere, E. Fletcher.«
Schweren Herzens griff ich nach dem Telefon. Nun mußte ich übers Wochenende auch noch über Millie nachdenken, diese arme Kleine. Nun gut. Ich steckte den Zettel in die Handtasche, machte das Licht aus und überließ das Gebäude der Barmherzigkeit der Putzfrauen.
Täglich Brot, dachte ich. Zertretenes Laub, das im Licht der Geschäfte glitzerte, machte den Bürgersteig feucht und glitschig. Ich sah zum düsteren, bewölkten Himmel hinauf. Die Berge waren nicht zu sehen. Ich hätte alles für einen sonnigen Herbstnachmittag gegeben. Dann wieder schienen die Berge zum Greifen nahe hinter der wuchtigen Backsteinmühle und der massigen Tabakfabrik.
Aber heute versteckten sie sich hinter der Wolkenwand, und es blieb nur der Anblick der wenig hübschen Stadt, die, abgesehen von zwei Jahren, bis jetzt immer mein Zuhause war. Vor dreißig Jahren nannte Louis MacNeice sie »eine Stadt auf Schlamm gebaut, eine Kultur auf Profit errichtet«, und seither hatte sich nicht viel verändert.
Ich machte mich auf den Weg zu der kleinen Bäckerei, bei der ich jede Woche einkaufte. Ein angenehmes, einfaches Geschäft, in dem Brot und Kuchen immer noch von hinten durch einen Vorhang bunter Plastikstreifen zur Verkaufstheke gebracht wurden. Seit meinem zweiten Jahr am Queen's-Gymnasium kauften Colin und ich dort regelmäßig Brötchen und Kuchen. Es hatte sich nichts geändert. Sogar Mrs. Green war noch da, plumper, grauer und wortreicher denn je. Sie war stolz darauf, daß sie Colin und mich schon vor unserer Verlobung gekannt hatte. Sie verfolgte unser Leben – Abschlußexamen, Heirat, erster Job in Birmingham und regelmäßige Besuche zu Hause – mit der gleichen Hingabe wie die Fernsehserie Coronation Street. Ich erinnere mich, wie sehr sie das riesige, verschnörkelte Hochzeitsalbum bewunderte, das Mutter ausgesucht hatte. Heute erkundigte sie sich nach Haus und Auto, der Einrichtung des Wohnzimmers, der Gesundheit unserer Eltern und unseren Plänen für die Zukunft.
Ich hatte die Hand schon auf dem Türgriff, drehte mich aber dann plötzlich um und ging schnell davon. »Nein, heute kann ich es nicht ertragen.« Niemand hatte mich gesehen, aber ich war über mein eigenes Verhalten schockiert. »Jenny McKinstry, was ist nur mit dir los?« Ich eilte davon und war dankbar, anonym und unsichtbar in der Masse untertauchen zu können.
Ich wollte heute nicht die Rolle der jungen, verheirateten, berufstätigen Frau spielen, wie Mrs. Green sie sich vorstellte, eine Frau, die die richtigen Dinge im richtigen Ton sagt und auf die richtige Art und Weise auf Andeutungen und Unterstellungen reagiert. Sie war eine warmherzige, freundliche Frau, aber ich konnte diese Seifenblase heute nicht aufrechterhalten. Also ging ich im Supermarkt einkaufen.
»Zeitungen, Miss. Sechste Auflage, Zeitungen!«
Ich stellte Aktentasche und Korb ab und suchte nach Kleingeld. Der Zeitungsjunge trug ein abgewetztes Jackett, das ihm viel zu groß war. Ich legte einige Münzen in seine feuchte ausgestreckte Hand und las die Schlagzeilen, während ich meine Sachen wieder aufhob. Gott sei Dank, sie hatten den Marsch abgesagt! Die Einzelheiten las ich nicht, die Tatsache war genug. Eine Sorge weniger, denn Keith und Siobhan wären sicherlich in Derry mitmarschiert, und jeder wußte, daß Polizei und B-Specials Befehl hatten, allen eine Lektion zu erteilen.
Du bist ein Feigling, Jenny McKinstry, dachte ich und fragte mich gleichzeitig, ob ich wirklich feige war. Hätte ich wie Keith und Siobhan den Mut zu demonstrieren, wenn ich noch Student wäre, oder hätte ich dann die gleiche politische Überzeugung? Oder machte ich nicht mit, weil ich die eine Hälfte eines respektablen jungen Ehepaares war?
Das hatte in ganz kleinen Buchstaben auf der Akte des Bankdirektors gestanden, der mit Colin über den Kredit für das Auto verhandelt hatte, das wir kaufen wollten. Obwohl der Aktendeckel verkehrt auf dem Tisch lag, konnte ich es entziffern. Wir mußten auf dem ganzen Weg zu unserer geliehenen Wohnung, in der unsere weltlichen Güter aufgestapelt auf ihren Bestimmungsort warteten, darüber lachen. Es wurde ein Witz zwischen uns, ein paar Worte, die einen Moment des Glücks und der Freude auf unsere neue Arbeit und unser erstes eigenes Zuhause widerspiegelten.
Bevor ich es merkte, stand ich in der Buchhandlung. Als ich meinen Namen hörte, drehte ich mich um.
»Hallo, Mr. Cummings, du meine Güte, heute ist aber viel los.«
»Ja, das ist wahr«, stimmte er zu und nickte munter. »Hier war es noch nie so voll. Kommen Sie mit in mein Büro.«
Ich folgte der großen, gebeugten Gestalt durch den Gang, in dem überall Bücher gestapelt waren, in eine kleine Kammer, die er stolz sein Büro nannte. Unter dem schrägen Dach war kein Platz für einen Schrank, aber an sämtlichen senkrechten Flächen hingen rosa, gelbe und blaue Klammern mit Bestellzetteln. Er zog zwei Klappstühle unter dem Tisch hervor, der auch über und über mit Zetteln bedeckt war.
»Setzen Sie sich, meine Liebe. Ich glaube, wir haben jetzt alles, was Sie bestellt haben, aber ich überprüfe es noch einmal.«
Er öffnete eine Klammer, blätterte durch den Stapel und nahm ein rosa Blatt Papier heraus. Ich sah es kurz an und atmete auf.
»Wundervoll, Mr. Cummings. Sie haben tatsächlich alles bekommen. Wie haben Sie das nur geschafft? Ich bin Ihnen sehr dankbar, denn ich war schon in Sorge.« Er lächelte und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Sie dürfen Ihr Fach nicht so beliebt machen, Mrs. McKinstry. Denken Sie an die Probleme Ihres armen Buchhändlers, wenn Sie doppelt so viele Studenten in Ihre Klasse aufnehmen.«
Ich mußte lachen. Mr. Cummings war ein alter Freund, und vor Jahren teilten wir die gleiche Leidenschaft für Poesie und junge Dichter aus Ulster, die wir oft persönlich kannten.
»Sie haben sich sehr viel Mühe mit dieser kleinen Bestellung gemacht. Drei Schüler, die als Ritter in Richard III. in dasselbe Textbuch schauen müssen, machen jede Dramatik zunichte!«
Er lachte und deutete auf die prallvollen Klammern, die überall im Zimmer hingen.
»An Bestellungen fehlt es nicht«, sagte er resigniert und traurig. »Sie glauben gar nicht, wieviel Belletristik ich verkaufe. Aber nicht Quantität, sondern Qualität zählt, nicht wahr?«
Ich nickte schweigend. Wenn über sein freundliches Gesicht ein Schatten des Bedauerns zog, dachte ich immer an meinen Vater. Sie waren ungefähr gleichaltrig, aber während mein Vater eher ironisch über sich und sein Leben sprach, erzählte Mr. Cummings traurig von seinen unerfüllten Plänen und daß es nun zu spät sei, auf bessere Tage zu hoffen.
»Noch ein Jahr, Mrs. McKinstry, und die Qualität meines Geschäftes interessiert mich nicht mehr. Immerhin bin ich dann in der Lage, die Bücher zu lesen, für die ich nie Zeit hatte ...«
Ich sah, daß er noch trauriger wurde, und wußte nicht, wie ich ihn trösten konnte.
»... dabei fällt mir ein«, fuhr er schnell fort, »was ich über Miss McFarlane gehört habe. Sie will in Pension gehen? Soviel ich weiß, hat sie doch noch ein paar Jahre zu arbeiten. Ich erinnere mich, daß ich sie immer an die Hand nahm und zur Dorfschule brachte, als ich schon in der Abschlußklasse war. Sie meint das doch nicht ernst, oder?«
»Ich glaube, daß ihre Mutter sehr krank ist«, antwortete ich ausweichend.
Wie immer, wenn ihm etwas sehr nahe ging, zogen sich seine Lippen zusammen.
»Eine wirkliche Persönlichkeit, die alte Mrs. McFarlane«, meinte er barsch. »Sie muß fast neunzig sein.« Aus seinem Ton konnte ich entnehmen, daß das Gerede über Connie im Lehrerzimmer nicht übertrieben war. Obwohl sie schon siebenundfünfzig war, behandelte ihre Mutter sie immer noch wie ein Kind. Sie stand jeden Morgen um halb sieben auf, machte Feuer und versorgte ihre Mutter, bevor sie das Haus verließ. Nach der Schule kaufte sie ein, kümmerte sich um den Haushalt, und an den Wochenenden mußte sie ihrer Mutter vorlesen oder mit ihr einen Ausflug aufs Land machen. Connie sprach nie darüber, obwohl sie sich manchmal entschuldigte, wegen »Mutter« an einer Abendveranstaltung nicht teilnehmen zu können.
»Sie bewundert Sie sehr, Mrs. McKinstry. Ich denke, Sie werden sie sehr vermissen.«
»Oh, natürlich. Seit ich am Queen's Crescent angefangen habe, war sie immer sehr freundlich zu mir.«
»Also ist es doch wahr.« Er nickte und sah fragend über die Ränder seiner Lesebrille. »Kommt vielleicht ein neues Gesicht? Oder vielleicht ein Gesicht, das ich schon sehr gut kenne?«
Ich wurde rot. Trotz seiner förmlichen und konservativen Art, entging ihm nichts.
»Vielleicht, Mr. Cummings«, begann ich verlegen. »Sie haben es erraten. Sie geht, und mir ist die Leitung ihres Ressorts angeboten worden. Miss Braidwood will es so schnell wie möglich bekanntgeben, also muß ich mich am Wochenende entscheiden. Es ist keine leichte Entscheidung.«
Er wirkte so überrascht, daß ich mich fragte, ob er überhaupt wußte, wie junge Paare und Familien heutzutage leben.
»Es ist sicher eine große Verantwortung, aber ich bin überzeugt, daß es sich lohnt«, lenkte er schnell ein, glücklich, sich wieder gefangen zu haben. »Ich nehme an, daß Sie auch im neuen Gebäude alles bekommen, was Sie brauchen.«
Ich nickte und erzählte ihm von den Englisch- und Theaterworkshops, die für das neue Gebäude am Rande der Stadt vorgesehen waren. Er hörte aufmerksam zu. Als ich fertig war, meinte er, ein Ressort könne immer nur so gut sein wie der Leiter, und er wisse, wen Connie dafür vorschlagen würde.
»Ich bin leider nicht mein eigener Herr«, sagte ich verlegen. »Alle reden von Gleichberechtigung und Karrierefrauen. Aber Menschen ändern ihre Einstellung nicht so schnell. Meine Familie lebt ebenso im neunzehnten wie im zwanzigsten Jahrhundert.« Die Schärfe meiner Stimme überraschte mich. Ich korrigierte mich hastig: »Mein Mann ist natürlich sehr verständnisvoll, aber seine Familie ist ziemlich konservativ.«
Plötzlich bemerkte ich, wieviel Zeit vergangen war. Ich stand abrupt auf. Mr. Cummings folgte mir.
»Es ist nicht so einfach, Mrs. McKinstry, ich weiß.« Er gab mir die Hand. »Aber denken Sie daran, Sie haben nur ein Leben. Wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist, kann man auch nicht alles geben.«
Er sah so traurig aus, daß ich trotz des Gedränges vor seiner Bürotür noch einmal stehenblieb.
»Ich spreche eigentlich nicht gern darüber, aber ich habe immer getan, was von mir erwartet wurde. Das hat seinen Preis, und es kann Sie im Leben teuer zu stehen kommen.«
Erst jetzt ließ er meine Hand los.
»Wenn Sie die Stelle übernehmen, muß ich wohl Madam zu Ihnen sagen.« Er wollte zum Abschied noch etwas Nettes sagen.
»Wenn ich annehme, müssen Sie Jenny zu mir sagen«, antwortete ich.
Er brachte mich zum Ausgang. An der Tür legte ich meine Hand auf seinen Arm. »Vielen Dank für Ihren Rat, Mr. Cummings. Sollte ich die Stelle annehmen, brauche ich Freunde. Ich sage Ihnen am Montag Bescheid.«
Ich drehte mich schnell um und blickte nicht zurück, aus Angst, in Tränen auszubrechen.
Es regnete etwas stärker. Das trübe Licht des Nachmittags war der Dämmerung gewichen. In den hohen Nischen des Rathausturms suchten Hunderte von Staren einen Schlafplatz für die Nacht. Aus den Büros strömten die Menschen auf die Straßen und Plätze. Ich bahnte mir einen Weg zur Bushaltestelle und wartete in der langen Schlange auf den Bus nach Stranmillis.
»Jenny!«
Ich war so in Gedanken, daß ich die vertraute Stimme nicht gleich erkannte, und blieb überrascht und verwirrt stehen.
»Keith!« rief ich, als ich den abgetragenen Lodenmantel und das vertraute, vom Ferienjob braungebrannte Gesicht meines Schwagers sah. Er lächelte.
»Ich bin es wirklich. Wie geht es dir?«
»Sehr gut. Wann bist du zurückgekommen?«
»Erst letzte Woche. Der Job war prima, gut bezahlt, deshalb sind wir so lange geblieben, wie wir konnten. Komm, wir trinken schnell einen Kaffee. Colin kommt erst in einer halben Stunde aus dem Büro, nicht wahr? Was gibt es Neues?«
»Wirklich gerne, aber ich kann nicht. Colin ist mit William John in London, und ich muß um halb sechs bei meinen Eltern sein. Ich komme sonst zu spät, und du weißt, was das heißt.«
Er nahm meine Aktentasche, legte den Arm leicht um meine Schultern und führte mich aus der Warteschlange.
»Natürlich weiß ich das. Bella steht um die Ecke an der Parkuhr. Auf der Fahrt können wir miteinander reden.« Ich konnte Keiths langen Schritten kaum folgen. Er war nicht viel größer als Colin, aber ganz anders gebaut. Während Colin blond war wie seine Mutter und sich bewegte, als hätte er genügend Zeit, hatte Keith dunkles Haar und war immer ein wenig nervös und angespannt. Im letzten Jahr hatte er sich einen Bart wachsen lassen. Die Sonnenbräune, die er aus Spanien mitgebracht hatte, zeigte die feinen Fältchen in den Augenwinkeln. Das Gesicht wirkte nicht mehr so jungenhaft, und obwohl er erst zweiundzwanzig war, sah er älter aus als Colin.
»Keith, was hast du mit der armen Bella gemacht?« Wir standen vor seinem uralten Volkswagen.
»Rostschutzfarbe«, erwiderte er kurz und suchte in der Hosentasche nach dem Autoschlüssel. »Ich hatte Angst, die Rostmoleküle könnten sich bald nicht mehr gegenseitig die Hand geben. Bella muß noch lange durchhalten. Wie du weißt, gibt es keinen Firmenwagen für den verwöhnten Sohn.«
In seiner Stimme lag nicht der geringste Anflug von Bosheit, obwohl Colin zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag einen roten Sportwagen bekommen hatte. Du bist ein besserer Mensch als ich, Keith McKinstry, dachte ich, als ich mich auf das weiche Stück Schaumgummi setzte, das den kaputten Beifahrersitz bedeckte. Als die Ampel auf Grün sprang, gab er Gas und setzte sich an die Spitze der kriechenden Autoschlange.
»Wie geht es deinem Vater, Jenny?«
»Sehr gut, danke. Er arbeitet noch immer zwei Tage in der Woche, läßt sich jedoch von Gladys Huey nach Hause bringen.«
Keith nickte freundlich. Er und mein Vater verstanden sich gut. Wenn unsere Familie zusammenkam, was selten genug geschah, unterhielten sie sich oft angeregt über Wirtschaft und Politik. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung waren, hatten sie doch großen Respekt voreinander.
»Und deine liebe Mutter?« fuhr er fort und zog die Augenbrauen hoch.
Ich seufzte. »Immer noch dasselbe, vielleicht ein bißchen schlimmer. Ich glaube, sie trifft sich oft mit deiner Mutter. Du weißt, was ich davon halte. Wenn sie sich nicht beschimpfen, bestärken sie sich gegenseitig in ihren Vorurteilen.«
»Das stimmt«, lachte er. »Sie hat mich ziemlich kühl empfangen, als ich zurückkam. Hat mich noch nicht einmal zu Wort kommen lassen. Sie weiß genau, daß ich ohne die Unterschrift des Alten keine Studienbeihilfe bekomme.«
»Aber warum, Keith? Gibt es dafür Gründe?« Ich war entrüstet.
»Ach, Jenny. Wenn ich unabhängig genug wäre, mich ihren Wünschen zu widersetzen, und mir die Firma aussuchen könnte, die mir gefällt, und das studieren dürfte, was ich möchte, wäre ich nicht mehr auf sie angewiesen. Es ist nichts weiter als kühle Erpressung.«
Ich sah ihn erstaunt an. Wie konnte er so geradlinig sein, so fröhlich? Wie schaffte er es ohne Stipendium? Als wir an einer Ampel abbogen, warf er mir einen flüchtigen Blick zu. »Das ist eine Sache. Aber kennst du vielleicht ein Hotel, das einen guten Kellner braucht? Schpreche Inglisch werry gud!« Er grinste übers ganze Gesicht.
Ich mußte lachen, aber was er gesagt hatte, war nicht komisch. »O Keith. Du kannst im dritten Studienjahr nicht auch noch arbeiten, du brauchst die Zeit für dein Studium.«
»Das sagt Siobhan auch.«
»Sie hat recht. Sag ihr, daß wir uns etwas überlegen müssen. Könnt ihr zum Essen kommen? Ich spreche mit Colin. Vielleicht können wir euch helfen.« Plötzlich wurde mir die Bedeutung meiner Worte bewußt. Falls wir William John nicht dazu bringen könnten, seine Meinung zu ändern, müßte ich Keith von meinem Gehalt unterstützen. Das würde in beiden Familien erhebliche Probleme aufwerfen.
Als der Verkehr wieder zum Stehen kam, fragte ich: »Hat Maisie dir gegenüber auch Ian Paisley zitiert?«
»Paisley?« Keith war entsetzt.
»Ich glaube, die beiden haben mehrmals an seinen Gottesdiensten teilgenommen. Mutter hat sich eine Reihe von seinen Schlagwörtern angeeignet. Du weißt ja, sie ist nicht sehr einfallsreich. Es kann sogar sein, daß wir wieder einmal in einer religiösen Phase stecken.«
»Du meine Güte, wie hält dein Vater das nur aus?«
»Das weiß ich auch nicht. Offenbar sieht er über vieles hinweg, aber es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, wie du weißt, war Daddy schon immer ein Realist.«
Wir krochen langsam auf den Shaftesbury Square zu, und ich sah wieder den Zeitungsjungen von vorhin.
»Die Demonstration ist abgesagt worden, Keith. Bist du sehr enttäuscht?«
Er lächelte kopfschüttelnd. »Die Demonstration ist nicht abgesagt worden, Jenny. Glaube nur nicht, was in der Zeitung steht. Falls die Organisatoren es nicht schaffen, werden die Jungen Sozialisten trotzdem marschieren. Heute abend findet eine Sitzung statt. Es muß weitergehen, auch wenn wir nur noch eine Handvoll Leute sind.«
Ich wollte protestieren, sagte aber nur leise: »Und Siobhan geht mit.«
»Natürlich.«
Wir hielten am Zebrastreifen gegenüber dem Queen's College. Studenten strömten aus dem Tor, Bücher und Ringhefte unter dem Arm. Vor fünf Jahren wäre ich wie sie auf diesem Bürgersteig entlang den Hügel hinaufgegangen, vorbei am Ulster Museum, dem großen, grauen Block der Keir Buildings und den vertrauten Geschäften von Stranmillis Village.
»Wie spät ist es?« fragte Keith und gab wieder Gas.
»In der Bäckerei gingen die Lichter aus. Ungefähr halb, nehme ich an«, antwortete ich so gleichgültig wie möglich.
»Es tut mir leid, wir sind nur langsam vorangekommen. Aber der Bus wäre auch nicht schneller gewesen.«
Wir bogen in den Rathmore Drive ein und hielten vor der viktorianischen Villa mit der Buchenhecke, in der ich seit meinem sechsten Lebensjahr gewohnt hatte. »Schade, daß wir keine Zeit für eine Tasse Kaffee haben.«
»Mir tut es auch leid«, antwortete ich traurig und stieg aus, drehte mich aber noch einmal um.
Er lächelte. »Vielleicht ist sie ja heute in guter Stimmung.«
»Verdammt, Keith. Ich mache mir keine Sorgen um Mutter. Ich habe gelernt, mit ihr umzugehen. Ich mache mir Sorgen um dich und Siobhan. Glaubst du, daß es zu Ausschreitungen kommt?«
Er nickte bedächtig. »Das wird nicht zu verhindern sein. Aber du vergißt eines, wir haben eine Waffe.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, was das sein könnte. Das einzige, woran ich denken konnte, waren Massen von unbewaffneten Studenten und jungen Leuten, die ohne jeden Schutz einer Armee gut ausgebildeter Männer gegenüberstanden, die den Befehl hatten, sie zusammenzuschlagen. Bei diesem Gedanken wurde mir übel vor Angst.
»Die Kameras, Jenny, die Kameras!« Er beugte sich nach hinten und zog meine Aktentasche und meinen Korb vom Rücksitz. »Ich kann nicht versprechen, daß es nicht unangenehm wird, wahrscheinlich sehr unangenehm, aber die Kameras bieten uns einen gewissen Schutz.«
Er sah mich mit einem beruhigenden Lächeln an. »Es ist etwas anderes, wenn Menschen die Brutalität der Polizei mit eigenen Augen im Wohnzimmer beim Teetrinken im Fernsehen sehen, anstatt nur davon zu hören. Und die B-Specials wissen das auch. Das schützt uns zwar nicht sehr, aber es ist immerhin etwas.« Ich nickte, traute mich aber nicht, etwas zu erwidern. »Mach dir keine Sorgen. Ich rufe dich am Sonntag abend an, sobald wir zurück sind.« Er küßte mich auf die Wange. »Nimm die Samstagszeitungen nicht zu ernst. Warte, bis du die Sonntagsausgabe liest.« Ich lächelte gezwungen. Seine Worte beruhigten mich nur wenig. »Viel Glück, Keith. Viele Grüße an Siobhan. Bis nächste Woche zum Abendessen. Wir verabreden uns am Sonntag.«
»In Ordnung.«
»Vielen Dank, daß du mich mitgenommen hast.«
»Alles Gute«, sagte er und blickte bei dem Gedanken an meine Mutter zum Himmel.
»Das kann ich gut gebrauchen.« Ich lachte kläglich, öffnete das Gartentor und eilte den gepflasterten Weg durch die Rosenbeete hinauf zum Haus.
Kapitel 2
George öffnete die Augen. Das Holz krachte im Kaminfeuer. Ein Funke flog in hohem Bogen durch die Luft und fiel auf den Korb mit Brennholz. Gott sei Dank, er ist nicht auf den neuen Vorhang geflogen, dachte er, streckte die Hand aus und griff nach dem Feuerhaken. Edna wäre bestimmt nicht erfreut, wenn sie nach Hause käme und einen versengten Vorhang vorfände.
Er dachte über die Spezifikationen für die neuen Traktoren nach, die Bertie von der Ausstellung in Birmingham mitgebracht hatte, und war plötzlich in Gedanken weit weg in Ballymena beim Auswechseln der Achse einer Zugmaschine mit dem alten Willie Prentice. Das war schon Jahre her. Solche Maschinen sah man heute nur noch im Museum. Es war schon merkwürdig, was einem alles wieder einfiel, wenn man nach dem Mittagessen ein paar Minuten döst.
Er sah auf die Uhr. Es war fast drei. Hatte er wirklich so lange geschlafen? Er beugte sich vor, griff, ohne aufzustehen, nach einem Holzscheit und versuchte, es auf die Glut zu legen. Plötzlich durchfuhr ihn ein Schmerz, und das Stück Holz fiel ihm aus der Hand.
»Pech gehabt, George, du hättest doch aufstehen sollen«, sagte er laut. Er legte eine Hand auf die Brust und richtete sich vorsichtig auf. »Wenn der Wind von dieser Seite weht, dann nimmst du eben deine Pillen und denkst nicht mehr daran, das Rosenbeet zu harken.«
Er stand unsicher auf, hielt sich an dem abgenutzten Ohrensessel fest und wartete, bis ihm die Beine wieder gehorchten. Dann sah er sich um und nickte. Gott sei Dank, die neue Putzfrau machte ihre Sache gut. Er hörte sie den ganzen Morgen arbeiten wie ein Pferd. Bevor sie ging, brachte sie ihm seine Sandwiches auf einem gedeckten Tablett, garniert mit Petersilie und Tomaten. Es sah genauso appetitlich aus wie die Bilder im Frauenmagazin. Aber man konnte Edna ja nichts mehr recht machen. Sie hatte schon lange kein freundliches Wort mehr für ihn. Dagegen war er machtlos.
Er schluckte seine Pillen, spülte das Glas aus und stellte es zum Trocknen umgekehrt hin. Dann sah er es noch einmal an, überlegte, trocknete es ab und räumte es weg. Als er die Schranktür schloß, durchfuhr ihn wieder ein Schmerz. Mühsam hielt er sich an der Spüle fest.
»Geh weg«, sagte er. »Komm morgen wieder, wenn es mir nicht so viel ausmacht.«
Schweiß stand ihm auf der Stirn, er wollte sich setzen. Aber in der Küche fühlte er sich nicht wohl. Edna haßte es, wenn er sich hier aufhielt. Falls sie jetzt aus der Stadt zurückkäme, wäre sie bestimmt ungehalten und würde sagen: »Du tust immer gerade das, was du nicht sollst. Wie kann ich meiner Arbeit nachgehen, wenn man dich nicht einmal fünf Minuten allein lassen kann?« Sie sagte immer fünf Minuten, obwohl sie fast den ganzen Tag weg war.
»Komm schon, George, geh weiter, denk einfach, es geht bergab.«
Er schaffte es bis ins Eßzimmer. Zu seiner Überraschung ließ der Schmerz nach.
»Gutes Zeug«, sagte er triumphierend. »Ich muß Feuer machen, solange es mir so gut geht. Wenn ich den ganzen Nachmittag bloß herumsitze, machen mir die Schmerzen nichts aus. Hauptsache mir geht es besser, wenn Jenny kommt.«
Gladys würde lachen, wenn sie ihn hören könnte. Seine Sekretärin, Freundin und Vertraute seit zwanzig Jahren, sagte immer, daß er keine Selbstgespräche führen solle, das mache einen merkwürdigen Eindruck auf die Leute.
»Und Sie sprechen nie mit sich selbst?« hatte er sie scherzend gefragt.
»Natürlich, aber nur, wenn niemand zuhört.«
Er schürte das Feuer und setzte sich erleichtert wieder hin. Der Schmerz war fast weg, aber er fühlte sich schwach. Waren es die Tabletten? Was es auch war, heute mußte er sich zusammennehmen. Ausruhen hatte der Arzt gesagt, ausruhen. In seinem Leben hatte er nie viel Ruhe gehabt, und jetzt fiel es ihm schwer. Aber er konnte wenigstens noch lesen. Er müßte sich glücklich schätzen, das Augenlicht und ein Dach über dem Kopf zu haben, wie man so sagt.
Er nahm ein kleines, in Leder gebundenes Buch vom Beistelltisch. Ein Stück von Goldsmith vielleicht in den sterbenden Monaten des Jahres? Oder Sweet Auburn? An längst vergangene Zeiten denken, als die Welt noch einfacher, vielleicht sogar besser war. Er öffnete es und betrachtete die vertraute Handschrift auf der ersten Seite. Für Daddy, in Liebe, weil deine alte Ausgabe auseinanderfällt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jenny.«
»Daddy, können wir noch zu Großmamas Hütte hinaufgehen, bevor wir nach Hause fahren?«
Er schaute hinunter auf die kleine Hand, die seinen Arm festhielt, und in die ernsten, dunklen Augen. »Es ist ein weiter Weg für dich, mein Schatz, und nach dem Regen ist es naß draußen.«
»Aber ich habe doch meine Stiefel, Daddy. Oma McTaggart hat gesagt, daß ich in meinen Siebenmeilenstiefeln überall hingehen kann.«
Mary McTaggart lachte und nahm die braune Teekanne vom Stövchen. »Trink noch eine Tasse Tee, George. Es ist besser, du gehst mit. Sie hat die ganze Woche von nichts anderem mehr geredet. Sie hat Lottie schon drei- oder viermal überredet hinaufzugehen, und sie wäre auch allein gegangen, wenn ich sie gelassen hätte.«
Er sah auf die Uhr. Edna erwartete sie pünktlich um sieben Uhr zur Schlafenszeit wieder zurück, und der Austin gehörte nicht zu den schnellsten Autos der Welt.
»Bitte Daddy. Die Ferien bei Oma McTaggart waren so schön, und sie hat mir alles über dich erzählt, als du noch klein warst.«
»Du meine Güte«, lachte George und sah die alte Frau an, die immer gut zu ihm gewesen war. »Hat sie dir alle meine Geheimnisse verraten?«
»Ja«, sagte das Kind unverblümt. »Aber ich kann Geheimnisse für mich behalten. Nicht wahr, Oma?«
»O ja, du kannst sehr vieles, kleine Dame. Ich hoffe, deine alte Oma ist in zehn Jahren noch hier, um dich dann zu erleben.«
»Wenn ich sechzehn und schon erwachsen bin?« Sie holte ein kleines Paar Gummistiefel aus einer Ecke der großen Küche, wo die Stiefel von Marys jüngstem Sohn und seiner Familie fein säuberlich in einer Reihe standen.
Der Regen hatte aufgehört. Die späte Augustsonne wärmte ihre Gesichter. Auf dem Hof ging George vorsichtig um die Pfützen herum, um seine guten, braunen Lederschuhe zu schonen. Fünf Monate waren seit ihrem Umzug vergangen – eine schwierige, sorgenvolle Zeit. Er hatte Darlehen aufnehmen müssen für den Ausstellungsraum, die Traktoren und Anhänger, die er in England bestellt hatte, und für die Hochglanzprospekte der Mähmaschinen, Strohpressen und Mähdrescher, die zu groß und zu teuer waren, um sie zu lagern. Die Hypothek auf dem Haus in Stranmillis, das einzige, das Edna gefiel, war höher, als er geplant hatte. Er brauchte jede freie Minute, die er nicht im Ausstellungsraum verbrachte, für den Umbau. Aber er hatte sich entschieden. Zum erstenmal in seinem Leben war er sein eigener Herr, und das war gut so.
In den letzten Monaten ging es aufwärts. Die Kriegsjahre hatten sich für die Bauern als sehr lukrativ erwiesen. Alle Nahrungsmittel wurden zu garantierten Preisen verkauft, und die letzten drei Jahre brachten durch die niedrigen Löhne auch Gewinne. Im Vertrauen darauf, daß die schlechten Zeiten endlich vorüber waren, begannen die Bauern nun das gesparte Geld auszugeben. Zuerst kauften sie Autos, bauten Badezimmer für die Familie und dachten erst dann an die altmodischen Landmaschinen. Ein Traktor war der erste Schritt. George war traurig, daß die Zugpferde weichen mußten. Schon während des Krieges hatten auf den großen Höfen erste Veränderungen begonnen, und er wußte, daß die kleineren Höfe folgen würden. Ein einziger Traktor ersetzte die Arbeit von mehreren Männern.
Nun gut, er mußte viele Traktoren verkaufen, um Harvey durch sein siebentes Jahr zu bringen. Harvey wollte unbedingt Arzt werden, und der Lehrer der neuen Schule sagte, er hätte gute Aussichten, das Examen zu bestehen. Das freute Edna sehr. Seit dem Umzug war es auch mit ihr leichter geworden. Sie hatte sich den Frauen der Kirchengemeinde angeschlossen und ging öfter aus. Manchmal, wenn er samstags im Ausstellungsraum Regale baute und dekorierte, brachte sie ihm eine Thermoskanne Tee. Hin und wieder war sie sogar mit ihm und ihrem Leben zufrieden.
»Bist du immer diesen Weg zur Schule gegangen?«