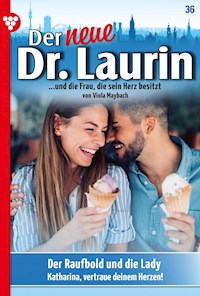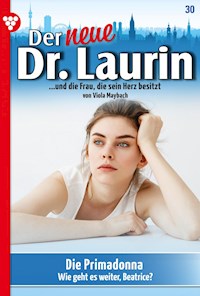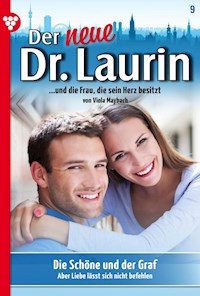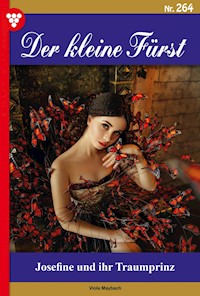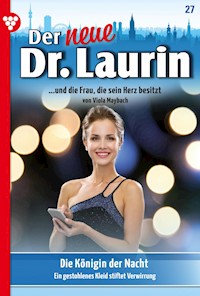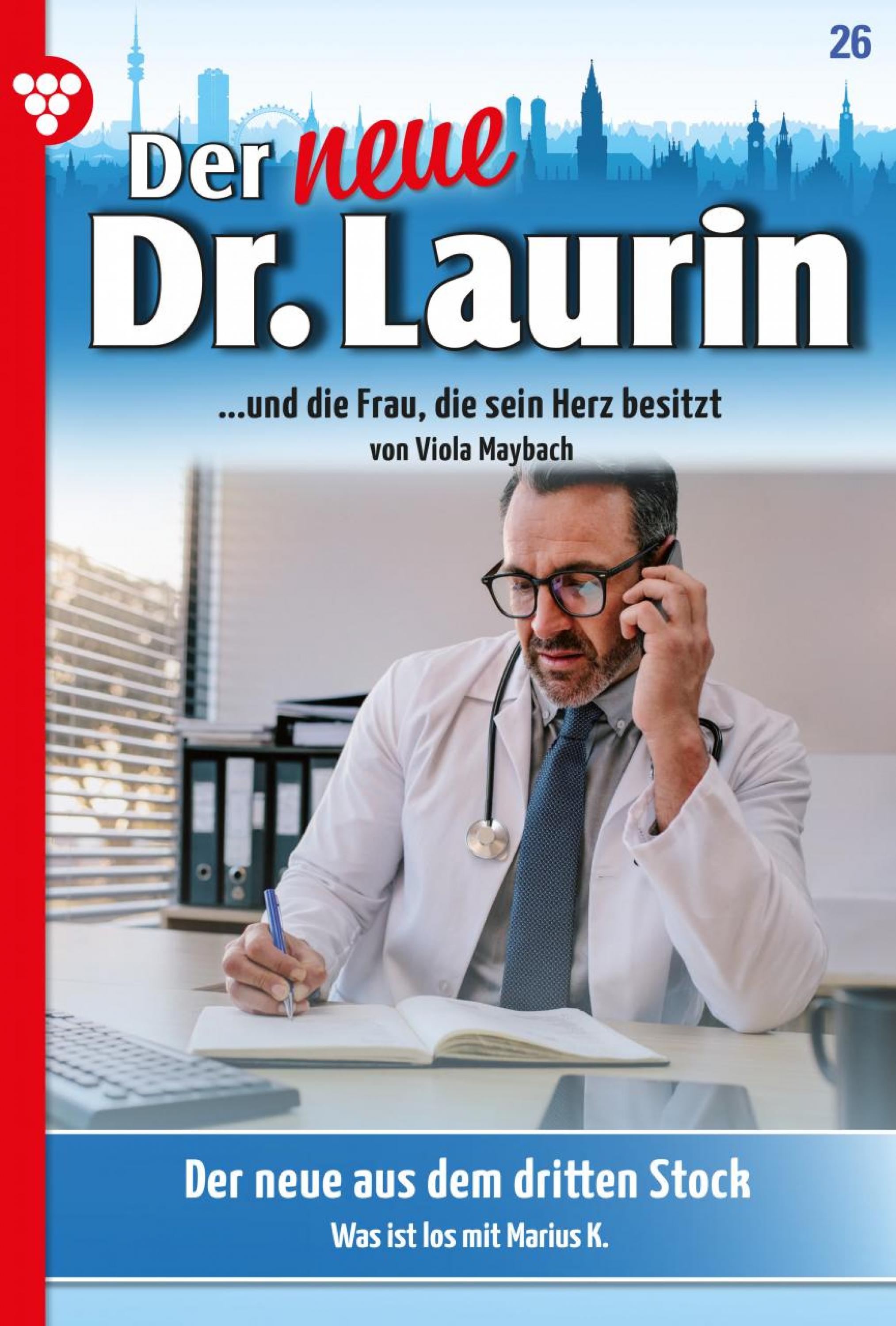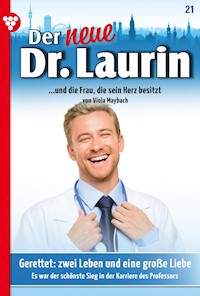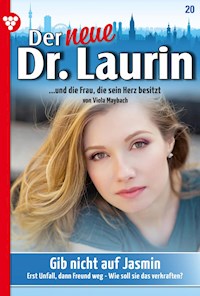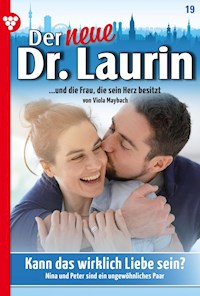Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der neue Dr. Laurin
- Sprache: Deutsch
Diese Serie von der Erfolgsschriftstellerin Viola Maybach knüpft an die bereits erschienenen Dr. Laurin-Romane von Patricia Vandenberg an. Die Familiengeschichte des Klinikchefs Dr. Leon Laurin tritt in eine neue Phase, die in die heutige moderne Lebenswelt passt. Da die vier Kinder der Familie Laurin langsam heranwachsen, möchte Dr. Laurins Frau, Dr. Antonia Laurin, endlich wieder als Kinderärztin arbeiten. Somit wird Antonia in der Privatklinik ihres Mannes eine Praxis als Kinderärztin aufmachen. Damit ist der Boden bereitet für eine große, faszinierende Arztserie, die das Spektrum um den charismatischen Dr. Laurin entscheidend erweitert. »Warum verrätst du uns nicht wenigstens ihren Namen?«, fragte Marion Zurmühlen ihren Sohn, als die Haushälterin die Desserts serviert hatte. »Du kannst dir doch vorstellen, wie neugierig wir sind und wie sehr wir uns darauf freuen, sie endlich kennenzulernen.« »Lass ihn, Liebes«, sagte ihr Mann Ulf und legte seine große, breite Hand auf ihre schmale, feingliedrige. »Du siehst doch, er braucht noch Zeit!« Noah dankte seinem Vater im Stillen für diese Unterstützung, zumal er wusste, dass dessen Neugier nicht kleiner war als die seiner Mutter. Im Grunde genommen konnten es beide kaum erwarten, dass ihr Sohn ihnen endlich eine Schwiegertochter präsentierte – und möglichst bald darauf das erste Enkelkind. Ihre Fragen danach waren im letzten Jahr immer drängender geworden. Es war nicht so, dass er sie nicht verstand. Seine Eltern hatten in der Schweiz, in Basel, mit ihrer Pharmafirma ein Vermögen verdient, und die erste große Enttäuschung bereits schlucken müssen, als er ihnen erklärt hatte, er sehe seine Zukunft nicht im Familienunternehmen, sie würden sich anderweitig nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger umsehen müssen. Er hatte mehrere Cousinen und Cousins, die seiner Ansicht nach viel besser als er geeignet waren, die Firma eines Tages zu übernehmen und die vor allen Dingen auch Lust darauf hatten und die nötige Energie dafür mitbrachten. Doch seine Eltern sahen das anders. Sie hofaften immer noch, er werde seine Meinung eines Tages ändern – oder aber, er werde bald Vater mehrerer Kinder, von denen eines dann hoffentlich das Unternehmen in die Zukunft führen werde. Seine Eltern waren noch ziemlich jung, sie arbeiteten gern und würden dann eben so lange weitermachen, bis eins ihrer Enkelkinder bereit war, die Verantwortung für das Familienimperium zu übernehmen. Es tat ihm leid, sie so enttäuschen zu müssen, aber seine Neigungen gingen nun einmal in eine völlig andere Richtung. Er hatte Kunstgeschichte studiert und arbeitete nun für mehrere Museen, Galerien und Auktionshäuser als Gutachter, und er tat es mit großer Freude und Begeisterung. Das war eine völlig andere Welt als die seiner Eltern. Es war seine Welt, darin fühlte er sich wohl, er wollte sie nicht missen. In einem Pharmaunternehmen hatte er nichts verloren, dort konnte er nur unglücklich werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der neue Dr. Laurin – 33 –Eine Lüge im Spiel
Sie wird dich begleiten, Noah!
Viola Maybach
»Warum verrätst du uns nicht wenigstens ihren Namen?«, fragte Marion Zurmühlen ihren Sohn, als die Haushälterin die Desserts serviert hatte. »Du kannst dir doch vorstellen, wie neugierig wir sind und wie sehr wir uns darauf freuen, sie endlich kennenzulernen.«
»Lass ihn, Liebes«, sagte ihr Mann Ulf und legte seine große, breite Hand auf ihre schmale, feingliedrige. »Du siehst doch, er braucht noch Zeit!«
Noah dankte seinem Vater im Stillen für diese Unterstützung, zumal er wusste, dass dessen Neugier nicht kleiner war als die seiner Mutter. Im Grunde genommen konnten es beide kaum erwarten, dass ihr Sohn ihnen endlich eine Schwiegertochter präsentierte – und möglichst bald darauf das erste Enkelkind. Ihre Fragen danach waren im letzten Jahr immer drängender geworden.
Es war nicht so, dass er sie nicht verstand. Seine Eltern hatten in der Schweiz, in Basel, mit ihrer Pharmafirma ein Vermögen verdient, und die erste große Enttäuschung bereits schlucken müssen, als er ihnen erklärt hatte, er sehe seine Zukunft nicht im Familienunternehmen, sie würden sich anderweitig nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger umsehen müssen. Er hatte mehrere Cousinen und Cousins, die seiner Ansicht nach viel besser als er geeignet waren, die Firma eines Tages zu übernehmen und die vor allen Dingen auch Lust darauf hatten und die nötige Energie dafür mitbrachten.
Doch seine Eltern sahen das anders. Sie hofaften immer noch, er werde seine Meinung eines Tages ändern – oder aber, er werde bald Vater mehrerer Kinder, von denen eines dann hoffentlich das Unternehmen in die Zukunft führen werde. Seine Eltern waren noch ziemlich jung, sie arbeiteten gern und würden dann eben so lange weitermachen, bis eins ihrer Enkelkinder bereit war, die Verantwortung für das Familienimperium zu übernehmen.
Es tat ihm leid, sie so enttäuschen zu müssen, aber seine Neigungen gingen nun einmal in eine völlig andere Richtung. Er hatte Kunstgeschichte studiert und arbeitete nun für mehrere Museen, Galerien und Auktionshäuser als Gutachter, und er tat es mit großer Freude und Begeisterung.
Das war eine völlig andere Welt als die seiner Eltern. Es war seine Welt, darin fühlte er sich wohl, er wollte sie nicht missen. In einem Pharmaunternehmen hatte er nichts verloren, dort konnte er nur unglücklich werden.
Da er es nicht eilig hatte, sich zu binden, hielt er seine Beziehungen zu Frauen eher locker, und bislang hatte es keinen Grund gegeben, daran etwas zu ändern. Möglicherweise gab es ja diese eine magische Begegnung, bei der es einem wie ein Blitz durch den ganzen Körper fuhr und man wusste: Die oder keine! Er hielt es für möglich, aber eigentlich glaubte er nicht daran. Vielleicht, dachte er manchmal, glaubte er einfach nicht an die Liebe. Sein bester Freund hatte sogar am Tag der Hochzeit noch gezweifelt, ob er es richtig machte, und jetzt, ein Jahr später, wusste er: Er hätte besser nicht geheiratet. Andere hatten ihm ebenfalls gestanden, dass sie sich wünschten, sich nicht so früh schon gebunden zu haben. Diese Erfahrungen bestärkten ihn in seiner Haltung.
Doch wie sollte er seinen Eltern klarmachen, dass er nicht war wie sie – und zwar ganz und gar nicht? Nicht nur hatte er andere berufliche Interessen, sondern er war auch an der Art Leben, wie sie es führten, nicht interessiert. Seine Eltern waren seit über dreißig Jahren glücklich miteinander, bei ihnen gab es keine Zweifel. Sie führten das Leben, das sie sich immer gewünscht hatten, sehnten sich nicht nach anderen Partnern, hatten einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, sie waren gesund und finanziell unabhängig. Besser ging es nicht. Nur: Er hielt sie für eine der seltenen Ausnahmen.
»Ihr werdet sie bald kennenlernen«, versprach er etwas lahm. Wer ›sie‹ war, blieb sein Geheimnis. Er hatte einmal eine vage Andeutung gemacht, es gebe jetzt eine Frau in seinem Leben, damit sie ihn endlich in Ruhe ließen, und aus dieser Andeutung hatte seine Mutter binnen kürzester Zeit das gemacht, was sie sich wünschte: ›Unser Sohn hat jetzt endlich die Frau seines Lebens gefunden.‹
Als er sie diesen Satz das erste Mal am Telefon zu einer Freundin hatte sagen hören, hätte er beinahe lautstark protestiert. Aber er hatte es nicht getan. Eine Zeitlang war tatsächlich Ruhe gewesen, aber danach war es wieder losgegangen: »Wann lernen wir sie denn nun endlich kennen, deine Freundin?«
So wie heute. Es gab vor diesem Thema offenbar kein Entrinnen. Kurz überlegte er, ob er sagen sollte, er habe sich leider von ›ihr‹ – vorsichtshalber hatte er ihr noch keinen Namen gegeben – trennen müssen, aber er entschied sich dagegen. Neue Enttäuschung, neue Fragen, neue Verzweiflung bei seinen Eltern über diesen Sohn, der ihren Erwartungen einfach nicht entsprechen wollte. Das war ihm für heute zu viel. Seine Mutter wollte etwas erwidern auf seine Ankündigung hin, aber er sah, dass sein Vater sie mit einem Blick bremste, und wieder war er ihm dankbar. Sein Vater wünschte sich, da machte er sich keine Illusionen, genauso stark wie seine Mutter, dass er, Noah, endlich eine zu ihm passende Frau fand und mit ihr eine Familie gründete. Aber er verstand es besser, seine Ungeduld zu bezähmen, weil er ahnte, wie sehr sich Noah davon unter Druck gesetzt fühlte.
»Ich muss bald los«, sagte er. »Der Zug wartet nicht auf mich.«
»Die Zeit geht immer so schnell herum, wenn du da bist«, seufzte seine Mutter.
»Ich komme ja wieder, Mama!«
»Aber meistens so kurz. Es wäre schön, dich wieder einmal etwas länger hier zu haben.«
»Wir haben alle viel zu tun«, sagte er. »So ist das nun mal.«
Er ließ den Blick durch das große Fenster auf den Rhein gleiten, der unten majestätisch vorbeifloss. Das Sommervergnügen der Baseler und der Touristen, sich von der Strömung des Flusses ein ganzes Stück tragen zu lassen, bevor man ihn wieder verließ, war für dieses Jahr vorüber. Nur einige Wagemutige in Neoprenanzügen waren noch im kalten Wasser, aber die meisten würden sich erst im nächsten Sommer wieder hineintrauen. Wenn er an seine Kindheit dachte, hatte er manchmal das Gefühl, dass seine Freunde und er den Sommer im Rhein verbracht hatten. Wunderbare Sommer. Manchmal hatten sie sich auch gefährlich weit in die Mitte des Flusses gewagt, es war eine Art Mutprobe gewesen. Passiert war zum Glück nie etwas.
Basel war früher seine Heimat gewesen. Seine Eltern waren in die Schweiz gezogen, als er noch keine fünf gewesen war, hier war er aufgewachsen. Er liebte die entspannte Stimmung in der Stadt, und auch diesen Hauch von Süden, der sie vor allem im Sommer durchwehte. Den gab es in München manchmal auch, in den Biergärten oder an der Isar. Aber nicht so wie hier, dachte er plötzlich. Trotzdem fühlte er sich heute in München zuhause, er hatte sein Studium dort abgeschlossen. Damals war es einer seiner Freunde gewesen, der ihn überredet hatte, sein gemütliches kleines Basel wenigstens für ein paar Semester zu verlassen. Und dann war er in München hängengeblieben.
Er hatte das Angebot seiner Eltern, ihn zum Badischen Bahnhof zu fahren, abgelehnt. Er fuhr gerne mit der Straßenbahn, und es war nur eine kurze Strecke. Dafür musste man das Auto nicht aus der Garage holen. Manchmal ging er auch zu Fuß, aber heute Abend war er zu müde.
Er umarmte seine Mutter zum Abschied. »Bis bald, Mama«, sagte er und küsste sie liebevoll auf beide Wangen. »Und hör auf, dir immer Sorgen um mich und meine Zukunft zu machen. Mir geht es sehr gut!«
Sie nickte und schluckte tapfer eine weitere Frage nach seiner Freundin hinunter.
Sein Vater umarmte ihn ebenfalls und klopfte ihm auf die Schultern. »Mach’s gut, Junge!« Mehr sagte er nicht.
Noah verließ das Haus und blieb einen Moment stehen. Es war ziemlich kühl geworden. Er schlug den Kragen seiner Jacke hoch und lief zur Haltestelle.
*
Emilia Börne war müde, als sie in Basel in den Zug stieg. Es war ein langer Tag gewesen. Sie hatte sich mit ihrem Chef Markus Hemmerling getroffen, der sowohl in Basel als auch in München eine Kunstgalerie betrieb. Sie war für die Münchener Galerie zuständig. Etwa einmal im Monat fuhr sie nach Basel, um sich ausführlich mit Markus zu beraten und gegebenenfalls Probleme zu lösen. Probleme hatte es dieses Mal tatsächlich gegeben. Sie würden eine Ausstellung verschieben müssen, da der Künstler krank geworden war und einige zugesagte Werke nicht hatte fertigstellen können. Es handelte sich um Kunstwerke aus Papier, zarte Gebilde, die sich überraschend gut verkauften. Jetzt musste sie also etlichen Interessenten absagen, was sie sehr ärgerte. Sie hatte sich von dieser Ausstellung gute Geschäfte erhofft. Daraus würde nun erst einmal nichts werden.
Aber sie hatten einen Ersatz gefunden, das immerhin. Nun musste sie zwar alle Ankündigungen ändern, neue Termine ausmachen, neue Prospekte drucken lassen, neue Pressemitteilungen verfassen. Viel Arbeit, aber sie hoffte sehr, dass sie die andere Ausstellung würden nachholen können.
Markus war eine Art väterlicher Freund für sie geworden. Er war schon über sechzig, wirkte aber viel jünger, weil er sich für vieles interessierte und voller Begeisterung über neue Entdeckungen reden konnte. Sie fand Gespräche mit ihm immer anregend und interessant.
Er hatte seine Frau früh verloren, die Ehe war kinderlos geblieben. Sie nahm an, dass er auch deshalb einen großen Freundes- und Bekanntenkreis pflegte. »Ich kann gut allein sein«, hatte er einmal zu ihr gesagt, »aber ich bin auch gern mit Menschen zusammen. Und jemand in meiner Situation muss seine Freundschaften pflegen, wenn das Alleinsein nicht in Einsamkeit umschlagen soll, das ist ja klar.«
Sie saß bereits an ihrem reservierten Platz, als sie merkte, wie hungrig sie war. Sie hatten zwar mittags eine Kleinigkeit gegessen, danach hatte es aber nur noch einen Kaffee und ein Sandwich gegeben, und irgendwann war es für ein Abendessen im Restaurant zu spät gewesen. Sie hatte sich am Bahnhof ein weiteres Sandwich, einen Apfel und eine Flasche Wasser gekauft, das musste reichen. Im Zugrestaurant war es ihr in der Regel zu voll, sie blieb lieber auf ihrem Platz sitzen. Wahrscheinlich würde sie ohnehin die halbe Fahrt verschlafen.
Sie saß im Großraumwagen, an einem der Plätze mit Tisch, weil sie sich meistens nach den Gesprächen mit ihrem Chef noch ein paar Notizen machen wollte, doch sie wusste, dass daraus heute nichts werden würde. Ihr brummte der Schädel, sie brauchte Schlaf und Ruhe, und morgen würde sie sich dann mit frischen Kräften an die Arbeit machen.
Sie hatte Glück: Zwei Plätze am Tisch blieben leer, der neben ihr und der ihr gegenüber. Auf dem verbliebenen Platz nahm ein Mann Platz, der etwa so alt wie sie sein mochte. Er lächelte sie kurz an, als er sich setzte.
Der ist genauso fertig wie ich, dachte sie, als sie sein Lächeln erwiderte. Er hatte schöne hellbraune Haare und ebenfalls braune Augen. Er sah nett aus und schien nicht der Typ zu sein, der versuchen würde, sie auf der Fahrt vollzuquatschen.
Als der Zug sich pünktlich in Bewegung setzte, packte sie ihr Sandwich aus und begann zu essen, während sie draußen die Außenbezirke von Basel vorbeifliegen sah.
*
Leon Laurin streckte seinen schmerzenden Rücken, nachdem er die Stichverletzungen versorgt hatte, die sich ein etwa Vierzehnjähriger in einem Streit mit einem etwas älteren Jungen zugezogen hatte. Der Ältere wurde im Behandlungsraum nebenan von seinem Kollegen Timo Felsenstein versorgt. Die Wunden waren nicht besonders tief und auf keinen Fall lebensgefährlich, dennoch fand Leon Fälle wie diesen mehr als beunruhigend. Wie kamen Halbwüchsige auf die Idee, sich in einer Stadt wie München mit Messern zu bewaffnen, wenn sie auf die Straße gingen – und vor allem: Wieso benutzten sie diese Messer dann auch? Was war passiert, dass man sich nicht mehr mit Worten bekämpfte, sondern mit Waffen, als herrschte Krieg?
Er würde seinem jungen Patienten diese Fragen stellen, sobald er wieder ansprechbar war, aber er wusste bereits, dass er keine zufriedenstellende Antwort bekommen würde. Zudem wartete bereits die Polizei, um die beiden Jungen zu vernehmen.
Timo erschien an der offenen Tür. »Fertig«, sagte er. »Schlimm sind die Verletzungen nicht, zum Glück. Was ist nur in diese Jungen gefahren? Haben die nichts Besseres zu tun, als mit Messern aufeinander loszugehen?«
»Genau diese Frage habe ich mir gerade auch gestellt. Wahrscheinlich wissen sie es selbst nicht«, erwiderte Leon.
Timo leitete die Notaufnahme der Kayser-Klinik, deren Chef Leon war, seit sein Schwiegervater, der Klinik-Gründer Professor Joachim Kayser, ihm die Leitung übertragen hatte. Leon hatte diese Aufgabe gern übernommen, war aber weiterhin in seinen beiden medizinischen Fachgebieten, der Gynäkologie und der Chirurgie, tätig. Er konnte sich nicht vorstellen, nicht mehr als Arzt zu arbeiten, und bislang schaffte er es gut, seine drei sehr unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche miteinander zu vereinbaren.
Und da er als Leiter der Klinik möglichst gut über alle Bereiche informiert sein wollte, übernahm er unter anderem regelmäßige Dienste in der Notaufnahme. Auch Nachtdienste, wie jetzt. Er lernte viel in solchen Nächten, sah, woran es mangelte und wo Abhilfe geschaffen werden musste, und ganz nebenbei, fand er, hielt es ihn fit in der Allgemeinmedizin, denn auf keiner Station gab es so unterschiedliche Anforderungen an das medizinische Personal wie in einer Notaufnahme.
»Meiner wacht gleich auf«, sagte Timo.
»Meiner auch. Und sonst?«
»Alles immer noch ziemlich ruhig.«
Sie hatten eine Frau versorgt, die plötzlich ohnmächtig geworden war, ein Mann mit Verdacht auf Schlaganfall war bereits auf der Intensivstation, und dann hatte es noch ein paar kleinere Unfälle mit leichten Verletzungen gegeben.
»Niemand mehr im Wartezimmer?«
»Niemand.«
»Hallo?«
Leon und Timo wechselten einen Blick. »Das ist meiner«, murmelte Timo und eilte zurück in den benachbarten Behandlungsraum.
Gleich darauf schlug auch Leons Patient die Augen auf und sah ihn feinselig an. Leon stellte ihm die Frage, wieso er überhaupt ein Messer bei sich gehabt hatte, und zu seinem größten Erstaunen bekam er eine Antwort. »Weil ich nicht abgestochen werden will. Ich habe mich gewehrt. Wenn ich kein Messer gehabt hätte, wär’ ich jetzt tot.«
»Die Polizei ist da, die wird dich auch danach fragen. Vernehmungsfähig bist du ja wieder.«