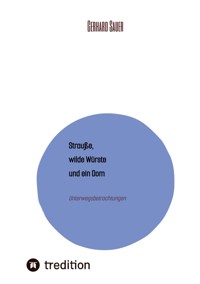8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mann auf der Flucht. Wer jagt ihn und warum? Ein Unfall. Eine Tote. Bei näherem Hinsehen entwickelt sich der harmlose Fall jedoch komplizierter als gedacht. Ein weiterer mysteriöser Todesfall. Was verbindet die Opfer? Ein schräger Schnüffler. Eine ehrgeizige Polizistin. Ermittlungen in Sackgassen. Politische Blockaden. Abgründe tun sich auf. Überraschungen warten auf die Ermittler. Lassen sich die Hintergründe klären? Und wer blickt am Ende noch durch? Der erste Fall des Berliner Hobby-Detektivs Finlo Halbe führt ihn u.a. weit in den Westen der Republik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mein Dank
an Marie-Luise für ihre unerschütterliche Geduld, die gemeinsame Zeit, ihre Inspiration und die unvergleichlichen Frühstücke; an Ditmar für das gelegentlich offene Ohr und die Kritik; an Michelle für die Kommasetzung und an Michael für Zuspruch und Unterstützung.
Gerhard Sauer
Sauerländer, 1957, lebt in Berlin und der Uckermark; schreibt mit Freude alltägliche Texte, Reiseberichte, hin und wieder Gedichte. „Eine Nacht. Immerhin.“ ist sein zweites Buch. Zuvor erschienen bereits „Das grüne Kleid – ein Heimatroman“ sowie die Kurzgeschichtensammlung „Der Kopf muss ab“ ebenfalls bei tredition.
Gerhard Sauer
Eine Nacht. Immerhin.
Kriminalroman
© 2021
Gerhard Sauer
Titelfoto:
Gerhard Sauer
Korrektor:
Ditmar Gatzmaga
Verlag & Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Paperback
978-3-347-40022-1
ISBN Hardcover
978-3-347-40023-8
ISBN e-Book
978-3-347-40024-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Wer andern eine Grube gräbt, ist ein Grubengräber.
1
Oostduinkerke-an Zee/Belgien, Dezember
Regen rinnt an den Fenstern der "Kusttram" herunter. Böiger Wind peitscht immer neue Schauerstaffeln heran. Dunkelgraue Wolken hängen tief über Meer, Strand und Land. Die Dämmerung setzt jetzt kurz vor Winteranfang bereits am frühen Nachmittag ein. Ein Tag wie geschaffen für Depressionen. Die Küstenstraßenbahn von Oostende nach De Panne stoppt mit einem Ruck kurz vor der Kreuzung in der Mitte des Badeortes Oostduinkerke-an Zee. Zischend öffnet sich die Tür. Ein Mann klappt seinen Mantelkragen hoch, setzt seinen Hut auf, zieht ihn tief in die Stirn. Mit professionellem Blick checkt er blitzschnell von links nach rechts die oberen Stockwerke der Häuser gegenüber, weiter huscht sein Blick diagonal über die Häuserfront nach links unten und zurück nach rechts an den Eingängen entlang. Er entspannt sich, nimmt seine Tasche in die Hand, will die drei Stufen aus der Bahn hinuntersteigen, um die Straße zu überqueren. Auf der untersten Stufe hält er inne. Ein Auto überholt die Bahn vorschriftswidrig rechts und schießt an ihm vorbei. Er seufzt. Er ist müde. Seit Tagen hat er kaum geschlafen. Das Gefühl unendlicher Nacht hat ihn umschlungen. Er atmet tief durch und tritt auf die ‚Albert I Laan‘, stakst drei Schritte über große Pfützen bis aufs Trottoir. Dicht an den Gebäuden entlang geht er ein paar Meter in Fahrtrichtung bis zur Ecke des ‚Astridplein‘, wendet sich dort mit einem Blick über die Schulter nach rechts. Der Regen kommt ihm jetzt fast waagerecht vom offenen Meer entgegen. Seinen Hut mit der linken Hand festhaltend trägt er in der anderen Hand seine Tasche. Der Mantel ist schon nach der der kurzen Strecke komplett durchnässt, er tropft. An der rechten Ecke des 'Astridpleins', dort wo der ‚Zeedijk‘ auf den Platz trifft, steigt er zwei Stufen hoch, schiebt mit der Schulter die Tür einer Kneipe auf. ‚t’Zand‘ blinkt ihm in bunten Farben entgegen. Schön belgisch bunt, denkt er beim Eintreten amüsiert, durchquert den Gastraum an der langen, einladenden Theke vorbei, setzt sich, ohne Mantel und Hut abzulegen, an einen der Tische im hinteren, von außen nicht einsehbaren Bereich, stellt die Tasche zwischen seine Füße, atmet noch einmal tief durch. Er spürt die Wärme, die von den Heizkörpern abgestrahlt wird. Ein schwach vernehmbarer Duft nach frittierten Pommes wabert durch den Raum. Musik plätschert unaufdringlich, irgendein aktueller Schlager. Ein paar Minuten vergehen.
Eine Frau ist unauffällig zu ihm herangetreten, spricht ihn an.
„Goden avond, mijn heer!“ (Guten Abend, mein Herr!)
Er schreckt kurz auf, schaut ihr in die Augen, nimmt seine Kopfbedeckung ab, schüttelt sich, lächelt.
„Goden avond!" (Guten Abend!)
„Will U wat bestellen?“ (Möchten Sie etwas bestellen?)
„Een biertje, alstublieft. Een Westvleeteren triple!“ (Ein Bier, bitte. Ein Westvleeteren triple.)
Mit einem tiefen Seufzer schiebt er „Ich brauch jetzt etwas Starkes!“, mehr zu sich selbst, hinterher. Endlich legt er auch den triefnassen Mantel ab und hängt ihn an die Garderobe in der Nähe der Heizung.
Es ist nicht viel los in dem Tearoom, die Bestellung wird prompt ausgeführt, das Bier auf den Tisch gestellt, ein Schälchen mit Erdnüssen hinzugereicht. Er lächelt die nicht mehr ganz junge, aber herrlich blonde Bedienung wiederum an.
„Dank u well!“ (Danke sehr!)
Sie lächelt zurück.
„Alstublieft! Gezondheit!“ (Bitte schön! Gesundheit!)
Der Mann hebt das Glas an den Mund, nimmt zwei, drei große Schluck Bier, setzt das Glas wieder ab, nimmt ein paar Erdnüsse. Hier war er schon mal. Vor dreißig Jahren. Vielleicht auch vierzig. Er hat sich erinnert. Kaum ein Mensch kann wissen, dass er sich hier auskennt. Er schaut sich um. Alles ruhig. Nichts Verdächtiges. Vor den Scheiben toben sich Sturm und Regen aus, normalerweise kann man von hier aus den breiten Strand überblicken. Doch mittlerweile ist es stockdunkel geworden. Das Licht der wenigen Straßenlaternen dringt kaum noch durch. Sie haben ihren Kampf um die Vorherrschaft offensichtlich aufgegeben. Das Wetter draußen hört man zwar, sieht aber nichts. Wie in einem Kokon, eine kleine und für den Moment auch heile Welt. Jetzt muss ihm nur noch eine Lösung einfallen, wo er heute Nacht schlafen kann ohne Datenspuren von online-booking oder Kreditkartenabrechnungen zu hinterlassen.
„Mag het iets anders zijn?“ (Darf es sonst noch etwas anderes sein?)
Sie hat gerade einen anderen Tisch abgeräumt und kommt auf dem Weg zur Theke wieder an ihm vorbei. Sie schaut ihm in die Augen. Ganz langsam nickt er und seine Augen leuchten auf. Und ob! Das ist DIE Lösung. Er lächelt sie an. Sie bemerkt seine Entspannung, lächelt auch. Der Mann atmet auf. Endlich Ruhe finden. Und sie hat so süße Grübchen.
*
Es ist Nacht. Die Jagd wird weitergehen. Dies ist nicht das Ende. Aber ein Ruhepunkt im Tunnel. Er dreht sich unter der warmen Decke um und sucht ihre Nähe. Eine Nacht. Immerhin.
2
Düsseldorf, Juli des gleichen Jahres
Schrage spürte ihre Lippen, den zarten Druck auf seinem Mund, den süßen Geschmack, das wohlige Kribbeln im Bauch - obwohl er sie seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Geschweige denn geküsst. Tagträume überkamen ihn in letzter Zeit immer häufiger. Ein Blick aus dem Fenster genügte, um ihn fortzutreiben. Abzuschweifen, sich wegzuträumen. Weg vom Geschwafel und der alltäglichen Wichtigtuerei in diesen Räumen. Er sah das gegenüberliegende Hochhaus. Das war zwar ebenfalls bevölkert von dieser ihn umgebenden beamteten Labermischpoke. Dort aber spiegelte sich jetzt am späten Vormittag immerhin die Sonne in der Fassade. Sich abhebend vom blau-weißen Himmel glänzte das rautenartige Glas- und Stahlgebilde über den stumpfen Grausinn hinweg. Träume. Gedanken an die unerreichbare Angebetete. Und Wünsche. Heiße Wünsche.
Eine Stimme erreichte sein Ohr.
„…und deshalb bin ich, um es noch einmal deutlich zu unterstreichen, ganz und gar der Auffassung, dass …“ –
Wieder eine dieser Floskeln, Füllfloskeln, die ihn nach all den Jahren anwiderten. Noch eine halbe Stunde war zu absolvieren, dann würde er den Laptop zuklappen und die Laufschuhe schnüren. Das hatte er sich vorgenommen, seit er sie kennengelernt hatte. Fitter werden, abnehmen. In der Mittagspause würde er ein paar Kilometer fressen, statt Kantinenfraß in sich hineinzuschaufeln. Seit sieben Uhr in der Früh hatte er den ganzen Morgen in Sitzungen verbracht, Termine besprochen, Texte geschrieben, verworfen, telefoniert. Das Übliche eben.
Und dann zerriss die geschwätzige Stille.
Ein Schrei.
Yves Maurice Claude Alain Schrage, genannt YMCA, lauschte einen Moment. Der Schrei hallte nach.
Wer hatte geschrien? Eine Frau, offensichtlich.
Wo? Im Treppenhaus, wahrscheinlich.
Jetzt nur keine Hektik aufkommen lassen, dachte Schrage. Nicht jetzt, so kurz vor meiner Mittagspause. Eine laute Stille erfüllte den Raum. Die üblichen Wortführer hielten inne. Was erwarteten sie? Alle am Tisch schauten Schrage an. Warum immer ich, bahnte sich Selbstmitleid durch seine Synapsen.
„Ok, ich schau mal nach“, gab er nach, erhob sich betont gelassen, trat durch die sich automatisch öffnende Glastür des Korridors und blieb erstarrt stehen.
3
Berlin, Juli
Meine Beine konnte ich gerade so mit dem Schuhabsatz an der Tischkante halten. Ich lag in meinen alten Sessel und baute eine Brücke zum Schreibtisch. Aber nur, weil ich mich kaum noch bewegen konnte. Mir war schlecht. Es war wohl schon Nachmittag. Irgendwo auf der rechten Seite des Zifferblatts, irgendwo kurz bevor der Zeiger ganz herunterfällt. Der Abend zuvor war einer dieser Abende gewesen, die irgendwann aus dem Ruder laufen. Warum auch immer. Was los war? Frag nicht. Denn danach ging die ganze Chose erst richtig los.
Aber der Reihe nach. Ich stelle mich wohl erstmal kurz vor. Mein Name: Halbe. Finlay Logan Halbe. Meine Freunde, so ich denn noch welche habe, nennen mich ‚Finlo‘. Oder einfach: Halbe. Kann auch ein Pseudonym sein. Wer weiß das schon. Ist mir letztendlich auch egal.
Also, es muss so im Februar gewesen sein. Ein Typ, keine Ahnung woher ich den kannte, verdächtigte seine schicke Schnickse, ihn um ein paar hart aber schwarz erworbene Euro erleichtern zu wollen. Ich sollte ihm Fotos liefern, die einen unzweifelhaft zweifelhaften Lebenswandel der guten Dame belegen könnten. Und Namen wollte er haben. Keine große Kunst, dachte ich, eigentlich nicht meine Welt, aber was will man machen.
Warum? Na, warum wohl. Die Kreditkarte machte schon hin und wieder Zicken, das Konto war leergeräumt und aus dem Kühlschrank konnte man auch schon wieder ein Echo hören. Ich brauchte also Knete. Und ein Vorschuss kam mir da gerade recht.
Ich hab zwar meinen verdammt gut bezahlten festen Job, doch Kredite, Unterhalt, Wohnung, Auto und die ein oder andere überflüssige Ausgabe im Laufe eines Monats fressen mir zu oft die Haare vom Kopf. Am Ende des Kontos ist immer zu viel Monat über. Und so prostituiere ich mich hin und wieder für meine Extras. Freiberuflich, wie man so sagt. Und da bin ich dann vor nix fies.
Die Fotos würde ich in den nächsten Tagen schießen können, da war ich mir damals sicher. Und dann würde es mir zumindest knetemäßig besser gehen. Ich hoffte, dass dieser gelackte Arsch auch meine Rechnung tatsächlich bezahlen würde. Denn bei diesen Typen weiß man ja nie so genau, ob die auch Wort halten, ihr Schwarzgeld schwarz an mich rüberzuschieben. Zu oft war ich schon auf die Fresse gefallen.
Erstmal hatte sich wochenlang nichts getan. Ich bekam die Dame nicht vor die Linse. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Wochenlang. Der Typ nervte, aber was sollte ich machen. Seine Informationen über ihren Aufenthalt waren entweder falsch - oder falsch … oder falsch. Zwischendurch verlor ich hin und wieder das Interesse und kümmerte mich nur dann, wenn mal wieder ein Anruf kam.
Dann plötzlich tauchte sie auf. Und ich hatte mich der Dame eine ganze Zeit an die Fersen gehängt – ohne den Erfolg, den mein Auftraggeber erwartete. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr und mich auf den Weg in meine Höhle gemacht, um mich zu verkriechen. Aber nix da. Wie das schon mal so ist. Rechts vom Durchgang zum Hinterhof, in dem der Aufgang zu meiner Wohnung liegt, lockte ein kühles Blondes. Das wusste ich, und hatte Durst bekommen. Ein paar Jungs hielten dort, wie jeden Tag um dieselbe Zeit, die Barhocker warm. Ich setzte mich dazu. Bestellen brauchte ich nicht. Der Barkeeper stellte mir ein Pils auf den Filz.
Der hat auch so seine Geschichte. Also der Barkeeper, nicht der Barhocker. Seit über zwanzig Jahren steht er nun schon hinter diesem Tresen, kennt Hinz und auch Kunz und zumeist auch deren kurvenreiche Lebensgeschichte dahinter, die Brüche, Sehnsüchte und Abgründe. Er mixt, serviert, kredenzt - und zapft nicht nur verschiedene Biere, sondern verzapft auch den ein oder anderen Blödsinn. Ob er nun seinen Haarschopf verloren hat aufgrund der haarsträubenden Geschichten, die er hier jeden Abend so zum Besten gibt oder aufgrund mangelnden Sonnenlichts, werde wohl selbst ich nicht mehr recherchieren können. Liegt im Dunkeln. Ist wahrscheinlich auch besser so.
Sei's drum. Das Pils nahm seinen üblichen Weg, über die Eingeweide Richtung Blase. Ich musste den ganzen Ärger der vergangenen Wochen hinunterspülen. Beruflichen Ärger. Aber nicht nur das. Die Schmerzen machen mich mürbe. Schon seit Monaten. Ich konnte kaum noch meinen Jobs nachgehen. Ergebnis: siehe oben.
Ich haderte also mal wieder, mit mir, mit der Welt. Mit den Frauen. Mit was weiß ich denn. Ich hatte die Schnauze voll. Von allen. Vor allem piesackte mich die Frage, ob ich mir wirklich einen Metzger suchen musste, der mir ein neues Hüftgelenk einbauen würde. Wie lange würde das in so einer Klinik wohl dauern? Was würde ich dann machen müssen, um wieder richtig laufen zu können? Reha? Und: wie lange würde ich das aushalten? Dicker Hals. Also, noch eins.
Das geübte Auge des langjährigen Alkoholikerbegleiters hinter der Theke musterte mich. Messerscharf sezierte er den Ärger. Und stellte mir einen dreistöckigen Ouzo neben mein Pils. Ohne große Worte. Ein Nicken. Und runter damit. Nach dem dritten Ouzo verschwamm der Abend. War wahrscheinlich auch besser so.
Mir war also immer noch schwummrig im Magen. Mein Schädel brummte. Ich brauche eine Alkaselzer, eine Flasche Wasser und eine Frau. Ich wollte bemuttert werden. Wie, das wollen die Mädels nicht mehr? Ok, dann nicht.
Aber zumindest das erste war dringend notwendig. Nur, woher nehmen? Ich dachte nach. Soweit das möglich war. Dann schloss ich die Augen und schlief wieder ein. Keine Träume.
Hä? Was war das? Vibrierte da etwas in meiner Hose? Warum? Mein traumloses Dahindämmern wurde jäh unterbrochen. Ich wusste nicht recht, wo ich war. Was war das? Dann verstand ich. Der Vibrationsalarm meines Handys machte sich bemerkbar. Doch bis dahin dauerte es einige Momente. Ich hatte zwar den Ton ausgeschaltet aber trotzdem nicht meine Ruhe. Merde, wie der Franzose sagt.
Ich meldete mich. Wer dran war? Natürlich: der Schnösel. Er gab mir die Koordinaten seiner Tussi durch. Es sei eilig, er habe keinen Bock mehr, ihren neuen Lover auch noch zu finanzieren und brauche subito die Fotos, spätestens am Wochenende wolle er klar Schiff machen und sie rausschmeißen. Und um die Scheidung möglichst kostengünstig zu gewinnen, müsse er sie beim Wickel nehmen können. Ich verstand. Und auch wieder nicht. Nur so viel: ich musste mich in Bewegung setzen. War der Job erst mal erledigt, würde ich den Rest des Jahres planen können. Und dann vielleicht mal wieder mit einer Mutti kuscheln. Man wird ja bescheiden, brummelte ich vor mich hin. Doch bis dahin war es noch ein langer, mühevoller Weg.
Ich erhob also meinen Allerwertesten. Ein bisschen Augenpflege, immerhin, und so schlurfte leidlich fit und ausgeschlafen Richtung U-Bahn. Nebenbei schüttete ich eine ganze Flasche Selters in mich hinein, sortierte mich, kontrollierte beim Gehen die Taschen: Handy, Geld, Kamera, Block, Stift, Taschentuch. Was der Meister so braucht.
Wie immer war ich unbewaffnet. Noch nicht mal ein Pfefferspray hatte ich dabei. Und das, obwohl man in dieser Stadt nie genau weiß, wem man im Laufe der Nacht so begegnet. Manchmal war ich mir nicht mehr so sicher, ob das vernünftig war, so peacemäßig herumzulaufen. Seitdem ich mal nachts in einer Nebenstraße der Hermannstraße ein paar Arabern über den Weg gelaufen war, hatte ich mir den Schwur aller Nachteulen ins Gedächtnis gerufen: „Besser ist, wenn die anderen auf dem Boden liegen.“ Doch wie ich das anstellen könnte, war mir verdammt unklar. Man will sich ja nicht auf das Hirnlosniveau herunter begeben. Unterwegs ratterte schon wieder dieses verfluchte Handy.
4
Düsseldorf, Juli
Madeleine D. hörte den Schrei nicht mehr. Sie hatte ihn zwar selbst ausgestoßen. Jetzt jedoch lag sie auf dem Boden am Fuße der Treppe vor der ersten Stufe. Eine große Blutlache bildete sich um ihren Kopf. Einen Entsetzenschrei hatten auch Birgit G., Personalratsvorsitzende und ihre Kollegin Sabine B. zum Besten gegeben. Beide waren auf dem Weg in die Kantine gewesen. Das Mittagessen würde jetzt ausfallen.
Sie sah nicht schön aus. Nicht mehr. Der dreizehnstufige Steintreppensturz und die Bekanntschaft mit den Streben des Stahlgeländers hatten ihr heftig zugesetzt. Gesicht zerschunden, blutende Wunden unterm Haarschopf, an der Nase, über den Augenbrauen, an den Beinen; der rechte Arm stand merkwürdig im rechten Winkel vom Körper ab, die Augen schreckweit geöffnet. Sie, die sonst die Perfektion bei Kleidung und Frisur so liebte, war ein einziger Jammerhaufen geworden. Und blutig dazu.
Birgit G. hatte sich als erste vom Schreck erholt. Sie fischte ihr Handy aus ihrer Tasche, tippte mit zittrigen Fingern die Ziffern 112 ein, den Rettungsdienst. Sabine B. schüttelte sich kurz, ging in die Hocke, legte die Hand an den Hals der bisherigen Abteilungsleiterin, schaute zu ihrer Kollegin hoch. Kein Puls zu fühlen, offensichtlich Exitus.
„Da ist nichts mehr zu machen“, murmelte sie ihrer Kollegin entgeistert zu. Sie richtete sich auf, hielt sich am Geländer fest, ihr wurde schwindlig.
YMCA packte ihren Arm und brachte sie zu der ein paar Meter entfernt stehenden Sitzgruppe.
„Ich hole Dir ein Glas Wasser.“ Weg war er.
In der Ferne war schon die Sirene des Rettungswagens zu hören. Ein Krankenhaus lag nur wenige Straßen entfernt, vielleicht waren sie gerade unterwegs gewesen und konnten somit bereits nach ein paar Minuten am Unfallort sein. Aber hier würde nichts mehr zu retten sein. Das wussten Birgit G. und Sabine B. Und sagten das auch. YMCA brachte gerade das Glas Wasser. Er verstand. Er hatte ihr oft den Tod gewünscht. Oder zumindest Pest und Cholera an den Hals. Und hatte das auch gesagt, im Kollegenkreis, in der Cafeteria. Würde man jetzt ihn verdächtigen? YMCA hielt inne, schüttelte sich. Ach Quatsch, er hatte ja ein Alibi. So eine Sitzung konnte also doch für etwas gut sein. Und überhaupt, wieso verdächtigen?
Jetzt drängten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Flur. Schauten, entsetzten sich, schüttelten den Kopf, fragten, behaupteten, machten sich Gedanken. YMCA versuchte, sie zurückzudrängen.
„Notarzt kommt. Bitte lasst das Treppenhaus frei.“ Mühsam. Sensationsgier.
Die Sanitäter und der Notarzt stürmten die Treppen hoch. Sie knieten sich hin, fühlten nach dem nicht mehr vorhandenen Puls, leuchteten in die Augen, legten Geräte an, versuchten noch ein Lebenszeichen der Dame im ehemals schicken Kostüm zu entdecken. Fehlanzeige. Kopfschütteln.
„Zu spät. Da können wir nichts mehr machen. Wir müssen die Polizei verständigen. Unfall mit Todesfolge. Das muss untersucht werden. Bitte sichern sie das Treppenhaus.“
Mittagszeit. Die Sonne am höchsten Punkt. Durch das komplett verglaste Treppenhaus war blauer Himmel zu sehen. Seit Tagen schon hielt die hochsommerliche Hitze an. Die Luft schien zu stehen und immer dicker zu werden. Parfum- und Blutgeruch überlagerten, durchmischten, übertrafen sich. Das Atmen fiel schwer und schwerer. YMCA würgte. Er musste raus, nur hinaus.
5
Berlin, Juli
Schrage laberte mir die Ohren voll. Eine Frau war ihm mehr oder weniger vor die Füße gefallen. Treppe runter, tot. Sah schrecklich aus, viel Blut, verrenkt, Polizei, Absperrung, Gespräche und so weiter. So erzählte er es mir. Dass er erst später hinzugekommen war, ließ er weg. War irgendwie auch egal. Er war auf jeden Fall durch den Wind. Seine Abteilungsleiterin war tot. Er habe ihr oft die Krätze an den Hals gewünscht, gestand er. Ich brummte ein paar zustimmende Laute dazu und wusste: mit Worten sind sie alle schnell, aber wenn das Gewünschte dann real wird, kriegen die meisten Leute dann doch voll den Moralischen. Wollen wieder für nix verantwortlich gewesen sein. Nun denn, sei’s drum, er musste mit jemandem quatschen. Und das war mal wieder: ich.
Schon seit unserer gemeinsamen Schulzeit hängt er wie eine Klette an mir. Wir sind uns in vielem ähnlich, nicht nur dass wir mehr oder weniger bekloppte Eltern hatten. Wieso bekloppt? Ganz einfach: mein Alter war Schottland-Fan, war dort oft mit seinem WoMo unterwegs gewesen, hatte Spiele von Celtic Glasgow besucht und soff immer mal wieder dieses grässliche Whiskey-Zeugs. Daher meine schottischen Vornamen. Und ja, YMCA‘s Muttchen hatte einen frankophonen Fimmel. Ergebnis: siehe Vornamenzeile im Reisepass. Außerdem sind wir etwa gleich groß, straßenköterblonde, ganz leicht gelichtete Haare, die Zumutungen des Alltags setzen sich bei uns beiden schon leicht an den Hüften an, und beide kleiden wir uns auch so lala normal. Das war’s dann aber auch schon. Während ich aus dem Vollen schöpfe, siehe oben, war und ist er ein Langweiler. Hab ich ihm schon oft gesagt. Hängt da in seinem Büro herum, befriedigt die Herrschaftsbedürfnisse seiner Vorgesetzten und die seiner Frau, rackert sich den Helmut wund, und wundert sich, dass er immer unzufriedener wird.
Nun gut, ein paar Wochen vor dem besagten Tag hatte er mir erzählt, dass er mit dem Laufen angefangen und da wohl auch so eine kleine Liebelei am Laufen habe. Foto aufm Smartphone. Unvorsichtig war er auch noch. Aber: heißer Feger. Hoffentlich bringt sie ihm mal die Flötentöne bei, dachte ich noch, könnte ja nicht schaden, vielleicht wird er dann lockerer.
Aber ich schweife ab. Also, YMCA phonte mich an, laberte mich voll. Das konnte ich jetzt gar nicht gebrauchen, ich war unterwegs, um meinen Job zu erledigen. Ich würgte ihn ab.
„Lass uns die Tage mal reden, Jung, mach‘s gut!“
*
Ich hatte die Spur aufgenommen, kletterte aus dem U-Bahn-Schacht, machte mich zu Fuß auf den Weg ein paar hundert Meter bis zur angegebenen Adresse. Kaum bog ich in das kleine, baumbestandene Sträßchen ein, überholte mich eine der in diesem Stadtteil üblichen schwarzen Stern-Karossen. Glänzend, teuer, verdunkelte Scheiben. Der Wagen hielt an, eine Frau stieg aus der rechten hinteren Tür.
Ich stutzte. Das Geschöpf kannte ich doch. War das nicht das Liebchen meines Freundchens? Uiuiui, da hatte er sich aber einen teuren Fisch geangelt. Aber was machte die Dame hier? 500 Kilometer entfernt?
YMCA frönte sein Dasein am Westrand der Republik, ich dagegen schlurfe hier auf den breiten Straßen der Hauptstadt. Sie hier, er dort, ich dazwischen. Irgendetwas stimmte hier nicht.
So dachte ich noch vor mich hin, als sich ein großes Portal öffnete und sie hinter dem eisernen Grundstückstor verschwand. War das nicht die Adresse, die auf meinem Zettel stand? Eine Botschafterresidenz. Noch mehr Verwirrung in meinem geschundenen Hirn. Ich ging weiter. Bis zur nächsten Straßenecke, dort bog ich ab, versteckte mich kurz hinter einer Hecke, und ging zurück. Das Nachbargrundstück war mit einem Eisenzaun auf einer kleinen Mauer umfriedet. Die nutzte ich, kletterte hoch, holte meine Kamera raus und hielt drauf. Das Glück war mir noch hold. Die zauberhafte Erscheinung