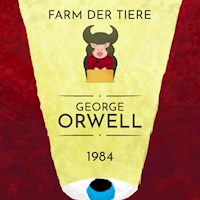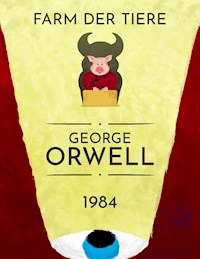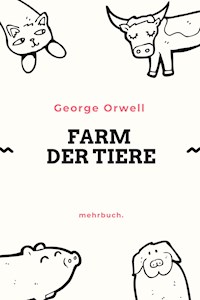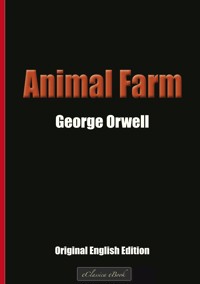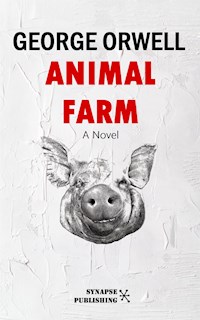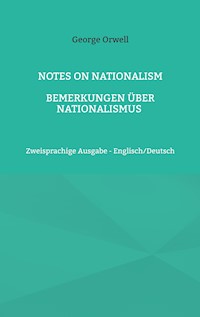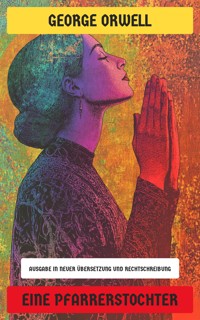
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In "Eine Pfarrerstochter" entfaltet George Orwell meisterhaft das Leben und die inneren Konflikte der Protagonistin, die in einem beschaulichen englischen Pfarrhaus aufwächst. Der Roman ist geprägt von einer klaren, ungeschönten Prosa, die Orwells charakteristische soziale Kritik direkt mit emotionaler Tiefe verbindet. Durch die Schilderung ihrer familiären Beziehungen und der gesellschaftlichen Erwartungen wird das Dilemma der Identitätsfindung in einer streng geprägten Umgebung deutlich, was das Werk zu einem zeitlosen Kommentar über persönliche Freiheit und gesellschaftliche Normen erhebt. George Orwell, bekannt für seine kritischen Auseinandersetzungen mit totalitären Regimen und sozialen Ungerechtigkeiten, nutzt autobiografische Elemente, um das Psychogramm seiner Heldin zu skizzieren. Diese tief empfundene Verbindung zur Figur und ihrem Umfeld ist kein Zufall; Orwells eigene Erfahrungen im ländlichen England und sein Bewusstsein für die Klassenunterschiede prägen die narrative Struktur und Thematik des Romans. Der Autor reflektiert nicht nur über das Innere des Menschen, sondern auch über die äußeren gesellschaftlichen Strukturen, die das Individuum formen. "Eine Pfarrerstochter" ist eine eindringliche Lektüre, die nicht nur Literaturliebhaber anspricht, sondern auch Leser, die sich für die tiefgründigen Fragen menschlicher Existenz interessieren. Orwells Erzählkunst und seine scharfe Analyse der sozialen Verhältnisse laden dazu ein, die eigenen Ansichten über Herkunft, Tradition und Identität zu hinterfragen. Ein unverzichtbares Werk für alle, die die vielschichtige Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft erkunden möchten. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eine Pfarrerstochter
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I
I
Als der Wecker auf der Kommode wie eine schreckliche kleine Bombe aus Glockenmetall explodierte, schreckte Dorothy aus den Tiefen eines komplexen, beunruhigenden Traums hoch, erwachte mit einem Ruck und lag auf dem Rücken, während sie in äußerster Erschöpfung in die Dunkelheit starrte.
Der Wecker setzte sein nerviges, weibliches Gezeter fort, das etwa fünf Minuten lang anhielt, wenn man ihn nicht abstellte. Dorothy schmerzte von Kopf bis Fuß, und ein heimtückisches und verächtliches Selbstmitleid, das sie normalerweise überkam, wenn es Zeit war, morgens aufzustehen, ließ sie den Kopf unter der Bettdecke vergraben und versuchen, das verhasste Geräusch abzuschalten. Sie kämpfte jedoch gegen ihre Müdigkeit an und ermahnte sich, wie es ihre Gewohnheit war, scharf in der zweiten Person Plural. Komm schon, Dorothy, aufstehen! Bitte nicht einschlafen! Sprüche 6:9. Dann erinnerte sie sich daran, dass, wenn der Lärm noch länger anhielt, ihr Vater aufwachen würde, und mit einer hastigen Bewegung sprang sie aus dem Bett, ergriff die Uhr von der Kommode und stellte den Wecker ab. Sie lag auf der Kommode, damit sie aufstehen musste, um sie abzustellen. Noch im Dunkeln kniete sie sich an ihr Bett und sprach das Gebet des Herrn, aber ziemlich zerstreut, da ihre Füße von der Kälte geplagt wurden.
Es war gerade halb sechs Uhr, und für einen Augustmorgen war es ziemlich kühl. Dorothy (sie hieß Dorothy Hare und war das einzige Kind von Pfarrer Charles Hare, dem Rektor von St. Athelstan's in Knype Hill, Suffolk) zog ihren abgetragenen Flanell-Bademantel an und tastete sich die Treppe hinunter. Es roch frisch und kühl nach Staub, feuchtem Putz und angebratenen Resten vom Abendessen am Vortag, und von beiden Seiten des Ganges im zweiten Stock konnte sie das an- und abschwellende Schnarchen ihres Vaters und von Ellen, der Mädchen für alles, hören. Vorsichtig – denn der Küchentisch hatte die unangenehme Angewohnheit, aus der Dunkelheit herauszutreten und einem auf den Hüftknochen zu schlagen – tastete sich Dorothy in die Küche vor, entzündete die Kerze auf dem Kaminsims und kniete sich, immer noch vor Müdigkeit schmerzend, hin und schürfte die Asche aus dem Herd.
Das Feuer in der Küche war ein „Biest“, das man anzünden musste. Der Schornstein war schief und daher ständig halb verstopft, und das Feuer erwartete, bevor es entzündet werden konnte, dass man ihm eine Tasse Kerosin hinzugab, wie einem Trunkenbold seinen morgendlichen Schluck Gin. Nachdem sie den Wasserkessel für das Rasierwasser ihres Vaters zum Kochen gebracht hatte, ging Dorothy nach oben und hängte sich von der Badewanne ab. Ellen schnarchte immer noch, mit schwerem jugendlichem Schnarchen. Sobald sie wach war, war sie eine gute und fleißige Dienerin, aber sie gehörte zu den Mädchen, die der Teufel und all seine Engel nicht vor sieben Uhr morgens aus dem Bett bekommen.
Dorothy füllte das Bad so langsam wie möglich – das Plätschern weckte immer ihren Vater, wenn sie den Wasserhahn zu schnell aufdrehte – und stand einen Moment lang vor dem blassen, unappetitlichen Wasserbecken. Ihr Körper hatte überall Gänsehaut. Sie verabscheute kalte Bäder; genau aus diesem Grund machte sie es sich zur Regel, von April bis November alle ihre Bäder kalt zu nehmen. Sie tauchte eine Hand zögernd ins Wasser – und es war schrecklich kalt – und trieb sich mit ihren üblichen Ermahnungen an. Komm schon, Dorothy! Rein mit dir! Bitte keine Angst! Dann stieg sie entschlossen in die Badewanne, setzte sich hin und ließ das eisige Wasser an ihrem Körper hinabrutschen und sie ganz untertauchen, bis auf ihre Haare, die sie hinter dem Kopf zusammengebunden hatte. Im nächsten Moment kam sie keuchend und zappelnd an die Oberfläche und hatte kaum wieder zu Atem gefunden, als sie sich an ihre „Notizliste“ erinnerte, die sie in der Tasche ihres Bademantels mitgebracht hatte und die sie lesen wollte. Sie griff danach und beugte sich über den Rand der Badewanne, bis zur Taille im eisigen Wasser, und las die „Notizliste“ im Licht der Kerze auf dem Stuhl durch.
Es lautete:
7 oc. H.C.
Frau T. Baby? Muss besuchen.
Frühstück. Speck . Muss Vater um Geld bitten. (P)
Frag Ellen, was für Vorhänge bei Solepipe zu besorgen sind.
Besuch bei Frau P. Schneide aus Daily M Angelikatee, gut gegen Rheuma. Frau L.s Hühneraugenpflaster.
12. Okt. Probe Charles I. NB. 1 Pfund Kleber bestellen 1 Topf Aluminiumfarbe
AbendessenMittagessen...?
Nimm die Runde durch die Gemeinde, Mag. NB. Frau F. schuldet 3/6 d.
16:30 Uhr Mütter-Tee-Kränzchen nicht vergessen 2½ Yards Vorhangstoff.
Blumen für die Kirche. 1 Dose Brasso.
Abendessen. Rühreier .
Vaters Predigt schreiben. Was ist mit der neuen Bandschreibmaschine?
NB. zwischen Erbsen und Ackerwinde entscheiden, furchtbar.
Dorothy stieg aus der Badewanne und als sie sich mit einem Handtuch abtrocknete, das kaum größer als eine Serviette war – im Pfarrhaus konnten sie sich nie Handtücher in anständiger Größe leisten –, lösten sich ihre Haarnadeln und fielen ihr in zwei schweren Strähnen über die Schlüsselbeine. Es war dichtes, feines, sehr blasses Haar, und es war vielleicht ganz gut, dass ihr Vater ihr verboten hatte, es kurz zu schneiden, denn das war ihre einzige positive Eigenschaft. Ansonsten war sie ein mittelgroßes, eher dünnes, aber kräftiges und wohlgeformtes Mädchen, und ihr Gesicht war ihr Schwachpunkt. Es war ein dünnes, blondes, unauffälliges Gesicht mit blassen Augen und einer Nase, die einen Hauch zu lang war; wenn man genau hinsah, konnte man Krähenfüße um die Augen herum erkennen, und der Mund sah, wenn er sich in Ruheposition befand, müde aus. Noch war es kein altjüngferliches Gesicht, aber in ein paar Jahren würde es das ganz sicher sein. Dennoch hielten Fremde sie aufgrund des fast kindlich ernsten Ausdrucks in ihren Augen für einige Jahre jünger als sie tatsächlich war (sie war nicht ganz achtundzwanzig). Ihr linker Unterarm war mit winzigen roten Flecken übersät, die wie Insektenstiche aussahen.
Dorothy zog wieder ihr Nachthemd an und putzte sich die Zähne – mit klarem Wasser natürlich; vor dem Frühstück sollte man besser keine Zahnpasta benutzen. Schließlich ist man entweder beim Fasten oder nicht. Da haben die R.C.s völlig recht – und selbst als sie das tat, geriet sie plötzlich ins Stocken und hielt inne. Sie legte ihre Zahnbürste hin. Ein tödlicher Schmerz, ein tatsächlicher körperlicher Schmerz, war durch ihre Eingeweide gefahren.
Sie erinnerte sich mit dem hässlichen Schock, mit dem man sich morgens an etwas Unangenehmes erinnert, an die Rechnung bei Cargill, dem Metzger, die seit sieben Monaten offen war. Diese gefürchtete Rechnung – sie könnte neunzehn oder sogar zwanzig Pfund betragen, und es bestand kaum die geringste Hoffnung, sie zu bezahlen – war eine der größten Qualen ihres Lebens. Zu jeder Tages- und Nachtzeit lauerte sie gleich um die Ecke ihres Bewusstseins, bereit, sich auf sie zu stürzen und sie zu quälen; und mit ihr kam die Erinnerung an eine Reihe kleinerer Rechnungen, die sich zu einer Summe auftürmten, an die sie nicht einmal denken wollte. Fast unwillkürlich begann sie zu beten: „Bitte, Gott, lass Cargill heute nicht wieder seine Rechnung schicken!“ Aber im nächsten Moment entschied sie, dass dieses Gebet weltlich und blasphemisch war, und sie bat um Vergebung dafür. Dann zog sie ihren Morgenmantel an und rannte in die Küche, in der Hoffnung, die Rechnung aus dem Kopf zu bekommen.
Das Feuer war wie immer ausgegangen. Dorothy legte es neu an, wobei sie sich die Hände mit Kohlenstaub beschmutzte, goss erneut Kerosin nach und wartete gespannt, bis der Kessel kochte. Vater erwartete, dass sein Rasierwasser um Viertel nach sechs fertig war. Mit nur sieben Minuten Verspätung nahm Dorothy die Kanne mit nach oben und klopfte an die Tür ihres Vaters.
„Komm rein, komm rein!“, sagte eine gedämpfte, gereizte Stimme.
Der Raum, der mit schweren Vorhängen verhangen war, war stickig und roch nach einem männlichen Duft. Der Rektor hatte die Kerze auf seinem Nachttisch angezündet und lag auf der Seite, während er auf seine goldene Uhr schaute, die er gerade unter seinem Kopfkissen hervorgezogen hatte. Sein Haar war so weiß und dicht wie Distelwolle. Ein dunkles, helles Auge blickte gereizt über seine Schulter zu Dorothy.
„Guten Morgen, Vater.“
„Ich wünschte, Dorothy“, sagte der Rektor undeutlich – seine Stimme klang immer gedämpft und senil, bis er seine dritten Zähne eingesetzt hatte –, „du würdest dich bemühen, Ellen morgens aus dem Bett zu bekommen. Oder selbst ein wenig pünktlicher sein.“
„Es tut mir so leid, Vater. Das Küchenfeuer ist immer wieder ausgegangen.“
„Na gut! Stell es auf den Frisiertisch. Stell es ab und zieh die Vorhänge zu.“
Es war jetzt helllichter Tag, aber ein trüber, bewölkter Morgen. Dorothy eilte in ihr Zimmer und zog sich mit der blitzschnellen Geschwindigkeit an, die sie an sechs von sieben Morgen für notwendig hielt. Es gab nur ein winziges Stück Spiegel im Zimmer, und selbst das benutzte sie nicht. Sie hängte sich einfach ihr goldenes Kreuz um den Hals – ein schlichtes goldenes Kreuz, bitte keine Kruzifixe! –, drehte ihr Haar zu einem Knoten nach hinten, steckte ein paar Haarnadeln eher nachlässig hinein und zog sich ihre Kleidung (grauer Jersey, abgetragener irischer Tweedmantel und -rock, Strümpfe, die nicht ganz zu Mantel und Rock passten, und viel getragene braune Schuhe) in etwa drei Minuten an. Sie musste vor der Kirche noch das Esszimmer und das Arbeitszimmer ihres Vaters „aufräumen“ und ihre Gebete zur Vorbereitung auf die Heilige Kommunion sprechen, was nicht weniger als zwanzig Minuten dauerte.
Als sie ihr Fahrrad am Morgen durch das Eingangstor schob, war der Himmel noch bedeckt und das Gras vom Morgentau durchnässt. Durch den Nebel, der den Hang umgab, ragte die St. Athelstan's Church schemenhaft wie eine bleierne Sphinx empor, und ihre einzige Glocke läutete trauervoll boom! boom! boom! Nur eine der Glocken war jetzt in Gebrauch; die anderen sieben waren aus ihrem Käfig gelöst worden und lagen seit drei Jahren still da, wobei sie langsam den Boden des Glockenturms unter ihrem Gewicht zersplitterten. In der Ferne, aus dem Nebel unten, konnte man das abstoßende Klappern der Glocke in der R.C.-Kirche hören – ein hässliches, billiges, blechernes kleines Ding, das der Rektor von St. Athelstan's gerne mit einer Muffin-Glocke verglich.
Dorothy schwang sich auf ihr Fahrrad und fuhr, sich über den Lenker beugend, schnell den Hügel hinauf. Die Brücke ihrer schmalen Nase war in der morgendlichen Kälte rosa. Ein Rotschenkel pfiff über ihr, unsichtbar gegen den bewölkten Himmel. Früh am Morgen soll mein Lied zu dir aufsteigen! Dorothy lehnte ihr Fahrrad gegen das Friedhofstor und, da ihre Hände immer noch grau von Kohlenstaub waren, kniete sie nieder und schrubbte sie im langen, nassen Gras zwischen den Gräbern sauber. Dann hörte die Glocke auf zu läuten, und sie sprang auf und eilte in die Kirche, gerade als Proggett, der Küster, in zerrissener Soutane und riesigen Arbeiterstiefeln den Gang hinaufstapfte, um seinen Platz am Seitenaltar einzunehmen.
Die Kirche war sehr kalt, es roch nach Kerzenwachs und altem Staub. Es war eine große Kirche, viel zu groß für ihre Gemeinde, und baufällig und mehr als halb leer. Die drei schmalen Inseln mit den Kirchenbänken erstreckten sich kaum über die halbe Länge des Kirchenschiffs, und dahinter lagen große Flächen mit nacktem Steinboden, auf denen ein paar abgenutzte Inschriften die Standorte alter Gräber markierten. Das Dach über dem Chorraum war sichtbar durchgesackt; neben dem Spendenkasten erklärten zwei durchlöcherte Balkenfragmente stumm, dass dies auf den Todfeind der Christenheit, den Totengräber, zurückzuführen war. Das Licht drang blass gefiltert durch die Fenster aus farblosem Glas. Durch die offene Südtür konnte man eine zerlumpte Zypresse und die Äste einer Linde sehen, die in der sonnenlosen Luft gräulich aussahen und sich leicht im Wind wiegten.
Wie üblich gab es nur eine weitere Kommunikantin – die alte Fräulein Mayfill von The Grange. Die Teilnahme an der Heiligen Kommunion war so schlecht, dass der Pfarrer nicht einmal Jungen dazu bewegen konnte, ihm zur Seite zu stehen, außer am Sonntagmorgen, wenn die Jungen gerne in ihren Soutanen und Chorhemden vor der Gemeinde angeben. Dorothy setzte sich in die Kirchenbank hinter Fräulein Mayfill und schob als Buße für eine Sünde von gestern das Sitzkissen beiseite und kniete sich auf die nackten Steine. Der Gottesdienst begann. Der Rektor, in Soutane und kurzem Leinengewand, sprach die Gebete mit einer schnellen, geübten Stimme, die jetzt, da er seine Zähne einsetzte, klar genug war, und seltsam unfreundlich. In seinem anspruchsvollen, gealterten Gesicht, blass wie eine Silbermünze, lag ein Ausdruck von Distanziertheit, fast von Verachtung. „Dies ist ein gültiges Sakrament“, schien er zu sagen, „und es ist meine Pflicht, es euch zu verabreichen. Aber denkt daran, dass ich nur euer Priester bin, nicht euer Freund. Als Mensch mag ich euch nicht und verachte euch.“ Proggett, der Küster, ein Mann von vierzig Jahren mit lockigem grauem Haar und einem roten, gequälten Gesicht, stand geduldig daneben, verständnislos, aber ehrfürchtig, und spielte mit der kleinen Glocke, die in seinen riesigen roten Händen verloren wirkte.
Dorothy presste die Finger gegen die Augen. Es war ihr noch nicht gelungen, ihre Gedanken zu sammeln – tatsächlich bereitete ihr die Erinnerung an Cargills Rechnung immer noch zeitweise Sorgen. Die Gebete, die sie auswendig kannte, strömten unbeachtet durch ihren Kopf. Sie hob für einen Moment die Augen und begann sofort, umherzuschweifen. Zuerst nach oben zu den kopflosen Dachengeln, an deren Hälsen man noch die Sägeschnitte der puritanischen Soldaten sehen konnte, andererseits wieder zurück zu Fräulein Mayfields schwarzem, an eine Schweinskopfsülze erinnernden Hut und ihren zitternden Jet-Ohrringen. Fräulein Mayfill trug einen langen, muffigen schwarzen Mantel mit einem kleinen Kragen aus fettig aussehendem Astrachan, der seit Dorothys Erinnerung derselbe war. Er war aus einem sehr eigenartigen Stoff, wie durchnässte Seide, aber gröber, mit schwarzen Rinnsalen, die in keinem erkennbaren Muster über den ganzen Mantel wanderten. Es könnte sogar dieser legendäre und sprichwörtliche Stoff sein, schwarzer Bombasin. Fräulein Mayfill war sehr alt, so alt, dass sie niemand anders als eine alte Frau in Erinnerung hatte. Ein schwacher Duft ging von ihr aus – ein ätherischer Duft, der sich in Eau de Cologne, Mottenkugeln und einem Hauch von Gin analysieren ließ.
Dorothy zog eine lange Stecknadel mit Glaskopf aus dem Revers ihres Mantels und drückte die Spitze heimlich, im Schutz von Fräulein Mayfields Rücken, gegen ihren Unterarm. Ihr Fleisch kribbelte vor Besorgnis. Sie hatte es sich zur Regel gemacht, sich jedes Mal, wenn sie dabei ertappte, nicht ihren Gebeten zu folgen, so fest in den Arm zu stechen, dass Blut herauskam. Das war ihre Art der Selbstdisziplin, ihr Schutz gegen Respektlosigkeit und gotteslästerliche Gedanken.
Mit der Nadel in Bereitschaft gelang es ihr für einige Momente, konzentrierter zu beten. Ihr Vater warf Fräulein Mayfill, die sich in Abständen bekreuzigte, einen missbilligenden Blick zu, eine Praxis, die er nicht mochte. Draußen schwatzte ein Star. Mit einem Schreck stellte Dorothy fest, dass sie prahlerisch auf die Falten des Messgewandes ihres Vaters schaute, das sie selbst vor zwei Jahren genäht hatte. Sie biss die Zähne zusammen und stach sich die Nadel einen halben Zentimeter tief in den Arm.
Sie knieten wieder. Es war das Allgemeine Schuldbekenntnis. Dorothy rief ihre Blicke zurück – die, ach!, schon wieder abgeschweift waren, diesmal zu dem Buntglasfenster zu ihrer Rechten, entworfen von Sir Warde Tooke, A.R.A., im Jahre 1851, das den heiligen Athelstan bei seiner Begrüßung am Himmelstor durch Gabriel und eine Legion von Engeln zeigte, die einander allesamt auffallend ähnlich sahen – und dem Prinzgemahl. Sie drückte die Nadelspitze gegen eine andere Stelle ihres Arms. Gewissenhaft begann sie, über die Bedeutung jeder einzelnen Wendung des Gebets zu meditieren, und brachte so ihren Geist wieder in einen aufmerksamen Zustand zurück. Doch selbst dann war sie beinahe gezwungen, die Nadel erneut zu benutzen, als Proggett mitten in „Darum loben wir mit Engeln und Erzengeln“ das Glöckchen erklingen ließ – denn sie wurde, wie stets, von einer entsetzlichen Versuchung heimgesucht, bei dieser Stelle in Lachen auszubrechen. Der Grund war eine Geschichte, die ihr Vater ihr einst erzählt hatte: wie er als kleiner Junge dem Priester am Altar gedient hatte, und das Kommunionglockchen einen aufschraubbaren Klöppel besaß, der sich gelockert hatte; und wie der Priester dann gesagt hatte: „Darum loben wir mit Engeln und Erzengeln und mit dem ganzen himmlischen Heer Deinen herrlichen Namen, und preisen Dich immerdar und sprechen: Schraub ihn fest, du kleiner Dummkopf, schraub ihn fest!“
Als der Rektor die Weihe beendete, begann Fräulein Mayfill sich mit äußerster Mühe und Langsamkeit aufzurappeln, wie ein zusammenhangloses Wesen aus Holz, das sich abschnittsweise aufrichtet und bei jeder Bewegung einen kräftigen Hauch von Mottenkugeln verströmt. Es gab ein außergewöhnliches Knarren – vermutlich von ihrer Stütze, aber es war ein Geräusch, als würden Knochen aneinander reiben. Man hätte meinen können, dass sich in dem schwarzen Mantel nur ein trockenes Skelett befand.
Dorothy blieb noch einen Moment länger auf den Beinen. Fräulein Mayfill schlich mit langsamen, schwankenden Schritten auf den Altar zu. Sie konnte kaum gehen, aber sie nahm es bitter übel, wenn man ihr Hilfe anbot. In ihrem alten, blassen Gesicht war ihr Mund überraschend groß, schlaff und feucht. Die Unterlippe, vom Alter herabhängend, sabberte nach vorne und legte einen Streifen Zahnfleisch und eine Reihe falscher Zähne frei, die so gelb waren wie die Tasten eines alten Klaviers. Auf der Oberlippe wuchs ein dunkler, feuchter Schnurrbart. Es war kein appetitlicher Mund; nicht die Art von Mund, aus dem man gerne aus seiner Tasse trinken würde. Plötzlich, spontan, als hätte der Teufel selbst es ihr in den Mund gelegt, rutschte Dorothy das Gebet über die Lippen: „Oh Gott, lass mich nicht den Kelch nach Fräulein Mayfill nehmen müssen!“
Im nächsten Moment begriff sie vor Entsetzen, was sie gesagt hatte, und wünschte sich, sie hätte sich auf die Zunge gebissen, anstatt diese tödliche Gotteslästerung direkt auf den Altarstufen auszusprechen. Sie zog die Nadel wieder aus ihrem Revers und stieß sie sich so fest in den Arm, dass sie nur mit Mühe einen Schmerzensschrei unterdrücken konnte. Dann trat sie zum Altar und kniete sich demütig links von Fräulein Mayfill nieder, um ganz sicherzugehen, dass sie den Kelch nach ihr nehmen würde.
Sie kniete nieder, den Kopf gebeugt und die Hände auf den Knien gefaltet, und begann schnell, um Vergebung zu beten, bevor ihr Vater sie mit der Hostie erreichen würde. Aber der Strom ihrer Gedanken war unterbrochen worden. Plötzlich war es völlig sinnlos, zu beten; ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Gebete hatten weder Herz noch Bedeutung. Sie konnte Proggetts Stiefel schlurfen hören und die klare, leise Stimme ihres Vaters murmeln hören: „Nimm und iss.“ Sie konnte den abgenutzten roten Teppichstreifen unter ihren Knien sehen, sie konnte Staub, Eau de Cologne und Mottenkugeln riechen; aber vom Leib und Blut Christi, von dem Zweck, für den sie hierher gekommen war, war ihr die Denkfähigkeit wie genommen. Eine tödliche Leere war in ihren Geist eingekehrt. Es schien ihr, als könne sie tatsächlich nicht beten. Sie rang mit sich, sammelte ihre Gedanken, sprach mechanisch die ersten Sätze eines Gebets aus; aber sie waren nutzlos, bedeutungslos – nichts als die leeren Hülsen von Worten. Ihr Vater hielt die Hostie in seiner wohlgeformten, gealterten Hand vor ihr. Er hielt sie zwischen Finger und Daumen, penibel, irgendwie geschmacklos, als wäre es ein Löffel mit Medizin. Sein Blick war auf Fräulein Mayfill gerichtet, die sich wie eine geometrische Raupe mit vielen Knirschen krümmte und sich so kunstvoll bekreuzigte, dass man meinen könnte, sie würde eine Reihe von Zopffröschen auf die Vorderseite ihres Mantels zeichnen. Einige Sekunden lang zögerte Dorothy und nahm die Oblate nicht. Sie wagte es nicht, sie zu nehmen. Es war besser, weitaus besser, vom Altar herunterzusteigen, als das Abendmahl mit einem solchen Chaos im Herzen zu empfangen!
Dann geschah es, dass sie einen Seitenblick durch die offene Südtür warf. Ein Sonnenstrahl hatte für einen Moment die Wolken durchbrochen. Er fiel durch die Blätter der Linden nach unten und ein Blattwerk in der Tür leuchtete mit einem vergänglichen, unvergleichlichen Grün, grüner als Jade, Smaragd oder atlantisches Wasser. Es war, als ob ein Juwel von unvorstellbarer Pracht für einen Augenblick aufblitzte, die Tür mit grünem Licht erfüllte und dann verblasste. Dorothy fühlte eine Welle der Freude in ihrem Herzen aufsteigen. Der Blitz lebendiger Farbe hatte ihr auf eine tiefere Weise als durch den Verstand ihren Seelenfrieden, ihre Liebe zu Gott und ihre Fähigkeit zur Anbetung zurückgegeben. Irgendwie war es durch das Grün der Blätter wieder möglich zu beten. O all ihr grünen Dinge auf Erden, lobet den Herrn! Sie begann zu beten, inbrünstig, freudig, dankbar. Die Hostie schmolz auf ihrer Zunge. Sie nahm den Kelch von ihrem Vater und kostete ohne Ekel, ja, sie empfand sogar eine zusätzliche Freude an diesem kleinen Akt der Selbsterniedrigung, als sie den feuchten Abdruck von Fräulein Mayfields Lippen auf dem silbernen Rand schmeckte.
II
Die Kirche St. Athelstan's Church stand auf dem höchsten Punkt des Knype Hill, und wenn man den Turm hinaufstieg, konnte man etwa zehn Meilen weit über das Umland sehen. Nicht, dass es etwas zu sehen gegeben hätte – nur die flache, kaum hügelige Landschaft von East Anglia, die im Sommer unerträglich langweilig war, aber im Winter durch das wiederkehrende Muster der Ulmen, die nackt und fächerförmig gegen den bleiernen Himmel standen, wieder gut gemacht wurde.
Direkt unter einem lag die Stadt, durch die die Straße in Ost-West-Richtung verlief und sie ungleich teilte. Der südliche Teil der Stadt war der alte, landwirtschaftlich geprägte und respektable Teil. Auf der Nordseite befanden sich die Gebäude der Blifil-Gordon-Zuckerrübenraffinerie, und rundherum und zu ihnen hin führten wirre Reihen abscheulicher gelber Backsteinhäuser, die größtenteils von den Fabrikarbeitern bewohnt wurden. Die Fabrikarbeiter, die mehr als die Hälfte der zweitausend Einwohner der Stadt ausmachten, waren Neuankömmlinge, Stadtbewohner und fast ausnahmslos gottlos.
Die beiden Dreh- und Angelpunkte, um die sich das gesellschaftliche Leben der Stadt drehte, waren der konservative Klub von Knype Hill (mit voller Schanklizenz), aus dessen Erkerfenster – zu jeder Zeit nach Öffnung der Bar – die großen, rosigen Gesichter der städtischen Elite wie pausbäckige Goldfische hinter einer Aquarienscheibe hervorlugten; und das Ye Olde Tea Shoppe, ein Stück weiter die Hauptstraße hinunter, der wichtigste Treffpunkt der Damen von Knype Hill. Wer zwischen zehn und elf Uhr vormittags nicht im Ye Olde Tea Shoppe erschien, um seinen „Morgenkaffee“ zu trinken und eine halbe Stunde oder so in jenem angenehmen Gezwitscher der oberen Mittelschicht zu verweilen („Meine Liebe, er hatte neun Pik bis zum Ass-Dame und ging auf ein Sans Atout, stell dir das vor. Was, meine Liebe, du willst doch nicht etwa sagen, du bezahlst schon wieder meinen Kaffee? Ach, aber, meine Liebe, das ist einfach zu reizend von dir! Morgen aber, da bestehe ich darauf, deinen zu bezahlen. Und sieh dir nur den lieben kleinen Toto an, wie er da sitzt und so ein gescheites kleines Männchen ist, mit seinem kleinen schwarzen Näschen, das so wackelt, und ja, das würde er, der süße Schatz, das würde er, das würde er, und seine Mama würde ihm ein Stück Zucker geben, das würde sie, das würde sie. Da, Toto!“), der war definitiv aus der Gesellschaft von Knype Hill ausgeschlossen. Der Rektor nannte diese Damen in seiner säuerlichen Art „die Kaffeebrigade“. In der Nähe der Kolonie von scheinbar malerischen Villen, die von der Kaffeebrigade bewohnt wurden, jedoch durch ein größeres Grundstück von ihnen getrennt, lag The Grange, das Haus von Fräulein Mayfill. Es war ein merkwürdiges, mit Zinnen versehenes, nachgeahmtes Schloss aus dunkelrotem Backstein – eine sogenannte „Folly“, erbaut um 1870 – und glücklicherweise fast vollständig von dichtem Gebüsch verborgen.
Das Pfarrhaus befand sich auf halber Höhe des Hügels, mit der Vorderseite zur Kirche und der Rückseite zur Hauptstraße. Es war ein Haus aus dem falschen Zeitalter, unpraktisch groß und mit einem gelblichen Putz versehen, der ständig abblätterte. Ein früherer Pfarrer hatte an einer Seite ein großes Gewächshaus angebaut, das Dorothy als Arbeitszimmer nutzte, das aber ständig reparaturbedürftig war. Der Vorgarten war mit zerlumpten Tannen und einer großen, ausladenden Esche übersät, die den Schatten auf die vorderen Räume warf und es unmöglich machte, Blumen zu züchten. Auf der Rückseite befand sich ein großer Gemüsegarten. Proggett übernahm das schwere Graben im Garten im Frühjahr und Herbst, und Dorothy übernahm das Säen, Pflanzen und Jäten in ihrer Freizeit, so gut es eben ging; trotzdem war der Gemüsegarten normalerweise ein undurchdringlicher Dschungel aus Unkraut.
Dorothy sprang vom Fahrrad am Eingangstor ab, an dem eine übereifrige Person ein Plakat mit der Aufschrift „Wählt Blifil-Gordon und höhere Löhne!“ angebracht hatte (es fand eine Nachwahl statt und Herr Blifil-Gordon stand auf der Tribüne der Konservativen). Als Dorothy die Haustür öffnete, sah sie zwei Briefe auf der abgenutzten Kokosmatte liegen. Einer war vom Dekan des Landbezirks und der andere war ein fieser, dünn aussehender Brief von Catkin & Palm, den Schneidern ihres Vaters. Es war zweifellos eine Rechnung. Der Rektor hatte seine übliche Praxis befolgt, die Briefe, die ihn interessierten, zu sammeln und die anderen liegen zu lassen. Dorothy bückte sich gerade, um die Briefe aufzuheben, als sie mit einem schrecklichen Schreck der Bestürzung einen unfrankierten Umschlag in der Briefklappe stecken sah.
Es war eine Rechnung – ganz sicher eine Rechnung! Außerdem „wusste“ sie, sobald sie ihn sah, dass es die schreckliche Rechnung von Cargills, dem Metzger, war. Ein flaues Gefühl breitete sich in ihrem Inneren aus. Für einen Moment begann sie tatsächlich zu beten, dass es nicht die Rechnung von Cargill sein könnte – dass es nur die Rechnung für drei und neun von Solepipe, dem Tuchmacher, sein könnte, oder die Rechnung von der International oder dem Bäcker oder der Molkerei – alles, nur nicht die Rechnung von Cargill! Dann, als sie ihre Panik überwunden hatte, nahm sie den Umschlag aus dem Briefschlitz und riss ihn mit einer krampfartigen Bewegung auf.
„Zur Abrechnung: 21,7 Schilling und9 Pence.“
Dies war in der harmlosen Handschrift von Herrn Cargills Buchhalter geschrieben. Darunter jedoch stand in dicken, anklagend aussehenden Buchstaben, die stark unterstrichen waren: „Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Rechnung schon sehr lange offen ist. Eine möglichst baldige Begleichung wäre sehr freundlich. S. Cargill.“
Dorothy war noch blasser geworden und spürte, dass sie kein Frühstück wollte. Sie steckte die Rechnung in ihre Tasche und ging ins Esszimmer. Es war ein kleiner, dunkler Raum, der dringend neu tapeziert werden musste, und wie jeder andere Raum im Pfarrhaus wirkte er, als sei er mit dem zusammengewürfelten Mobiliar eines Antiquitätenladens eingerichtet worden. Die Möbel waren „gut“, aber irreparabel ramponiert, und die Stühle waren so von Würmern zerfressen, dass man nur dann sicher darauf sitzen konnte, wenn man ihre individuellen Schwächen kannte. An den Wänden hingen alte, dunkle, unkenntlich gemachte Stahlstiche, von denen einer – ein Stich von Van Dycks Porträt von Karl I. – wahrscheinlich von Wert gewesen wäre, wenn er nicht durch Feuchtigkeit ruiniert worden wäre.
Der Rektor stand vor dem leeren Kamin, wärmte sich an einem imaginären Feuer und las einen Brief, der aus einem langen blauen Umschlag kam. Er trug immer noch seine Soutane aus schwarzer, gewässerter Seide, die perfekt zu seinem dicken weißen Haar und seinem blassen, feinen, nicht allzu freundlichen Gesicht passte. Als Dorothy hereinkam, legte er den Brief beiseite, zog seine goldene Uhr heraus und musterte sie bedeutungsvoll.
„Ich fürchte, ich bin etwas spät dran, Vater.“
„Ja, Dorothy, du bist etwas spät dran“, sagte der Rektor und wiederholte ihre Worte mit zarter, aber deutlicher Betonung. „Du bist zwölf Minuten zu spät, um genau zu sein. Glaubst du nicht, Dorothy, dass es besser wäre, wenn du es schaffst, zum Frühstück zu kommen, ohne ein bisschen zu spät zu kommen, wenn ich um Viertel nach sechs aufstehen muss, um die Heilige Kommunion zu feiern, und dann sehr müde und hungrig nach Hause komme?“
Es war klar, dass der Rektor in einer, wie Dorothy es euphemistisch nannte, „unangenehmen Stimmung“ war. Er hatte eine dieser müden, kultivierten Stimmen, die nie wirklich wütend und nie auch nur annähernd gut gelaunt sind – eine dieser Stimmen, die die ganze Zeit zu sagen scheinen: „Ich kann wirklich nicht verstehen, warum du so einen Aufstand machst!“ Er machte den Eindruck, als würde er ständig unter der Dummheit und Langweiligkeit anderer Menschen leiden.
„Es tut mir so leid, Vater! Ich musste einfach nach Frau Tawney fragen.“ (Frau Tawney war die „Frau T“ auf der „Memos-Liste“. „Ihr Baby wurde letzte Nacht geboren, und sie hat mir versprochen, dass sie nach der Geburt zur Kirche kommt. Aber natürlich wird sie das nicht tun, wenn sie denkt, dass wir uns nicht für sie interessieren. Du weißt ja, wie diese Frauen sind – sie scheinen es so sehr zu hassen, zur Kirche zu gehen. Sie werden nie kommen, wenn ich sie nicht dazu überrede.“
Der Rektor grunzte nicht wirklich, aber er stieß einen kleinen unzufriedenen Laut aus, als er sich zum Frühstückstisch bewegte. Damit wollte er erstens sagen, dass es Frau Tawneys Pflicht war, ohne Dorothys Zureden zum Kirchgang zu kommen, und zweitens, dass Dorothy ihre Zeit nicht damit verschwenden sollte, das ganze Gesindel der Stadt zu besuchen, schon gar nicht vor dem Frühstück. Frau Tawney war die Frau eines Arbeiters und lebte in einem Teil der Gemeinde, der nördlich der Hauptstraße lag. Der Pfarrer legte die Hand auf die Stuhllehne und warf Dorothy einen Blick zu, der bedeutete: „Sind wir jetzt bereit? Oder gibt es noch mehr Verzögerungen?“
„Ich glaube, es ist alles da, Vater“, sagte Dorothy. „Vielleicht könntest du einfach das Tischgebet sprechen ...“
„Benedictus benedicat“, sagte der Rektor und hob die abgegriffene silberne Decke vom Frühstücksteller. Die silberne Decke war, wie der vergoldete Marmeladenlöffel, ein Familienerbstück; die Messer und Gabeln und der Großteil des Geschirrs stammten von Woolworth. „Schon wieder Speck, wie ich sehe“, fügte der Rektor hinzu und betrachtete die drei Minuten alten, zusammengerollten Scheiben auf den gebratenen Brotstücken.
„Mehr haben wir leider nicht im Haus“, sagte Dorothy.
Der Rektor nahm seine Gabel zwischen Daumen und Zeigefinger und drehte mit einer sehr zarten Bewegung, als würde er Mikado spielen, eine der Speckscheiben um.
„Ich weiß natürlich“, sagte er, „dass Speck zum Frühstück eine englische Institution ist, die fast so alt ist wie die parlamentarische Regierung. Aber denkst du nicht, dass wir gelegentlich etwas anderes essen könnten, Dorothy?“
„Speck ist jetzt so billig“, sagte Dorothy bedauernd. „Es wäre eine Sünde, ihn nicht zu kaufen. Das Pfund hat nur fünf Pence gekostet, und ich habe Speck gesehen, der ganz anständig aussah und nur drei Pence gekostet hat.“
„Ah, dänisch, nehme ich an? Was für eine Vielzahl dänischer Invasionen wir in diesem Land schon erlebt haben! Zuerst mit Feuer und Schwert und jetzt mit ihrem abscheulichen billigen Speck. Was wohl für mehr Todesfälle verantwortlich ist?“
Nach diesem Witz fühlte sich der Rektor etwas besser, ließ sich in seinem Stuhl nieder und machte sich aus dem verhassten Speck ein recht gutes Frühstück, während Dorothy (sie hatte heute Morgen keinen Speck gegessen – eine Buße, die sie sich gestern dafür auferlegt hatte, dass sie „Verdammt“ gesagt und nach dem Mittagessen eine halbe Stunde lang nichts getan hatte) über einen guten Gesprächseinstieg nachdachte.
Vor ihr lag eine unsagbar hasserfüllte Aufgabe – eine Geldforderung. Selbst in den besten Zeiten war es so gut wie unmöglich, Geld von ihrem Vater zu bekommen, und es war offensichtlich, dass er an diesem Morgen noch „schwieriger“ sein würde als sonst. „Schwierig“ war ein weiterer Euphemismus von ihr. Er hat wohl schlechte Nachrichten, dachte sie verzweifelt, als sie den blauen Umschlag betrachtete.
Wahrscheinlich hätte niemand, der jemals länger als zehn Minuten mit dem Rektor gesprochen hatte, bestritten, dass er ein „schwieriger“ Mensch war. Das Geheimnis seiner fast unfehlbaren schlechten Laune lag in der Tatsache, dass er ein Anachronismus war. Er hätte nie in die moderne Welt hineingeboren werden dürfen; ihre ganze Atmosphäre widert ihn an und macht ihn wütend. Ein paar Jahrhunderte früher, als ein glücklicher Pluralist, der Gedichte schrieb oder Fossilien sammelte, während Vikare mit 40 Pfund im Jahr seine Pfarreien verwalteten, wäre er vollkommen zu Hause gewesen. Selbst jetzt, wenn er ein reicherer Mann gewesen wäre, könnte er sich damit trösten, das zwanzigste Jahrhundert aus seinem Bewusstsein auszuschließen. Aber in vergangenen Zeiten zu leben, ist sehr teuer; man kann es nicht mit weniger als zweitausend im Jahr tun. Der Rektor, der aufgrund seiner Armut an das Zeitalter Lenins und der Daily Mail gebunden war, befand sich in einem Zustand chronischer Verzweiflung, die er nur allzu natürlich an der Person ausließ, die ihm am nächsten stand – normalerweise also an Dorothy.
Er war 1871 als jüngerer Sohn des jüngeren Sohns eines Barons geboren worden und war aus dem veralteten Grund, dass die Kirche der traditionelle Beruf für jüngere Söhne ist, in die Kirche eingetreten. Seine erste Stelle als Pfarrer hatte er in einer großen, heruntergekommenen Gemeinde im Osten Londons angetreten – ein übler, rüpelhafter Ort, und er blickte mit Abscheu darauf zurück. Schon damals gerieten die unteren Klassen (wie er sie zu nennen pflegte) entschieden außer Kontrolle. Es war etwas besser, als er als leitender Vikar an einem abgelegenen Ort in Kent tätig war (Dorothy war in Kent geboren), wo die anständig unterdrückten Dorfbewohner noch vor dem „Pfarrer“ den Hut zogen. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits geheiratet, und seine Ehe war teuflisch unglücklich; und weil Geistliche sich nicht mit ihren Frauen streiten dürfen, war das Unglück geheim und daher zehnmal schlimmer. Er war 1908 im Alter von siebenunddreißig Jahren und mit einem unheilbar verdorbenen Temperament nach Knype Hill gekommen – ein Temperament, das dazu geführt hatte, dass er sich jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in der Gemeinde entfremdet hatte.
Es war nicht so, dass er ein schlechter Priester war, nur als Priester. Bei seinen rein klerikalen Pflichten war er gewissenhaft korrekt – vielleicht ein wenig zu korrekt für eine ostanglische Gemeinde der Low Church. Er leitete seine Gottesdienste mit perfektem Geschmack, hielt bewundernswerte Predigten und stand jeden Mittwoch und Freitag zu unangenehmen Morgenstunden auf, um die Heilige Kommunion zu feiern. Aber dass ein Geistlicher auch Pflichten außerhalb der vier Wände der Kirche hat, war ihm nie ernsthaft in den Sinn gekommen. Da er sich keinen Vikar leisten konnte, überließ er die Drecksarbeit der Gemeinde ganz seiner Frau und nach ihrem Tod (sie starb 1921) Dorothy. Die Leute sagten boshaft und fälschlicherweise, dass er Dorothy seine Predigten für ihn hätte halten lassen, wenn es möglich gewesen wäre. Die „unteren Schichten“ hatten von Anfang an verstanden, wie er ihnen gegenüber eingestellt war, und wenn er ein reicher Mann gewesen wäre, hätten sie ihm wahrscheinlich nach ihrer Sitte die Stiefel geleckt; so aber hassten sie ihn nur. Nicht, dass es ihn gekümmert hätte, ob sie ihn hassten oder nicht, denn er war sich ihrer Existenz größtenteils nicht bewusst. Aber auch mit den oberen Schichten kam er nicht besser zurecht. Mit dem County hatte er sich nach und nach überworfen, und was den Kleinadel der Stadt anging, so verachtete er sie als Enkel eines Barons und machte kein Geheimnis daraus. In dreiundzwanzig Jahren war es ihm gelungen, die Gemeinde von St. Athelstan von sechshundert auf unter zweihundert zu reduzieren.
Dies lag nicht allein an persönlichen Gründen. Es hatte auch damit zu tun, dass der altmodische Hochanglikanismus, an dem der Rektor unbeirrbar festhielt, von einer Art war, die alle Parteien in der Gemeinde gleichermaßen verärgerte. Heutzutage hat ein Geistlicher, der seine Gemeinde behalten will, nur zwei Möglichkeiten. Entweder er bekennt sich ganz und gar zum Anglo-Katholizismus – oder besser gesagt: ganz, aber nicht gar so einfach –, oder er gibt sich kühn modern und aufgeschlossen und predigt tröstliche Sermone, in denen er beweist, dass es keine Hölle gibt und alle guten Religionen im Grunde dasselbe sind. Der Rektor tat weder das eine noch das andere. Einerseits hegte er die tiefste Verachtung für die anglo-katholische Bewegung. Sie war spurlos an ihm vorübergegangen; „Römisches Fieber“ nannte er sie. Andererseits war er den älteren Mitgliedern seiner Gemeinde zu „hochkirchlich“. Von Zeit zu Zeit jagte er ihnen beinahe den Verstand aus dem Leib, wenn er das verhängnisvolle Wort „katholisch“ gebrauchte – nicht nur an seinem geheiligten Platz im Glaubensbekenntnis, sondern auch von der Kanzel herab. Natürlich schrumpfte die Gemeinde von Jahr zu Jahr, und es waren die besten Leute, die zuerst gingen. Lord Pockthorne von Pockthorne Court, dem ein Fünftel der Grafschaft gehörte, Herr Leavis, der pensionierte Lederhändler, Sir Edward Huson von Crabtree Hall und jene Vertreter des niederen Landadels, die ein Automobil besaßen, hatten St. Athelstan’s allesamt den Rücken gekehrt. Die meisten fuhren sonntagmorgens nach Millborough, fünf Meilen entfernt. Millborough war eine Stadt mit fünftausend Einwohnern, und man hatte die Wahl zwischen zwei Kirchen: St. Edmund’s und St. Wedekind’s. St. Edmund’s war modernistisch – ein Zitat aus Blakes „Jerusalem“ prangte über dem Altar, und der Abendmahlswein wurde aus Likörgläsern gereicht – und St. Wedekind’s war anglo-katholisch und befand sich in einem Zustand ständiger Guerillakriegsführung mit dem Bischof. Doch Herr Cameron, der Sekretär des konservativen Klubs von Knype Hill, war zum römisch-katholischen Glauben übergetreten, und seine Kinder standen mitten im römisch-katholischen Literaturbetrieb. Man sagte, sie hätten einen Papagei, dem sie beibrachten, „Extra ecclesiam nulla salus“ zu sagen. Tatsächlich war niemand von Rang und Namen St. Athelstan’s treu geblieben – außer Fräulein Mayfill vom Grange. Fräulein Mayfill, so sagte sie, habe den Großteil ihres Vermögens der Kirche vermacht; unterdessen war sie jedoch nie dabei beobachtet worden, mehr als sechs Pence in den Klingelbeutel zu legen, und sie schien entschlossen, ewig zu leben.
Die ersten zehn Minuten des Frühstücks verliefen in völliger Stille. Dorothy versuchte, den Mut aufzubringen, um zu sprechen – offensichtlich musste sie irgendeine Art von Gespräch beginnen, bevor sie die Geldfrage stellte –, aber ihr Vater war kein Mann, mit dem man leicht Smalltalk führen konnte. Manchmal verfiel er in so tiefe Abstraktionen, dass man ihn kaum dazu bringen konnte, einem zuzuhören; ein anderes Mal war er allzu aufmerksam, hörte aufmerksam zu, was man sagte, und wies dann eher müde darauf hin, dass es nicht der Rede wert sei. Höfliche Plattitüden – über das Wetter und so weiter – riefen bei ihm im Allgemeinen Sarkasmus hervor. Dennoch beschloss Dorothy, es zuerst mit dem Wetter zu versuchen.
„Es ist ein seltsamer Tag, nicht wahr?“, sagte sie – obwohl sie sich der Sinnlosigkeit dieser Bemerkung bewusst war, als sie sie machte.
„Was ist so komisch?“, fragte der Rektor.
„Na ja, ich meine, heute Morgen war es so kalt und neblig, und jetzt ist die Sonne herausgekommen und es ist ganz schön geworden.“
„Ist daran irgendetwas besonders Lustiges?“
Das war natürlich nicht gut. Er musste schlechte Nachrichten haben, dachte sie. Sie versuchte es wieder.
„Ich wünschte, du würdest dir irgendwann einmal die Dinge im Hintergarten ansehen, Vater. Die Stangenbohnen gedeihen so prächtig! Die Schoten werden über einen Fuß lang. Ich werde natürlich die besten für das Erntedankfest aufheben. Ich dachte, es würde so schön aussehen, wenn wir die Kanzel mit Girlanden aus Stangenbohnen und ein paar dazwischen hängenden Tomaten schmücken würden.“
Das war ein Fauxpas. Der Rektor blickte mit einem Ausdruck tiefster Abscheu von seinem Teller auf.
„Meine liebe Dorothy“, sagte er scharf, „ist es notwendig, mir schon jetzt Sorgen wegen des Erntedankfestes zu machen?“
„Es tut mir leid, Vater!“, sagte Dorothy verlegen. „Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich dachte nur ...“
„Glaubst du, dass es mir Spaß macht, meine Predigt zwischen Girlanden aus Stangenbohnen halten zu müssen? Ich bin kein Gemüsehändler. Allein der Gedanke daran verdirbt mir den Appetit auf mein Frühstück. Wann soll das elende Ding stattfinden?“
„Am sechzehnten September, Vater.“
„Das ist in fast einem Monat. Um Himmels willen, lass mich das noch ein wenig vergessen! Ich nehme an, wir müssen diese lächerliche Angelegenheit einmal im Jahr abhalten, um die Eitelkeit jedes Hobbygärtners in der Gemeinde zu kitzeln. Aber lass uns nicht mehr darüber nachdenken, als unbedingt nötig ist.“
Der Rektor hatte, wie Dorothy sich hätte erinnern sollen, eine vollkommene Abscheu vor Erntedankfesten. Er hatte sogar einen wertvollen Gemeindemitglied verloren – einen Herrn Toagis, einen mürrischen pensionierten Gärtner – weil er es, wie er sagte, nicht mochte, seine Kirche als Imitation eines Marktstandes verkleidet zu sehen. Herr Toagis, ein geborener Nonkonformist, war nur deshalb bei der Kirche geblieben, weil er zum Erntedankfest den Seitenaltar mit einer Art Stonehenge aus riesigen Kürbissen schmücken durfte. Im Sommer zuvor war es ihm gelungen, einen perfekten Riesenkürbis zu züchten, ein feuerrotes Ungetüm, das so groß war, dass zwei Männer nötig waren, um es zu heben. Dieses monströse Objekt wurde im Chor platziert, wo es den Altar in den Schatten stellte und dem Ostfenster jegliche Farbe nahm. Egal, in welchem Teil der Kirche man stand, der Kürbis stach einem, wie man so schön sagt, ins Auge. Herr Toagis war ganz aus dem Häuschen. Er hielt sich zu jeder Tageszeit in der Kirche auf, unfähig, sich von seinem angebeteten Kürbis loszureißen, und brachte sogar Freunde mit, damit sie ihn bewundern konnten. Sein Gesichtsausdruck verriet, dass er Wordsworth auf der Westminster Bridge zitierte:
Die Erde hat nichts Schöneres zu bieten:Wer könnte aneinem so majestätischen Anblickvorbeigehen?
Dorothy hatte sogar die Hoffnung, ihn danach zur Heiligen Kommunion zu bewegen. Aber als der Rektor den Kürbis sah, wurde er ernsthaft wütend und befahl, „dieses abscheuliche Ding“ sofort zu entfernen. Herr Toagis war sofort „in die Kapelle gegangen“, und er und seine Erben waren für immer für die Kirche verloren.
Dorothy beschloss, einen letzten Versuch zu unternehmen, um ein Gespräch zu beginnen.
„Wir sind gerade dabei, die Kostüme für Charles den Ersten anzufertigen“, sagte sie. (Die Kinder der Kirchenschule probten ein Theaterstück mit dem Titel Charles I., um den Orgelfonds zu unterstützen.) „Aber ich wünschte, wir hätten etwas Einfacheres gewählt. Die Rüstung ist eine furchtbare Arbeit, und ich fürchte, die Stiefel werden noch schlimmer. Ich denke, nächstes Mal müssen wir wirklich ein römisches oder griechisches Stück aufführen. Etwas, bei dem sie nur Togas tragen müssen.“
Dies entlockte dem Rektor nur ein weiteres gedämpftes Grunzen. Schulaufführungen, Festumzüge, Basare, Flohmärkte und Benefizkonzerte waren in seinen Augen nicht ganz so schlimm wie Erntedankfeste, aber er tat nicht so, als würde er sich dafür interessieren. Sie seien notwendige Übel, pflegte er zu sagen. In diesem Moment stieß Ellen, die Magd, die Tür auf und kam unbeholfen ins Zimmer, wobei sie eine große, schuppige Hand an ihren Bauch hielt, um ihre Schürze festzuhalten. Sie war ein großes Mädchen mit runden Schultern, mausfarbenem Haar, einer klagenden Stimme und einem schlechten Teint, und sie litt chronisch an Ekzemen. Ihre Augen huschten besorgt zum Rektor, aber sie wandte sich an Dorothy, denn sie hatte zu viel Angst vor dem Rektor, um ihn direkt anzusprechen.
„Bitte, Fräulein ...“, begann sie.
„Ja, Ellen?“
„Bitte, Fräulein“, fuhr Ellen klagend fort, „Herr Porter ist in der Küche und er sagt, bitte könnte der Pfarrer vorbeikommen und das Baby von Frau Porter taufen? Weil sie nicht glauben, dass es den Tag überlebt, und es noch nicht getauft wurde, Fräulein.“
Dorothy stand auf. „Setz dich“, sagte der Pfarrer prompt, mit vollem Mund.
„Was glauben sie, ist mit dem Baby los?“, fragte Dorothy.
„Nun, Fräulein, es wird ganz schwarz. Und es hatte ganz schlimmen Durchfall.“
Der Rektor leerte mühsam seinen Mund. „Muss ich mir diese widerlichen Details anhören, während ich mein Frühstück esse?“, rief er aus. Er wandte sich an Ellen: „Schick Porter weg und sag ihm, dass ich um zwölf Uhr bei ihm zu Hause sein werde. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, warum die unteren Schichten immer die Essenszeiten wählen, um einen zu belästigen“, fügte er hinzu und warf Dorothy einen weiteren genervten Blick zu, als sie sich setzte.
Herr Porter war ein Arbeiter – ein Maurer, um genau zu sein. Die Ansichten des Rektors über die Taufe waren völlig in Ordnung. Wenn es dringend nötig gewesen wäre, wäre er zwanzig Meilen durch den Schnee gelaufen, um ein sterbendes Baby zu taufen. Aber er sah es nicht gern, wenn Dorothy auf Geheiß eines gewöhnlichen Maurers den Frühstückstisch verließ.
Während des Frühstücks wurde nicht mehr gesprochen. Dorothys Herz sank immer tiefer. Die Forderung nach Geld musste gestellt werden, und doch war es völlig offensichtlich, dass sie zum Scheitern verurteilt war. Nachdem er sein Frühstück beendet hatte, stand der Rektor vom Tisch auf und begann, seine Pfeife aus der Tabakdose auf dem Kaminsims zu stopfen. Dorothy sprach ein kurzes Gebet für Mut und kneifte sich dann in die Seite. Los, Dorothy! Raus damit! Bitte kein Funkeln! Mit Mühe brachte sie ihre Stimme unter Kontrolle und sagte:
„Vater...“
„Was ist denn?“, sagte der Rektor und hielt das Streichholz in der Hand inne.
„Vater, ich möchte dich etwas fragen. Etwas Wichtiges.“
Der Gesichtsausdruck des Rektors veränderte sich. Er hatte sofort erraten, was sie sagen wollte; und seltsamerweise wirkte er jetzt weniger gereizt als zuvor. Eine steinerne Ruhe hatte sich auf seinem Gesicht ausgebreitet. Er sah aus wie eine ziemlich distanzierte und wenig hilfreiche Sphinx.
„Nun, meine liebe Dorothy, ich weiß sehr gut, was du sagen willst. Ich nehme an, du wirst mich wieder um Geld bitten. Ist es das?“
„Ja, Vater. Weil ...“
„Nun, ich kann dir die Mühe auch gleich ersparen. Ich habe überhaupt kein Geld – absolut kein Geld bis zum nächsten Quartal. Du hast dein Taschengeld bekommen und ich kann dir keinen halben Penny mehr geben. Es ist völlig sinnlos, mir jetzt Sorgen zu machen.“
„Aber Vater ...!“
Dorothys Herz sank noch tiefer. Das Schlimmste war, dass er so schrecklich ruhig und wenig hilfsbereit war, als sie ihn um Geld bat. Er war nie so ungerührt wie jetzt, als du ihn daran erinnertest, dass er bis über beide Ohren verschuldet war. Anscheinend konnte er nicht verstehen, dass Handwerker gelegentlich bezahlt werden wollen und dass kein Haus ohne ausreichende Geldmittel in Gang gehalten werden kann. Er gewährte Dorothy achtzehn Pfund im Monat für alle Haushaltsausgaben, einschließlich Ellens Lohn, und gleichzeitig war er „wählerisch“, was sein Essen anging, und bemerkte sofort, wenn die Qualität nachließ. Das Ergebnis war natürlich, dass der Haushalt ständig verschuldet war. Aber der Rektor kümmerte sich nicht im Geringsten um seine Schulden – er war sich ihrer kaum bewusst. Wenn er bei einer Investition Geld verlor, war er zutiefst beunruhigt; aber eine Schuld gegenüber einem einfachen Händler – nun, das war etwas, worüber er sich einfach keine Gedanken machen konnte.
Eine friedliche Rauchwolke stieg aus der Pfeife des Rektors auf. Er betrachtete mit meditativem Blick den Stahlstich von Charles I. und hatte Dorothys Geldforderung wahrscheinlich bereits vergessen. Als sie ihn so unbekümmert sah, durchfuhr sie ein Anflug von Verzweiflung, und ihr Mut kehrte zurück. Schärfer als zuvor sagte sie:
„Vater, bitte hör mir zu! Ich brauche bald etwas Geld! Ich muss einfach ! So wie bisher können wir nicht weitermachen. Wir schulden fast jedem Händler in der Stadt Geld. Manchmal ertrage ich es kaum, morgens die Straße entlangzugehen und an all die ausstehenden Rechnungen zu denken. Weißt du, dass wir Cargill fast zweiundzwanzig Pfund schulden?“
„Na und?“, sagte der Rektor zwischen zwei Rauchwolken.
„Aber die Rechnung steigt seit über sieben Monaten! Er hat sie immer und immer wieder geschickt. Wir müssen sie bezahlen! Es ist so unfair, ihn so auf sein Geld warten zu lassen!“
„Unsinn, mein liebes Kind! Diese Leute erwarten, dass man sie auf ihr Geld warten lässt. Es gefällt ihnen. Am Ende bringt es ihnen mehr ein. Gott weiß, wie viel ich Catkin & Palm schulde – ich möchte es lieber nicht wissen. Aber du hörst mich nicht jammern, oder?“
„Aber Vater, ich kann das nicht so sehen wie du, ich kann es nicht! Es ist so schrecklich, immer Schulden zu haben! Auch wenn es nicht wirklich falsch ist, ist es so abscheulich. Ich schäme mich so sehr dafür! Wenn ich in Cargills Laden gehe, um den Braten zu bestellen, spricht er so kurz mit mir und lässt mich nach den anderen Kunden warten, nur weil unsere Rechnung die ganze Zeit steigt. Und doch traue ich mich nicht, nicht mehr bei ihm zu bestellen. Ich glaube, er würde uns sonst anzeigen.“
Der Rektor runzelte die Stirn. „Was! Willst du damit sagen, dass der Kerl dir gegenüber unverschämt war?“
„Ich habe nicht gesagt, dass er unverschämt war, Vater. Aber man kann es ihm nicht verübeln, wenn er wütend ist, wenn seine Rechnung nicht bezahlt wird.“
„Ich kann ihm das auf jeden Fall vorwerfen! Es ist einfach abscheulich, wie sich diese Leute heutzutage aufführen – abscheulich! Aber so ist es nun mal. Das ist die Art von Dingen, denen wir in diesem wunderbaren Jahrhundert ausgesetzt sind. Das ist Demokratie – Fortschritt, wie sie es gerne nennen. Bestelle nicht wieder bei dem Kerl. Sag ihm sofort, dass du deine Rechnung woanders begleichen wirst. Das ist die einzige Möglichkeit, mit diesen Leuten umzugehen.“
„Aber Vater, damit ist doch nichts geklärt. Meinst du nicht, dass wir ihn wirklich und wahrhaftig bezahlen sollten? Wir können das Geld doch sicher irgendwie auftreiben? Könntest du nicht ein paar Aktien verkaufen oder so?“
„Mein liebes Kind, sprich nicht mit mir über den Verkauf von Aktien! Ich habe gerade die unangenehmsten Nachrichten von meinem Broker erhalten. Er sagt mir, dass meine Sumatra-Zinn-Aktien von sieben und vier Pence auf sechs und einen Penny gefallen sind. Das bedeutet einen Verlust von fast sechzig Pfund. Ich sage ihm, er soll sie sofort verkaufen, bevor sie noch weiter fallen.“
„Wenn du dann verkaufst, hast du doch etwas Geld zur Verfügung, oder? Meinst du nicht, dass es besser wäre, ein für alle Mal deine Schulden loszuwerden?“
„Unsinn, Unsinn“, sagte der Rektor ruhiger und steckte seine Pfeife wieder in den Mund. „Du weißt überhaupt nichts über diese Angelegenheiten. Ich muss sofort in etwas Hoffnungsvolleres reinvestieren – das ist der einzige Weg, um mein Geld zurückzubekommen.“
Mit einem Daumen im Gürtel seiner Soutane runzelte er gedankenverloren die Stirn und betrachtete den Stahlstich. Sein Makler hatte United Celanese empfohlen. Hier – in Sumatra Tin, United Celanese und unzähligen anderen abgelegenen und kaum bekannten Unternehmen – lag die zentrale Ursache für die Geldsorgen des Rektors. Er war ein eingefleischter Spieler. Natürlich betrachtete er es nicht als Glücksspiel; es war lediglich eine lebenslange Suche nach einer „guten Investition“. Als er volljährig wurde, hatte er viertausend Pfund geerbt, die dank seiner „Investitionen“ allmählich auf etwa eintausendzwanzig geschrumpft waren. Schlimmer noch, jedes Jahr schaffte er es, aus seinem mickrigen Einkommen weitere fünfzig Pfund zusammenzukratzen, die auf demselben Weg verschwanden. Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass die Verlockung einer „guten Investition“ Geistliche anscheinend hartnäckiger verfolgt als jede andere Gruppe von Menschen. Vielleicht ist es das moderne Äquivalent zu den Dämonen in weiblicher Gestalt, die die Eremiten des Mittelalters heimsuchten.
„Ich werde fünfhundert United Celanese kaufen“, sagte der Rektor schließlich.
Dorothy begann, die Hoffnung aufzugeben. Ihr Vater dachte jetzt an seine „Investitionen“ (sie wusste nichts über diese „Investitionen“, außer dass sie mit phänomenaler Regelmäßigkeit schiefgingen), und in einem weiteren Moment wäre ihm die Frage der Ladenschulden völlig entfallen. Sie unternahm einen letzten Versuch.
„Vater, lass uns das bitte klären. Glaubst du, dass du mir bald etwas mehr Geld geben kannst? Nicht sofort, aber vielleicht in den nächsten ein oder zwei Monaten?“
„Nein, meine Liebe, das kann ich nicht. Vielleicht um die Weihnachtszeit – aber selbst dann ist es sehr unwahrscheinlich. Aber im Moment sicher nicht. Ich habe keinen halben Penny, den ich entbehren könnte.“
„Aber Vater, es ist so schrecklich zu wissen, dass wir unsere Schulden nicht bezahlen können! Es ist so beschämend für uns! Als Herr Welwyn-Foster das letzte Mal hier war [Herr Welwyn-Foster war der Dekan des ländlichen Raums], ist Frau Welwyn-Foster durch die ganze Stadt gezogen und hat jedem die persönlichsten Fragen über uns gestellt – wie wir unsere Zeit verbringen, wie viel Geld wir haben, wie viele Tonnen Kohle wir pro Jahr verbrauchen und so weiter. Sie versucht immer, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Stell dir vor, sie würde herausfinden, dass wir hoch verschuldet sind!“
„Das ist doch wohl unsere eigene Angelegenheit? Ich verstehe überhaupt nicht, was das mit Frau Welwyn-Foster oder sonst jemandem zu tun hat.“
„Aber sie würde es überall wiederholen – und sie würde es auch noch übertreiben! Du weißt, wie Frau Welwyn-Foster ist. In jeder Gemeinde, die sie besucht, versucht sie, etwas Schändliches über den Geistlichen herauszufinden, und dann wiederholt sie jedes Wort davon dem Bischof. Ich möchte nicht lieblos über sie sein, aber wirklich, sie ...“
Als Dorothy merkte, dass sie doch böswillig sein wollte, schwieg sie.
„Sie ist eine abscheuliche Frau“, sagte der Rektor gleichmütig. „Na und? Wer hat je von der Frau eines Landdekans gehört, die nicht abscheulich war?“
„Aber Vater, ich scheine nicht in der Lage zu sein, dir klarzumachen, wie ernst die Lage ist! Wir haben einfach nichts, wovon wir im nächsten Monat leben können. Ich weiß nicht einmal, woher das Fleisch für das heutige Abendessen kommt.“