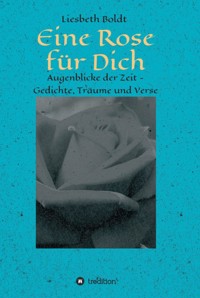
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch enthaelt Gedanken und Gedichte von Liesbeth Boldt, ihre Liebe zu ihrem Ehemann und deren Zusammenleben, beruecksichtigen aber auch die immerwaehrenden Themen von Geschichte und Heimat, Glueck und Liebe und den Beruf des Schmiedes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Liesbeth Boldt
Eine Rose für Dich
Augenblicke der Zeit - Gedichte, Träume und Verse
© 2021 Liesbeth Boldt
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-40960-6
Hardcover:
978-3-347-40961-3
e-Book:
978-3-347-40962-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Eine Rose für Dich
•Augenblicke der Zeit•
Gedichte, Träume und Verse
Liesbeth Boldt
Zusammengestellt von Andreas Boldt
In liebevoller Erinnerung an
Dieter Boldt
1.7.1948 – 9.4.2018
und
Liesbeth Boldt
9.11.1949 – 1.8.2018
Vorwort
Das Jahr 2018 war für die Familien und Freunde von Dieter und Liesbeth Boldt ein großer Verlust. Im Allgemeinen bereitet sich jeder irgendwann auf den Verlust der eigenen Eltern vor, aber wenn es passiert, erschüttert es uns bis ins Mark. Es war eine sehr traurige und herausfordernde Zeit, beide Eltern im selben Jahr zu verlieren. Und obwohl Dieter und Liesbeth in unseren Erinnerungen weiterleben werden, möchte ich Liesbeths Gedichte über sich und Dieter mit den Lesern teilen.
Dieses Buch ist eine überarbeitete Zusammenstellung aller gefundenen Gedanken und Gedichten meiner Mutter Liesbeth Boldt. Es gab drei Quellen für diese Schriften: ein kleines Notizbuch aus den 1960er Jahren, fünf Bände mit schön geschriebenen und geschmückten Gedichten und einen Jahreskalender, der fast vollständig mit Stichwortsammlungen, Gedichten und Sprichwörtern gefüllt war. Die Einträge sind in chronologischer Reihenfolge aufgeführt, wobei der erste Eintrag aus dem Notizbuch von 1966 bis zum Jahr ihrer Hochzeit im Jahr 1972 reicht. Den Abschnitt auf Meier Helmbrecht hatte sie aus einem Buch kopiert, zeigt aber ihr Interesse an ihrer Herkunft, da ihre Mutter eine geborene von Helmbrecht war und aus der Region um Thorn stammte (heutiges Polen). Das Wissen um die Herkunft und die Suche nach einer neuen Heimat und Identität hatte meine Mutter als Flüchtlingskind sehr geprägt. Die auffälligste Sammlung sind die Gedichte, die größtenteils in den drei Jahren zwischen 2011 und 2013 verfasst wurden. Die Gedichte wurden sorgfältig geschrieben und mit Bildern und Zeichnungen aus der Hand meiner Mutter verziert. Die letzten Gedichte in der Sammlung stammen vom Mai 2018, dem Monat nach dem Tod von Dieter. Sie wurden auf kleine Blätter geschrieben, als wären sie zufällige Momente der Reflexion. Die Gedichte selbst beziehen sich hauptsächlich auf meine Eltern, ihr Zusammenleben und ihre Liebe zueinander, berücksichtigen aber auch die immerwährenden Themen von Geschichte und Heimat, Glück und Liebe, Zeit und den Beruf des Schmiedes. Obwohl sich die Gedichte auf meine Eltern beziehen, sind sie doch recht allgemein geschrieben, so dass sich hoffentlich jeder mit dem Thema identifizieren und die Gedichte, auch ohne Vorwissen oder meine Eltern gekannt zu haben, mit Freude genießen kann.
Schließlich gab es noch in einem Notizbuch eine allgemeine Sammlung von Stichwörtern, Phrasen und Sprichwörtern. Aus dieser Sammlung habe ich Liesbeths Sprüche und Redewendungen sowie abschließend eine Selbstbeschreibung übernommen.
Kurz vor ihrem Tode hatte Liesbeth mehrfach erwähnt, dass es Anfragen auf eine Veröffentlichung ihrer Gedichte gab und sie dem nicht abgeneigt war. Ihrem Wunsche folgend, möchte ich daher die Gedanken und Gedichte meiner Mutter Liesbeth der Öffentlichkeit zugänglich machen, um auch ihre Worte für die Nachwelt zu bewahren.
Da kaum Gedichte einen Titel erhielten, sind sinngemäß jeweils die ersten Wörter der ersten Zeile eines Gedichts durch fette Großbuchstaben hervorgehoben, um das nächste Gedicht anzudeuten. Gleichzeitig kann man sagen, haben die Gedichte somit auch einen Titel erhalten.
Diese Zusammenstellung von Liesbeths Schriften ist auch eine lebendige Erinnerung an meinen Vater Dieter Boldt und sein Schmiedehandwerk. Familie und Freunde, die jemals das gemeinsame Zuhause Im Uhlenbrook 26 in Lilienthal bei Bremen besucht haben, wo Dieter und Liesbeth über 42 Jahre lebten, werden sich an Dieters vielfältige Eisenschmiedearbeiten im ganzen Haus erinnern. Eines seiner bekanntesten Werke ist die Figur des arbeitenden Schmieds, die neben der Haustür angebracht war. Dieses Stück befindet sich jetzt in Irland bei mir zu Hause, wo es in absehbarer Zukunft seinen neuen Platz an einer Wand finden wird. Mit diesem Meisterwerk der Eisenschmiedekunst meines Vaters Dieter und der Sammlung von Werken meiner Mutter Liesbeth trage ich ihr gemeinsames lebendiges Gedächtnis für uns alle fort.
Níamh und Andreas Boldt
Multyfarnham, Irland, 2021
Frühe Schriften (1966 bis 1972)
Privat !!!
Liesbeth Tapper
Wir lassen vom Schein des Lebens uns blenden,
Um nicht den Blick auf den Kern zu wenden;
Wir lassen vom Lärm der Welt uns betören,
Um nicht die Stimmen der Stille zu hören.
Liesbeth [erste Eintragung, wohl 1966 geschrieben]
Mein Lebensideal mit zwanzig Jahren?[geschrieben um 1969]
Es liegt mir zu viel Unklares doch auch wieder Bewusstes darin. Jede wirkliche Entwicklung ist ein unbewusster Vorgang, ist das Durchsetzen der Persönlichkeit mit allen, was an ihr tüchtig ist, ist das freudige Ergreifen der täglich neuen Gegenwart mit all ihrem Wechsel und ihrer Mannigfaltigkeit, unbekümmert, wieviel Hoffnungen und Meinungen von gestern verblühten und verschwanden mit einem Wort: Nicht ein Ideal, sondern ‚Idealismus‘, und nicht mit zwanzig Jahren, sondern durch das ganze Leben.
Ich habe nie an ein präzis formuliertes Lebensideal gehabt. Ich weiß nur eines: Das Glück ist nicht die Hauptsache im Leben. Die Hauptsache ist, vor niemand die Augen niederschlagen zu müssen; weder vor einem Menschen noch vor einer Erinnerung!
„Mein Ideal mit 20 Jahren war – zu werden, was ich geworden bin! Im Übrigen vermag nach meiner Ansicht ein jeder sein Ideal zu erreichen, vorausgesetzt, dass dieses Ideal mit seinen angeborenen Fähigkeiten im Einklang steht.“
Liesbeth
Ein Winter auf dem Lande![geschrieben um 1969]
Nach Frühling und Sommer kommt der Winter, der lange, lange Nordlandwinter mit seinen endlosen Nächten, seinen tiefen Schnee, seinen kurzen, traurigen Tagen. Durch die letzten zerflatternden Wolken bricht die Abendsonne und wirft ihren schimmernden Purpurglanz über die Erde. Es ist kalt draußen. Wie lebt man dann in den Höfen, die so fern des Waldes liegen, abgeschnitten oft auch vom nächsten Nachbar. Kann man hier überhaupt leben? Ich schaudere leicht zusammen. In den großen vollreichen Städten, wo Leben und Luft nie so hoch aufjubeln wie gerade in sturmdurchtobter Winterszeit, wo eine Fülle von Lichtströmen uns vergessen mag. Ich denke an die hellen Straßen. Und doch ist der Winter schön auch hier in der Stille. Wenn draußen die Stürme toben und der Schnee stöbert, dann ist es Zeit, am warmen Kamin Platz zu suchen. Die Hausfrauen greifen dann zu Nadel und Schere und bessern Sachen aus. Wie einladend gemütlich winkt der hohe Kamin. Es träumt sich herrlich im Schein der Flammen, wenn draußen der Nordsturm braust. Ich stehe am Fenster und schaue übers weite Land. Weit ist es wirklich, unabsehbar weit. Endlose Ebene. Hügel, Wiesen und Gräben. Und mitten zwischen Wiesen und Felder verstreut liegen die Herren- und Bauernhöfe. Breit und stattlich liegen sie da, jeder für sich, inmitten seiner Felder und Wiesen. Lange Wege musste man hier oft wandern, um von einem Gehöft zum anderen zu gelangen. Es ist auch hier draußen auf dem Lande ein schöner Winter.
Liesbeth
Jugenderinnerung.[geschrieben um 1969]
Warum fällt mir diese Geschichte nur so oft ein? – Nun in meiner Jugend stand ich selbst hungrig und durstig vor einer Hölle von Schätzen. Ich wünschte mir, so viel zu lernen. Das war damals nicht möglich. Ich habe es eingesehen, dass es gut ist (d.h. vorteilhaft) für sich selbst, wenn man gehorcht. Was ist schon deshalb nötig, weil in der Tat nicht jede Pflicht, die einem Kinde auferlegt wird, augenblicklich für den Gehorchenden vorteilhaft ist. Warum? Am letzten Ende ist doch nur der Mensch glücklich, der in Ehrfurcht sich seinem Ideal nähert, denn durch Ehrfurcht nähert man sich dem Erhabenen an. Der Respekt vor dem Guten, vor dem sittlichen Gesetz, vor der Menschenwürde in mir ist ja doch auch der beste, nein, der einzige Schutz vor dem Schmutz. Und zu diesem Gefühl wird der Keim in frühsten Kindheitstagen in die jungen Seelen gelegt. Man kann ein Kind davor behüten. Wem aber große und reine Gedanken erfüllen, den erhellt das Unreine, und er vermeidet es. Ich wollte reich sein, ich wollte mich in Kostbarkeiten hüllen, und dazu muss man eben arbeiten, ehe man es zum Reichtum bringt. Ich will keine Prinzessin sein. Ich bin ein einfaches Bürgermädchen, ich möchte nach getaner Arbeit meine Ruhe haben und mich in mein Stübchen zurückziehen können.
Liesbeth
Helmbrechts Land[geschrieben um 1969]
„Von Wilhelm Scheuermann-Freienbrink“
Das deutsche Schrifttum besitzt in dem mittelhochdeutschen Gedicht: „Meier Helmbrecht“ ein unvergleichliches Denkmal ältester Bauernschilderung. Von dem Dichter wissen wir nur, was er selbst uns mitteilt, dass er sich Wernher der Gaertner nannte und fahrender Sänger war, der seine Lieder bei festlichen Gelegenheiten unter der Dorflinde, in Gasthöfen und bei Hausfeiern vorlas. Er berichtet uns auch, dass sein Gedicht nach 1234 entstanden sein muss, denn Neidhart von Reuenthal nennt er als bereits verstorben, wobei er ihn als den größeren Meister preist, ein Urteil voll löblicher Bescheidenheit, dem sich die Nachwelt nicht angeschlossen hat. Sie erkennt dem Meier Helmbrecht die Krone der bedeutendsten Dichtung ihrer Entstehungszeit zu. Im Gegensatz zu den höfischen Sängern des verfallenden Rittertums greift Wernher der Gaertner in das volle Menschenleben. Er überschüttet uns nicht mit einem Schwall immer wiederholter „romantischer“ Abenteuer, sondern er gestaltet eine knappe und flüssige Erzählung aus dem Bauernleben, dem er sich durch eigene Herkunft verbunden fühlt. Diese Darstellung aber ist voll immer, packender Wahrheit; sie bleibt, abgesehen von der künstlerischen Gestaltung, wertvoll als kulturgeschichtliche Urkunde. Den Unterschied zwischen seiner Art und derjenigen der höflichen Abenteuersammler erklärt Wernher der Gaertner selbst in den Eingangsworten: Andere berichteten von Minne und Gewinne und großen Taten – „hier will ich sagen, was mir geschah, das ich mit meinem Augen sah.“ Seit der Wiederentdeckung unserer mittelhochdeutschen Denkmäler ist mit Recht immer wieder betont worden, welche ganz andere, volksverbundene Kraft das bodenständige deutsche Schrifttum hätte gewinnen können, wenn das Beispiel des Meier-Helmbrecht Verfassers, ins volle Menschenleben hineinzugreifen und das Volk bei der Arbeit aufzusuchen, mehr Nachfolger gefunden hätte, statt dass es sich im luftleeren Raum des Romans verlor, der umso höher geschätzt wurde, je unwahrscheinlicher, unechter und unmöglicher er wurde. Der „Meier Helmbrecht“ führt uns in eine schlimme Zeit unserer vaterländischen Geschichte. Das Kaisertum hat seine letzte Kraft in den Kreuzzügen und in den Kämpfen der Hohenstaufen in Italien verbraucht. Unvergessene Ströme deutschen Blutes sind in der Fremde nutzlos vergeudet worden. Nun fehlt es im Reiche völlig an Führung. Wer sein Recht haben will, muss es selbst suchen und notfalls mit Waffengewalt erstreiten. Geistliche und weltliche Fürsten, Ritter, Klöster und Städte liegen im ständigen gegenseitigen Kampfe. Die Zeche bezahlt der Bauer. Seit ihn Karl der Sachsenschlächter entrechtet hat, ist seine Lage immer schlimmer geworden. Er, der einstmals Edelfreie, ist jetzt der Einzige, dem es verboten ist, Wasser zu tragen und zu besitzen. Von seiner Arbeit muss er allen zinsen, den Fürsten und Städten und vor allem der Geistlichkeit. Wie diese Lage auf dem deutschen Bauern wirkt, erfahren wir im Gedicht vom Meier Helmbrecht. Der beste Teil der Bauernschaft bleibt sich trotz der Bedrückung seines adeligen Eigenwertes bewusst und bekundet ihn stets von neuem durch seine unablässige, aufbauende Arbeit. Aber es gibt doch auch jüngere Vertreter des Bauerntums, die diese Haltung als altmodisch und einfältig ablehnen. Wozu sich zum gedrückten Bauernstande bekennen, wenn man als fahrender Ritter mit einem Schlage mehr gewinnen kann, als des Vaters ganze Lebensmühe eingetragen hat? Das ist der dramatische Gegensatz, auf dem sich die Dichtung aufbaut.
Meier Helmbrecht ist ein rechter Bauer vom alten Schrot und Korn, aber sein Unglück ist, dass er nicht die richtige Bäuerin gefunden hat. Sie verzieht die Kinder, besonders den Sohn, der ebenfalls Helmbrecht heißt. Zuerst staffiert sie ihn in der Kleidung rittermäßig aus, so dass sich der eitle Bursche als Wunder was vorkommt, wenn die Mädchen beim Tanz seine goldgestrickte Mütze bewundern und zu der Überzeugung gelangt, dass er für die Bauernarbeit viel zu gut ist. Er will sein Glück als fahrender Ritter probieren, und nachdem ihm die Mutter auch noch heimlich Wasser gekauft hat, sagt er seinem Vater den Hofdienst auf. Vergeblich redet ihm dieser ins Gewissen. Als alle guten Gründe nichts helfen, lässt sich der Vater schließlich selbst bewegen, sein Teil zur Ausstattung des Sohnes beizutragen, indem er ihm ein wertvolles Reitpferd kauft, nachdem er ihm noch einmal eindringlich den Wert der Bauernarbeit vorgestellt und ihn daran erinnert hat, dass ihm der wohlhabende Nachbar Meier Ruprecht seine Tochter zur Frau zu geben bereit ist. Dafür hat der Sohn nur Spott, und so reitet er auf seinem teuren Ross davon und nimmt Hofdienst bei einem der vielen benachbarten Raubritter, die immer Bedarf an gewissenlosen Spießgesellen seiner Art haben.
Nach einem Jahre treibt es den Sohn, sich wieder einmal in der Heimat sehen zu lassen. Er hat es weit gebracht. Unter den Räubern, die sich vom Überfall der Wanderer und von der Plünderung der Bauernhöfe nähren, ist er eine Art Führer geworden. Mit frechen Worten rühmt er sich seiner Untaten, sucht sich als etwas Besonderes aufzuspielen, indem er in seine Reden allerhand fremde Ausdrücke mengt, und da er sich mit dem Vater noch weniger als früher verstehen kann, zieht er bald wieder seines Weges, nachdem er seine Schwester, die schon früher auf seiner Seite gestanden hat, verleitet hat, ihm zu folgen, um einem von seinen Miträubern zu heiraten. Bei dieser Hochzeit geht es hoch her mit dem Verprassen von geraubtem Gut. Aber damit hat die Herrlichkeit auch ein Ende. Die ganze Hochzeitsgesellschaft wird ausgehoben, die neuen Spießgesellen werden gehängt, bei dem jungen Helmbrecht aber macht der Richter von seinen gesetzlichen Rechte Gebrauch: Er lässt ihn blenden, ihm einen Fuß und eine Hand abhauen, so wie es die Räuber früher mit den Überfallenen gemacht haben, und lässt ihn dann zum warnenden Beispiele laufen. Demütig bettelt der blinde Krüppel am väterlichen Hoftore um Aufnahme. Aber der alte Helmbrecht kennt nun keine Gnade. Obwohl ihn das Schicksal des einzigen Sohnes in das Herz getroffen hat, weist er ihn ab. Lieber würde er einem wildfremden ehrlichen Mann Heimat gewähren als dem zum Räuber gewordenen Sohne. Dass er seine schönen Rinder verkaufen musste, um das Reitpferd zu bezahlen, rührt ihn genug – ein echt bäuerlicher Zug. Nur die Mutter schickt dem Blinden noch einen Laib Brot hinaus. Und dann erfüllt sich das Schicksal: Der junge Bettler gerät in ein Dorf, wo die von ihm ausgeplünderten Bauern ihren Schinder wiedererkennen. Nach altdeutscher Sitte geben sie ihm mitleidig noch eine Erdscholle als Not-Abendmahl und dann hängen sie ihn an einem Baumast.
Die Ambraser Handschrift der Dichtung führt die Überschrift „Meier Helmbrecht“, und zu gutem Recht. Denn wenn auch





























