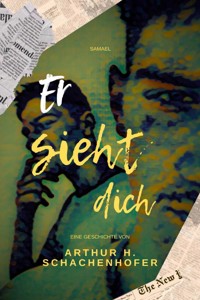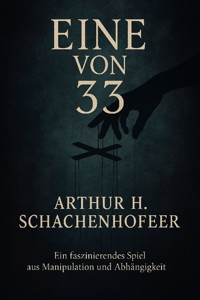
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Der Text erzählt die Geschichte einer Frau, die sich von einem faszinierenden, aber manipulativen Mann angezogen fühlt. Er ist kultiviert, charismatisch und scheinbar voller Tiefe, doch nach und nach offenbart sich seine wahre Natur. Er lenkt Menschen, ohne dass sie es bemerken, hinterlässt kein Chaos, sondern feine Risse in der Wahrnehmung seiner Mitmenschen. Die Protagonistin gerät zunehmend in seine Welt, fühlt sich gesehen, doch nie wirklich erkannt. Während sie glaubt, durch ihn eine tiefere Verbindung zu sich selbst zu finden, beginnt sie zu ahnen, dass ihre Beziehung mehr auf Kontrolle als auf Liebe basiert. Die Geschichte entfaltet sich wie ein psychologisches Kammerspiel, das die subtilen Mechanismen von Macht und Einfluss aufzeigt. Es geht um das schleichende Gefühl, Teil eines Spiels zu sein, dessen Regeln sie nicht selbst bestimmt hat. Der Mann konstruiert eine Realität, in der sie sich zunehmend verliert, bis sie sich fragt, ob sie ihn liebt oder nur der Angst erliegt, allein mit der Wahrheit zu sein. Später wird klar, dass er nicht einfach ein Meister der Manipulation ist – er ist eine Fortsetzung eines Systems, das weit über ihn hinausgeht. Sein eigenes Erbe, seine Prägung, das Wissen, das er weitergibt, sind Teil einer größeren Ordnung. Als die Frau erkennt, wie tief sie verstrickt ist, steht sie vor einer letzten Entscheidung: Lässt sie sich weiterhin steuern oder findet sie einen Weg, sich aus seinem Schatten zu lösen? Doch die Frage bleibt, ob es möglich ist, einer solchen Struktur zu entkommen – oder ob sie bereits weitergegeben wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sein Name fiel in Gesprächen wie ein Versprechen: kultiviert, belesen, ein Mann mit einer fast aristokratischen Selbstverständlichkeit. In Gesellschaft war er das Zentrum, ohne sich aufzudrängen. Seine Stimme – warm, ruhig, durchdrungen von jener unauffälligen Autorität, die Menschen dazu bringt, innezuhalten, zuzuhören, sich öffnen zu wollen. Er sprach wenig über sich, doch gerade das verlieh ihm eine geheimnisvolle Tiefe. Seine Geschichten kamen dosiert, maßvoll – immer gerade so viel, dass man ihn für verletzlich halten konnte, niemals genug, um ihn wirklich zu erkennen.
Sie war ihm mit einer Faszination begegnet, die anfangs wie Verliebtheit wirkte, sich aber später eher, wie eine Abhängigkeit anfühlte. In seiner Gegenwart hatte sie das Gefühl, gesehen zu werden – doch es war ein Blick, der durch sie hindurchging, wie jemand, der ein Werkzeug prüft, nicht einen Menschen.
Er war ein Architekt des Vertrauens. Er stellte Fragen, aber nicht aus echtem Interesse – vielmehr, um Informationen zu sammeln, um sie später zu nutzen, manchmal nur beiläufig, manchmal mit chirurgischer Präzision. Wenn sie sich öffnete, hatte sie das beklemmende Gefühl, dass jedes Wort katalogisiert wurde, um eines Tages gegen sie verwendet zu werden – nicht in offener Feindschaft, sondern in einem Gespräch, das sich anfühlte wie ein sanftes Erwürgen mit Samthandschuhen.
Und dann waren da diese Momente, fast unsichtbar, aber schneidend klar, wenn man hinsah: Die Art, wie er andere subtil in Frage stellte, ihre Erinnerungen, ihre Wahrnehmung, ihre Integrität – und das alles unter dem Deckmantel der Fürsorglichkeit. „Du hast sicher deine Gründe, dich so zu fühlen“, sagte er einmal, mit einem Lächeln, das Wärme simulierte, aber keine trug. Es war keine Unterstützung – es war Entmachtung in höflichem Ton.
Sein Charme war keine Gabe, sondern ein Werkzeug. Jedes Lächeln war eine Maske, und jede Maske trug er mit vollkommener Überzeugung – nicht aus Heuchelei, sondern weil er nichts anderes kannte. Emotionen schienen für ihn weniger etwas Erlebtes als etwas Beherrschbares, wie Rollen in einem Stück, dessen Drehbuch nur er kannte. Er konnte wütend sein, ohne laut zu werden, und verzweifelt wirken, ohne Tränen. Seine Mimik war präzise wie ein Schauspieler im Close-up. Sie begriff: Er litt nicht, er imitierte das Leiden, wenn es ihm nützte.
Er sprach von Moral wie von einer Theorie, nicht wie von einem inneren Kompass. Schuld war für ihn kein Gefühl, sondern ein Konzept, das sich bei Bedarf gegen andere wenden ließ. Wenn er sich entschuldigte, dann nur, um Kontrolle zu behalten. Wenn er lobte, dann nur, um sie höher zu heben – bevor er sie wieder fallen ließ. Immer mit einem Lächeln. Immer mit einer Begründung, die so vernünftig klang, dass man sich selbst zu hinterfragen begann.
Sie hatte den Verdacht lange mit sich getragen, wie einen Splitter unter der Haut. Nun aber, da sie ihn durchschaute, erkannte sie, wie meisterhaft seine Fassade gebaut war. Sie war nicht zufällig entstanden – sie war das Produkt eines klugen, empathielosen Geistes, der gelernt hatte, wie man Menschen nicht nur liest, sondern steuert. Und sie war längst Teil seines Spiels geworden.
Sie erinnerte sich genau an den Moment, als sie ihn zum ersten Mal sah. Es war auf einer Veranstaltung, die sie beinahe abgesagt hätte – eine Buchpräsentation, ein schmaler Salon voller Menschen, die mehr über sich selbst redeten als über das Buch. Der Raum war zu warm, zu laut, zu sehr bemüht um Bedeutung. Und dann stand er plötzlich neben ihr – unaufdringlich, aber mit einer Präsenz, die wie ein feiner Riss durch die Oberfläche der Konversation zog.
„Sie sehen aus, als wären Sie versehentlich in diesen Zirkus geraten“, sagte er, ohne sie vorher angeschaut zu haben. Keine flüchtige Höflichkeit, kein forciertes Lächeln – nur ein Satz, der klang, als hätte er sie längst beobachtet, als hätte er genau gewusst, was sie dachte. Es hätte übergriffig wirken können, aber da war diese Ruhe in seiner Stimme, diese gefährlich angenehme Selbstsicherheit, die ihn von den anderen abhob.
Sie hatte gelacht, unsicher, überrascht, irgendwie ertappt – und fühlte sich gleichzeitig geschmeichelt. Ihre Antwort weiß sie nicht mehr, nur, dass sie sprach, obwohl sie sonst Fremden gegenüber zurückhaltend war. Er hatte diese seltsame Gabe, Menschen das Gefühl zu geben, bei ihm sei jede Reaktion richtig, jede Regung von Bedeutung. Seine Aufmerksamkeit war nicht grell, sondern tief – wie ein Raum ohne Spiegel, in dem man sich selbst auf neue Weise sah.
Er stellte keine der üblichen Fragen. Keine Biografie. Kein Beruf. Stattdessen: „Was ist das Unangenehmste, das man über Sie sagen könnte – das aber vielleicht stimmt?“ Ein Satz wie eine feine Nadel, direkt durch die Fassade hindurch.
Damals hielt sie das für Mut, für Tiefe. Heute verstand sie, dass es etwas anderes war: ein Test. Kein Interesse – ein Zugriff.
Sie sprach trotzdem. Irgendetwas Verklärtes, Kluges, halb ehrlich. Er nickte. Er kommentierte nicht. Er beobachtete. Später, als sie gemeinsam das Gebäude verließen – ihr Gespräch längst zu einer stillen Vertrautheit gewachsen –, bemerkte sie, dass er fast nichts von sich erzählt hatte. Und doch hatte sie das Gefühl, ihn zu kennen. Jetzt wusste sie: Das war seine Kunst.
Am Ende des Abends verabschiedete er sich nicht wie andere. Kein „Ich hoffe, wir sehen uns wieder“. Kein „Es war schön“. Nur: „Ich finde es angenehm, wie leise Sie denken. Das ist selten.“ Dann verschwand er in der Dunkelheit, ohne sich umzudrehen.
Sie blieb noch eine Weile stehen, das Handy in der Tasche, seine Nummer auf einem Stück Papier, von seiner Handschrift fast zärtlich umrahmt. Damals hielt sie ihn für anders – jetzt wusste sie, wie wahr das war. Nur ganz anders, als sie gehofft hatte.
Es begann harmlos. Ein paar Nachrichten, selten, bedacht. Keine plumpen Floskeln, sondern Sätze, die den Eindruck erweckten, als sei sie die Einzige, mit der er wirklich sprechen wollte. Keine Emojis. Keine vorschnellen Einladungen. Nur Worte – durchdacht, exakt, so formuliert, dass sie in ihr nachhallten, lange, nachdem der Bildschirm dunkel geworden war.
Sie trafen sich ein zweites Mal. Dann ein drittes. Er schlug nie etwas direkt vor – er ließ Andeutungen fallen, die sie selbst aussprechen musste. Wenn sie zögerte, wartete er. Nicht ungeduldig. Nicht verletzt. Nur mit dieser sanften, fast beunruhigenden Gelassenheit, als wüsste er ohnehin, dass sie zurückkehren würde. Und sie tat es. Immer wieder.
Er war aufmerksam, aber nie aufdringlich. Er wusste, wann sie überarbeitet war, obwohl sie es nicht sagte. Er schickte ihr Texte – keine kitschigen Liebesbekundungen, sondern Auszüge aus Büchern, Sätze, die genau in ihr Innerstes trafen. Immer klug gewählt. Immer so, als würde er etwas in ihr sehen, dass sonst niemand wahrnahm. Sie begann, sich durch seine Augen zu betrachten – und verlor dabei unbemerkt ein Stück ihres eigenen Blicks auf sich selbst.
Langsam veränderte sich die Dynamik. Seine Komplimente kamen seltener, wurden durch kritische Bemerkungen ersetzt – beiläufig, charmant verpackt. „Du wirkst müde, wenn du dich so schminkst.“ Oder: „Ich glaube, du bist klüger, wenn du weniger versuchst, es zu beweisen.“ Es waren keine Beleidigungen. Es waren kleine Stiche, so präzise gesetzt, dass sie sich fragte, ob er nicht recht hatte.
Freunde bemerkten, dass sie sich veränderte. Sie lachte weniger. Sie zweifelte mehr. Wenn man ihn traf, war er perfekt – höflich, charmant, aufgeschlossen. Niemand hätte etwas sagen können. Aber sie spürte, dass er in Gesprächen mit anderen stets die Oberhand behielt, ohne je die Stimme zu heben. Seine Worte waren nie laut – sie waren gezielt. Wie Tropfen auf Stein.
Sie begann, sich zu rechtfertigen. Dafür, wenn sie keine Zeit hatte. Dafür, wenn sie anderer Meinung war. Er reagierte nicht mit Wut, sondern mit Enttäuschung – einer Enttäuschung, die subtil Schuld erzeugte. Er sprach nicht davon, dass sie ihn verletzt hätte. Stattdessen sagte er Dinge wie: „Ich hätte dir mehr zugetraut.“ Und damit stellte er ihre Loyalität infrage, nicht ihre Handlung.
Er betrat ihr Leben nicht wie ein Sturm – sondern wie ein leiser Nebel, der alles durchdrang. Ihre Entscheidungen. Ihre Gedanken. Ihren Schlaf. Und als sie eines Morgens in der Küche stand, eine Tasse in der Hand, sein Hemd an ihrem Körper, begriff sie, dass er längst überall war. Nicht in ihren Schränken, nicht in ihren Schubladen – sondern in ihren Selbstzweifeln, in ihren Sehnsüchten, in ihrer Stille.
Noch sagte sie sich, dass sie die Kontrolle hatte. Doch irgendwo in ihr regte sich etwas – ein leiser Widerstand, noch unförmig, aber wach. Ein Teil von ihr wusste, dass sie nicht einfach mit ihm zusammen war. Sie war in ihn verstrickt aber irgendwie auch verliebt.
Mit jedem Tag wuchs in ihr das Gefühl, sich aufzulösen – nicht in Schmerz, sondern in Sehnsucht. Es war keine Liebe, wie sie sie kannte. Nicht die warme, sichere, klare Art, sondern eine Liebe wie ein Fieber: fiebrig, schillernd, unklar. Eine, bei der man nicht weiß, ob man sich gerade heilt – oder langsam zugrunde geht.
Er war immer präsent, auch wenn er nicht da war. Manchmal verschwand er für Tage. Kein Anruf. Keine Nachricht. Und genau dann, wenn die Stille in ihr zu gären begann, meldete er sich mit einer Stimme, die so sanft war, als wäre nie etwas gewesen. Er erklärte nie. Er beruhigte nicht. Er kehrte einfach zurück – wie etwas, das selbstverständlich war. Und sie – sie ließ ihn zurückkehren.
Sie fragte ihn nie, wo er war. Nicht weil sie nicht wissen wollte. Sondern weil sie die Antwort fürchtete. Und weil sie spürte, dass er jede Frage als Schwäche betrachtete – und Schwäche, das hatte sie inzwischen gelernt, wurde von ihm nicht bestraft, sondern registriert. Abgelegt. Gemerkt.
Es gab Momente, in denen sie aufwachte und dachte, sie müsse ihn verlassen. Unvermittelt, aus einem Traum heraus, in dem sein Blick zu lange kalt blieb. Doch dann rief er an, und seine Stimme war weich, beladen mit einer Zärtlichkeit, die sie gleichzeitig tröstete und fesselte. Es war, als würde er spüren, wann sie an der Kante stand – und sie im letzten Moment zurückholen. Nicht durch Zwang. Sondern durch die Illusion von Geborgenheit.
Er sagte ihr, sie sei die Einzige, die ihn wirklich sehe. Dass andere ihn missverständen, ihn benutzten, ihn fürchten würden, ohne Grund. Er sprach von seiner Kindheit – bruchstückhaft, nie als Geschichte, immer als Andeutung. Von Dingen, die er „überstanden“ habe. Und sie, mit ihrem tiefen Wunsch, zu verstehen, zu retten, zu verbinden – hörte ihm zu und glaubte, dass das Dunkle in ihm vielleicht nur eine Wunde sei.
Sie vertraute ihm. Nicht weil er vertrauenswürdig war. Sondern weil er der Einzige war, der ihr sagte, dass niemand sonst sie wirklich verstehen könne. Und weil das stimmte. Denn mit der Zeit hatte sie begonnen, sich von allen zu entfernen. Ihre Freunde – sie sprachen von ihm mit Sorge. Ihre Familie – mit Skepsis. Doch sie hatte das Gefühl, dass niemand mehr den Menschen kannte, der sie geworden war. Nur er.
Und das war das Paradox: Obwohl sie ihm nicht traute, war er der Einzige, dem sie noch etwas anvertrauen konnte. Ihr Misstrauen war glasklar – aber auch machtlos. Denn ihre Einsamkeit war inzwischen ein Raum, den nur er betreten durfte. Und je mehr sie in seinen Bann geriet, desto mehr fragte sie sich, ob das, was sie empfand, Liebe war – oder nur die Angst davor, allein mit der Wahrheit zu sein.
In einer Nacht, die sich wie ein leises Dröhnen anfühlte, lag sie neben ihm und beobachtete sein Gesicht im Dunkeln. Er schlief, oder tat zumindest so. Sie suchte nach einem Anzeichen – für Echtheit, für Tiefe, für Schuld. Doch da war nichts. Nur diese vollkommen friedliche Maske, als wäre er nicht bei ihr, sondern längst in einer anderen Rolle, in einem anderen Leben.
Und sie verstand: Es war nicht sie, die sich in ihn verliebt hatte. Es war das Bild, das er in ihr erschaffen hatte – das Gefühl, gesehen zu werden, ohne selbst ganz sichtbar sein zu müssen. Und obwohl sie das erkannte, hielt sie ihn fester.
Nicht aus Liebe. Aus Abhängigkeit.
Ein paar Tage nach jener Nacht, in der sie ihn im Dunkeln beobachtete wie ein Rätsel, das sich selbst im Schlaf nicht offenbart, stand sie zum ersten Mal in seiner Wohnung. Nicht zufällig – er hatte sie eingeladen, mit einer beiläufigen Geste, als wäre es ein ganz normaler Schritt. Sie hatte diesen Moment lange erwartet, sich sogar danach gesehnt, in seine Welt einzutreten. Doch nichts hätte sie auf das vorbereitet, was sie dort fand.
Die Wohnung lag in einem alten Palais nahe der Stadtgrenze, versteckt hinter Efeu und schmalen Fenstern, die den Eindruck erweckten, die Zeit dringe nur gedämpft hindurch. Innen war es still. Kein Fernseher, keine Geräte, nur Bücher, Instrumente, seltsame Skizzen auf handgeschöpftem Papier.
In einem der Zimmer blieb sie stehen. Es war ein Atelier – groß, lichtdurchflutet, der Geruch von Terpentin lag in der Luft. Und da, an der Wand, nebeneinander, aufgespannt auf grober Leinwand: Porträts. Von ihr. In verschiedenen Stimmungen. In Posen, die sie nie eingenommen hatte – aber die ihr seltsam vertraut waren. Sie war darauf abgebildet, wie sie sich nie gesehen hatte, aber wie sie sich manchmal gefühlt hatte: leer, verletzlich, wachsam, sehnsüchtig.
Er war in der Tür erschienen, leise wie immer. „Ich male nur, wenn ich jemanden nicht vergessen kann“, hatte er gesagt, ohne sie anzusehen.
Sie hatte geschwiegen, zu überwältigt, zu verwirrt. Zwischen Bewunderung und Beklommenheit. Die Bilder waren schön, ja – aber nicht schmeichelnd. Sie waren ehrlich auf eine Weise, die fast grausam wirkte. Als hätte er nicht sie gemalt, sondern ihre Widersprüche.
Und dann, am Abend, hatte sie ihn spielen hören.
Nicht in der Wohnung – sondern später, als er sie zu einem Konzert mitnahm. Er hatte nie darüber gesprochen. Kein Wort von seiner Karriere, von den Sälen, in denen er gespielt hatte, von den Orchestern, die ihn einluden, als wäre sein Name ein Privileg. Und doch: Als sie ihn auf die Bühne treten sah, allein, mit diesem massiven, beinahe archaisch wirkenden Kontrabass, wusste sie sofort – hier war er wahr.
Sein Spiel war nicht nur virtuos. Es war – beunruhigend. Wie etwas, das nicht aus Technik, sondern aus einer tieferen, gefährlicheren Quelle kam. Als würde der Klang nicht aus dem Instrument, sondern aus seinem Inneren brechen. Jeder Bogenstrich war kontrolliert, und doch schien etwas in ihm zu kämpfen – nicht gegen das Publikum, nicht gegen die Musik, sondern gegen sich selbst.
Sie saß in der dritten Reihe, regungslos. Ihre Hände kalt, ihr Herz unruhig. Denn zum ersten Mal begriff sie, dass seine Dunkelheit nicht nur ein Schatten war – sondern eine Form von Genie. Und dass diese Begabung keine Erlösung war, sondern ein weiterer Spiegel seines Abgrunds.
Er spielte nicht, um zu gefallen. Er spielte, um zu überleben.
Und wieder war sie verloren. Denn was sie an ihm fürchtete, bewunderte sie nun umso mehr. Dieses ungreifbare, flammende Etwas, das ihn von der Welt trennte – und sie zugleich an ihn fesselte.
Als sie später nebeneinander durch die leeren Gassen gingen, sagte sie leise: „Warum hast du mir das nie erzählt?“Er lächelte nur, schmal.„Weil es nichts ändert“, sagte er. „Man liebt mich deswegen – oder man hasst mich trotzdem.“
In ihr war es still. Aber irgendetwas hatte sich verschoben. Tiefer. Unerklärlicher. Und sie spürte: Sie war jetzt nicht mehr nur verliebt. Sie war verwickelt in einen Mythos, dessen Hauptfigur ihr zu nahe war – und doch immer außerhalb ihrer Reichweite blieb.
Immer mehr war sie beeindruckt von seiner Fürsorge – einer Fürsorge, die nie aufdringlich wirkte, sondern durch das Detail überzeugte: Er wusste stets, wann sie fror, wann sie Ruhe brauchte, wann ein Glas Wasser mehr half als jedes große Wort. Er erinnerte sich an Kleinigkeiten, die selbst ihr entfallen waren – wie sie ihren Tee trank, wie sie mit den Fingern den Saum ihres Ärmels streifte, wenn sie nervös wurde. Es war keine demonstrative Aufmerksamkeit, sondern eine stille Wachsamkeit, die sich wie eine schützende Hand anfühlte.
Sein Wissen schien endlos. Er sprach von Philosophie, als hätte er mit ihr gelebt, von Kunst, als hätte er sie selbst erfunden, von Geschichte, als hätte er sie überlebt. Und dabei war er niemals belehrend. Im Gegenteil – seine Worte hatten jene weiche Kante, die nicht stach, sondern einlud. Er wusste, wie man Erkenntnis so formte, dass sie nicht erschlug, sondern verführte. Mit ihm zu sprechen, fühlte sich an, als würde man mit jemandem wandern, der den Weg nicht vorgibt, sondern so fragt, dass man selbst ihn findet.
Seine Haltung dem Leben gegenüber war eigenwillig, aber fesselnd: eine Mischung aus mildem Zynismus und beinahe aristokratischer Nachsicht. Er wirkte nicht enttäuscht von der Welt – eher amüsiert über ihre Naivität. Menschen, sagte er einmal, seien wie Städte: Man müsse ihre dunklen Gassen kennen, bevor man behaupten könne, sie zu lieben. Sie wusste nicht, ob sie das schön oder schmerzhaft fand – aber sie wusste, dass er glaubte, was er sagte. Und das verlieh seinen Worten Gewicht.
Doch dann gab es diese anderen Momente.
Momente, in denen sie nicht gesehen wurde, sondern sah.
Einmal, bei einem Abendessen mit Bekannten, saß er ruhig am Ende des Tisches, ein Glas in der Hand, der Blick leicht geneigt. Er sprach kaum – aber sie beobachtete, wie die Gespräche sich langsam in seine Richtung verlagerten. Nicht weil er etwas sagte, sondern weil er durch kurze Einwürfe die Richtung veränderte. Wie beiläufig brachte er zwei Gäste dazu, sich gegenseitig zu widersprechen – nicht offen, sondern in einer dieser feinen Dissonanzen, die erst viel später auffallen. Und als sich die Spannung im Raum zu verdichten begann, war es wieder seine Stimme, die sie löste – ein feiner, verbindender Satz, der Frieden stiftete, ohne dass jemand verstand, wer den Krieg begonnen hatte.