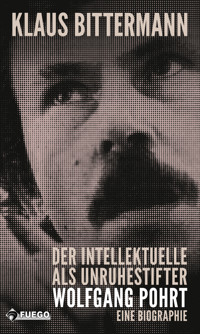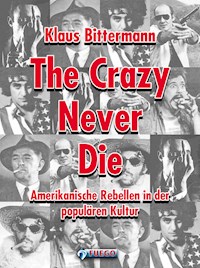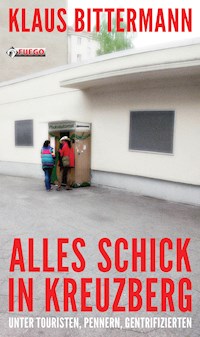12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Anlässlich 40 Jahre Edition Tiamat versammelt der Verleger einige seiner größeren und kleineren Essays und Nachrufe über wichtige Autoren des Verlags, die einen großen Einfluss auf ihn hatten und das Gesicht des Verlags nicht unwesentlich geprägt haben, wie u. a. Wolfgang Pohrt, Eike Geisel, Roger Willemsen, Hunter S. Thompson, Guy Debord, Harry Rowohlt, Robert Kurz und Wiglaf Droste, mit dem ihn eine besondere und langjährige Freundschaft verband. Außerdem legt der Verleger eine kleine Auswahl seiner Buchbesprechungen vor von Autoren, die er bewundert und gerne verlegt hätte, wie Patrick Modiano, Lucia Berlin, Mordecai Richler, Hans Magnus Enzensberger u. a., und außerdem hat er ein paar Polemiken gegen seine Lieblingsfeinde Günter Grass, Martin Walser und Thilo Sarrazin versammelt, deren Bücher einen Literaturgeschmack voraussetzen, der unerlässlich für die Plage der Bestsellerei ist. Es sind die Außenseiter, die den Mainstream zerpflückenden Analytiker, die Schlechtlaunigen mit ihrem grimmigen Humor, die Geächteten, die Häretiker, die Zweifler, die Unwirschen, die aus guten Gründen den vorherrschenden Literaturgeschmack nicht teilen und die deshalb bei Tiamat vor Anker gingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Klaus Bittermann
Einige meiner besten
Freunde und Feinde
40 Jahre Edition Tiamat
FUEGO
- Über dieses Buch -
Anlässlich 40 Jahre Edition Tiamat versammelt der Verleger einige seiner größeren und kleineren Essays und Nachrufe über wichtige Autoren des Verlags, die einen großen Einfluss auf ihn hatten und das Gesicht des Verlags nicht unwesentlich geprägt haben, wie u. a. Wolfgang Pohrt, Eike Geisel, Roger Willemsen, Hunter S. Thompson, Guy Debord, Harry Rowohlt, Robert Kurz und Wiglaf Droste, mit dem ihn eine besondere und langjährige Freundschaft verband. Außerdem legt der Verleger eine kleine Auswahl seiner Buchbesprechungen vor von Autoren, die er bewundert und gerne verlegt hätte, wie Patrick Modiano, Lucia Berlin, Mordecai Richler, Hans Magnus Enzensberger u. a., und außerdem hat er ein paar Polemiken gegen seine Lieblingsfeinde Günter Grass, Martin Walser und Thilo Sarrazin versammelt, deren Bücher einen Literaturgeschmack voraussetzen, der unerlässlich für die Plage der Bestsellerei ist. Es sind die Außenseiter, die den Mainstream zerpflückenden Analytiker, die Schlechtlaunigen mit ihrem grimmigen Humor, die Geächteten, die Häretiker, die Zweifler, die Unwirschen, die aus guten Gründen den vorherrschenden Literaturgeschmack nicht teilen und die deshalb bei Tiamat vor Anker gingen.
Pressestimmen
»Klaus Bittermann hat das Verlagsschiff durch schwere See gesteuert mit vielen Glücksmomenten und auch in schwierigen Phasen in der 40jährigen Verlagsgeschichte. Ich finde dieses Buch wunderbar, es ist ein Lieblingsbuch für mich in diesem Herbst.« (Annemarie Stoltenberg, NDR)
»Nach der Lektüre des Buches möchte man spontan sagen: Welch ein Autor und Essayist ist uns verloren gegangen, um den großartigen Verleger Bittermann zu gewinnen. Aber das ist natürlich Quatsch. Die hier versammelten Portraits, Essays und Nachrufe hängen direkt mit dem Verlegerleben zusammen. Denn Bittermann gehört zu den Überzeugungstätern im Kulturbetrieb, die Literatur samt ihrer politischen Implikationen ernst nehmen und neue Horizonte eröffnen. Der Mann kann einfach kein uninteressantes Buch verlegen. Und spätestens mit dieser Textsammlung zeigt er, dass er auch keinen uninteressanten Essay schreiben kann.« (Martin Compart, Blog)
Vorwort
Dass der Verlag einmal 40 Jahre alt werden würde, das habe ich mir nie vorstellen können, weil die Zeit damals vor vierzig Jahren nicht zu vergehen schien und man nie auch nur einen Gedanken an sie verschwendete. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie sich vierzig Jahre Verlag anfühlen würden. Warum auch? Es interessierte mich nicht. Auf einmal aber blickt man auf gut sechzig Leitzordner voller Besprechungen zurück, Ordner mit Artikeln, Manuskripten und Korrespondenz. Und dann stellt man plötzlich fest, dass man aus einer untergegangenen Epoche stammt, in der man sich noch Briefe schrieb. Viele der Autoren des Verlags und vor allem viele wichtige sind inzwischen tot, wie Hunter S. Thompson, Eike Geisel, Wolfgang Pohrt, Guy Debord, Harry Rowohlt, Mark Fisher und der kürzlich verstorbene Wiglaf Droste.
Da lag es nahe, noch einmal in mein Archiv hinabzutauchen, um Porträts, Nachrufe und Essays herauszusuchen, die ich im Laufe der letzten Jahre geschrieben habe, um an die Autoren zu erinnern und gleichzeitig zu zeigen, welches Profil sie dem Verlag gegeben haben. Ich bin stolz darauf, dass ich nicht nur die genannten oder in diesem Buch gewürdigten Autoren für den Verlag gewinnen konnte, sondern viele, die häufig nicht weniger wichtig waren als die genannten. Dass nicht alle vorkommen, liegt einfach daran, dass ich nicht über jeden geschrieben habe und der Anlass, über meine Autoren etwas zu schreiben, häufig ihr Tod war.
Zudem gibt es natürlich viele Autoren und Schriftsteller, die ich großartig finde und die ich gerne verlegt hätte, wenn es möglich gewesen wäre. Deren Bücher habe ich häufig besprochen, und von diesen Rezensionen eine Auswahl getroffen, wie um aus zahlreichen Puzzleteilen ein Bild des Verlags entstehen zu lassen, einen Kosmos, in dem, wie ich hoffe, mein Literaturgeschmack deutlich wird und meine Sympathie für die Abweichler, Melancholiker, Analytiker, Unruhestifter, Sonderlinge, Verweigerer, Irrlichter, Rabauken und Rebellen, die mit ihren Büchern ein Affront gegen den gesellschaftlichen Mainstream und nicht wirklich einzuordnen sind, und die ihren ganz eigenen Stil haben, den man nur findet, wenn man es ernst meint mit der Literatur.
Fragebogen des Fachbuchjournals
F: Was ist Ihre Erinnerung an Ihr erstes Buch? Um welches Buch handelt es sich?
A: Die Hornblower-Romane. Alle Romane von C.S. Forester über Horatio Hornblower.
F: Ihre drei Lieblingsbücher sind ...
A: Mario Vargas Llosa »Tante Julia und der Kunstschreiber«, Nabokov »Lolita« und John Kennedy Toole »Die Verschwörung der Idioten«.
F: Würden Sie Ihre Lieblingsbücher auch als eBook lesen?
A: Nur auf einer einsamen Insel ohne Bücher aber mit Stromanschluss.
F: Entspannen Sie beim Lesen oder was sind Ihre Mittel gegen Stress?
A: Im Bett liegen und Bücher lesen, bei denen man gleich einschläft. Schlafe ich bei der Lektüre nicht ein, habe ich das falsche Buch erwischt.
F: Traumjob VerlegerIn? Beruf oder Berufung?
A: Nichts tun und Geld verdienen ist der bessere Traumjob. Verleger ist ein Beruf, für den man keinen Uni-Abschluss braucht. Diesen Vorteil sollte man nutzen.
F: Wie kam es zu dieser Entscheidung?
A: Jahrzehntelange Überlegung, bis ein anderer Job nicht mehr in Frage kam und nur noch Verlegerei und Schriftstellerei übrigblieb.
F: Gibt es für Sie ein Vorbild aus der Welt der VerlegerInnen?
A: Gérard Lebovici. Er verschickte nie auch nur ein Rezensionsexemplar an die Presse und wurde 1984 in Paris erschossen.
F: Wie beginnt ein guter Tag als VerlegerIn?
A: Mit Kaffee und der FAZ, in der ein Buch des Verlags besprochen wurde.
F: Und wie sieht ein schlechter Tag aus?
A: Mit Kaffee und der FAZ, in der kein Buch des Verlags besprochen wurde.
F: Was war das spannendste Ereignis in Ihrem Berufsleben?
A: Die Entdeckung des Romans »Harold« von dem pseudonymen Autor einzlkind, das bisher einzige unverlangt eingesandte Manuskript, das im Verlag veröffentlicht wurde.
F: In einem FAZ-Interview stellte Felicitas von Lovenberg Verlegern diese Frage: Wenn Sie eine einzige Veränderung am Buchmarkt bestimmen könnten – welche wäre es?
A: Die Einführung einer Geschmackspolizei.
F: Wieviel Prozent seines Umsatzes wird Ihr Verlag im Jahr 2015 durch elektronische Informationen erwirtschaften?
A: Keine Ahnung. Ich mache Bücher, keine elektronischen Informationen.
F: Und die große Frage am Schluss: Wie wird sich die Verlagslandschaft in den nächsten zehn Jahren verändern?
A: Die Verleger werden noch mehr jammern über sinkende Absatzzahlen und trotzdem weitermachen. Jeder schreibt sein Buch und veröffentlicht es, d.h. die Autoren nehmen umgekehrt proportional zu den Lesern zu.
2014
»Mit der anmutigen Geschmeidigkeit eines Panthers«
Wiglaf Droste
Es muss 1988 gewesen sein, als mir der Name Wiglaf Droste zum ersten Mal bei der Lektüre der taz auffiel, jedenfalls las ich das schöne Wort »Klassenkampfstreber« und wurde neugierig auf mehr, weil ich sofort an den »Klassenkampfstreber« par excellence Oliver Tolmein dachte. Aber als ich im taz-Archiv nach dem Begriff suchte, stieß ich auf eine Besprechung eines Roger-Chapman-Konzerts, die mit einer harschen Kritik des Sommers begann:
»Scheußlich, ja, moralzerrüttend ist der ekle Sommer: die Kreuzberger Kämpfenden Truppen, die Alt-Einundachtziger und Klassenkampfstreber, sie schmurgeln im Prinzenbad, als wäre die Resolution schon erledigt; Kerle, die ihr Schuldenkonto ohnehin schon mit den drei Todsünden Goldkettchen, Vollbart und Stinkepfeife über Gebühr belastet haben, fügen jetzt noch Schiesser Feinripp, Kurzbehostheit und Lochsandalette hinzu, riechen unter den Achselhöhlen wie das Tote Meer, und überhaupt ist der Sommer ein nur zu willkommener Vorwand, die letzten Rudimente von Selbstrespekt freudig über Bord zu werfen.«
Seit dieser mir aus dem Herzen sprechende Suada gegen den Kreuzberger Mief durchforstete ich die taz regelmäßig nach den Artikeln Wiglafs, um im tristen Berliner Alltag, der damals zwar noch fast vollkommen touristenfrei, aber auch grau und speziell in 36 von einer autonomen Kiezpolizei beherrscht war, die nicht immer zimperlich in der Wahl der Waffen war, wenn jemand gegen ihre ungeschriebenen Gesetze verstieß. Einem dieser militanten Betonköpfe, der auch noch »Manne« hieß, konnte ich einmal bei der Arbeit zusehen, als er eine illegale Kneipe in der Adalbertstraße betrat, in der sich nicht viel mehr befand als ein zusammengenagelter Tresen und dahinter wahrscheinlich ein paar Kästen laumwarmen Biers, um die Einrichtung und den Wirt fachgerecht zu zerlegen. Keine Ahnung, um was es ging oder was sich der Mann zu Schulden hatte kommen lassen, aber der sich austobende Wahn, sich als Ordnungsmacht aufzumanteln, war nicht schön anzusehen. Ausgerechnet mit »Manne«, erfuhr ich dann später, wohnte Wiglaf einmal zusammen. Wahrscheinlich deshalb konnte Wiglaf dieses Milieu so genau und mit so leidenschaftlicher Abscheu beschreiben.
Er steckte mittendrin in der Szene, als die amerikanische Journalistin Jane Kramer 1988 nach Berlin kam, um über sie zu berichten und über das Restaurant Maxwell in der Oranienstraße, das schließen musste, weil autonome Straßenkämpfer meinten, es würde die falschen Leute anziehen und hätte in Kreuzberg nichts verloren, weshalb sie einen Eimer Scheiße im Lokal auskippten. Jane Kramer war vom New Yorker und ließ sich von Wiglaf über die Szene aufklären und verschaffte ihm einen großen Auftritt in einem der wichtigsten intellektuellen Magazine Amerikas:
»In Kreuzberg gibt es so etwas wie eine Etikette der Vergeltung. Wiglaf Droste, der Kunstkritiker der taz, sagt, wenn man Besuch von Autonomen bekomme [...], dann führe man ein paar Telefongespräche, trommle seine Freunde zusammen und statte einen Gegenbesuch ab. In Kreuzberg heißt das: eine Diskussion führen. Droste hat selbst Erfahrungen mit dem Besuchtwerden. Eines Tages kam er nach Hause und stellte fest, dass seine Tür mit Blut beschmiert war (die Inschrift lautete ›666‹ und ›Heil Satan‹). Zehn Kilo tote Fische und verfaultes Fleisch lagen auf der Fußmatte. Die Täter gaben sich in der Szene als Autonome aus, aber Droste wusste, dass sie bloß frustrierte Rockmusiker waren, denen seine Artikel nicht gefallen hatten, und deshalb stattete er ihnen auch keinen ›Gegenbesuch‹ ab. Droste ist einer der maßvollsten und scharfsinnigsten Kritiker der Kreuzberger Szene (wenngleich Fremde Schwierigkeiten haben, ihn von dieser Szene zu unterscheiden – in der ausgebeulten, gestreiften Zirkushose, der schwarzen Smokingjacke mit dem löchrigen T-Shirt, der roten Schnur anstelle eines Gürtels und den alten Turnschuhen mit offenen Schnürsenkeln.)«
In dieser Szene, in der aufgrund mangelnder Artikulations- und Kommunikationsfähigkeit Konflikte auch gerne mit den Fäusten ausgetragen wurden und Schlägereien mit den »Bullen« eine beliebte Freizeitgestaltung junger Menschen waren, konnte man, wenn man sich in der Szene aufhielt, kaum mit feingeistiger Lyrik reüssieren. Da half nur Polemik, und zwar nicht gerade »maßvolle«, die einen wie Wiglaf schnell verdächtig werden ließ, und da reichte noch Jahre später, 1994, sogar ein so lustiger Text wie »Der Schokoladenonkel bei der Arbeit«, um ihn als Kinderschänder zu brandmarken, seine Lesungen zu boykottieren und mit Buttersäure zu verhindern. Aber da hatte die Kiez-Camarilla mit ihren bundesweit organisierten Sympathisanten nicht bedacht, dass auch der rasende Reporter Wiglaf in Kreuzberg die Nächte durchgemacht und Erfahrungen als street fighting man hinter sich hatte. Er trommelte nicht nur zahlreiche weibliche Fans und Freundinnen zusammen, die den Saalschutz übernahmen, er schreckte auch nicht davor zurück, sich vor laufender Spiegel-TV-Kamera mit Linksautonomen zu prügeln, die nicht mal wussten, was Satire ist.
In diesem von Krawallen begleiteten Gemenge wuchs sein Ruf, seine Bekanntheit, die mir natürlich nicht entging. Leibhaftig und zum ersten Mal begegnete ich ihm allerdings schon lange vorher auf der Buchmesse Anfang der Neunziger, als gerade das Buch von Roger Willemsen »Kopf oder Adler. Ermittlungen gegen Deutschland«, eine vehemente Kritik des Wiedervereinigunspolitik in der Ära Kohl, erschienen war und ich mich mit dem Autor auf die Suche nach möglichen Rezensenten machte. Wiglaf war damals Redakteur bei Titanic und beäugte uns skeptisch, als wir ihm das Buch überreichten. Was immer er sich damals dachte, es war der Auftakt für zahlreiche und lange Telefonate, in denen ich ihn zu überzeugen versuchte, sich mit einem Beitrag zum Golfkriegspazifismus an einer kleinen Anthologie zu beteiligen, denn die Hysterie der Friedensbewegten, die mit weißen Laken als Zeichen der Kapitulation so taten, als würde der Krieg in Deutschland stattfinden, erschien ihm ebenso lächerlich wie mir, mit den von mir geschätzten Enzensberger und Broder zwischen zwei Buchdeckel gepresst zu werden, das wollte er jedoch nicht. Da hatten wir schon unseren ersten Dissens, der der Beginn einer bis zu seinem Tod dauernden Freundschaft wurde.
Ein paar Jahre später suchte er ein Zimmer und da ich gerade eins übrig hatte, zog er bei mir ein, mit ein paar Kartons Büchern, einer Schreibmaschine und zwei Obstkisten. Auf der einen saß er, auf der anderen hatte er die Schreibmaschine gestellt, auf der er seine Artikel schrieb. Vermutlich hätte sich an diesem Zustand auch die folgenden sechs Jahre, in denen wir zusammenwohnten, nichts geändert, denn mit der Organisation des täglichen Lebens wollte er seine Lebenszeit als Autor nicht verschwenden. Ich besorgte ihm also einen großen Schreibtisch, einen Drehstuhl und einen Büroschrank, damit er unter einigermaßen normalen Bedingungen dichten konnte. Als er dann nach sechs Jahren wieder auszog, war der Boden seines Arbeitszimmers flächendeckend mit einer ungefähr 5 Zentimeter dicken Schicht von Papieren, Briefen, Artikeln, CDs, Schallplatten, Kassetten, Manuskripten, Zeitungen, Ausrissen seiner Artikel und Büchern übersät. Nur ein schmaler Trampelpfad führte zwischen den sanften Hügeln aus Papieren von der Tür zum Schreibtisch. Er ließ alles einfach liegen, weil er von einer solchen Situation überfordert war.
Es war 1995, als Wiglaf bei mir einzog. Wir wohnten in einer großen Berliner Altbauwohnung, ich zusammen mit meinem Verlag nach vorne zur Straße hinaus, Wiglaf hinten im Seitenflügel mit Blick auf eine Remise. Dazwischen das Berliner Zimmer, in dem einige ausschweifende Gelage stattfanden. Damals lasen wir noch Die Zeit, und zwar nicht nur wegen Harrys neuester »Pooh's Corner«-Kolumne, sondern weil die Zeit eine Quelle sehr abstruser und verschrobener Artikel war, die uns wiederum zu Repliken inspirierten, um das von mir ins Leben gerufene »Who's who peinlicher Personen« zu füllen. Wiglaf kam dann in seinem blauen Bademantel in das Verlags-Zimmer, kicherte und las mir kuriose Stellen vor, die unbedingt kommentiert werden mussten.
Der Bademantel war seine Toga, in der er seine Strategien entwarf, wen oder was er als nächstes pisacken würde wegen sprachlicher Unzulänglichkeit, Nachlässigkeit oder sonstiger Todsünden. Ein Feldherr im blauen Bademantel, dem nur ein Hügel fehlte, um seine imaginären Truppen strategisch gegen den Feind in Stellung zu bringen. Ich liebte diese Auftritte, denn sie waren geistvoll, sarkastisch und lustig, und nur mit solchen Mitteln ließen sich die Zumutungen der Welt und die Anmaßungen der Dummheit, mit der wir uns ständig konfrontiert sahen, abwehren. Es waren Sternstunden.
Eine dieser Stellen, die Wiglaf vorlas, stammte von Peter Sloterdijk, der sich Ende der Neunziger gerade anschickte, die von Habermas besetzte Stelle als Oberphilosoph Deutschlands einzunehmen, und der einem Zeit-Feuilletonisten ein Rätsel stellte, von dem er überzeugt war, dass es niemand würde lösen können: »Wie stellt man es an, hinter vorgehaltener Hand über jemanden zu reden, hinter dessen Rücken man steht?«
Bei der Lösung des Rätsels wollten wir natürlich behilflich sein, denn im Grunde, sagte Wiglaf, ist das doch »kinderleicht«. Also entwarfen wir eine Versuchsanordnung, um die Frage zu beantworten, von der Sloterdijk so gequält wurde, und ließen davon ein Foto anfertigen, um die Sache auch für einen Philosophen zu verdeutlichen. Wir veröffentlichten es, erhielten aber leider nie ein Dankeschön, womit allerdings auch nicht zu rechnen war.
Damals führten wir inspiriert von der schrulligen Wochenzeitung aus Hamburg noch große Debatten, allerdings konterkarierten wir die Behäbigkeit des Blattes mit satirischer Vehemenz, und auch das Thema war von größerer Brisanz als in der Zeit, denn die Debatte durfte nur unter zwei Voraussetzungen geführt werden: »Es darf um nichts gehen, und dafür müssen alle Register gezogen werden«. In diesem Sinne führten wir eine Debatte über die Frage aller Fragen: »Ist der Winter in Deutschland überflüssig?« Ich übernahm dabei die »Pro«-Seite, beklagte »das Land der misslaunigen Muffel«, schrieb »Der Graupelschauer ist ein Meister aus Deutschland« und denunzierte den Winter als »verkappten Nazi«. Wiglaf empörte sich auf der »Contra«-Seite, »dass die Hetze gegen sibirische Temperaturverhältnisse von Klaus Bittermann vorgetragen wird, jenem Klaus Bittermann, dem Dadaismus, Surrealismus, Situationismus und Anarchie immer mehr bedeutet haben als das Wohl des Volkes. Im Gegenteil: Die Forderung des Defätisten Reinhard Lettau, das Volk abzuschaffen, unterstützt Klaus Bittermann ausdrücklich [...] Mit der Unverfrorenheit des notorisch Durchgefrorenen denunziert Bittermann jene Kälte, die einst Hitlers Sechste Armee niederwerfen half, er sehnt sich hingegen nach Verhältnissen, in denen der Wüstenfuchs Rommel einst gedieh. Das sagt ja wohl alles: Wer nicht frieren will, will Krieg!« Unsere Beiträge erschienen in der taz und Wiglaf brachte sie in seinem Benno-Ohnesorg-Theater zu Gehör.
Es gab in den neunziger Jahren eine sehr innige und intensive Zusammenarbeit, vor allem, als wir »Das Wörterbuch des Gutmenschen« gegen die Schaumsprache herausgaben und Wiglaf zu einem der Hauptmitarbeiter des »Who's who peinlicher Personen« wurde mit dem Motto »Warum sachlich, wenn's auch persönlich geht«, um unserer Aversion gegen die Wichtigtuer in der Kultur und Politik auch in gemeinsam verfassten Texten eine Bühne zu geben, und im nachhinein staune ich, mit welch großer Lust und inhaltlicher Übereinstimmung wir gegen alle möglichen lächerlichen und zumeist absurden Feuilletondebatten anschrieben und uns gegenseitig vor gegnerischen Angriffen in Schutz nahmen.
Wiglaf war ein manischer Arbeiter, er konnte Nächte durcharbeiten und am nächsten Morgen feststellen, dass das doch nichts war, was er zu Papier gebracht hatte, oder er hatte gleich drei glänzende Texte niedergeschrieben. Und er brauchte sofort die Bestätigung, sofort die Veröffentlichung, er musste spätestens am nächsten Morgen sehen, dass seine Kolumne gedruckt und in der Welt war. Er schrieb wie Balzac gnadenlos für den Tag, und dennoch setzten seine Texte nicht sofort nach Erscheinen Patina an, schon gar nicht ließen seine Artikel die Leser gleichgültig. Nicht wenige fanden sie genau und treffend, aber noch mehr reagierten gereizt und nervös. In den neunziger Jahren standen ihm fast alle Zeitungen offen, obwohl er fast den gesamten Kulturbetrieb beleidigt hatte und ihn wissen ließ, was er von ihm hielt. Damit schaffte er es sogar auf das Titelbild des Zeit-Magazins.
Er trug seine Texte einem schnell anwachsenden Publikum vor mit einer Bassstimme, die ihm, wie es Humphrey Bogart einmal ausdrückte, eine Stange Geld gekostet hatte. Er lieh anderen Autoren und Klassikern auf Hörbüchern seine Stimme, er hatte mit dem Spardosenterzett eine Musikkombo, mit der er rock'n'roll-mäßig unterwegs war, und sang wunderschöne eigene Songs, manchmal auch die von seinen großen Idolen Johnny Cash, Van Morrison, Kinky Friedman, und er schrieb und schrieb und schrieb. Mehr als dreißig Bücher, unzählige, an denen er mitgewirkt hat. Aber keine Romane, nur zwei kleine, die in Zusammenarbeit und auf Initiative Gerd Henschels zustande kamen, weil er alleine nicht die Geduld aufbrachte, und auch keine politischen Abhandlungen – auf eine über die SPD unter Schröder wartete der Rowohlt Verlag vergeblich –, sondern es war die kurze durch die Deckung gehende Gerade, die ziemlich sicher zum Knockout des Gegners führte, die ihm am besten lag. Und diese Kunst beherrschte er wie kein anderer. Und natürlich die Lyrik.
Er war der Hunter S. Thompson Deutschlands. Sein Leben fand auf der Überholspur statt, er war maßlos, weil er alles genießen wollte, und das sofort. Er hatte die verantwortungslose Fröhlichkeit, mit der er die betulichen Bügelfaltenschriftsteller gegen sich aufbrachte, er spottete und lästerte wie Villon gegen »Goldkettchenautoren«, »Ölfilmjournalisten«, »Grüßauguste«, »Dauerjauler«, und er nahm dabei keine Rücksichten darauf, aus welchem Lager jemand kam, ob er Gremliza hieß, Zaimoglu oder Möllemann. Und deshalb wurde er auch von seiner Kollegin Sibylle Berg angehimmelt:
»Wichtig bei der Auswahl meines Lieblingsschriftstellers ist auch, dass er verstörend gut aussieht. Wiglaf Droste vereinigt die anmutige Geschmeidigkeit eines Panthers mit der Gazellenhaftigkeit eines wilden Mustangs. Dieser Schriftsteller ist schlau und gut, ich hab ihn lieb.«
Als freier Autor und Vortragsreisender verdiente er zeitweise so gut, dass er sich mehrere Häuser davon hätte kaufen können, was andere ziemlich sicher gemacht hätten. Wiglaf gab alles, was er verdiente, wieder aus, so wie Georg Best, den er bei dieser Gelegenheit gerne zitierte: »Ich habe mein ganzes Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich verprasst.« Und bis auf schnelle Autos stimmte das. Er hätte auch gar nicht gewusst, was er sonst mit dem Geld hätte anfangen sollen. Es sparen wäre ihm pervers vorgekommen. Geld war dazu da, um unter die Leute gebracht zu werden.
Er war der großzügigste Mensch, den ich je getroffen habe. Er unterstützte Freunde, die nichts hatten, ohne je darauf zu achten, ob er wieder etwas zurückbekam, und er tat das, ohne darüber zu reden. Es war für ihn eine selbstverständliche Geste. Deshalb hasste er auch den Geiz und den Kleinkrämergeist, und als er, wie er mir einmal erzählte, eine Honorarabrechnung seines damaligen Verlags bekam, in dem ihm das Porto für den ihm zugesandten Brief in Rechnung gestellt wurde, hatte ich endlich meinen Lieblingsautor gewonnen, der im Laufe der kommenden Jahre dreizehn Bücher bei Tiamat veröffentlichte.
Wiglaf war zudem ein großer Zusammenbringer und Förderer. Zu seinem in der Volksbühne stattfindenden Benno-Ohnesorg-Theater, aber auch auf vielen Lesungen überall in Deutschland, der Schweiz und Österreich, lud er Autoren ein, die er mochte und gab ihnen ein große Bühne, die sie dann unter Umständen auch mal für sich allein hatten, wenn Wiglaf in allerletzter Minute absagte. Zu seinen Gästen zählten die noch am Anfang ihrer Karriere stehende Sibylle Berg, die hochgradig nervöse Simone Borowiak, der noch völlig unbekannte Funny van Dannen, der große Bär Harry Rowohlt, der Filmemacher Fritz Tietz, der wegen seiner gewaltigen Dichtkunst verehrte Horst Tomayer, die Bühnen-Diva Ernst Kahl.
Als der irische Schriftsteller Jean McGuffin zusammen mit Harry Rowohlt zu Gast in der Volksbühne war und sich jemand per Zwischenruf beschwerte, dass McGuffin englisch sprach, wurde Wiglaf stocksauer und stauchte minutenlang das Publikum zusammen, denn es sei zum Zuhören und nicht zum Meckern da, und sprach wie auch Harry fortan und extra für den Beschwerdeführer ebenfalls nur noch englisch, während das gemaßregelte Publikum danach extrem darauf bedacht war, nicht noch mehr den Zorn Wiglafs auf sich zu ziehen. Auch ich war etwas erschrocken über die Vehemenz der Zurechtweisung, aber daraus sprach eine Unerbittlichkeit gegenüber Unhöflichkeit, gegen Dummheit, Anmaßung, Bräsigkeit, Selbstgefälligkeit, gegen die in der Szene übliche auftrumpfende Frechheit, die ihn manchmal in heilige Raserei versetzen konnte.
Er war, wie der von ihm verehrte Jörg Fauser einmal über sich schrieb, »kein netter Mensch«, sondern Schriftsteller, und er dachte gar nicht daran, es allen recht zu machen, vielmehr konnte er sich sehr schnell mit jemanden in die Haare kriegen. Wenn er auf einen Dissens in politischen Fragen stieß, sagte er das auch, und das mitunter heftig und verletzend. Und das tat er vor allem, wenn er sich ausgenutzt fühlte und seine Popularität zu Vertraulichkeiten führte, die er nicht für angemessen hielt. Dann konnte die Rache fürchterlich sein.
Aber er machte sich auch unfreiwillig Feinde, wie einen Veranstalter, der in seiner Verachtung für Journalisten, die umsonst sein Haus besuchten, Wiglaf vertraulich erzählte, dass diese Spezies bei ihm unter »Fußpilz« lief, was Wiglaf so faszinierte, dass er es ganz frisch dem Publikum weitererzählte. Für eine Pointe, einen schönen Plot, ein originelles Wort war er bereit, tödlich beleidigte Leute zurückzulassen, die allerdings in der Regel vor allem tödlich beleidigte Leberwürste waren.
Natürlich forderte das ausschweifende Leben seinen Tribut, und irgendwann gab es für Wiglaf kein Zurück in das geregelte Leben der heilen, abstinenten Welt, genausowenig wie für Hunter S. Thompson und Guy Debord, zwei anderen Fixsternen am Tiamat-Himmel, die aus Notwehr gegen die pathische Normalität tranken. Zu weit und vor allem zu lange hatte er sich auf gefährliches Territorium vorgewagt, auf dem das Exzessive, der Tumult und das Unkontrollierte sich austoben und einen mit Krallen festhalten. Wiglaf kämpfte nur hin und wieder gegen die Dämonen, als wäre er sich darüber im klaren, dass er sowieso am kürzeren Hebel saß und dass keine Illusionen halfen, weshalb er beizeiten sein eigenes Epitaph schrieb:
Der intellektuelle Unruhestifter
Wolfgang Pohrt
»Wo Pohrt erscheint, bleiben Proteste nicht aus. Ich kenne keinen zweiten Autor, der es in so kurzer Zeit geschafft hätte, alle, an die er sich wendet, gegen sich zu mobilisieren«, schrieb Henryk M. Broder im Spiegel 1982 in einer Rezension des Buches »Endstation« von Pohrt. Die Leute, die sich von Pohrt auf den Schlips getreten fühlten, weil er ihre geheimen Beweggründe analysierte, ergäben ein beeindruckendes Who's who der beleidigten Kulturschaffenden. Niemand mag es, wenn jemand zerpflückt, was man für einen großartigen und hehren Gedanken hält, der die Welt verbessern würde. Das Echo, das Pohrt hervorrief, war für einen freischaffenden Kritiker und Autor ungewöhnlich. An ihm schieden sich die intellektuellen Geister, ihn hasste die Meinungselite in Deutschland aufrichtig und von ganzem Herzen. »Denunziationen« gegen die neue Bewegung witterte Eckhard Jesse in der Süddeutschen Zeitung. »Larvierte Menschenverachtung« warf ihm Jürgen Manthey in der Frankfurter Rundschau vor. Für den Pflasterstrand war er ein »Finsterling mit Faschismus-Paranoia«. Ein Jack Zipes fand es in Ästhetik & Kommunikation verheerend, dass Eike Geisel und Pohrt »ihre Wörter wie Waffen benutzen, um ihre Gegner, ob links oder rechts, zu eliminieren oder auszurotten«. Thomas Schmid, heute Chefredakteur der Welt, damals Herausgeber des Freibeuter, leitartikelte: »Der furiose Wolfgang Pohrt, der sechs Millionen ermordete Juden zu seinem Betriebskapital gemacht hat und ebenso scharfrichterlich wie intellektuell unseriös auf alles einschlägt, was er nicht selber ist, ist einer der geistigen Ahnherrn der journalistischen Unkultur.« In die gleiche Kerbe ließ Titanic Yaak Karsunke schlagen, der meinte, Pohrts »beliebiges Hantieren mit dem Grauen als Versatzstück ist zynisch«. Nur der Jean-Améry-Preisträger Lothar Baier, der sich intensiv mit dem Nationalsozialismus befasst hatte, stellte in der Zeit die Frage, wer wohl »in jüngster Zeit ähnlich erhellendes über das KZ-Universum geschrieben hat wie Pohrt«?
Angesichts einer »schwachen Opposition«, die es zu unterstützen gälte, suche Pohrt »die totale Konfrontation«, bemängelte Hermann Peter Piwitt in Konkret, während Bärbel Goddar in Radio Bremen die beruhigende Nachricht verbreitete: »Pohrts Buch ist für Intellektuelle geschrieben, es dürfte mit seinen Aussagen die werktätige Bevölkerung kaum erreichen.« Auf seine polemische Thesen wurde in der Regel verärgert und mit Abscheu reagiert. Als Pohrt in Joseph Hubers Buch über die Alternativbewegung Denkmuster eines »potentiellen Faschisten« entdeckte und das im Spiegel veröffentlichte, ereiferte sich Robert Jungk: »Der wüste Anschlag von Wolfgang Pohrt auf Joseph Huber hat bei mir assoziativ die Erinnerung an das sinnlose Attentat gegen John Lennon geweckt.« Und Johano Strasser sah einen »geradezu neurotischen Vernichtungswillen« am Werk.
Auch wenn die meisten Kritiker heute niemand mehr kennt, in den Achtzigern gaben sie den Ton an. Der »Magier« Pohrt, wie Franz Josef Degenhardt ihn nannte, war an die Grenze zur Prominenz gestoßen. Aber als sich der Rauch verzogen hatte, sah man keine Leichen auf dem Schlachtfeld der intellektuellen Kontroverse herumliegen, sondern lauter quietschlebendige und rachedurstige Menschen aus dem journalistischen Gewerbe, die im Kulturbetrieb den Ton angaben und die, da sie sich von Pohrts Kritik oft persönlich getroffen fühlten, aus verständlichen Motiven keinen Wert darauf legten, Pohrt länger Gehör zu verschaffen. Redakteure, die seinen Scharfsinn bewunderten, kamen immer seltener auf die Idee, ihn schreiben zu lassen. Dem Leser der Zeit wollte man Pohrt lieber nicht zumuten. Vermutlich aus guten Gründen. Nur für Konkret, die er regelmäßig mit Artikeln belieferte, arbeitete er 1984 vier Monate lang als Redakteur, und Jan Philipp Reemtsma ermöglichte ihm für ein paar Jahre eine Tätigkeit als Privatgelehrter Anfang und Mitte der neunziger Jahre, während die taz ihn als Redakteur ablehnte, weil man befürchtete, dann nicht mehr in Ruhe frühstücken zu können.
1989 gab Pohrt seine »Geschäftsaufgabe« als Ideologiekritiker bekannt. Die Marktlücke, die sich durch die Protestbewegung aufgetan hatte und die von Leuten wie Schultz-Gerstein beim Spiegel über den Niedergang dieser Bewegung hinaus offen gehalten wurde, gab es nicht mehr. Viel wichtiger jedoch: Der Ideologiekritiker war in den Augen Pohrts obsolet geworden. Der Gegenstand seiner Kritik hatte sich verflüchtigt: eine Bewegung, mit der sich noch auseinanderzusetzen lohnte und die sich noch nicht rückstandslos im nationalen Volkskörper aufgelöst hatte. Die Linke war das Koordinaten- und Bezugssystem Pohrts. 1989 aber kamen die rechten Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus.
»Wenn also rund acht Jahre, nachdem die Linken in der Bundesrepublik eine nationale Frage überhaupt erst wieder ins Gespräch gebracht hatten unter dem Vorwand, derlei nicht den Rechten überlassen zu wollen, diese Politik schließlich Früchte trägt, und wenn die Früchte dann in den Garten nicht des angemaßten, sondern des rechtmäßigen Besitzers dieser nationalen Frage fallen, so ist für die Ideologiekritik wieder einmal der Zeitpunkt gekommen, wo sie im Bewusstsein, es besser gewusst und dennoch nichts bewirkt zu haben, getrost abdanken kann.«
Die Protestbewegung sei kein Ziel für Polemik mehr, weil sie sich »in einen Gegenstand der allgemeinen anthropologischen Betrachtung« verwandelt habe.
Zehn Jahre hatte Pohrt gegen die Politik der Protestgeneration angeschrieben. Er konnte das deshalb so genau, weil er selbst ein Teil dieser Bewegung war. Er hatte in Frankfurt und Berlin Soziologie studiert, sich mit Marx, Adorno, Horkheimer und Krahl befasst. Er trug die Säulenheiligen der Bewegung jedoch nicht wie eine Monstranz vor sich her, um sich durch sie zu immunisieren oder den eigenen Artikeln Bedeutung zu verleihen, sondern Pohrt nutzte ihre Methode und ihr Handwerkszeug, ohne einfach nur ihre Gedanken zu reproduzieren.
1976 erschien seine Dissertation »Theorie des Gebrauchswerts«. An der Lüneburger Uni hielt er Seminare über »Die Aktualität des Faschismus«, »Marx-Kontroversen« und über das »Verhältnis von Ohnmacht, Apathie und Wahn im Spätkapitalismus«. Dem glücklichen Umstand, dass die Hochschule seinen Vertrag nicht verlängerte, ist es zu verdanken, dass in Deutschland über Jahre hinweg Polemik auf so hohem Niveau praktiziert wurde.
1980 erschien im Berliner Rotbuch Verlag »Ausverkauf«, der erste Band mit »Pamphleten und Essays«, bzw. »Schubladentexten«, denn niemand hatte Pohrt bis dahin wahrgenommen und veröffentlicht, sieht man von einem Aufsatz über »Wegwerfbeziehungen« ab, der 1974 im Kursbuch erschien. Das änderte sich jetzt. Spätestens nach einer Kritik in der Frankfurter Rundschau von Wolfram Schütte, der im intellektuellen Leben Deutschlands eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielte:
»Der Reichtum an Erkenntnissen, Einsichten und Durchblicken, den das Buch in jeder seiner dreizehn Arbeiten enthält und verschwenderisch ausbreitet – oft mit aphoristischer Prägnanz und abgründigem Witz formuliert, die Pohrt auf einen Schlag zu einem unserer besten Polemiker machen –: diese intellektuelle Fülle ist hier gar nicht zu referieren. Von allen essayistischen, zeitkritischen ›Kopfgeburten‹ der letzten Zeit sind deshalb Pohrts Pamphlete und Essays die monströsesten, Kinder des Schreckens, gezeugt von Intelligenz und politischer Moral, aufgezogen von Empörung und Zorn und in die Welt geschickt, um Unruhe zu stiften.«
Im Pathos dieser Zeilen und in der hochtrabenden Formulierung klang jedoch bereits an, dass die neue Freundschaft nicht lange währen würde. Und tatsächlich konnte es sich Pohrt nicht verkneifen, Schütte in einem Brief als »Ehrenretter der Kulturnation« und »Prinz Eisenherz der neudeutschen Kunst« zu verspotten.
In »Ausverkauf« schlägt Pohrt den Ton und die Motive an, die er in den nächsten zehn Jahren in Zeitungsartikeln und Vorträgen umkreisen wird, eine Kampfansage an die deutschen Intellektuellen, denen es immer schwer gefallen ist, »zwischen einer Ergebenheitsadresse und einer Meinung zu unterscheiden«. Das jedenfalls ist der Befund Pohrts, als er die Ereignisse um die Entführung von Hanns-Martin Schleyer 1977 untersucht, die sich als Zäsur innerhalb der Linken erweisen sollten. Damals gaben 123 Professoren und 54 wissenschaftliche Mitarbeiter »ihre Devotion« in der FR kund.
»Diese Professoren, wie alle Linken vom Sozialistischen Büro bis zu den Jungsozialisten, haben vor Angst den Verstand verloren, wenn sie sich heute in die Schlange derer drängeln, die darauf warten, unter den wohlwollenden Blicken der Macht und unter dem Beifall der Menge auch mal auf die Bösewichter spucken zu dürfen.«
Damals noch vom Furor der Moral getrieben, verzichtete Pohrt später auf nebulöse Begriffe wie Macht, weil Macht in der Regel spezifisch ist und einen Namen hat. Aber man merkte, hier schrieb einer mit offenem Messer und keiner, der auf das Bundesverdienstkreuz scharf war und wohl ausgewogene Erörterungen anstellte.
In der öffentlichen Diskussion über Stammheim und Mogadischu ging es Pohrt nicht darum, die RAF zu kritisieren, sondern daran zu erinnern, dass es sich um Leute handelte, »die amerikanische Einrichtungen angegriffen hatten, um dem Bombenterror gegen Vietnam nicht tatenlos zusehen zu müssen«. Es wäre jedoch falsch, Pohrt für einen Sympathisanten der RAF zu halten, die von seiner Kritik nicht verschont wurde, vielmehr ließ er sich in seiner Argumentation davon leiten, dass es weit triftigere Gründe gab, gegen die neue Gleichschaltung der Medien zu polemisieren als gegen Leute, mit denen Pohrt eine gemeinsame Vergangenheit verband, nämlich der Protest gegen das amerikanische Flächenbombardement in Vietnam, und ein gemeinsames Ziel hatte, nämlich die Abschaffung von Verhältnissen, in denen der Mensch ein geknechtetes und unterdrücktes Wesen war. Und aus diesem Grund trat Pohrt immer wieder für eine Amnestie der Gefangenen ein. Dies war das einzige, was man nach Pohrts Überzeugung sinnvollerweise noch tun konnte, das einzige auch, wo die Motive des einzelnen keine Rolle spielten. Und hätte man für ein damals geplantes rororo-aktuell-Bändchen den Papst für eine Amnestiekampagne gewonnen, umso besser, und kein Grund, die Nase zu rümpfen.
Aus dem berechtigten antiimperialistischen Protest wurde jedoch schnell ein antiamerikanisches Ressentiment. Ende Oktober 1981 erschien in der Zeit »Ein Volk, ein Reich, ein Frieden«. Darin beschrieb Pohrt, wie nach der Raketenstationierung aus der Friedensbewegung eine »deutschnationale Erweckungsbewegung« wurde. Als Beispiel zitierte er den damals grundguten und als unantastbar geltenden Friedensapostel Gollwitzer, der in einem Leserbrief an den Spiegel geschrieben hatte: »Kein Deutscher kann diese bedingungslose Unterwerfung der Interessen unserer Volkes unter fremde Interessen, diese Auslieferung der Verfügung über die Existenz unseres Volkes an eine fremde Regierung hinnehmen.« Und auch Hermann Peter Piwitt stöhnte in Konkret »herzzerreißend über die Besetzung seiner Heimat durch die ›Yankee-Kultur‹«. »Mögen anderswo dem amerikanischen Kulturimperialismus die tradierten Lebensformen ganzer Nationen zum Opfer gefallen sein«, erwiderte Pohrt darauf apodiktisch, »in Deutschland aber begann mit dem amerikanischen Kulturimperialismus nicht die Barbarei, sondern die Zivilisation.« Und er fährt mit einem Satz fort, der bei der Zeit-Leserschaft für Furore sorgte und noch in Talkshows für Gesprächsstoff sorgte: »In diesem Land ist jede weitere Filiale der McDonald-Hamburger-Kette eine neue Insel der Gastfreundschaft und eine erfreuliche Bereicherung der Esskultur.«
Aus einer Fußnote des Zeit-Artikels erfährt man, dass »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« von Konkret abgelehnt worden war. Und von Broder erfährt man, Gremliza habe gezischt: »Was Pohrt jetzt schreibt, ist einfach skandalös.« Das fanden auch andere, wie z.B. die damals für die Taschenbuchreihe bei Rotbuch zuständige Marie-Luise Knott, bei der die Behauptung Pohrts, die Frauenbewegung sei aus einem Missverständnis heraus entstanden, auf wenig Gegenliebe stieß. Pohrts Analyse hielt sie für einen Witz und erinnerte sie an einen »männlichen Stammtischreißer«. Pohrt hatte in einem Nachruf auf die siebziger Jahre geschrieben:
»Als aus den Revolutionären Kindergärtner geworden waren und folglich windelnde und spülende Männer eine Landplage, ging man oft ins Kino, um Humphrey Bogart als einzigen Mann und letzten Helden in ›Casablanca‹ zu bewundern. Die Kinobesuche machten aus Kindergärtnern keine Helden, schürten aber den Hass der Frauen auf ihre männliche Begleitperson: die Frauenbewegung war geboren.«
Bei allen damals hochkochenden Debatten war Pohrt nicht fern. Als Broder 1984 von Alice Schwarzer als »militanter Jude« stigmatisiert wurde, mit dem kein Mitglied der Emma-Redaktion Kontakt haben dürfe, regte Pohrt die Herausgabe einer Anthologie an »über das Verhältnis der Linken zum Antisemitismus«, in der – wäre das Buch zustande gekommen – die besten und verhasstesten Polemiker versammelt gewesen wären: Pohrt, Broder, Schultz-Gerstein und Eike Geisel. Es gab jedoch genügend andere Anlässe und Gelegenheiten, sich mit diesem Problem zu befassen, welches darin bestand, dass die Linken »weder den Nationalsozialismus noch Auschwitz begriffen hatten, weil sie ersteren mit einem besonders tyrannischen Regime und letzteres mit einem besonders grausamen Blutbad« verwechselt und deshalb die Hoffnung nicht aufgegeben hätten, »das Unrecht, welches sie anderswo entdecken, könne Deutschland entlasten«.
Bei den Linken, deren Liebe zu den Palästinensern besonders heftig brannte, ließ sich diese Entlastung für Deutschland besonders schön beobachten:
»Dreihundert von der südafrikanischen Polizei in Soweto erschossene Schüler kümmern niemand. Drei erschossene Schüler in Hebron machen die westdeutsche Linke vor Empörung fassungslos. Die Unterdrückung und Verfolgung der Palästinenser durch Israel wird so genau beobachtet und so leidenschaftlich angeprangert, weil sie beweisen soll: es gibt keinen Unterschied. So merkt die westdeutsche Linke nicht, dass ihr der Unterschied zwischen Deutschland und den anderen Nationen mit jedem Versuch, ihn zu verwischen und zu tilgen, nur umso kolossaler entgegentritt.«
Dieses Nicht-Begreifen der deutschen Geschichte leistete einem Denken Vorschub, welches jedes Massaker, das einem politisch in den Kram passte, mit Auschwitz gleichsetzte, um unter der Flagge von Humanität und Menschenrechten staatliche Souveränität missachten und Kriege anzetteln zu können. Die deutsche Linke hatte dafür die Argumente geliefert, die die rot-grüne Regierung im Bürgerkrieg in Jugoslawien nur noch zu übernehmen brauchte.
Am 1. November 1983 hielt Pohrt im großen Saal der Berliner »Akademie der Künste« vor ca. tausend Zuhörern einen Vortrag über den »Krieg als wirklichen Befreier und wahren Sachwalter der Menschlichkeit«. Anschließend gab es eine Diskussion mit dem Friedensbewegten Fritz Vilmar und dem ehemaligen Frankfurter Sponti und Mitglied der »Revolutionärer Kampf«-Gruppe Thomas Schmid, der heute als konservativer Leitartikler die Öffentlichkeit vor linken Irrtümern warnt. Das Publikum war so gespalten wie das Podium, und Pohrt war in seinem Element. Die heftigen Reaktionen ließen ihn zur Höchstform auflaufen, und je mehr es im Saal brodelte, desto spöttischer und beißender wurden seine Diskussionsbeiträge. Nichts war ihm unangenehmer als eine reglos dasitzende Zuhörerschaft, und deshalb begann er jeden Vortrag mit einer auf die Veranstalter und die Themenstellung gemünzten provozierenden Anmerkung, um die Zuhörer aus der Reserve zu locken. Das setzt jedoch immer ein Publikum voraus, das uneins ist und sich zumindest teilweise auf die Seite Pohrts schlägt. Auf dem Konkret-Kongress im Sommer 1993, auf dem sich zum letzten Mal so etwas wie eine unabhängige Linke traf, war die Ablehnung Pohrts massiv und einhellig. Er selbst war enttäuscht und genervt.
Nach sechs Essay-Bänden, die mit Witz und Verve geschrieben sich als kritische Chronik der siebziger und achtziger Jahre lesen lassen, war mit dem Fall der Mauer eine neue Epoche angebrochen. Für Pohrt höchste Zeit, sich den Ereignissen auf andere Weise zu nähern als mit feuilletonistischer Kommentierung. Er machte Reemtsma das Angebot, das Massenbewusstsein der Deutschen in der Umbruchsphase zu untersuchen und die Chancen für einen neuen Faschismus zu sondieren. Im Hamburger Institut zusammen mit Ulrich Bielefeld zu forschen kam für ihn allerdings nicht in Frage. »Da hat der vereinte Sachverstand gründlich nachgedacht, und es kam der originelle Vorschlag heraus, dass sich fünf Leute in Hamburg treffen sollen, um von ihren nicht vorhandenen konkreten Vorschlägen zu erzählen«, machte sich Pohrt über »Forschungsprojekte«, wie sie Bielefeld betrieb, lustig und beharrte darauf, als Einmannforschungsteam die Studie zu erstellen, die sich an der sozialwissenschaftlichen Methode der Frankfurter Schule und an dem 1950 erschienenen »The Authoritarian Personality« orientierte.
Pohrt traktierte seine Freunde, Verwandten und Bekannten mit einem 58 Aussagen umfassenden Papier, in dem Sätze bewertet werden sollten wie: »Im Wohlstand verkümmern die inneren Werte der Menschen, weil jeder nur auf den eigenen Wohlstand bedacht ist.« Er führte ausführliche Interviews und Gespräche, protokollierte sie und wertete sie aus, er zog sämtliche Register der Statistik und empirischen Sozialforschung, um schließlich zu dem von seitenlangen Ziffern und Koeffizienten untermauerten Ergebnis zu gelangen, dass die Werte »auf eine antizivilisatorische, antidemokratische Überzeugung schließen lassen, deren unerhörte Einhelligkeit ferner die ungebrochene Neigung zur freiwilligen Selbstgleichschaltung verrät«.
Pohrt hatte im Alleingang und in nur einem Jahr ein über 300seitiges Forschungsergebnis vorgelegt, womit sich ein größeres Wissenschaftsteam zehn Jahre lang die Zeit hätte vertreiben können. Auf eine nennenswerte Resonanz stieß diese Arbeit nicht, obwohl man zur Beurteilung der drei zentralen Ereignisse Anfang der neunziger Jahre in der Zone (Ausländerverfolgung), in Jugoslawien (Serbienfeldzug) und im Irak (Golfskriegspazifismus) auf die Studie Pohrts gut hätte zurückgreifen können.
Im Abstand von jeweils einem Jahr folgten mit »Das Jahr danach« und »Harte Zeiten« zwei weitere Bücher, die allerdings nicht mehr in Form einer empirischen Sozialstudie erschienen, sondern als »Analysen zur Zeitgeschichte, deren bescheidener Nutzen darin besteht, dass sie die spätere Legendenbildung erschweren könnten«. Pohrt hatte auf die Katastrophe hingewiesen, »als welche die Wiedervereinigung und der Zusammenbruch des Ostblocks sich entpuppten«, ohne dass eine gesellschaftlich relevante Gruppe den Versuch unternommen hätte, diese Entwicklung aufzuhalten.
1994 begann die Entwicklung schließlich an Dynamik zu verlieren, sie wurde zum Dauerzustand. Das Elend wurde chronisch, aber niemals Grund zur Einsicht oder gar größerer und nachhaltiger Proteste. Die Intellektuellen wurden noch national gesinnter und die Bevölkerung war jederzeit bereit, weitere Einschneidungen im Sozialsystem hinzunehmen. Stattdessen wurden Pohrt in der taz für seine Studien folgende Komplimente gemacht: er sei ein »deutscher Apokalyptiker«, ein »außer Rand und Band geratener Utopist«, ein »deutscher Rassist par excellence« und ein »manischer Inländerfeind«. Das behauptete jedenfalls Reinhard Mohr, der sich mit solchen Artikeln für einen Job beim Spiegel empfahl.
Pohrt wurde in einem ungeheuren publizistischen Kraftakt zum führenden politischen Kommentator, der im Dunstkreis einer unabhängigen Restlinken und von Konkret, in der er regelmäßig veröffentlichte, den Ton und manchmal auch die Richtung vorgab und dennoch immer ein Fremdkörper blieb, weil ihm jede Gefolgschaft suspekt war. Die Abwendung vom Palästinenserfeudel hin zu einer Pro-Israel-Haltung, die im Golfkrieg 1991 offensiv vertreten wurde und Konkret mehrere hundert existenzgefährdende Abonnenten kostete, kam nicht zuletzt durch seine vehemente Fürsprache der amerikanischen Einmischung zustande, die in seinem Wunsch kulminierte, die Israelis würden sich der Bedrohung durch den Irak notfalls mit einer Atombombe zur Wehr setzen. Später bedauerte er die Äußerung, die aus der Erregung darüber entstanden war, dass man in Deutschland Saddams Scud-Raketen als selbstverschuldete Bedrohung bagatellisierte. Inzwischen hat sich im Nahen Osten einiges geändert, weshalb er das unreflektierte Festhalten an dieser Position später als Unfähigkeit kommentierte, sich von einer liebgewonnenen Einsicht wieder zu verabschieden, wenn die gesellschaftlichen Prämissen andere geworden sind.
1997 erschien seine letzte Untersuchung, noch einmal von Reemtsma finanziert, von diesem aber schließlich nicht mehr gut geheißen. In »Brothers in Crime« ging es um die Auflösung der Politik und deren Transformation in ein klassisches Bandenwesen, und im Untertitel bereits klang an, das die Aussichten trübe waren: »Die Menschen im Zeitalter ihrer Überflüssigkeit.« Auch diesem Werk war trotz beachtlicher Resonanz kein großer Erfolg beschieden. Pohrts Kritik war zu radikal und verzichtete weitgehend auf populäre Thesen und Agentenromantik, wie sie Dagobert Lindlau in seinem Bestseller »Der Mob« verwendete.
Pohrt meldete sich Ende der Neunziger nur noch sporadisch mit gelegentlichen Vorträgen zu Wort. Dann wurden ihm die Zigaretten zuviel, die er für das Schreiben eines Artikels brauchte. Er schwieg. Das mochte man zwar bedauerlich finden, aber zumindest verfiel er nicht der Versuchung vieler anderer Autoren, die zeitlebens einen originellen Gedanken, den sie mal hatten, variieren.
Nur einmal noch ließ er sich aus der Reserve locken, als er am 3. Oktober 2003 zusammen mit Henryk M. Broder einer Einladung eines »Bündnisses gegen Antisemitismus und Antizionismus« ins Berliner Tempodrom folgte, eine Veranstaltung, die Pohrt selbst als Fiasko wertete. Immerhin zeigte die lebhafte Reaktion auf seinen Auftritt, dass er immer noch als Feindbild in der Linken wahrgenommen wurde. In dem aus dieser Veranstaltung heraus entstandenen Buch »FAQ« ergriff Pohrt die Gelegenheit, die Positionen der sogenannten »Antideutschen« zu kritisieren, als deren Ikone und theoretischer Protagonist er galt, und zwar mit dem Hinweis, dass jede Wahrheit einen Zeitkern hat, also nur gültig ist unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen.
»Manche Leute freut es, wenn sie von sich behaupten können, sie hätten es schon immer gesagt. Mir geht es weniger um die Ewigkeit als den richtigen Zeitpunkt. Deshalb gefällt es mir, dass ein umfangreicher Teil meines 1992 erschienenen Buches ›Das Jahr danach‹ die Ausländerverfolgung anprangert. Und aus dem gleichen Grund wäre es mir nicht angenehm, wenn dieser Text unkommentiert jetzt wieder erschiene, wo sein Charakter der eines Mit-den-Wölfen-Heulens wäre.«
Als 1991 in Rostock-Lichtenhagen das Wohnheim für Ausländer in Brand gesteckt wurde, hatte der Staat auf der ganzen Linie versagt. Zehn Jahre danach sah die Sache anders aus:
»Antisemiten und Rassisten werden bekämpft, weil man sie benötigt. Sie werden gebraucht, weil sie so was wie der Dreck sind, an welchem der Saubermann zeigen kann, dass er einer ist. Sie werden gebraucht, damit Schröder die von ihm geführten Raubzüge der Elite als ›Aufstand der Anständigen‹ zelebrieren kann. Sie werden gebraucht, weil die Ächtung von Antisemitismus und Rassismus das moralische Korsett einer Clique sind, die sich sonst alles erlauben will, jede Abgreiferei, aber wie jeder Verein für ihren Bestand Verbote und Tabus benötigt.«
Damit hatte sich Pohrt wieder einmal der politischen Einvernahme durch die Linke, bzw. eine ihrer Fraktionen, entzogen. Er hatte die letzten Bewunderer vor den Kopf gestoßen und die letzten Drähte gekappt. Und er hat dies getan, ohne sich neue Freunde zu schaffen. Er hat sich von der Restlinken verabschiedet, ohne sich ins bürgerliche Lager zu retten. Er hat dies allein dadurch geschafft, indem er einfach nur die Zeichen der Zeit zu deuten versuchte und sich nie auf einer einmal gefundenen Wahrheit ausruhte. Er war über dreißig Jahre hinweg der vielleicht brillanteste Kopf der Linken. Sie hat ihn nie gemocht, weil er ihr den Spiegel vorgehalten hat, in dem sich ihr in der Regel kein schöner Anblick bot. Nachdem die Linke spätestens mit der Wiedervereinigung zum bloßen Gegenstand »anthropologischer Betrachtung« wurde, geben für Pohrt nun auch die Verhältnisse selbst nichts mehr her, das sich noch zu analysieren und zu kommentieren lohnte, jedenfalls nicht, um einen Verein oder eine Gemeinde damit zu erfreuen, die die Linke bestenfalls noch ist. Andere jedoch, die an seiner Meinung interessiert sind, gibt es nicht allzu viele, jedenfalls nicht in den Blättern, die bislang keine große Anstrengung unternommen haben, an der von Pohrt vor dreißig Jahren konstatierten freiwilligen Gleichschaltung wirklich etwas zu verändern.
Some of my best friends are German
Eike Geisel
Der 1997 verstorbene Historiker und Journalist Eike Geisel gehörte zusammen mit Wolfgang Pohrt, Henryk M. Broder, Lothar Baier und Christian Schultz-Gerstein einer Generation von Kritikern an, die sich seit den siebziger Jahren radikal, scharfsinnig und originell mit dem ideologischen, politischen und kulturellen Zeitgeist auseinandersetzten, ohne einer institutionalisierten Opposition oder Gruppe anzugehören. Als Achtundsechziger hatte Geisel sein Denken wie viele andere an Adorno und Horkheimer geschult, im Unterschied zu vielen anderen aber auch an Hannah Arendts »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« und an ihrem Eichmann-Buch. In einer Zeit, als die Literatur über den Nationalsozialismus noch sehr spärlich war, beschäftigte er sich u.a. mit H.G. Adlers Theresienstadt-Studie, las Eugen Kogons Standardwerk »Der SS-Staat« und Jean Améry, dessen rhetorische Vortragskunst er bewunderte.
Er promovierte über »Marx und die nationale Frage«, arbeitete zwischen 1973 und 1975 am Otto-Suhr-Institut, bevor er anschließend (von 1975 bis 1981) zusammen mit Wolfgang Pohrt als Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Lüneburg lehrte, wo er u.a. Seminare über die Aktualität des Faschismus und über Marx abhielt. In dieser Zeit lernte er die kommunistische Jüdin, Partisanenkämpferin und KZ-Überlebende Hanna Lévy-Hass kennen und überredete sie, ihre Tagebücher »Vielleicht war das alles erst der Anfang« im Rotbuch Verlag (1979) zu veröffentlichen, denen ein langes Gespräch mit der Autorin beigefügt war.
1981 erschien das von ihm herausgegebene Buch »Im Scheunenviertel«, ein Bildband mit einem großen Essay, Fotos, zeitgenössischen Texten und Dokumenten über die während der Kriegs- und Revolutionswirren nach Berlin geflüchteten Ostjuden, ein Buch, das zahlreiche Auflagen erlebte. Weil die DDR in den 35 Jahren nach Kriegsende wenig getan hatte, um diese verrufene Gegend zu sanieren (was dem Westen innerhalb weniger Jahre dann vollständig gelang), erinnerten alte Reklameschriften an Wänden, Einschusslöcher und Elendsbehausungen noch rudimentär an den Krieg und das Leben armer Juden, das da einmal auf engstem Raum stattgefunden hatte.
Anfang der Achtziger lernte er auch Henryk Broder kennen, der sich schon seit den siebziger Jahren mit dem Antisemitismus in der Linken auseinandersetzte und mit linker Prominenz und Zeitschriften wie Emma und Konkret im Clinch lag, u.a. deshalb, weil Emma-Redakteurin Ingrid Strobl Israel das Existenzrecht absprach und Alice Schwarzer einer Angestellten Kontaktverbot zum »militanten Juden« Broder erteilte. Immerhin ein Vorfall, der zur Planung einer kleinen Anthologie über das Verhältnis der Linken zum Antisemitismus führte, die dann allerdings nicht zustande kam.
Mit Broder verband Geisel eine enge Freundschaft. Gemeinsam suchten sie in den USA und Israel Überlebende des Jüdischen Kulturbunds auf, sammelten Dokumente und drehten den Film »Es waren wirklich Sternstunden«, der 1988 ausgestrahlt wurde. Geisel erstellte das Konzept für eine dann 1992 an der Akademie der Künste gezeigten großen Ausstellung mit einem umfangreichen Katalog (»Geschlossene Vorstellung«). Zudem erschien im gleichen Jahr ein Buch von ihm und Broder zu diesem Thema mit dem Titel »Premiere und Pogrom«.
Broder beteiligte sich da allerdings nur noch sporadisch an der historischen Forschung, denn mit der am 2. August 1990 beginnenden Annektierung Kuweits durch Saddam Hussein und der Intervention der USA und ihrer Verbündeten am 16. Januar 1991 begann in Deutschland eine heftig geführte Debatte, in die beide leidenschaftlich involviert waren. In der Textsammlung »Liebesgrüße aus Bagdad. Die ›edlen Seelen‹ der Friedensbewegung und der Krieg am Golf« spotteten sie über die wieder von den Toten auferstandenen Pazifisten, die weiße Laken als Zeichen der Kapitulation aus dem Fenster hängten, und polemisierten gegen Leute wie Rudolf Augstein, Alice Schwarzer und Christian Ströbele, die dem vom Irak durch Raketenbeschuss bedrohten Israel eine gewisse Mitschuld am Krieg gaben. Sie mieteten eine große elektronische Werbetafel an der Ecke Joachimsthalerstraße und Kurfürstendamm gegenüber vom Café Kranzler, auf der dann zu lesen war: »An die deutsche Friedensbewegung: Vielen Dank für die moralische Nachrüstung. Ihr Saddam Hussein.«
Danach setzte die Debatte um die Stasi ein, die für Broder allerdings eine andere Bedeutung hatte als für Geisel. Er sah in der kollabierten DDR nicht so sehr den mit dem Nationalsozialismus vergleichbaren Unrechtsstaat, sondern eine kommode und lächerliche Diktatur, mit der sich die Bevölkerung arrangiert hatte, bis die Verlockungen des Westens in Form von Beate Uhse und Bananen und weniger von Freiheit sie überlaufen ließen. In der öffentlichen Diskussion über die Stasi erkannte er das Bedürfnis der Deutschen, die nicht stattgefundene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nach 1945 nachzuholen, um sich ein gutes Gewissen zu machen. Die Outings von ehemaligen Stasimitarbeitern fand er nicht weniger erbärmlich als die »Schwerter-zu-Pflugscharen«-Pazifisten, die sich als Fundamentalopposition stilisierten, lächerlich. Empörend fand er die Jagd auf Ausländer im Osten, die schließlich im Pogrom in Lichtenhagen kulminierte, und über die Rechtsradikalen, die es zusammen mit dem Mob phasenweise schafften, »national befreite Zonen« einzurichten, in die sich keine Bürger anderer Staaten mehr trauten. Als er 1992 zu einem Vortrag in die Vereinigten Staaten reiste, schrieb er mir: »Es wird höchste Zeit, dass ich abhaue, ehe alle Brüder und Schwestern aus der Zone kommen. Die Wiedervereinigung sehe ich mir gerne aus 6000 km Entfernung an.«