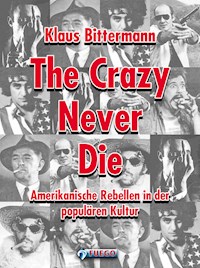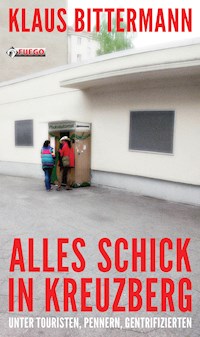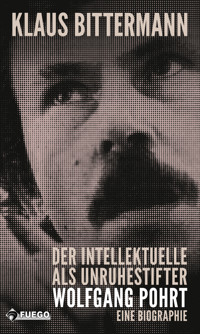
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Anfang der achtziger Jahre Wolfgang Pohrt die öffentliche Bühne betrat, wurde den Lesern schnell klar, dass da jemand einen neuen Ton anschlug. Pohrt verstand es, seine Thesen mit großer Schärfe, Klugheit und Eleganz zu formulieren. Seine Kritik an den Grünen und der Friedensbewegung ist legendär, vor allem, seit diese nationale Töne anschlugen und die Nation nicht mehr abschaffen, sondern retten wollten. In der Biographie wird daran erinnert, dass die Linke in Deutschland zwar versagt hat, aber dank Wolfgang Pohrt das Niveau der Kritik an ihr weit besser war, als sie es verdient hatte, man kann sagen, dass ein realistisches Bild von ihr nur deshalb erhalten geblieben ist, weil Pohrt sich ihrer Fehler und Eigenarten angenommen und damit die Mythenbildung erschwert hat. Mit seiner großen Massenbewusstseinsstudie der Deutschen und dem Konkret-Kongress 1993 kündigte sich sein Abschied an, aber noch heute macht sich sein Einfluss bemerkbar, als ob seine Gedanken wie ein schwacher unterirdischer Strom immer wieder einen Nerv treffen und eine Reaktion erzeugen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Klaus Bittermann
Der Intellektuelle als UnruhestifterWolfgang Pohrt
Eine Biographie
Über dieses Buch
»Sie sagen mir, was Sie denken, und ich sage Ihnen, warum das falsch ist.« (Wolfgang Pohrt)
Als Anfang der achtziger Jahre Wolfgang Pohrt die öffentliche Bühne betrat, wurde den Lesern schnell klar, dass da jemand einen neuen Ton anschlug. Pohrt verstand es, seine Thesen mit großer Schärfe, Klugheit und Eleganz zu formulieren. Seine Kritik an den Grünen und der Friedensbewegung ist legendär, vor allem, seit diese nationale Töne anschlugen und die Nation nicht mehr abschaffen, sondern retten wollten. In der Biographie wird daran erinnert, dass die Linke in Deutschland zwar versagt hat, aber dank Wolfgang Pohrt das Niveau der Kritik an ihr weit besser war, als sie es verdient hatte, man kann sagen, dass ein realistisches Bild von ihr nur deshalb erhalten geblieben ist, weil Pohrt sich ihrer Fehler und Eigenarten angenommen und damit die Mythenbildung erschwert hat. Mit seiner großen Massenbewusstseinsstudie der Deutschen und dem Konkret-Kongress 1993 kündigte sich sein Abschied an, aber noch heute macht sich sein Einfluss bemerkbar, als ob seine Gedanken wie ein schwacher unterirdischer Strom immer wieder einen Nerv treffen und eine Reaktion erzeugen.
»Es ist ein absolutes Vergnügen, die Pohrt-Biographie zu lesen. Sehr spannend, was Bittermann über die Studentenjahre in Erfahrung gebracht hat. Und egal, an welcher Stelle man das Buch aufschlägt, man möchte sofort in den Text einsteigen.«
(Kai Lückemeier)
Denken in Zeiten pathischer Normalität
Vorwort
Als Anfang der achtziger Jahre bei Rotbuch »Ausverkauf« und »Endstation« von Wolfgang Pohrt erschienen, wurde den Lesern schnell klar, dass da jemand einen neuen Ton anschlug. Der Autor verstand es, seine Thesen und Analysen mit großer Schärfe, Klugheit und Eleganz zu formulieren, kein Wort klang falsch oder deplatziert, er verwendete keine Schaumsprache und keine Weihrauchvokabeln, seine Argumentation traf genau, und er nahm keine Rücksicht auf den Gegenstand seiner Kritik. Seinen politischen Analysen wohnte etwas Selbstverständliches inne, sie hatten eine große Überzeugungskraft und versprühten Witz und Sarkasmus.
Dabei nahm Pohrt immer den gegenteiligen oder zumindest einen anderen Standpunkt ein als den, der von Denkfaulheit zeugte und der von Leuten vertreten wurde, die lieber vorgefertigte Meinungen verbreiteten oder glaubten, mit dem Weltbild eines Tagesschausprechers ihre Karriere voranzubringen. Diese intellektuelle Kompromisslosigkeit, diese Unnachgiebigkeit in der Argumentation, sprach jeden an, der von der real existierenden Linken ohnehin nicht sehr viel hielt, seit sie sich ein alternatives Lebenskonzept zugelegt hatte, die Grünen und die Friedensbewegung nationale Töne anschlugen und die Nation nicht mehr abschaffen, sondern retten wollten, weshalb auch deren Sprache immer wolkiger und staatstragender wurde.
Vielleicht tauchte Pohrt genau zum richtigen Zeitpunkt auf, denn die linke Theoriebildung war langweilig und abschreckend geworden, während Pohrts nüchterne, scharfsinnige Analysen einen neuen Wind in die Debatten brachten. Zwar gab es Marx, Hegel, Adorno, Horkheimer, aber sich an deren Einsichten zu erfreuen und sie zu bestaunen war das eine, etwas anderes war es, deren Gedanken nicht nur zu rekapitulieren, sondern sie auf konkrete gesellschaftliche Ereignisse anzuwenden, wie Pohrt das scheinbar mühelos gelang. Die meisten haben das nicht geschafft, im Unterschied zu Pohrt jedoch damit Karriere an der Uni gemacht, indem sie nur lange genug Klassikerexegese betrieben.
Aus den Büchern Pohrts drang ein Sound, der ganz anders war als der, der bislang zu vernehmen war, unabhängig, erfrischend und nicht darauf aus, korrekt zu sein und die Wahrheit gepachtet zu haben. In »Ausverkauf« wurde man angesprungen von Sätzen wie:
»In einer gedankenlosen Wirklichkeit ist das Denken wesentlich Hirngespinst. Daher die Esoterik und tendenzielle Nicht-Verstehbarkeit authentischer Theorie, der gelegentlich selbst deren Verfasser zum Opfer fällt. Zwei faule Wochen oder eine Erkältung genügen, die Niederschrift eines Aufsatzes von der Unfähigkeit zu trennen, diesen auch nur noch zu verstehen.«1
Dass er dieses Apodiktische auch selbstironisch gegen den Verfasser wendete, das war freies, abschweifendes Denken, wobei dieses Denken ihn nicht davon abhielt, vehement darum zu streiten, ob ein Gedanke oder eine Argumentation richtig oder falsch waren. Weil sich das zwar alles schön behaupten lässt, man sich mit etwas gutem Willen aber auch ganz andere Inhalte darunter vorstellen kann, hier noch ein Zitat:
»Die Abschaffung von Herrschaft hieß zweierlei: die Führer und die Massen abschaffen [...] Die Abschaffung von Herrschaft war inhaltlich bestimmt: als – freilich noch gemeinsam zu entwickelnde – Fähigkeit eines jeden, ohne Partei und Führer gemeinsam mit anderen und notfalls auch allein das Richtige zu tun.«2
Endlich verklärte einer mal nicht die Massen als – und sei es nur – potentielles Subjekt der Geschichte, sondern brachte das Offensichtliche zum Ausdruck, nämlich dass die Massen einem feindlich gesinnt waren (vor allem in der noch in den siebziger und achtziger Jahren präsenten Nachkriegsgesellschaft, in der die Nazis so leben konnten, als wäre nie etwas passiert, und die RAF-Hysterie daran erinnerte, dass die pathologische Normalität sich fortgesetzt und sich nicht wirklich etwas verändert hatte, jedenfalls nicht in den Köpfen der Leute, die gerne und sofort einem Erschießungskommando beigetreten wären, um politische Unruhestifter zu exekutieren). Und wenn es nicht anders ginge, dann besser alleine und auf eigene Rechnung handeln. Pohrt verweist an dieser Stelle auf Johann Georg Elser, »der ganz allein die Bombe bastelte und deponierte, die im Bürgerbräukeller am 8.11.1939 Hitler erwischt hätte, wenn er programmgemäß geblieben wäre«.3
Masse war nach der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus so desavouiert, dass sie sich nicht mehr als Größe betrachten ließ, auf die man sich praktisch oder auch nur theoretisch beziehen konnte, um eine politische Veränderung herbeizuführen, und dennoch spekulierte die Linke ganz selbstverständlich darauf, die Massen für ihre Zwecke zu mobilisieren und auf ihre Seite zu ziehen in der irrigen Annahme, die »Massen« wären akzeptabel, wenn man sie in eine »Arbeiterklasse« umbenannt hätte. Die Nazis hatten jedoch gründlich dafür gesorgt, dass es eine kommunistisch gesinnte Arbeiterbewegung nicht mehr gab. Die Psychopathologie, von der Adorno unter dem Eindruck des Nationalsozialismus schrieb, dass sie zum Normalzustand geworden sei, wirkte in den sechziger und siebziger Jahren fort.
Von der »unverwüstlichen Kriegsgeneration mit der hohen Kampfmoral im Schlußverkauf« und mit dem »gnadenlosen Überlebenswillen«, die »aus jedem Holzbein eine Waffe«4 macht, war nichts zu erwarten, schon gar keine Revolution, jedenfalls keine, bei der man selber ungeschoren davonkommen würde. Nicht einmal so etwas Elementares wie Menschlichkeit ließ sich voraussetzen, denn im Deutschland der siebziger Jahre hatte so etwas wie Zivilisation noch nicht Einzug gehalten, und die Linke trug nicht gerade dazu bei, dass sich dies änderte.
In »Die schweigende Mehrheit vor der Verwirklichung ihrer geheimen Wünsche durch ihre Opfer bewahren«5 beschreibt Pohrt das verhärtete Kollektiv der Deutschen, das sich von keiner Anwandlung humanen Verhaltens, von keiner Erinnerung an die eigenen Kinder, die sie weich werden ließe, davon abhalten lassen würde, andere zu denunzieren und sich an der verdeckten Menschenjagd auf Mitglieder der RAF zu beteiligen. Und auch heute noch ernten Leute wie Thilo Sarrazin großen Zuspruch und landen Bestseller mit Büchern, die die »Überfremdung« und die Hartz-IV-Mentalität des Landes anklagen und die dabei die gescheiterte Existenz des eigenen Sohnes, der in einem Plattenbau im Osten Berlins wohnt und gerne arbeitslos ist, nicht etwa milde stimmt, sondern die vielmehr das Material herzugeben scheint, um besonders hart gegen Menschen ins Gericht zu gehen, denen das Schicksal aus welchen Gründen auch immer übel mitgespielt hat. Aber es waren nicht nur die Senioren, die einem das Leben schwer machten. »Um so alt zu werden, wie heute die 20jährigen sind, hätte ein Mensch früher dreihundert Jahre gebraucht.«6 Und diesem Phänomen der frühen Vergreisung, die in den Gesichtern der Menschen häufig sichtbare Spuren hinterlässt, begegnet man immer noch beziehungsweise wieder.
Diese Beobachtungen standen nicht im Zentrum seiner Kritik, aber sie waren eine Art Grundrauschen, etwas, das seine Kritik implizit voraussetzte, wenn er sich der großen Themen wie der Aktualität des Nationalsozialismus oder der Friedens- und Antiatombewegung befasste. Vor diesem Hintergrund lässt sich seine Kritik manchmal erst richtig einschätzen. Mitunter sind es nur Nebensätze und Marginalien, die Hinweise liefern, woher der Impuls seiner Kritik stammt. Dieses Grundrauschen, wie z.B. die Bezugnahme auf die Schwarze Botin, die Zitate von André Breton und die popkulturellen Hinweise auf Janis Joplin und Jimi Hendrix, die Flugblätter der Gruppe »Subversive Aktion« und die Reden und Artikel von Hans-Jürgen Krahl als Gegengift zum Kursbuch, dessen Weg in »die neudeutsche Klebrigkeit« er einmal beschrieb (1980), deutete an, in welchem Koordinatensystem Pohrt sich in den Siebzigern bewegte, auch wenn er nie darauf explizit Bezug nahm, wie er das bei Adorno, Horkheimer, Benjamin, Arendt und anderen tat.
Vor diesem Hintergrund ließ sich die Friedensbewegung, die im Oktober 1981 in Bonn mit 300.000 Demonstranten ihren Höhepunkt erreicht hatte, nur mit Skepsis betrachten, und von Pohrt konnte man lernen, ihr nicht einfach nur mit einem Gefühl der Abneigung zu begegnen, sondern sie als gesellschaftliches Phänomen zu begreifen, das etwas über die deutsche Wirklichkeit aussagte. Er zeigte, dass hinter ihrem hehren Wunsch nach Frieden die Sehnsucht nach Nation steckte und dass sich in ihrem Weltbild deutliche Spuren völkischer Gesinnung nachweisen ließen.
Damals begriff sich Pohrt als Ideologiekritiker, und zwar nach der Devise: »Die Leute sagen mir, was sie denken, und ich sage ihnen, warum das falsch ist.« Die Postmoderne hatte zwar die Ideologiekritik als erkenntnis-theoretisches Problem erkannt, insofern Ideologiekritik mit dem Anspruch auftritt, allein falsche Ideologie entlarven zu können, weil sich die Frage stellt, warum andere dazu nicht in der Lage sein sollten, aber Pohrt hatte nie diesen Anspruch, er hatte jedoch auch nichts dagegen, wenn er der Einzige war, dem es gelang. Jedenfalls beschränkte sich Pohrt nicht auf die Kritik als Kunst der Vermittlung, vielmehr stellte er in den Achtzigern, als er als Journalist arbeitete, seine Rolle als Ideologiekritiker selbst in Frage.
Aus seinem Vortrag »Die Rebellion der Heinzelmännchen«, den er am 5. November 1982 in einem besetzten Haus hielt, stammt ein interessanter Hinweis darauf, wie er seine Tätigkeit als Ideologiekritiker sah:
»Ich habe weder an dieser Bewegung teilgenommen, noch habe ich sie erforscht oder gründlich studiert, ich habe nicht mit Besetzern gesprochen, nie in einem besetzten Haus gewohnt, und ich besitze keine Dossiers. Ich habe nicht recherchiert, weder im journalistischen noch im kriminalistischen Sinne, und man hat mir daraus einen Vorwurf gemacht. Man hat mir vorgeworfen, die Friedensbewegung, die Alternativen, die Grünen und die Hausbesetzer leichtfertig, gewissenlos und verantwortungslos zu verleumden. Dem halte ich entgegen, daß ein Kommentator oder Kritiker deshalb, weil er keine Macht hat, Urteile zu fällen oder Strafen zu verhängen, auch nicht an die Regeln der Beweisaufnahme gebunden ist, welche die Strafprozeßordnung verlangt. Man trägt keine Verantwortung, wenn man sich Gedanken macht und eine begründete abweichende Meinung äußert, nicht als Kritiker oder Publizist, der keine administrative Macht besitzt. Wenn der Kanzler Unsinn erzählt, dann ist dieser Unsinn deshalb, weil sein Erzähler die Macht besitzt, ihn zu verwirklichen, immer noch wichtig. Wenn ich Unfug schreibe oder rede, so ist dieser Unfug vollkommen bedeutungslos, und man kann ihn getrost als Produkt eines mitteilungssüchtigen Spinners ignorieren.«7
Indem er seine eigene Bedeutung als Kommentator solcherart herunterspielte, ließ er gleichzeitig auch alle anderen, die im gleichen Gewerbe tätig waren, nicht gerade in einem vorteilhaften Licht erscheinen, er stellte damit ein Geschäftsmodell in Frage, von dem auch seine eigene Existenz abhing, und er gab den Leuten zu verstehen, dass den sogenannten »Experten«, die im öffentlichen Raum ihre Meinung kundtaten, nur die Bedeutung zukam, die man ihnen entgegenbrachte.
»Mein Job ist die Ideologiekritik, das habe ich gelernt«, sagte Pohrt 1987 den Stuttgarter Nachrichten. Aber er wusste auch, dass er damit in eine Sackgasse geriet. »Man tritt in der BRD in eine Phase ein, in der es kein falsches Bewußtsein, sondern die Absenz jeden Bewußtseins überhaupt gibt – was den Job des Ideologiekritikers natürlich schwierig macht...«
Kurze Zeit später kamen mit der Wiedervereinigung die Ausländerverfolgung, der Golfkrieg und der Krieg in Jugoslawien, also eine Zeit, in der Pohrt keinen Sinn mehr darin sah, als Ideologiekritiker weiterhin das Feuilleton mit lustigen, kleinen Artikeln über Kulturphänomene zu bereichern.
Pohrt hat das schon früh erkannt, und er hat daran gelitten, dass er als Ideologiekritiker – und in den Neunzigern dann als Soziologe, der das Massenbewusstsein der Deutschen erforschte – nicht mehr tun konnte, als dagegen anzuschreiben. Er hat sich von den ungeheuren Vorgängen und Morden im Osten dazu hinreißen lassen, dem Mob von Rostock-Lichtenhagen das gleiche Schicksal zu wünschen, das dieser den Ausländern hatte bereiten wollen, als er sich anschickte, das Flüchtlingsheim anzuzünden, und die Staatsgewalt sich eine Woche lang vornehm zurückhielt. Pohrt warf man wegen seiner Kritik »Furor teutonicus« vor und »Germanozentrismus«, als ob er es den rechten Schlägerbanden gegenüber an Anstand missen ließ. Seine Analysen, denen man wenig entgegenzusetzen hatte, versuchte man als »Küchenpsychologie« und »Vulgärmarxismus« zu diskreditieren.
Seine Artikel waren nicht abgeklärt, ausgewogen und wissenschaftlich wasserdicht, und sie sollten es auch nicht sein, sie waren vielmehr Ausdruck einer Verzweiflung und Empörung über die Zustände. Aber genau deshalb nimmt man es ihm ab, dass Unrecht in erster Linie nicht etwas ist, für dessen Erforschung man eine Unikarriere einschlagen muss, sondern ein starkes Motiv, praktisch etwas dagegen zu tun oder theoretisch zumindest die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Und dafür wertete er jede Menge Zeitungen aus, deren Berichte er interpretierte.
Die Wiedervereinigung hatte z.B. dazu geführt, »daß man plötzlich 17.000 entlaufene Väter suchte«, und er konstatierte einen »rapiden Zerfall aller sozialen Beziehungen in der Zone«, die das Märchen, »wie tapfer die Revolutionäre gewesen waren, wie erbittert sie für die Einheit gekämpft« hatten, zu einer Story machte, »die man ohne zu erröten nur in Papua-Neuguinea auftischen konnte«.8 Aber viel schlimmer waren die Konsequenzen der Ausländerverfolgung in der Zone:
»Keineswegs rotteten die Einheimischen sich in der Zone gegen die andersfarbigen Nachbarn im gleichen oder im nächsten Wohnblock zusammen, mit denen sie zu vielen auf engem Raum zusammenlebten. Sondern nach dem Prinzip faschistischer Vollstreckungskommandos gebaute Gruppen spürten Personen auf, die zu finden den Vorsatz, Mobilität, beinahe zielfahnderisches Geschick und eine schwarze Liste erfordert, weil sie in der Zone nicht mal zahlreich genug für eine Minderheit sind und so schwach, daß jede normale jugendliche Streetgang mit halbwegs intaktem Ehrenkodex sie anderswo unbehelligt ließe, weil sie sonst als ein Haufen von Feiglingen verachtet würden.«9
Immer wieder wurde Pohrt vorgeworfen, er leide, wie seine Polemik gegen die Deutschen beweise, an deutschem Selbsthass, und gerade darin zeige sich, dass er deutscher sei als all die Deutschen, die er kritisiere. Der Hass aber, den die Linken und Intellektuellen in seinen sarkastischen und scharfen Formulierungen entdeckt zu haben glaubten, ist bei ihm eine menschliche Regung, die einfach nur in der Weigerung besteht, still dazusitzen, wenn wie in Rostock-Lichtenhagen Ausländer attackiert werden, ohne dass staatliche Organe eingriffen. Die po-gromartigen Zustände machten es ihm unmöglich, sich als unbeteiligter, »objektiver« Beobachter zu verhalten. Nicht der in Pohrts Formulierungen beklagte Hass ist das Problem, denn als nicht mit den geringsten Machtbefugnissen ausgestatteter Autor hatte Pohrt, wie er selbst immer wieder betont hat, in der Regel keine Möglichkeit, anderen wirklichen Schaden zuzufügen, schon gar nicht hat die Kritik die Fähigkeit, den anderen zu vernichten oder gar hinzurichten, wie Schriftsteller gerne behaupten, nur weil deren Buch verrissen wurde, denn selbstverständlich wird ihnen nie auch nur ein Haar gekrümmt, vielmehr hielt Pohrt mit den unzulänglichen Mitteln des Journalismus fest, von welcher Gesinnung Leute getrieben sein müssen, die andere verfolgen und manchmal auch ermorden, ohne dass es dafür einen Grund wie Habsucht oder Eifersucht gäbe, sondern nur den abstrakten Hass auf einen anderen, der einem völlig unbekannt ist, mit dem einen sogar so existentielle Dinge verbinden wie Perspektivlosigkeit und Armut. Der Hass, den man Pohrt unterstellt, hat nichts mit dem Wunsch nach Vernichtung zu tun, er ist auch kein Ausdruck »zynischer Menschenverachtung«, sondern die verzweifelte Reaktion eines Menschen, der den straflosen Versuch der Brandstiftung unter Inkaufnahme, dass Flüchtlinge in ihrer Unterkunft verbrennen, und der verharmlosenden Reaktion der Politik und der Kapitulation staatlicher Organe hilflos gegenübersteht.
So wie Pohrt gegen die Mordversuche und tatsächlichen Morde anzuschreiben, setzt vielmehr eine Fähigkeit zur Empathie voraus. In der Verfilmung von »Tante Julia und der Kunstschreiber« von Mario Vargas Llosa10 sagt der Aufwiegler und Regisseur von Hörspielen im Rundfunk, Peter Falk, der mit seinen von großen Gefühlen handelnden Seifenopern das Leben als Drama inszeniert und dabei gerne an der bürgerlichen Ordnung zündelt, dass Liebe ebenso brenne wie Hass, und dass das eine ohne das andere nicht existieren könne. Steht man allerdings Menschen in wirklich existentiellen Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, nicht anders gegenüber als der Pressesprecher im Bundeskanzleramt, der routiniert sein »aufrichtiges Bedauern« über die als »Ereignisse« verharmlosten Mordversuche ausspricht, dann hat man den idealen Aggregatzustand eines Journalisten erreicht, der sich leicht durch einen »intelligenten Computer« ersetzen lässt, aber eines wird man von diesem auf keinen Fall erwarten dürfen: Erkenntnis und Fortschritt. »Hass«, schreibt Pohrt in seinem Vortrag über die »Zukunftsangst«, den er am 2. November 1985 in Mainz gehalten hat, ist »eines der wichtigsten Motive für den analysierenden, wörtlich: zersetzenden Verstand, dem wir alle Humanisierung vorgefundener Gewaltverhältnisse durch deren Zerstörung verdanken«.11
Unruhe und Rebellion
Die unverwüstliche Kriegsgeneration im Nacken
»Das sichtbarste Abenteuer eines jeden Menschen besteht aus einer Folge von Akten, die das Gesetz brechen.«
André Breton
»Doch nirgends wird dieser Alptraum von Zerstörung und Schrecken weniger verspürt und nirgendwo wird weniger darüber gesprochen als in Deutschland. Überall fällt einem auf, daß es keine Reaktion auf das Geschehene gibt, aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine irgendwie absichtliche Weigerung zu trauern oder um den Ausdruck einer echten Gefühlsunfähigkeit handelt.«
Hannah Arendt (1950)
Nachkriegswirren
Seine Herkunft war etwas, worüber Wolfgang Pohrt schwieg, wobei familiäre Beziehungen damals sowieso kein Thema waren, das für ihn Stoff für eine abendfüllende Unterhaltung geboten hätte. Es verwundert also nicht, dass die biographischen Daten über ihn sehr spärlich sind. Fest steht, dass er nur knapp dem Krieg entronnen ist. Genau drei Tage vor der Kapitulation Deutschlands wurde Wolfgang Erik Pohrt am 5. Mai 1945 in Dommitzsch im Kreis Torgau (Sachsen) geboren. Am gleichen Tag, nur 127 Jahre früher, kam ein Mann zur Welt, der Pohrts Leben entscheidend beeinflusste: Karl Marx. Die Surrealisten hätten darin wahrscheinlich einen »objektiven Zufall« gesehen, in jedem Fall war es ein wundersamer Zufall, denn Wolfgang Pohrt war in seiner Generation einer der wenigen, der Marx nicht nur rekapituliert, nicht nur wie ein Schutzschild vor sich hergetragen hat, um sich gegen Angriffe zu immunisieren, sondern ihn mit seiner »Theorie des Gebrauchswerts« tatsächlich angewendet und weiterentwickelt hat.
Davon konnte mitten in den Kriegswirren niemand etwas ahnen. In Torgau herrschte zwei Wochen vor der Geburt Pohrts ein großes Chaos. Als sich am 25. April amerikanische und russische Truppen in Torgau an der Elbe trafen, war das ein historisches Ereignis, dem seither als »Elbe Day« gedacht wird und das einen Tag später auf der zerstörten Elbebrücke nachgestellt und fotografisch festgehalten wurde. Die amerikanische Reporterin und Fotografin Lee Miller war damals dabei und hatte die Szenerie festgehalten:
»Die Kontaktaufnahme mit den Russen war bekanntgegeben und ein Treffpunkt auf der anderen Seite der Elbe bei Torgau vereinbart worden. Ich brach in einem mit Maschinengewehr bestückten Jeep und vier Jungs vom 273. Infanterie-Regiment der 69. Division auf. Wir nahmen eine andere Route zu dem Treffen als der Rest der Meute. Wir fuhren durch viele Städte, wobei die Einwohner ganz unterschiedlich reagierten. Viele flohen in alle Richtungen, weil sie uns für Russen hielten. Verschleppte und Vertriebene jubelten uns wild zu. Bewaffnete deutsche Soldaten versteckten sich, etc. Wenn wir anhielten, kamen die deutschen Zivilisten zurück und umlagerten uns, überglücklich, da sie glaubten, wir seien statt der gefürchteten Russen der Vorstoßtrupp der amerikanischen Besatzung.
Auf der östlichen Seite des Ufers bewegen sich große Flüchtlingskolonnen in beide Richtungen, die eine auf die Russen zu und die andere weg von ihnen. Die nach Osten gehen, sind Polen und Russen, die versuchen, zu ihren Leuten zurückzukehren, während die nach Westen Gehenden vor ihnen fliehen. Die Stadt Torgau ist zerstört und von den Krauts verlassen; nur noch Russen wohnen dort.
Es ist unmöglich zu erklären, dass mein ganzer ideologischer Austausch mit den Russen unter einer Sprachstörung litt aufgrund der neuen Art und Weise, Wodka zu trinken, der gefährlichen Schießerei in die Luft und der Tatsache, dass ich hoffte, sie behandelten die Deutschen so, wie Goebbels behauptete, dass sie es tun würden. Und ich fand es auch komisch, dass die große symbolische Vereinigung zweier großer moderner Armeen so aussah: Amerikaner, die ungeschickt über einen schnellen Fluss rudern, um Russen zu treffen, die von Pferden gezogene Artilleriegeschütze bedienen.«12
Die Familie wohnte Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Riga, als die Mutter Pohrts zur Welt kam. Damals lebten und arbeiteten viele Deutsche in Riga. 1887 war fast die Hälfte aller Einwohner in Riga deutscher Herkunft. Schon im 12. Jahrhundert wanderten Deutsche ins Baltikum aus. Anfang des 20. Jahrhunderts machten die Balten-Deutschen ca. 13 Prozent der Bevölkerung in Riga aus. Sie gehörten in der Regel zur Oberschicht, die trotz russischer Vorherrschaft großen Einfluss ausübte. So war bis 1891 Deutsch die offizielle Amtssprache in Riga.
Die Wege der aus Riga in Lettland stammenden Mutter Roswitha Bong nach Dommitzsch sind verschlungen. Sie wurde am 7. August 1909 geboren und hatte ihren Schulabschluss am Gymnasium gemacht. Aber bevor die Familie in den Westen aufbrach, war sie noch nach Viljandi (Fellin) in Estland gezogen, 220 Kilometer weiter nördlich, wo sie wahrscheinlich ihren späteren Ehemann Gert Uno Pohrt kennenlernte und 1916 ihre Schwester zur Welt kam. 1915, nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, lag Riga an der Frontlinie. Die Blüte und der Aufschwung der Hafenstadt wichen jetzt der Kriegswirtschaft, unter der etwa 200.000 Einwohner zu leiden hatten, denn es wurden vor allem Arbeiter mit ihren Familien nach Zentralrussland deportiert, um die Rüstungsindustrie anzukurbeln. Trotz der russischen Bemühungen fiel Riga im September 1917 den Deutschen in die Hände. Allerdings nicht lange. Nach Kriegsende wurde Riga zum Schauplatz des lettischen Unabhängigkeitskrieges, in den alle möglichen Kriegsparteien verwickelt waren. Allein im Jahr 1919 versuchten sowjetrussische Truppen, die baltische Landeswehr zusammen mit deutschen Freikorps und die weißrussische Befreiungsarmee die Vorherrschaft in der Stadt an sich zu reißen, was ihnen jeweils für kurze Zeit auch tatsächlich gelang und den Bürgern nicht gerade ein Gefühl der Sicherheit vermittelte. Kein Wunder, dass sich die Familie möglichst weit weg in Sicherheit brachte.
Wann die Familie Richtung Westen zog, ist unbekannt, aber nach Beendigung des lettischen Unabhängigkeitskriegs begann schon ab 1920 eine erneute Blütezeit in Riga, weil den großen Minderheiten wie Russen, Deutschen und Juden weitgehende Rechte eingeräumt wurden. Gleichzeitig riefen die Flüchtlingsmassen, die seit dem Ersten Weltkrieg unterwegs waren, Probleme hervor, auf die die Staaten mit einer »Denaturalisationsgesetzgebung« reagierten. Weit über diese Bestimmungen hinaus gingen die Nazis 1933, als sie gesetzlich festlegten, dass allen im Ausland lebenden Deutschen jederzeit die Staatsbürgerschaft entzogen werden konnte. Die Vergehen, die den Verlust der Staatsbürgerschaft nach sich zogen, waren in den Verordnungen so vage gehalten, dass es buchstäblich jeden treffen konnte. Zwar wohnte die Familie zu diesem Zeitpunkt bereits in Berlin, denn Pohrts Schwester kam am 9. April 1933 im Bezirk Schöneberg zur Welt, aber die rechtliche Situation von Flüchtlingen, Staatenlosen und im Ausland lebenden Staatsbürgern war schon die gesamten zwanziger Jahre über prekär und unsicher.
Am 27. Dezember 1931 heiratete die Mutter den aus Fellin in Estland stammenden und am 10. September 1903 geborenen Gert Uno Pohrt, der laut Meldekarte »Ingenieur« war und von dem sie sich vom Landgericht Bromberg Ende 1942 wieder scheiden ließ. Jedenfalls geht das aus Unterlagen des Einwohnermeldeamtes Bad Krozingen hervor, wohin es die Mutter mit ihrem Sohn später verschlug. Warum in Bromberg ist unklar, aber möglicherweise hatte dort die Heirat stattgefunden, denn Bromberg liegt in der Nähe von Toruń, wo die Familie Anfang der Dreißiger lebte, und Toruń wurde nach dem Überfall der Deutschen auf Polen 1939 dem Regierungsbezirk Bromberg zugeordnet, d.h. vermutlich musste man die Papiere für die Scheidung dort beglaubigen lassen, denn man hatte ja geheiratet, als Thorn noch Toruń hieß und polnisch war.
Aus den Einwohnermeldepapieren aus Bad Krozingen geht weiterhin hervor, dass die Scheidung erst am 23. Januar 1943 rechtskräftig wurde. Schon vorher, und zwar am 31. Juni 1941, erhielt Roswitha Pohrt die vom Regierungspräsidenten in Würzburg beglaubigte Einbürgerungsurkunde ausgehändigt, d.h. dass sie als eine im Ausland geborene Deutsche, was sie vermutlich war, sich nunmehr mit diesem Dokument als »Reichsdeutsche« ausweisen konnte.
Von Gert Uno Pohrt ist außer den dürren Fakten seines Geburtsorts und seines Geburtsdatums nichts bekannt, auch nicht, wann er eingezogen wurde und wann er im großen vaterländischen Krieg schließlich fiel, aber vermutlich ist er in den letzten beiden Kriegsjahren, also nach der Scheidung, gefallen, da die Mutter Pohrts sonst den Status einer Witwe innegehabt hätte. Wann sich Roswitha Pohrt, die den Namen ihres Ex-Mannes beibehielt, mit ihrer Tochter in Dommitzsch niedergelassen hat, wo sie als Aushilfslehrerin arbeitete, darüber gibt kein Dokument Auskunft, aber vermutlich verließ sie Berlin, als die Bombardierungen zunahmen. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass sich die reiselustige Mutter in Georg Schwarz verliebte, der Schauspielleiter in Dessau war und von dem sie mitten im »Endkampf« ein zweites Kind erwartete. Als der jedoch verlangte, das Kind in ein Internat abzuschieben, ging die Beziehung auseinander.
Georg Schwarz, der die Vaterschaft ablehnt, hat sein Kind nie gesehen, und der als Wolfgang Erik Pohrt am 5. Mai 1945 geborene Sohn – die Geburtsurkunde wurde erst am 26. Oktober 1945 ausgestellt, da die zivilen Einrichtungen noch nicht wieder ihre Arbeit aufgenommen hatten – lernt seinen Vater nie kennen. Und an diesen komplizierten Verhältnissen, in denen vieles nicht gesichert ist und im Dunkeln bleibt und die eine längere Verweildauer oder ein Einrichten in gesicherten Strukturen nicht möglich machten, erkennt man ein bisschen den modernen Flüchtling, wie er in Eric Amblers Romanen vorkommt und dessen prekäre Existenz Pohrt in seiner kongenialen Studie über Ambler analysiert.
»Festgehalten im Stand der Rechtlosigkeit, welcher den der Gesetzlosigkeit einschließt, waren sie [die Flüchtlinge] der anschaulichste Beweis für das Schrumpfen des Geltungsbereichs von Gesetzen, für Zersetzungserscheinungen im Bereich staatlicher Kontrolle über die Bevölkerung und überhaupt für die wachsende Unfähigkeit des überkommenen Sozialgefüges, das Leben der Menschen in geregelten Bahnen zu halten.«13
Dommitzsch, in dem die Mutter schließlich strandet, ist eine kleine, öde Ortschaft westlich der Elbe. Dass sie im vorletzten Kriegsjahr, in dem die russischen Truppen immer näher rücken, schwanger wird, macht das Leben nicht einfacher. Die folgenden Jahre sind wie überall von Entbehrungen geprägt, vom Organisieren des Überlebensnotwendigen, und zudem voller Pläne, möglichst schnell und möglichst weit weg von den Russen zu kommen. Mit der Flucht ins Badische tauscht die Mutter eine trostlose Kleinstadt gegen eine andere aus, wo das Leben von kleinbürgerlichen Verkehrsformen bestimmt wird. Hier findet die Flucht ein Ende und damit auch der Status eines Flüchtlings, denn die Mutter besitzt im Unterschied zu Amblers Arthur Abdel Simpson – diesen Namen benutzt Pohrt später einmal als Pseudonym – mittlerweile das richtige Dokument, einen deutschen Pass.
Im Mai 1950 zieht sie mit ihren beiden Kindern nach Bad Krozingen in ein kleines, gerade fertiggestelltes und für die fünfziger Jahre typisches Vierfamilienhaus in der Belchenstraße 38, wo Wolfgang Pohrt von 1952 bis 1956 die Volksschule besucht. Vermutlich fiel ihr der Entschluss leicht, denn in der Gegend des umkämpften Torgau war vieles zerstört worden. Wie sie nach Bad Krozingen gelangte, darüber ist nichts bekannt, aber da Westdeutschland 1950 aufgrund der gestrandeten Flüchtlinge zehn Prozent mehr Einwohner hatte als vor dem Krieg und 16,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus den verlorenen Ostgebieten stammten, während zugleich 25 Prozent des Wohnungsbestandes nicht mehr existierten, waren die Flüchtlinge nirgends sonderlich beliebt.14 Man gab ihnen zu verstehen, dass sie sich zum Teufel scheren sollten, häufig wurden sie als »Zigeunerpack« beschimpft, und manchmal mussten die Alliierten eingreifen, damit die Vertriebenen den ihnen zugewiesenen Wohnraum beziehen konnten, meist in äußerst beengten Verhältnissen.
Gestrandet in Bad Krozingen
In seinem Artikel »Heimat« (1984)15 streift Pohrt das Thema, als er auf die allgemeine »Heimatlosigkeit« in der Nachkriegszeit zu sprechen kommt, als die Flüchtlinge aus ihrer Heimat vertrieben wurden und die Einheimischen sich wie Fremde fühlten, weil die Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten bei ihnen einquartiert wurden. Die Schnulze »Heimatlos« von Freddy Quinn wird zur sentimentalen Hymne der Deutschen, in der sich alle wiederfinden, auch wenn es wie bei den Pohrts nicht ganz so dramatisch zugegangen ist, denn Roswitha Pohrt bekam laut einer handschriftlichen Notiz auf einer »Liste Ostflüchtlinge« des Stadtarchivs Bad Krozingen eine Hinterbliebenenrente, und das ist eine weitere Ungereimtheit, denn das hieße wiederum, dass sie verwitwet gewesen sein musste. Auch wurde sie bei der Vermietung von Wohnraum bevorzugt behandelt. In einem anderen Haus in der Belchenstraße, das von der gleichen »Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft« errichtet worden war, ist, wie es in einem amtlichen Schreiben heißt, »Belegung mit Geflüchteten über ein Kontingent nachgewiesen«.
Am 20. Juli 1955 beantragte Roswitha Pohrt in Bad Krozingen für das zehnjährige Kind eine Namensänderung von Bong in Pohrt und bekam über diesen Vorgang gegen eine Gebühr von elf DM eine Urkunde ausgehändigt, die nach dem Gesetz »über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 5.1.1938 – RGB1.1 S. 9« rechtskräftig wurde, denn uneheliche Kinder mussten den Mädchennamen der Mutter annehmen und verloren automatisch den Namen, der der Frau damals durch Heirat zugesprochen wurde.
Auch als Pohrt von 1956 bis 1962 auf das Progymnasium in Staufen geht, bevor er die folgenden zwei Schuljahre auf das Rotteckgymnasium in Freiburg wechselt, dürfte er häufig als »Polacke« beschimpft worden sein. Das Leben als Paria und Außenseiter war ihm also nicht fremd, und auch wenn er als Kind vielleicht noch nicht begreifen konnte, warum die Leute so reagierten, den Hass und die Ablehnung bekam er täglich zu spüren. Der Hass, den Hannah Arendt in der Zwischenkriegszeit in der Atmosphäre des öffentlichen Lebens feststellte und der geladen schien »mit der schwülen und unheilvollen, diffusen Irritabilität einer Strindbergschen Familientragödie«, war auch nach 1945 noch zu spüren, als »er in alle Poren des täglichen Lebens« drang, er »konnte sich nach allen Richtungen verbreiten, konnte die phantastischsten, unvorhersehbarsten Formen annehmen«.16
Pohrt war diese Zeit durchaus präsent:
»So lange ist es noch nicht her, dass eine ›uneheliche Mutter‹ – so hieß die damals – sozial geächtet war. Kinder hatten dem heiligen Bund einer auf Lebenszeit geschlossenen Ehe zu entstammen. Wenn nicht, dann war das nicht nur für die Mama, sondern auch für die Kinder ein Makel.«17
Pohrt hatte also ein feines Sensorium für diese Art sozialer Ächtung ausgebildet; in der von Neid und Missgunst geprägten Atmosphäre, in der er aufgewachsen war, hatte er gelernt, bedingungslos für das Aufenthaltsrecht von Flüchtlingen einzutreten, und zwar nicht nur, weil man billige Arbeitskräfte benötigte. Und vielleicht reagierte er nicht zuletzt auch deshalb so fassungslos auf Hoyerswerda, weil dort Flüchtlinge um Leib und Leben fürchten mussten allein aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwo einquartiert wurden, genauso wie die Nachkriegsflüchtlinge.
Leute, in deren Verhalten er die Muster der sozialen Verachtung wiedererkannte, den Hass auf alles, was nach ihrer Meinung nicht hierher gehörte, waren seine Feinde, und die überzog er mit Häme und Spott und führte ihnen ihre Schäbigkeit argumentativ vor Augen. Die kleinbürgerliche Umgebung, in der er aufwuchs, war bestimmt keine friedliche Idylle, sondern ähnelte eher einem Minenfeld aus Ressentiments, in dem man ständig auf der Hut sein musste, um Angriffen, Beleidigungen und Gängelungen aus dem Weg zu gehen. Schon den falschen Akzent zu sprechen konnte da empfindliche Folgen haben. In seinem Essay über Ambler schrieb Pohrt:
»Die auf falschem Akzent beruhende gesellschaftliche Diskriminierung und die von der Zurücksetzung verursachte Sensibilität, das feine Gehör also mag der Grund dafür gewesen sein, daß unter den Wörtern, die sich im Hirn von Kindern mitunter einnisten wie das Sandkorn in der Auster, im Falle des kleinen Ambler eines mit weitreichenden Folgen war.«18
Gemeint war das Wort »Flüchtling«, und genauso könnte es auch bei Pohrt gewesen sein. Jedenfalls hatte er schon früh Gelegenheit, die Massenpsychologie der Deutschen unter Extrembedingungen zu studieren, und sein Verhalten war davon in gewisser Weise geprägt, wenn er unduldsam und schneidend auf Ressentiments und Ignoranz reagierte. Aber seine frühen Erfahrungen schützten ihn auch davor, sich Illusionen über die Deutschen zu machen, und selbst als ihm noch eine politische Revolution als die einzige Möglichkeit schien, gesellschaftliches Unrecht abzuschaffen, war ihm bewusst, dass man mit diesen Deutschen besser keine Revolution versuchen sollte.
Es geht hier jedoch nicht einfach um eine frühkindliche Prägung in einem Klima des Hasses. Dem retrospektiven Blick auf das Leben entgeht auch einiges, wenn er nur auf das Elend schaut. Für die Kinder waren die Trümmer der Nachkriegszeit eine große Abenteuerlandschaft, in der man ein ungebundenes Leben in Freiheit verbringen konnte. Die Ruinen in Berlin waren nicht nur ein Sinnbild des Elends und der Not, sondern sie entfalteten auch eine Faszination. Die Trümmerlandschaft wurde z.B. als Hintergrund für Modefotos festgehalten oder diente als eindrucksvolle Filmkulisse für »A Foreign Affair« (1948) mit Marlene Dietrich, die lange überlegte, ob sie die Rolle als von den Nazis angehimmelte Künstlerin spielen sollte, die nun in einer verrauchten Ruinenspelunke für die Amerikaner sang. Wie auch immer die familiäre Situation der dreiköpfigen Familie Pohrt gewesen sein mochte, sie hielt für das Kind auch so etwas wie Freiheit, Intensität und Glück parat, die aus einem materiellen Mangel heraus entstehen können, eine »nie gekannte, eruptive Daseinsfreude«,19 die Harald Jähner in »Wolfszeit« beschreibt, wenn sich alles neu ordnet, was aus den Fugen geraten war.
Pohrt hat dieses Phänomen in seiner Studie »Brothers in Crime« gestreift unter dem Stichwort »Rumtreiber«, als er das von ihm geschätzte Buch »The Gang« über das Chicago der Zwanziger von Frederic M. Trasher besprach, dem bei der jahrelangen Beobachtung der Slumbewohner nicht nur das Elend auffiel, sondern auch das freie, ungebundene Leben. Und vermutlich hätte er diesen Aspekt nicht erwähnt, wenn er nicht selbst diese Erfahrung gemacht hätte.
»Zwar leiden die Kinder in den Slums unter Entbehrungen aller Art: Dürftiges Essen, erbärmliche Wohnungen, die Eltern überlastet und zerstritten. Dafür bekommen diese Kinder, was die anderen nicht haben, nämlich Wirklichkeit. Denn Gangland bietet den Jungs, wovon die Kameraden in den besseren Wohngegenden nur träumen. Die wohlbehüteten Kinder lesen Rittergeschichten, und vielleicht besitzen sie eine Spielzeugkiste voll mit Requisiten und Kostümen. Aber viel anfangen können sie damit nicht, weil der Mummenschanz bald langweilig wird. Im Slum dagegen haben die Kinder das wilde Mittelalter, das sie lieben, vor der Tür.«20
Ein aus Pohrts Nachlass stammender »Tabellarischer Lebenslauf« enthält einige wenige Stichpunkte. Unter dem Jahr 1956 steht: »Krise; Kaffeewärmer, Schlitzauge«. Es war das Jahr, in dem seine zwölf Jahre ältere Schwester mit 23 Jahren eine Tochter bekommt. Der elfjährige Wolfgang muss nun, nach der Erzählung der Nichte, die fast ausschließlich ihm geltende Aufmerksamkeit seiner Mutter mit dem neuen Familienmitglied teilen, was immer wieder zu Streit führt, bis die Schwester das Haus verlässt, das Kind aber bei seiner Oma bleibt.
Ein anderer Eintrag unter 1960 enthält eine Aufzählung, was der 15jährige Pohrt gelesen hat: kiloweise Groschenhefte, und zwar Rolf Torrings Abenteuer, eine Romanheftreihe, die schon in den Dreißigern erschien und nach dem Krieg jedoch inhaltlich und ideologisch der neuen Zeit angepasst wurde und heute im Internet teuer gehandelt wird. Dann Jörn Farrows U-Boot-Abenteuer, die »Fernando, der Bandit« hießen oder »Die Spuk-Insel«, »Weiße Sklaven« oder »Schrecken der Meere«, auf dem ein Mann in den Fängen einer Riesenkrake sich zu wehren versucht. Neben diesen beiden heute eher nicht mehr so bekannten Autoren von Heftchen-Romanen, hat Pohrt noch Tom Prox notiert, dessen Westernabenteuer noch heute von Bastei Lübbe vertrieben werden. Außerdem Billy Jenkins, der nach einem abenteuerlichen Leben als Varietékünstler und Westernreiter während der NS-Zeit seine jüdische Herkunft verbergen musste und als NSDAP-Mitglied im Berliner Wintergarten, in der Scala und im Hansa-Theater auftrat, u.a. noch 1939 als Cowboy, der im Berliner Plaza seine Lassokünste vorführte und schließlich Wildwest-Romane schrieb. Vor allem aber las Pohrt »Jerry-Cotton«-Hefte, die mit einer Gesamtauflage von 850 Millionen Exemplaren erfolgreichste Krimiserie.
Das Verschlingen solcher Abenteuerhefte, die ihn alles um sich herum vergessen ließen, bescherte ihm Momente des Glücks und beweist ganz nebenbei, dass die Klage der Kulturkonservativen, »Schundliteratur« würde zur Verblödung führen, auf ihre Urheber zurückfällt. In diesen Heftchen geht es ohne Umschweife zur Sache, was sie bieten, ist Spannung, und Spannung verspricht zumindest zeitweilig Ablenkung von der schlechten realen Welt. Wie jede Jugendlektüre bleibt sie im Gedächtnis, und Pohrt verdrängt oder verspottet sie auch später nicht als Trivialliteratur, sondern zieht sie als solche selbst noch der Gegenwartsliteratur von 1985 vor, die meist so öde und zäh ist, dass sie nicht mal, wie Harry Rowohlt zu sagen pflegte, zum Einschlafen taugt. Überhaupt empfindet Pohrt eine Hochachtung für Autoren wie Balzac, die für den Tag und für den Markt geschrieben haben und den Leser nicht mit introvertierter oder erbaulicher Literatur langweilen durften. In seinem Artikel »Kein älterer Hut als ein neues Buch« schreibt er:
»Endgültig verschlissen ist damit [mit der Verlagspolitik, alle Themen auszuschlachten und plattzuwalzen] die literarische Substanz, die vor 20 oder 30 Jahren Billy Jenkins, Tom Prox, Kommissar X, Perry Rhodan, Donald Duck und Jerry Cotton hier geschaffen haben. Nach rund zwanzig Jahren einheimischer Literatur zum Abgewöhnen steht fest: keine neue Pflichtlektüre, sondern nur das Groschenheft kann die Bevölkerung, speziell die Autoren, Rezensenten und Kulturredakteuren vor dem drohenden Analphabetismus retten.«21
Die Lektüre scheint Wolfgang Pohrt Lust auf eigene Abenteuer zu machen, das normale Leben verliert für ihn mit 15 jede Attraktivität, er will und kann nicht mehr funktionieren in einer Umgebung, die für ihn »Krise« bedeutete, dessen Symptom so etwas wie der »Kaffeewärmer« gewesen sein könnte, ein typisches Accessoire der kleinbürgerlichen Lebensweise, das den Ausbruch geradezu herausfordert und sich sogar in physischen Beschwerden wie »Halsweh, Erkältung, Magenbeschwerden« niederschlagen, die als Stichpunkte nicht dastünden, wenn sie nicht auch psychische Ursachen gehabt hätten.
Der folgende Eintrag aus dem Jahr 1960 lautet: »Denunziatorische Aufklärung über die Herkunft«. Was immer ihm da zugestoßen sein mag, es muss tiefe Spuren hinterlassen haben, denn Denunziation ist ein starkes Wort, das Pohrt Jahrzehnte später mit Sicherheit nicht unbedacht hingeschrieben hätte. Vermutlich hat die »Aufklärung« mit seinem Vater zu tun, den er nie kennenlernte. Dass dies nicht ganz unwahrscheinlich ist, belegt eine von seiner Nichte erzählte Episode, derzufolge Wolfgang Pohrt – möglicherweise Ostern 1963, also mit 18 Jahren – mit seiner späteren Frau Maria nach Berlin zu Verwandten getrampt ist, um dem Geheimnis seiner Herkunft auf die Spur zu kommen. Die Dokumente und Briefe, die sie dann mitnahmen, vergaßen sie jedoch im Auto der Mitfahrgelegenheit, mit der sie zurück nach Baden fuhren. Durchaus möglich, dass Pohrt diese Dokumente mit Absicht liegen ließ; unwahrscheinlich hingegen ist ein zufälliges Vergessen, da sie der Grund für eine Reise nach Berlin waren.
Auf jeden Fall scheint Wolfgang Pohrt »aus der Spur« zu geraten, wie die weiteren Stichworte verraten, die ebenfalls unter dem Jahr 1960 auftauchen. Er fängt an zu rauchen, trägt Zeitungen aus, arbeitet auf dem Feld vermutlich als Erntehelfer und unterschlägt sein Schulzeugnis. Als Folge davon reißt er mit einem Freund aus, schmiedet Pläne, über Hamburg nach Marseille auszuwandern, und träumt davon, bei einem Preisausschreiben eine Reise in die USA zu gewinnen und »nie mehr« zurückzukehren.
Pohrts Unzufriedenheit mit seinem Zuhause belegt auch eine von KD Wolff erzählte Episode. Als dieser mit seinem Bruder Frank, der auf dem Gymnasium mit Pohrt in die gleiche Klasse ging, ihn zu Hause besuchte und von seiner Mutter freundlich empfangen wurde, schien das dem vielleicht 16jährigen Wolfgang sichtlich unangenehm gewesen zu sein, weil er, wie KD Wolff vermutete, sich wegen seiner Mutter und seiner kleinbürgerlichen Herkunft schämte. Womit dieses Widerwillen ausstrahlende Verhalten Pohrts in jedem Fall zu tun hatte, dass es einem peinlich ist, wenn Freunde Einblick in die verhasste Privatsphäre bekommen, ein Phänomen, das heute nicht anders ist als früher, aber in Zeiten der damals beginnenden subkulturellen Unruhen vielleicht häufiger als sonst vorkam und tiefere Spuren hinterließ.
Ein Jahr später – 1961 – scheint sich die Situation zu beruhigen, Pohrt notiert »Reintegration« und hält fest, dass er »in Mathe von knapp 4 auf gut 2« gekommen ist. Im Sommer, Herbst und Winter arbeitet er in der Schnapsfabrik Schladerer und fährt das erste Mal Mitte des Jahres nach Berlin. 1962 notiert er: »Stehcafé und Zigaretten – Party – Bodensee – Fotoapparat – Theater Andorra«, ein Drama des Schweizer Schriftstellers Max Frisch, der in einer Parabel der Frage von Schuld und Identität nachgeht und am Beispiel antisemitischer Einstellungen beschreibt, wie sich Vorurteile auswirken, Themen also, die den 17jährigen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit konfrontieren, und zwar auf ganz andere Weise als im alltäglichen Leben, in dem man ständig mit Menschen im Clinch liegt, die einen stromlinienförmig zurechtbiegen möchten. »Engagiertes Theater« nannte man das damals, und als das Stück am 2. November 1961 in Zürich Premiere hatte, rief es ein großes Echo in der Presse hervor und wurde zu einem der erfolgreichsten Theaterstücke der Nachkriegszeit. Frischs Stück »Andorra« würde kaum in seinen Notizen Erwähnung finden, wenn Pohrt nicht mit seiner theaterbegeisterten Mutter in die Schweiz zur Aufführung gefahren wäre, denn offensichtlich scheint sie großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben.
Zu Hause geht es nicht sonderlich harmonisch zu, denn im Alter von 19 kommt es schließlich zum »Bruch«, er schmeißt mitten in der Abiturklasse »aus sehr privaten Gründen« die Schule hin, arbeitet auf dem Bau, um Geld zu verdienen, und fährt am 17. August 1964 von München nach »Beograd«. Dieses Datum steht in seinem Reisepass, aber dass dieses Ereignis auch in seinen biographischen »Stichpunkten« auftaucht, lässt darauf schließen, dass die Reise mit seiner vier Jahre jüngeren Freundin Maria, deren Eltern aus Novi Sad stammen, möglicherweise die erste größere Reise mit ihr allein war.
Novi Sad liegt an den Ufern der Donau und wird als »serbisches Athen« bezeichnet. Alexandar Tišma ist dort aufgewachsen, und sein Roman »Der Gebrauch des Menschen« spielt in dieser Stadt, die eine Geschichte hat, die noch nicht vergessen ist, als Pohrt dort seine Ferien verbringt: 1942 wurden auf Befehl eines von den Nazis unter Druck gesetzten ungarischen Generals (das Königreich Ungarn gehörte zu den Achsenmächten, die Novi Sad besetzt hatten) über 1200 Zivilisten, darunter 800 Juden, erschossen. Auch die Befreiung der Stadt Ende 1944 durch die Partisanen, denen sich Alexandar Tišma mit zwanzig angeschlossen hatte, ist den Bewohnern dreißig Jahre später noch im Gedächtnis. An diese »großartige Tradition der Partisanen« erinnert Pohrt später in einem nicht zustande gekommenen Interview mit Milošević und schreibt rückblickend über einige merkwürdige Dinge, mit denen man als deutscher Tourist damals konfrontiert wurde und die durch den Bürgerkrieg in Jugoslawien mehr als nur eine Randglosse werden:
»In der Wojwodina war ich 1964 zum ersten Mal. Ich kam damals mit Ungarn ins Gespräch, die den Deutschen herzlich empfingen und sich als große Hitler-Verehrer entpuppten. Das hat mich gewundert. Gewundert hat mich auch, daß Radio Novi Sad in ungarischer Sprache gesendet hat, und daß es ungarische Schulen gab. Später hat mich gewundert, daß man in Slowenien im Restaurant nicht bedient worden ist, wenn man auf Serbokroatisch bestellte. Sprach man Deutsch, kam der Kellner gleich angeflitzt. Das alles wurde geduldet. Was nicht geduldet wurde, war die Kritik von Djilas an der ›Neuen Klasse‹. Djilas saß im Gefängnis, die völkischen Agitatoren saßen im Rundfunk.«22
Am 2. September 1964 ergreift Pohrt die Flucht nach Berlin und wohnt ab dem 15. September in einem »trüben, möblierten Zimmer« im Kapellensteig 1 in der Siemensstadt. In dem typischen grauen Berliner Wohnblock stellt ihm der Arbeitgeber eine Werksunterkunft »bei einer Schusterwitwe« zur Verfügung, »die mich am Samstagabend einlud, mit ihr Peter Frankenfeld zu gucken«.23 Den Job als Hilfsschlosser bei Siemens hält er jedoch nicht lange aus, nachdem er auf einer Betriebsfeier eines langjährigen Mitarbeiters einen Blick in die eigene Zukunft wirft, die nur den Tod auf Raten verspricht, sollte er bei Siemens bleiben. Stattdessen holt er auf dem Abendgymnasium das Abitur nach und verdient sich als »Marktverkäufer« und bei »Feinkost Jaletzke« seinen Unterhalt.
Das heißt aber nicht, dass das Leben nicht auch seine angenehmen Seiten gehabt oder Pohrt das zurückgezogene Leben eines Einsiedlers geführt hätte. In einem 1987 gehaltenen Vortrag gibt er einen Hinweis auf seine Freizeitgestaltung in dieser Zeit:
»Damals, Mitte der 60er Jahre, florierte in West-Berlin eine Nachtlokal-Kette, die mit dem Spruch ›Was soll'n wir reden, gehn wir ins Eden‹ um Besucher warb. In manchen Räumen liefen Zeichentrickfilme, andere waren zu Diskotheken ausgebaut, und nirgends saßen diese schweigend ins Gespräch vertieften Mumien herum, die sich im Hypnotisieren von Kaffeetassen und Biergläsern üben. Ein dankbares Publikum sorgte allabendlich für drangvolle Enge, denn damals hatten es nicht nur die protestierenden Studenten satt, nach Feierabend noch die eigene Sozialverträglichkeit durch jene Art von Pflichterfüllung zu beweisen, die in der Aufrechterhaltung des Scheins besteht, man genieße das Spiel mit der Belanglosigkeit, das früher Konversation hieß und längst harte Arbeit geworden war, die jedem den Schweiß auf die Stirn und das Blut in die Ohren treibt.«24
Das Ringen um die Wahrheit
Am 21. Mai 1965, mit 20 Jahren, unterzog er sich »der Reifeprüfung für Schulfremde«. Mit den »Leistungen«, also den Noten, würde er heute von keiner Universität mehr aufgenommen. In dem ihm ausgehändigten »Zeugnis der Reife« hat er lediglich in Geschichte und Gemeinschaftskunde ein »gut«, und lediglich in Physik und Chemie ein »befriedigend«. In allen anderen Fächern (Erdkunde, Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik und Biologie) wird er mit »ausreichend« benotet. Eigentlich hätte Pohrt gerne Physik studiert, weil es sein »Lieblingsfach« war, aber nach seinen deprimierenden Erfahrungen bei Siemens und in der Abendschule wollte er wissen, »warum die Menschen ein ungelebtes Leben hinnehmen«.
Das Studium des seiner Meinung nach dafür zuständigen Faches Psychologie verhinderte der Numerus clausus, aber es war sowieso eine Fehleinschätzung, von diesem Studium Antworten auf seine Fragen zu erwarten.
Wieder steht ein Umzug an. Diesmal in den Ernst-Bumm-Weg, eine kleine Sackgasse in der Nähe des Spandauer Damms, in eine hässliche, kleinbürgerliche Wohnanlage aus den Fünfzigern, unweit des Charlottenburger Schlosses. Er schreibt sich an der FU Berlin im Fach Soziologie und in den Nebenfächern Psychologie, Politik, Germanistik und VWL ein.
Nun begann die »Resozialisierung« nach Schulabbruch und Abendschule. »Aus dem Paria Schulabbrecher & Gelegenheitsarbeiter war ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft geworden, ein Student.«25 Er bekam während der Semestermonate 200 Mark Stipendium, musste also jobben, um sich über Wasser zu halten. Das Studium der Soziologie erweist sich als »unbekömmlich«. Vor allem für einen, der Dostojewski liest und weiß, was Spannung ist, ist das, was im Fach Soziologie angeboten wird, »hochkonzentrierte Langeweile«. Und um die zu ertragen, bräuchte man schon »das Naturell eines Krokodils, das tagelang im Schlamm liegend auf seine Beute warten kann, ohne dass ihm je langweilig würde«.26
Pohrt steht also vor der Entscheidung, das Studium abzubrechen, beschließt dann aber, »der Soziologie eine letzte Chance zu geben«. Seiner eigenen Legende zufolge greift er mehr oder weniger willkürlich in der Seminarbibliothek unter A wie Adorno nach einem schmalen, grauen Bändchen eines ihm unbekannten Autors. Das Buch heißt »Dialektik der Aufklärung«:
»Ich verstand alles und nichts, weil ich viele Vokabeln gar nicht kannte und nur aus dem Zusammenhang auf ihre Bedeutung schließen konnte. Die Fremdwörter schrieb ich auf, wenn ich mich nachts durch das Büchlein durchbiss, um sie am nächsten Tag in der UB nachzuschlagen. Das machte mir überhaupt keine Mühe, sondern war ein Vergnügen wie die Lösung eines interessanten Rätsels, eigentlich Detektivarbeit. Ich las das Buch wie einen Krimi, es hielt mich nächtelang wach. Ich glaubte, eine ungeheure Willenskraft und einen tiefen Ernst zu spüren, das Gegenteil von der mir zutiefst verhassten üblichen infantilen akademischen Gemütlichkeit, und stellte mir Adorno und Horkheimer als Menschen vor, die Büchner mit einem aufgeklappten Rasiermesser verglichen hatte. Sie waren das genaue Gegenteil, keine Fanatiker, sondern Genießer. Unbestechlich, wie ich denke, aus Eigennutz, weil sie wussten, dass ihre Gedanken unbezahlbar, nicht in Gold aufzuwiegen waren.«27
Jetzt war Pohrt ein richtiger Student, »der nächtelang mit heißen Ohren wissenschaftliche Bücher verschlingt und mit sich selbst um die Wahrheit ringt«.28
Den Herbst und Silvester verbringt er in Rastatt, wo die Eltern der damals 16jährigen Maria Schmidt wohnen. Sie ist nicht nur eine Jugendfreundin, sondern sie wird die Frau seines Lebens, vielleicht sogar zu seiner Obsession. Davon erzählt eine Episode, in der Pohrt vollkommen verzweifelt darüber war, dass die Familie von Maria umgezogen war, ohne dass sie ihm davon erzählt hatte. Pohrt begibt sich auf die Suche und findet die Schmidts in einem Nachbarort. Er klingelt und fragt Maria vorwurfsvoll, warum sie ihm nichts vom Umzug erzählt hätte, worauf Maria antwortet: »Ich wusste, dass du mich finden würdest.«
1966 vertieft er sich in das Studium von Adorno und Horkheimer, u.a. beschäftigt er sich mit der zweibändigen Ausgabe von »The Authoritarian Personality« und kommt seinen spärlichen Eintragungen zufolge lediglich im Sommer nach Freiburg, um in der Forstverwaltung zu arbeiten und Silvester in Karlsruhe zu feiern. 1967 zieht Wolfgang Pohrt nach Frankfurt in eine »Mansarde«, vermutlich um näher bei Maria zu sein, jedenfalls hat dieser Grund für Pohrt seither immer Priorität, und nicht etwa die Möglichkeit, bei Adorno studieren zu können, bei dem er ein Seminar über die »Autoritäre Persönlichkeit« besucht, das zu einer der »herbsten Enttäuschungen« seiner Studienzeit zählt:
»Alles goldrichtig irgendwie, ebenso fleißig wie bemüht, alles so ewig schon bescheidwisserisch hingebimst, daß man's nicht mehr hören mag, vergeistigt auf diese penetrante Art, ganz anders als in Adornos Texten, wo es in einem Atem heißt: ›Philosophie ist das Allerernsteste, aber so ernst wieder nicht!‹«29
Wenn man das von Pohrt angefertigte Protokoll eines Referats in einem Adorno-Seminar vom 23. Januar 1968 über »Probleme der autoritätsgebundenen Persönlichkeit« liest,30 weiß man auch, was Pohrt meint, denn man merkt dem Text die Mühe an, dem universitären Anspruch in einer wissenschaftlich-verschraubten Sprache gerecht zu werden.
Auch die Tatsache, in Frankfurt seinen ehemaligen Klassenkameraden Frank Wolff wiederzutreffen oder dem Studentenführer Hans-Jürgen Krahl im Kolbheim-Keller zu lauschen, wo dieser selbst noch nach exzessivem Alkoholgenuss stundenlang auf höchstem theoretischen Niveau monologisieren konnte, wie Pohrt einmal erzählte, spielte bei seinem Entschluss, nach Frankfurt zu ziehen, nicht die entscheidende Rolle. Die Semesterferien verbringt er mit der nunmehr 18 gewordenen Maria in der Nähe ihrer Eltern auf einem Zeltplatz bei Rastatt, in Frankfurt ist er jetzt aktiver Teil der Studentenbewegung und Mitglied des SDS.
Als Pohrt später nach dem Einfluss Horkheimers und Adornos auf ihn gefragt wird, sagt er, dass sie den Einfluss zweifellos hatten, allerdings nur deshalb, weil das »Glück« auf seiner Seite war, »in einer bestimmten Zeit zu lernen, in einer Zeit, die einen dazu bringt, Adorno und Horkheimer zu lesen. So was tut heute keiner mehr. Das ist kein Zufall.«31 Und will man wissen, warum das so ist, müsste man sich weiter fragen, »wie hat sich damals ein geistiges Klima gebildet, wo zum ersten Mal in der Geschichte der BRD es an den Universitäten lebendige Diskussionen gegeben hat?«32 Das ist sehr nüchtern formuliert, aber er beschreibt den Moment, in dem Theorie, wenn auch nicht die Massen, so immerhin die Studenten ergreift, und dieser Moment ist unabhängig von der Theorie; es war einfach Glück, im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen zu sein, um sich anstecken zu lassen.
Vermutlich nimmt Pohrt in diesem Jahr auch an der 22. Delegiertenkonferenz des SDS teil, auf der Dutschke das gemeinsam mit Krahl verfasste »Organisationsreferat« hält, in dem er in einer der freien Rede zu verdankenden wirren Begrifflichkeit aufgrund der kapitalistischen Entwicklung in Deutschland die »Propaganda der Tat« als Unterstützung der »Propaganda der Schüsse« von Che Guevara fordert, um auf den Zulauf von Mitgliedern seit der Erschießung Benno Ohnesorgs und auf die überkommene bisherige Struktur einer bürgerlichen Mitgliederpartei, die der SDS beibehalten hatte, zu reagieren. »Eine Urbanisierung ruraler Guerilla-Tätigkeit« erscheint ihm geschichtlich möglich: »Der städtische Guerillero ist der Organisator schlechthinniger Irregularität als Destruktion des Systems der repressiven Institutionen.«33
Diese durch die gewaltsamen Verhältnisse entwickelte Legitimation von Militanz zeigt, wie weit verbreitet und selbstverständlich und alltäglich die Vorstellung war, sich militant zur Wehr setzen zu müssen, und das nicht nur als Reaktion auf bestimmte Repressionsmaßnahmen. Für den 22jährigen am Anfang seines Studiums stehenden Pohrt dürfte das umso überzeugender geklungen haben, je unmittelbarer er in die Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Polizei involviert war, und umso enttäuschter war er später, als sich »die Genossen« schließlich nicht mehr daran erinnern wollten.
In diesem Jahr 1967 entsteht sein erster längerer Text, jedenfalls der erste, den Pohrt selbst aufbewahrt und der in einem späteren Verzeichnis seiner Artikel auftaucht: »Arbeit und Faulheit«. Aus ihm wird ersichtlich, womit er sich in den letzten zwei, drei Jahren beschäftigt hat: Marx, »Das Kapital« 1–3, die »Pariser Manuskripte«, »Die Deutsche Ideologie«, Engels' »Anti-Dühring«, Oskar Negt über Comte/Hegel, Karl Löwiths »Von Hegel zu Nietzsche«, Veblens »Theorie der feinen Leute«, Friedmanns »Grenzen der Arbeitsteilung«, Freuds »Werke Bd. 14« (Texte 1925–1931), Marcuses »Vernunft und Revolution«, »Triebstruktur und Gesellschaft« und »Kultur und Gesellschaft II«, Pollocks »Automation«, Paul Lafargues »Recht auf Faulheit«, Habermas' »Theorie und Praxis«, Blochs »Prinzip Hoffnung«.
Mit diesen Büchern hat er sich mehr als nur den theoretischen Kanon eines 68ers angeeignet, an dem allerdings erstaunlich ist, dass Adorno fehlt, den er schon 1964 gelesen hat, während er bis auf Marx und Freud fast alle anderen Autoren nie sonderlich geschätzt hat und die auch später nicht mehr als Referenzen auftauchen, weshalb man davon ausgehen kann, dass diese Lektüre dem Zeitgeist geschuldet war: Eine zumindest rudimentäre Kenntnis der Bücher war notwendig, um mitreden zu können. Auch Rosa Luxemburg stand, wie er später einmal schrieb, in seinem Regal: »Über die erste Seite kam ich wegen übermäßiger Langeweile nie hinaus. Das war mein Glück. Mein Unterhaltungsbedürfnis hat mich davor beschützt, auf die schiefe Bahn zu geraten und Antikommunist zu werden.«34
1967 ist Arbeit eine zentrale Kategorie, an der sich nicht nur Pohrt abarbeitet. Er versucht, ihren Doppelcharakter als wertschaffende Verausgabung menschlicher Arbeitskraft und als Gebrauchswert produzierende, konkret nützliche Arbeit in den Griff zu bekommen, weil darin auch der Schlüssel zum Verständnis der politischen Ökonomie liegt. Pohrt zeichnet die Entwicklung des Arbeitsbegriffs bei Marx nach, wobei die zahlreich zitierten Texte, die er gelesen hat, noch nicht die zwingende Argumentation erkennen lassen, die ihn später auszeichnet. Es ist, als würde er vorerst das Besteck vor sich ausbreiten, mit dem er schließlich die Ideen und Vorstellungen der Leute sezieren wird. Die Faulheit als Absage an den Verzicht auf Glück ist für ihn damals zwar wichtig, und er erkennt sogar bei den sogenannten »Gammlern« dieses Moment als durchaus legitim an, aber sie infiziert ihn nicht so wie der Begriff der Arbeit, mit dem er sich in seiner Dissertation auseinandersetzen wird. Nur äußerst knapp erscheint die Faulheit am Rande, und zwar in einem Zitat von Thorstein Veblen, an dem vor allem auffällt, dass auch Gedanken, die man nicht im Universum der Protestbewegungsgeneration vermuten würde, bei Pohrt auftauchen:
»Die gefällige Wirkung untadeliger Kleider ist hauptsächlich, wenn nicht vollständig dem Umstand zuzuschreiben, daß sie die Vorstellung eines müßigen Lebens wachrufen, also auf die Befreiung vom persönlichen Kontakt mit irgendwelcher handwerklicher oder gewerblicher Arbeit hinweisen.«35
Diese Überlegung dürfte Pohrt gefallen haben, wenn er auch nie ein Interesse an Mode zeigte oder auf die Idee gekommen wäre, mittels Kleidung ein Statement abzugeben oder einen bestimmten Anschein zu erwecken. Auch wenn er den eleganten italienischen Anzug durchaus schätzte, war er für ihn nie eine Option, als wolle er nicht vortäuschen, was er nicht war. Die Negation des bürgerlichen Habitus im nachlässigen und hippiesken Auftreten der Alternativen gab ihm höchstens Anlass zu Spott, wenn er sich über deren »Schlabberlook« lustig machte.
Seine Erscheinung war unauffällig, jedenfalls war ihm extravagante Kleidung fremd. Die Negation des äußeren Erscheinungsbildes, als die Studenten noch mit ihren Eltern verwechselt werden konnten, wenn sie sich für den Kirchgang oder für ein Vorsprechen beim Professor schick machten, diese Negation, die manche sogar dazu verführte, sich als Django zu kostümieren, war für Pohrt immer eine rein äußerliche Angelegenheit. Und dieses dezente Outfit hat Wolfgang Pohrt nie abgelegt, weswegen er immer wie ein Fremdkörper wirkte, wenn er vor alternativem oder friedensbewegtem und strickendem Publikum auftrat, ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, wie ein Handelsreisender in der Fremde.
Aus dem Jahr 1967 gibt es ein Foto, auf dem Pohrt sich ein bisschen mit unangepasster Attitüde inszeniert, ein bisschen existentialistisch mit einem skeptischen Blick auf die Welt, der eine gewisse durch Unnahbarkeit überspielte Unsicherheit verrät. Sein Jackett mit aufgenähten Taschen und breitem Revers ist zugeknöpft, er trägt einen dunklen Schal, die seitengescheitelten langen Haare stehen widerspenstig ab, und seine rechte Hand führt kunstvoll eine Zigarette zum Mund. Das scheint das äußerste gewesen zu sein, was sich Pohrt als Selbstdarstellung erlaubte.
Unauffällig im Zentrum der Bewegung
Aus den autobiographischen Stichpunkten des Jahres 1968 erfährt man nicht viel. In den Sommerferien zeltet er in der Umgebung von Stuttgart mit Maria und erlebt einen »Rauswurf«, aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Wohnung seiner Mutter. Seine Pläne, mit Maria nach Novi Sad zu trampen, zerschlagen sich wegen des Einmarschs der Russen in der Tschechoslowakei. Er zieht ins Kolbheim, das Studentenwohnheim am Beethovenplatz, in eine der 69 »Wohneinheiten« mit je 8,5 Quadratmeter.
Das Kolbheim war damals die Zentrale des Frankfurter SDS, wo wöchentlich Mitgliederversammlungen stattfanden, die meistens im »Kolbkeller« mit Bier fortgeführt wurden. Kein Wort verliert er über seine Teilnahme am Vietnam-Kongress im Februar in Berlin, wo ca. 5000 Linke an der Technischen Universität zusammenkommen und wo u.a. Giangiacomo Feltrinelli und Peter Weiss sprechen und Grußbotschaften verlesen werden; anschließend demonstrierte man mit »Ho-Tschi-Minh«-Rufen auf dem Kudamm. Überhaupt erfährt man nicht viel über seine aktivistische Tätigkeit, außer dass er einmal bei einer Veranstaltung der Jungen Union »das Maul zu weit aufgerissen«36 habe und dann von Rentnern mit Krückstock bedroht wurde und das Weite suchen musste. Und in einem Brief schreibt er, dass er mal als SDS-Delegierter 1968 bei einem »Jugendtreffen« auf die Wartburg in der DDR eingeladen war.
»Ich erinnere mich noch an das viele ›Druschba‹-Gebrülle (irgendein sowjetischer Vizeminister war auch dabei) und daran, dass mein Glas nie leer wurde, weil hinter den Gästen Kellner standen, deren einziger Job das Nachschenken war. Solche feudale Dekadenz hatte ich noch nie erlebt.«37
Von Frank Wolff stammt der Hinweis, dass Pohrt auf einem Teach-in im Hörsaal 6 der Uni Frankfurt einen Beitrag vom Blatt abliest und von Cohn-Bendit mit dem Zwischenruf unterbrochen wird: »Sprich doch frei, Genosse!« Allerdings war das nicht der einzige Beitrag Pohrts auf den häufig stattfindenden Teach-ins, wie sich sein damaliger Freund André Wohlleben erinnert.
Um kurz ins Gedächtnis zu rufen, welche Ereignisse in Frankfurt 1968 das politische Klima prägten und an welchen Wolfgang Pohrt als Mitglied des SDS ziemlich sicher auch teilgenommen hat, die ihn zumindest beeinflusst haben: Am 5. Februar versuchen Mitglieder des SDS aus Protest gegen den Vietnamkrieg, das amerikanische Konsulat zu besetzen. Nachdem ein GI am 13. Februar auf der Flucht aus der Gutleutkaserne angeschossen und verhaftet worden ist, gibt es eine Protestaktion der Studenten. Am 29. Februar findet auf dem Römerberg eine Kundgebung gegen den Vietnamkrieg statt, auf der es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kommt. Studenten stürmen das Polizeipräsidium in der Friedrich-Ebert-Anlage. Kurz vorher ist Rudi Dutschke am Flughafen festgenommen und zwei Stunden festgehalten worden. Am 20. März findet die Uraufführung des Theaterstücks »Viet Nam Diskurs« von Peter Weiss im Schauspiel Frankfurt statt, in dem der Vietnamkrieg als Verbrechen angeprangert wird und das junge Publikum »Ho-Tschi-Minh« skandiert. Vom 2. auf den 3. April legen Baader, Ensslin, Thorwald Proll und Horst Söhnlein drei Brände im Kaufhof und im Kaufhaus M. Schneider, am 4. April werden sie verhaftet. Am 11. April wird Rudi Dutschke bei einem Attentat in Berlin schwer verletzt. Am gleichen Tag finden spontane Kundgebungen in Frankfurt vor dem Schauspiel und am Hauptbahnhof statt. Einen Tag später gibt es Demonstrationen gegen die Springer-Presse und eine Blockade der Societäts-Druckerei im Gallusviertel, wo die Bild