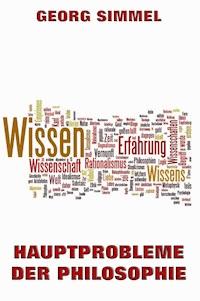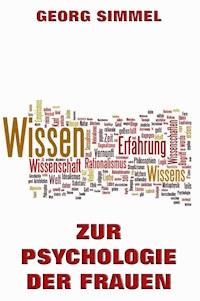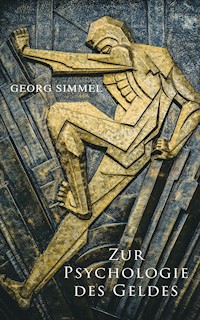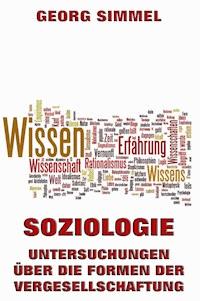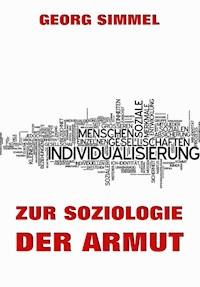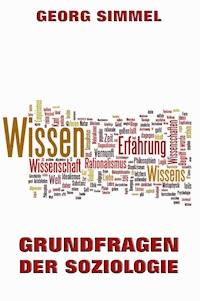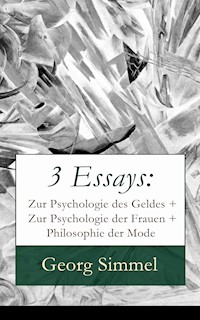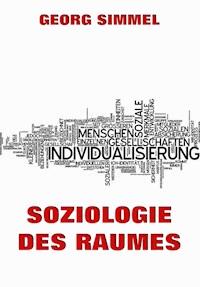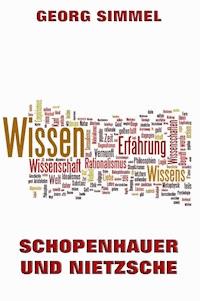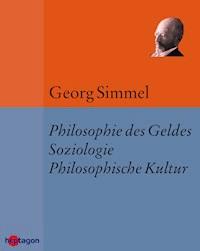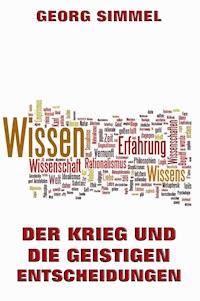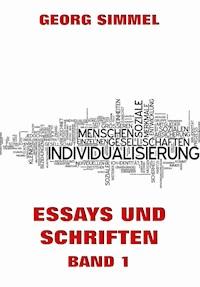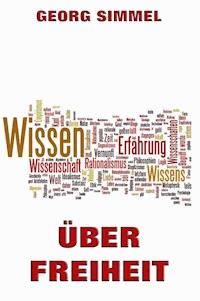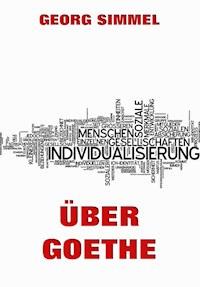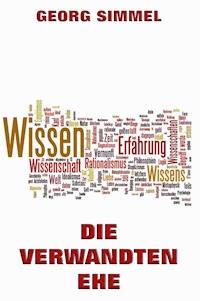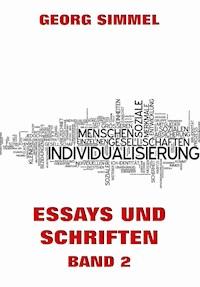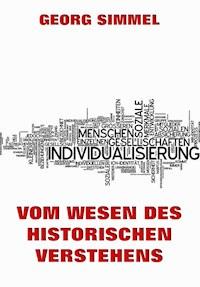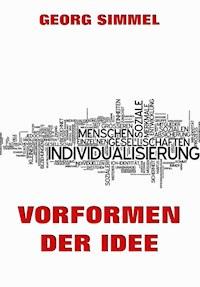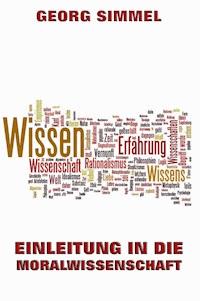
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die unübersehbare Fülle der Moralprinzipien und die Entgegengesetztheit in ihnen und ihren Ausführungen beweist unmittelbar, dass die Ethik diejenige Sicherheit der Methoden noch nicht gefunden hat, die in anderen Wissenschaften ein harmonisches Nebeneinander und aufsteigendes Nacheinander der Leistungen bewirkt. Von der Form der abstrakten Allgemeinheit, die zu den Einzelerfahrungen kein erkenntnisstheoretisch geprüftes Verhältnis hat, von ihrer Verquickung mit der Moralpredigt und den Reflexionen der Weisheit scheint ihr Weg zu einer historisch-psychologischen Behandlung aufwärts zu gehen. Sie hat einerseits, als Teil der Psychologie und nach deren sonst festgestellten Methoden, die individuellen Willensakte, Gefühle und Urteile zu analysieren, deren Inhalte als sittliche oder unsittliche gelten. Inhalt: Vorwort zu dem ersten Neudruck (von 1904) Vorwort zur ersten Auflage Erstes Kapitel: Das Sollen Zweites Kapitel: Egoismus und Altruismus Drittes Kapitel: Sittliches Verdienst Viertes Kapitel: Die Glückseligkeit Fünftes Kapitel: Der kategorische Imperativ Sechstes Kapitel: Die Freiheit Siebtes Kapitel: Einheit und Widerstreit der Zwecke
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1273
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung in die Moralwissenschaft - Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe
Georg Simmel:
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Einleitung in die Moralwissenschaft - Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe
Vorwort zu dem ersten Neudruck (von 1904)
Vorwort zur ersten Auflage
Erstes Kapitel: Das Sollen
Zweites Kapitel: Egoismus und Altruismus
Drittes Kapitel: Sittliches Verdienst
Viertes Kapitel: Die Glückseligkeit
Fünftes Kapitel: Der kategorische Imperativ
Sechstes Kapitel: Die Freiheit
Siebtes Kapitel: Einheit und Widerstreit der Zwecke
Einleitung in die Moralwissenschaft, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616939
www.jazzybee-verlag.de
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Vorwort zu dem ersten Neudruck (von 1904)
Statt einer im eigentlichen Sinne neuen Auflage dieses seit längerer Zeit vergriffenen Buches biete ich hier nur eine chemigraphische Reproduktion der ersten Auflage - nicht obgleich, sondern weil ein inzwischen vollzogener Wandel meiner prinzipiellen Überzeugungen eine völlige Umarbeitung des Werkes nötig gemacht hätte.
Denn an einer solchen verhindern mich für absehbare Zeit anderweitige wissenschaftliche Verpflichtungen, während die weiterbestehende Nachfrage erkennen lässt, dass das Buch auch in seiner jetzigen Gestalt nicht völlig überflüssig geworden ist.
Dass ich diesem Bedürfnis entgegenkomme, glaube ich verantworten zu können, weil die Weiterbildung meiner Ansichten mehr eine Ergänzung als eine einfache Verneinung der früheren Darlegungen fordern würde.
Hauptsächlich aber, weil - wie es in philosophischen Entwicklungen häufig der Fall ist - die beiden Standpunkte, die ein Einzelgeist nacheinander erlebt, in rein sachlicher Hinsicht koordiniert sind.
Von den Gegensätzlichkeiten der empiristischen und der metaphysischen Überzeugung, der historischen Wirklichkeitsentwicklung und der Wertprüfung, der psychologischen und der sachlichen Methode - ist eine jede an sich und für andre Persönlichkeiten darum noch nicht die höhere, weil sie es für eine individuelle Entwicklung geworden ist.
Diese Differenzen sind der Ausdruck von Grundgesinnungen, die jenseits der Alternative von wahr und falsch stehen.
Die Einsicht in eigentliche und wesentliche Irrtümer hätte Umänderung oder Unterdrückung des Buches gefordert; jene prinzipielle Wendung aber gestattet seine erneute Darbietung seitens des Verfassers, in demselben Sinn, in dem er das Buch eines Dritten herausgeben könnte, das ihm objektiv der Veröffentlichung nicht unwürdig erscheint, obgleich es eine andre Weltanschauung als die seinige vertritt.
####
Vorwort zur ersten Auflage
Die unübersehbare Fülle der Moralprinzipien und die Entgegengesetztheit in ihnen und ihren Ausführungen beweist unmittelbar, dass die Ethik diejenige Sicherheit der Methoden noch nicht gefunden hat, die in anderen Wissenschaften ein harmonisches Nebeneinander und aufsteigendes Nacheinander der Leistungen bewirkt.
Von der Form der abstrakten Allgemeinheit, die zu den Einzelerfahrungen kein erkenntnisstheoretisch geprüftes Verhältnis hat, von ihrer Verquickung mit der Moralpredigt und den Reflexionen der Weisheit scheint mir ihr Weg zu einer historisch-psychologischen Behandlung aufwärts zu gehen.
Sie hat einerseits, als Teil der Psychologie und nach deren sonst festgestellten Methoden, die individuellen Willensakte, Gefühle und Urteile zu analysieren, deren Inhalte als sittliche oder unsittliche gelten.
Sie ist andrerseits ein Teil der Sozialwissenschaft, indem sie die Formen und Inhalte des Gemeinschaftslebens darstellt, die mit dem sittlichen Sollen des Einzelnen im Verhältnis von Ursache oder Wirkung stehen.
Endlich ist sie ein Teil der Geschichte, indem sie auf beiden genannten Wegen jede gegebene moralische Vorstellung auf ihre primitivste Form, jede Weiterentwicklung derselben auf die historischen Einflüsse, die sie treffen, zurückzuführen hat und so auch auf diesem Gebiete die historische Analyse als die Hauptsache gegenüber der begrifflichen anerkennen lässt.
Für diese Auffassung ist es fraglich, ob die Ethik überhaupt als eine besondere Wissenschaft bestehen bleiben wird.
Es wird vielleicht eines Tages nicht mehr zweckmässig erscheinen, unter dem von ihr gestellten Gesichtspunkt Teile so mannigfaltiger Wissenschaften zusammenzubringen.
Dies ist indes eine bloss praktische Frage der wissenschaftlichen Arbeitsteilung.
Dagegen dürfte es schon heute feststehen, dass wenn die Moralwissenschaft sich über die Eingrenzung zwischen abstrakten Imperativen und unmethodischen oder spekulativen Betrachtungen erheben will - dass dann ihre Aufgaben nicht mehr von einem einzelnen Arbeiter, sondern nur von der Gesamtentwicklung der Wissenschaft zu lösen sind.
Ich hoffe, die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein einzelnes Buch so wenig den Titel "Ethik" schlechthin führen wird, wie etwa den Titel "Physik" schlechthin.
Zu der bezeichneten, in Abschnitten der ethischen, psychologischen und soziologischen Literatur schon partiell verwirklichten Behandlung der Moralwissenschaft wollen die nachfolgenden Gedankenreihen gewissermassen ein Vorwort oder eine Oberleitung sein, indem sie ihre Ausgangspunkte noch von der reflektierenden und teilweise spekulativen Denkart nehmen und auf dem Boden dieser selbst zu dem Punkte führen, wo sie über sich hinaus auf die Notwendigkeit exakter Einzeluntersuchungen weist.
Sie kritisieren deshalb die scheinbar einfachen Grundbegriffe, mit denen die Ethik zu arbeiten pflegt, und zeigen einerseits deren höchst komplizierten und vieldeutigen Charakter auf, andrerseits den Begriffsrealismus, mit dem man sie aus nachträglichen Abstraktionen zu wirkenden psychischen Kräften gemacht hat; sie zeigen, dass die Unsicherheit in Sinn und Begrenzung dieser Begriffe ihre Verknüpfung zu ganz entgegengesetzten Prinzipien gestattet, von denen jedes das gleiche Mass scheinbarer Beweisbarkeit besitzt wie das andere; sie weisen endlich auf die Schichtung belastender und entlastender Momente hin, die die einzelne Tat in der Verzweigtheit ihrer psychologischen Vorbedingungen ebenso wie in der ihrer sozialen Folgen findet.
Praktisch versittlichend wird freilich eine dementsprechende positive Ethik nicht wirken, der das Gute wie das Böse ein gleichmässig gleichgültiges Objekt blosser genetischer Erkenntnis ist.
Erstes Kapitel: Das Sollen
Die geistige Entwicklung der Menschheit hat eine Stufe durchgemacht, auf der man sich keines Unterschiedes zwischen den Vorstellungen, denen eine Wirklichkeit entspricht, und denen, die unwahr und rein psychologische Vorgänge sind, bewusst war.
Von den Naturvölkern hören wir vielfach, dass sie den Vorstellungen des Traumes dieselbe Wirklichkeit zuschreiben und dieselben Folgen geben, wie denen des Wachens; dass die tollste Einbildung, z. B. die Anwesenheit von Geistern, genau dieselbe Realität für sie besitzt, wie irgend ein sinnlich wahrnehmbares Ding; dass sie die Vorstellung eines Menschen, die sein Bildnis hervorruft, von der seiner wirklichen Gegenwart nicht zu unterscheiden wissen.
Die Kulturvölker zeigen an ihren Kindern noch die gleiche Erscheinung; es ist oft unmöglich dem Kinde klar zu machen, dass eine Wendung des Spiels oder des erzählten Märchens, die ihm Tränen entlockt, nicht Wirklichkeit, und dass die Puppe, die es wegen einer eingebildeten Ungezogenheit schlägt, kein wirklicher Mensch ist; ein Kind im dritten Jahre, zu dessen Belustigung man Papierfiguren ausschnitt, weinte heftig, wenn eine Figur durch rasches Schneiden in Gefahr kam, ein Glied zu verlieren; ein andres, das geträumt hatte, seine Mutter verliesse es, machte dieser nach dem Erwachen die grössten Vorwürfe darüber.
Entsprechend tritt dieser Mangel an Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem bloss Vorgestellten bei weniger entwickelten Geistern vergleichsweise stärker hervor; die Juristen bemerken bei ihrem Verkehr mit den ungebildeten Klassen, dass es diesen fast unmöglich ist, die Tatsachen und ihre Auslegungen und Phantasiegebilde auseinander zu halten.
Aber auch in den höheren Kulturkreisen sind noch genug Überbleibsel dieser Unvollkommenheit auffindbar.
Man scheut sich etwas Böses auch nur beim Namen zu nennen, man darf gewisse Dinge nicht einmal im Scherze sagen, offenbar weil für uns an der blossen Vorstellung schon ein Teil Realität haftet; dass man den Teufel nicht an die Wand malen, dass auch an der unsinnigsten Verleumdung immer etwas daran sein soll und dass immer etwas von ihr hängen bleibt - dies alles ist die Folge einer nicht genügend scharfen Scheidung des blossen Gedankens von demjenigen, der zugleich die Wirklichkeit bedeutet.
Noch in der Symbolik des brahmanischen Opfers lässt die gleiche Verschwommenheit des Denkens das gesprochene Wort als Gewissheit, die mitschwebende Bedeutung der Sache als ihre Wirklichkeit erscheinen: "Prajâpati schuf zu seinem Abbild das was das Opfer ist; darum sagt man: das Opfer ist Prajâpati."
Um was es sich hier handelt, das ist nicht der Irrtum, der das Erzeugnis der Einbildung in das Gewand der Wahrheit kleidet und so bei prinzipieller Klarheit über den Unterschied zwischen bloss psychologischer und objektiv wahrer Vorstellung die Inhalte beider vertauschte, sondern darum handelt es sich, dass bei primitiverem Denken der Unterschied zwischen Denken und Sein nicht nur nicht in abstrakter Weise, sondern nicht einmal tatsächlich in der Anwendung auf den einzelnen Fall gemacht wird.
Die Vorstellungsinhalte tauchen zunächst rein als solche psychologisch auf und es bedarf erst eines langen Differenzierungsprozesses, um sie in wahre und unwahre, logische und psychologische zu teilen.
Überall, wo das Bewusstsein ganz und gar von einer Vorstellung ausgefüllt ist, so dass kein Vergleich und kein reflektierendes Zusammenhalten mit der Gesamtheit der andern stattfindet, da pflegt sie sich auch in späteren Stadien der Geistesentwicklung noch unmittelbar als reale darzustellen.
Darum erscheinen einem die meisten Gedanken im Augenblick der Konzeption als wahre, darum ist der Schöpfer einer Idee, die sein ganzes Denkvermögen ausfüllt, ihr gegenüber meistens so kritiklos, darum sind wir meistens von der objektiven Richtigkeit von Parteimeinungen durchdrungen, die durch die Fülle der mit ihnen verbundenen Interessen unser Bewusstsein ganz und gar ausfüllen; selbst in der Wissenschaft ist diese Überschätzung des eignen Gebietes ganz gewöhnlich, weil die subjektiv-psychologische Bedeutung für uns gar zu leicht den Anschein einer sachlichen annimmt; so, um ein weniger bekanntes Beispiel zu nennen, zeigt die Geschichte der Tierpsychologie, dass die wirklichen Beobachter, die sich eingehend mit der Tierwelt beschäftigt haben, die Fähigkeiten der Tierseele fast durchgehendes überschätzten.
So gewinnt auch das erste Dogma, dem unser Studium sich hingibt und das noch unbestrittenen Raum zur Ausbreitung in unserm Geist findet, uns so oft zu seinen Anhängern; darum übt das Gegenwärtige, bloss weil es ein solches ist, eine psychologische Kraft, die über seine objektive Bedeutung oft weit hinausreicht.
Denn das Sein oder die Wahrheit ist auch nur ein Verhältnisbegriff, d. h. die Majorität der mit einander zusammenhängenden und übereinstimmenden Bewusstseinsinhalte nennen wir Wahrheit, gegenüber der Minorität, und wiederholen damit im Individuellen das schon sonst ausgesprochene Verhältnis, dass Wahrheit die Vorstellung der Gattung, Irrtum aber die schlechthin individuelle Vorstellung wäre.
Wenn also die Enge des Bewusstseins es verhindert, dass sich neben eine sehr mächtige Vorstellung noch andere setzen, wenn an Stelle eines vollkommenen Weltbildes, an dem sich die Kraft, d. h. hier: die Wahrheit einer Vorstellung erst zu messen hätte, nur diese letztere allein unsern Geist ausfüllt, so ist sie eben für uns wahr, weil kein ihr überlegenes Kriterium vorhanden ist.
So wenig cogito ergo sum ein Schluss ist, der von einer vorher gesetzten Beziehung zwischen Denken und Sein abhängig wäre, so wenig stammt der Glaube an die Realität jedes Phantasmas, den wir auf den niedrigen Denkstufen finden, aus einem bewussten oder unbewussten Schlusse: cogitatur ergo est.
Da vielmehr die Zweiheit: Denken und Sein, noch gar nicht als solche aufgetaucht ist, so findet kein Prozess der psychologischen Überführung von jenem in dieses statt, sondern für den ganz unerfahrenen Geist ist das eine unmittelbar das andere, oder vielmehr keines von beiden, sondern der reine sachliche Inhalt der Vorstellung übt auch die psychologischen Wirkungen, die bei differenzierterem Vorstellen nur den mit dem Zeichen der Realität versehenen Inhalten zukommen.
Es werden ausschliesslich praktische Veranlassungen sein, die dann zwischen Denken und Sein scheiden lehren.
Wenn die Handlungsweisen, die von gewissen Vorstellungen ausgingen, den gehofften Erfolg nicht erzielten, so wird sich mit diesen Vorstellungen ein anderes Gefühl psychologisch assoziieren, als mit anderen, auf Grund deren man seine Zwecke erreichte.
Nicht die Kategorie eines Seins liegt zu Grunde, in welche auf solche Erfahrungen hin die Vorstellungen eingereiht oder von der sie ausgeschlossen würden; sondern begreiflicher erscheint der Vorgang so, dass sich auf Grund praktischer Erfahrungen von Täuschung und Befriedigung eine Differenzierung innerhalb der Vorstellungen bildet, deren einer Teil dann die Wirklichkeitsvorstellung, der andere blosse Idee genannt wird; oder vielmehr mangels der Klarheit darüber, dass im letzten Grunde ja auch die Wirklichkeit nur Vorstellung ist, heisst der eine Teil der Vorstellungen schliesslich das Sein schlechthin, der andere das Denken.
Das Sein ist freilich keine Eigenschaft der Dinge, denn damit sie überhaupt eine Eigenschaft zeigen können, müssen sie schon sein; dagegen kann man es als eine Eigenschaft der Vorstellungen bezeichnen; indem wir einer Vorstellung das Sein zusprechen, drücken wir damit das Vorhandensein gewisser Beziehungen derselben zu unserm Empfinden und Handeln aus.
Die Realität ist etwas, was zu den Vorstellungen psychologisch hinzukommt, aber nicht ursprünglich irgendwie an ihnen haftet; es ist erst Sache späterer Entscheidung, ob wir einer Vorstellung das Sein zusprechen oder sie als blosse, vielleicht irrende Vorstellung betrachten, während sie bei ihrem Auftauchen einen Indifferenzzustand zwischen beiden darstellt; der blosse Inhalt der Vorstellung, der zunächst das Bewusstsein füllt, lässt es noch zweifelhaft, unter welche von beiden Kategorien er gehöre.
Aber auch für den Geist, der über die Zweiheit derselben vollkommene Klarheit erreicht hat und gerade für ihn steht der sachliche Inhalt der auftauchenden Vorstellung noch immer am Scheidewege zwischen Sein und Nichtsein.
Sicherlich zwar ist die Hypothese falsch, nach der ein Schluss von der Wirkung auf die Ursache dazu gehörte, um von den blossen Bewusstseinstatsachen zur Vorstellung einer realen Welt zu kommen.
Das ist der alte Irrtum der Projektionslehre, der durch den richtig verstandenen Kant unmöglich gemacht sein sollte.
Es existiert nicht ein Raum ausserhalb unser, in den wir unsere Empfindungen hineinsetzen wie Möbel in ein Zimmer; sondern die Räumlichkeit der Dinge selbst ist gar nichts anderes, als ein Verhältnis von Vorstellungen untereinander, eine Ordnung der Empfindungen, die nicht ausserhalb ihrer existiert; einen Gegenstand anschauen, heisst Empfindungen in einer Art ordnen, die wir räumlich nennen.
Ebenso ist auch die Wirklichkeit nichts was ausserhalb der Vorstellungen derart existierte, dass diese nun erst in jene versetzt würden; sondern eine gewisse psychologische Qualität der Vorstellungen wird dadurch bezeichnet, dass wir diese wirkliche nennen - wenn sich diese Qualität auch erst im Laufe der Entwicklung des Vorstellungslebens einstellt; zusammenfassend könnte man sagen, dass die Räumlichkeit und die Wirklichkeit der Dinge nichts andres sind, als psychische Prozesse, die an dem Inhalt der Vorstellungen vor sich gehen.
Ebenso sicher aber ist es, dass es oft sehr mannigfaltiger Umstände und Kombinationen als psychologischer Vorbedingungen bedarf, um die verschiedenartigen Bestandteile der Vorstellungswelt in die Kategorie des Seins emporzuheben.
Nachdem die Scheidung zwischen Vorstellung und Wirklichkeit einmal vollzogen ist, hat die Gattungserfahrung aus der Summe der einzelnen Fälle die Merkmale der Scheidung festgestellt: bald durch direkten Augenschein, bald durch logische Überlegung, bald durch Ausschluss des Gegenteils, bald durch glaubensmässige Motive wird die auftauchende Vorstellung als reale oder irrende beurteilt; vielerlei Brücken führen in unserm jetzigen Vorstellen von der Gedankenwelt zu der Welt der Wirklichkeit, auf vielerlei Quellen kann der Gedanke sich zurückleiten, um aus ihnen das Prädikat der Realität zu schöpfen.
Zwar führen oft erst mannigfaltige Schlussreihen zu der Überzeugung, dass eine Vorstellung Realität besitzt; allein dies bedeutet nur, dass nun die Bedingungen zu jenem psychischen Zustand der Vorstellung gegeben sind, den wir Wirklichkeit nennen, und dass der innerliche Vorgang, der zu ihm führt, sich nun in dem verstandesmässigen Bewusstsein spiegelt, in dem er natürlich die diesem eigenen Formen, hier die des Schlusses, annimmt.
Die Beschaffenheit, weiche die Vorstellung durch die angeführten Merkmale erhält, ist unmittelbar ihre Realität; das Sein und das blosse Gedachtwerden einer Vorstellung sind so zu sagen nur verschiedene Zustände derselben, oder verschiedene Lokalzeichen, welche den gleichen Inhalt begleitend ihm verschiedene Stellen anweisen, von denen sich dennoch keine von der andern anders unterscheidet, als durch immanente psychologische Merkmale.
Auch in rein logischer Beziehung gewinnt die Sonderung des Inhalts der Vorstellung von der Frage nach ihrem Sein oder Nichtsein Bedeutung.
Wir weisen jedem Begriffe seinem sachlichen Inhalt nach eine Stelle zwischen über- und untergeordneten an, die er behält, gleichviel ob wir ihn oft oder selten realisiert finden; wir erkennen gesetzliche Beziehungen zwischen den Dingen an, deren Gültigkeit völlig unabhängig davon ist, wie oft oder ob überhaupt der Verlauf der Wirklichkeit die Bedingungen ihres Inkrafttretens darbietet; ja, alles über den einzelnen Fall hinausgehende Erkennen, betreffe es den logischen Schematismus oder die Naturgesetzlichkeit der Dinge, bezieht sich auf deren blossen Inhalt, in scharfer Abscheidung von der Frage, wann und wo dieser Inhalt die psychologische Form gewinnt, die wir Wirklichkeit nennen.
Dieses Fürsichbestehen der blossen Sachlichkeit der Vorstellung, die ihre Bestimmung nach Sein oder Nichtsein erst von ihrem weiteren psychologischen Schicksal erwartet, gibt auch noch anderen Bestimmungen als der der genannten scharfen Alternative Raum.
Auch der Wille als solcher ist in der Selbstbesinnung von jedem Inhalt abtrennbar.
Ich kann jeden Moment der Handlung, ein Stück Holz zu einem Pfeil zu schnitzen, völlig klar und lückenlos, aber bloss theoretisch denken; tritt das Bewusstsein hinzu, dass ich dies nun in Wirklichkeit ausführen will, so verändert sich dadurch im Inhalt der Vorstellung nicht das Geringste: sonst würde ich nicht eben dieses wollen.
Die bloss abstrakte Vorstellung meines Handelns unterscheidet sich nur durch ein Gefühl von der Beabsichtigung dieses Handelns, durch ein Gefühl, über dessen Eigenart wir in einem späteren Kapitel zu handeln haben.
So wenig sich hundert gedachte Taler inhaltlich von hundert wirklichen unterscheiden, so wenig auch von hundert, die durch meinen Willen wirklich werden sollen.
Das Wollen einer Sache ist gewissermassen ein mittlerer Zustand zwischen ihrem Nichtsein und ihrem Sein, wie es ein mittlerer zwischen Haben und Nichthaben ist; so wenig wir es weiter erklären können, was es denn bedeute, dass eine Vorstellung, die wir denken, ausserdem auch wirklich ist, wie dies vielmehr nur ein Gefühl ist, das, woraus auch immer entstanden, die Vorstellung begleitet: so wenig können wir mit Worten sagen, was das Wollen einer solchen Vorstellung eigentlich sei; auch dies ist nur eine gefühlsmässige Begleitung der Vorstellung.
In ganz derselben Weise ist das Hoffen ein Gefühl, welches den objektiven Inhalt von Vorstellungen begleitet, ebenso nun auch das Sollen; der ganz gleiche Inhalt erscheint uns einmal als wirklicher, ein andres Mal als gewollter, als erhoffter, als gesollter.
Das Sollen ist eine Kategorie, die zu der sachlichen Bedeutung der Vorstellung hinzutretend, ihr eine bestimmte Stelle für die Praxis anweist, wie sie eine solche auch durch die Begleitvorstellung des Seins, des Nichtseins, des Gewolltwerdens usw. erhält.
Ihrer Bedeutung nach zu beschreiben ist aber keine von diesen, wenn auch vielleicht die Bedingungen, gelegentlich derer sie sich entwickeln, und die Folgen, für deren Eintreten sie die Motive bilden; es sind Gefühle, die durch die Ausbildung und Notwendigkeiten des Lebens hervorgerufen, die reine Sachlichkeit des Vorstellens von Dingen und Geschehnissen begleiten, so zu sagen die gleiche Melodie immer in verschiedene Tonarten transponieren.
Man könnte sie sämtlich in eine phänomenologische Reihe eingliedern, welche von der Vorstellung des Nichtseins, des blossen Gedachtwerdens zu der der vollkommenen Wirklichkeit führt; das Wollen, das Hoffen, das Können, das Sollen - alles dies sind gewissermassen Zwischenzustände und Vermittlungen zwischen dem Nichtsein und dem Sein, die wir für denjenigen, der sie nie empfunden hätte, so wenig beschreiben könnten, wie wir zu sagen wissen, was denn das Sein oder das Denken eigentlich ist: es gibt keine Definition des Sollens.
Wie die gleiche Materie verschiedene Aggregatzustände annehmen kann, von dem der grössten Festigkeit bis zum gasförmigen und vielleicht dem noch darüber hinausliegenden strahlenden, so kann auch die gleiche Vorstellung ihren Inhalt gewissermassen in verschiedenen psychologischen Aggregatzuständen darstellen, von der vollkommenen Realität bis zur vollkommenen Idealität.
Das Sollen ist nur einer dieser Zustände; es betrifft Vorstellungen, denen wir das Sein noch absprechen, oder wenigstens in so weit nicht zusprechen, als sie eben bloss gesollt werden, und die dennoch nicht in der Gleichgültigkeit des Nichtseins verharren.
Es ist von jedem Inhalt vollkommen abtrennbar, denn sonst wäre die für jedes beliebige Tun anzustellende Überlegung, ob ich es soll oder nicht, eine Unmöglichkeit.
Das Sollen ist ein Denkmodus wie das Futurum und das Präteritum, oder wie der Konjunktiv und der Optativ; durch die Form des Imperativs hat die Sprache diesem Verhalten Ausdruck gegeben.
Auch findet die Bestimmung des Inhalts für das Sollen auf ganz so mannigfaltige Weise statt, wie für das Sein.
Wie durch all die oben angeführten Kriterien immer die eine Form des Seins den Vorstellungen zugesprochen wird, so verschieden sind auch die Mittel, auf Grund deren sie die Form des Sollens gewinnen: bald die Realität, bald die Nichtrealität, bald der Vorteil für einen Einzelnen, bald der für die Gesamtheit, bald der Befehl einer egoistischen Autorität, bald gerade die Entgegensetzung gegen einen solchen.
Und wie wir uns eine ganze Welt theoretisch vorstellen können, mit allen Gesetzen und Einzelheiten, und dann noch zu fragen haben, ob sie wirklich ist oder nicht, so können wir ebenso fragen, ob sie sein soll oder nicht.
Denn von Vielem sagen wir, dass es sein soll, was persönlich anzubefehlen sinnlos wäre; wenn Kant behauptet, der Natur gegenüber könne es kein Sollen geben, weil sie einfach den Gesetzen ihrer Wirklichkeit gehorcht und kein Ohr hat einen darüber hinausgehenden Imperativ zu vernehmen, so ist dies psychologisch nicht ganz richtig; auch von dem natürlichen Lauf der Dinge, an dessen Notwendigkeit wir nicht zweifeln, sagen wir oft genug, dass er hätte anders sein sollen.
Und zwar nicht nur im Vorblick, der uns noch keine Sicherheit des Verlaufs gewährt, sondern auch im Rückblick auf das schon Vollendete.
Wenn wir uns nicht scheuen, dem unausweichlich bestimmten Handeln der Menschen doch ein Sollen andern Inhalts gegenüber zu stellen, so sehe ich nicht, weshalb wir uns durch die nicht grössere Bestimmtheit der übrigen Natur brauchten verhindern zu lassen, auch für sie ein Sollen zu konstruieren.
Nur dass es unnütz ist, weil ganz allein an psychologischen Wesen das ausgesprochene Sollen seine Nützlichkeit ausüben kann, dürfte den Hinderungsgrund bilden.
Und gerade Kant, indem er die ungerechte Verteilung von Tugend und Glückseligkeit in der wirklichen Welt als etwas ganz Unerträgliches hervorhebt, empfindet das angemessene Verhältnis, nach dem der Gute seinen Lohn und der Böse seine Strafe erhält, als ein Sollen, das der Natur gegenüber gilt und dem sie dann auch in einer jenseitigen Welt nachkommt.
Der Imperativ ist nur ein einzelner Fall des Sollens oder vielmehr ein Mittel, durch welches das Sollen in das Sein übergeführt wird.
Aus diesem erkenntnistheoretischen Charakter des Sollens ergibt sich zunächst die Vergeblichkeit aller Versuche, aus dem Begriffe desselben heraus einen bestimmten Inhalt seiner zu gewinnen.
Sobald wir erkennen, dass das Sollen nur eine der Formen ist, welche der rein sachliche ideelle Inhalt der Vorstellungen annehmen kann, um eine praktische Welt zu bilden, ist klar, dass wir ihm von vornherein keine stärkere innerliche Beziehung zu dem einen als zu dem andern Inhalt zusprechen können.
Darum hat Kant schon zu viel getan, als er die, wenn auch noch so allgemeine Formel des kategorischen Imperativs aus dem Begriff des Sollens überhaupt heraus deduzierte.
Er begeht damit einen ontologischen Irrtum, nicht geringer als der, den er am Begriffe des Seins so schlagend gerügt hatte.
Weder lässt sich aus dem Begriffe eines Dinges erkennen, ob es ist oder nicht, noch aus dem Begriffe des Seins, dass es irgend einem besonderen Inhalt zukommen müsse; und eben so wenig gibt uns irgend ein Geschehen seinem Begriffe nach eine Anweisung darauf, dass das Sollen mit ihm verbunden sein müsse, noch das Sollen, dass es irgend einen bestimmten Inhalt sich aneigne.
Wollen wir uns über das Sollen klar werden, so müssen wir es scharf von denjenigen Inhalten sondern, mit denen es durch die unantastbare Heiligkeit derselben und durch lange Gewöhnung psychologisch so eng assoziiert ist, dass eines unmittelbar das andre reproduziert; die Vorstellung gewisser Handlungsweisen erscheint uns unabtrennbar von dem Sollen, das ihre Verwirklichung entweder gebietet oder verbietet, und ebenso scheint es leicht undenkbar, dass das Sollen begrifflich von gewissen wenigstens allgemeinsten Inhalten ablösbar wäre.
Erst wenn wir uns klar werden, dass unser ganzes Vorstellen aus zwei Elementen besteht: einerseits dem sachlichen ideellen Inhalt, dem Was der Dinge, andrerseits den Gefühlen, die diesen Inhalt begleitend ihm eine positive, negative oder Übergangsbeziehung zur Realität geben - erst dann ist die Grundlage da, auf der sich eine reine Betrachtung des Sollens erheben kann.
Dass das Sollen freilich in diese Reihe gehöre, dass sein Begriff noch keine Spur eines Inhaltes, sei er sozialer, individualistischer, eudämonistischer, pessimistischer Art einschliesst, dass es nur so zu sagen ein gefühlter Spannungszustand von Inhalten ist, der wie das Können, das Sein, das Wünschen eine Art ihres Verhältnisses zur Wirklichkeit ausdrückt, das ist so wenig exakt und unwiderleglich auszumachen, wie überhaupt die Bedeutung psychologischer Begriffe, für die man nur an die Selbstbesinnung apellieren kann, deren Ergebnisse schliesslich von der der logischen Deduktion entzogenen Subjektivität abhängen.
In solchen begrifflichen und zugleich auf ein Gefühl zurückweisenden Erörterungen gibt es nur Indizienbeweise und der Forscher darf sich kaum ein höheres Ziel stecken, als denjenigen Geistern, die das Material und die Disposition zu der gleichen Erkenntnis latent in sich tragen, zu deutlicherem Bewusstsein darüber zu verhelfen.
Wir haben oben ausgemacht, dass es kein verstandesmässiger Schluss ist, der uns ursprünglich von den Empfindungen, die gewisse Inhalte begleiten, zu der Vorstellung von deren Wirklichkeit führt; vielmehr ist dies unmittelbar ihr reales Sein; Wirklichkeit einer Sache ist nichts andres als der Name für einen bestimmten psychologischen Charakter ihrer Vorstellung und aller verstandesmässige, logische Beweis, dass eine Vorstellung Wirklichkeit ist, bedeutet nur das Herbeiführen oder das Bewusstwerden der Vorbedingungen für das Eintreten jener psychologischen Verfassung der Vorstellung, die wir Wirklichkeit nennen.
Zudem kann der Beweis, dass etwas ist, immer nur geführt werden, wenn eine andre Vorstellung schon als wirklich gesetzt wird und nun die gleichen inneren Bedingungen, die diese charakterisieren, an dem anderen erkannt werden, sei es direkt oder durch Übertragung oder durch Analogie; denn das Sein überhaupt kann nicht bewiesen, sondern nur erlebt und gefühlt werden, und darum lässt es sich nie aus blossen Begriffen deduzieren, sondern nur aus solchen, in welche irgendwo das Sein schon aufgenommen ist.
Das Sollen verhält sich in gleicher Weise.
Dass wir etwas sollen, lässt sich, wenn es logisch erwiesen werden soll, immer nur durch Zurückführung auf ein andres als sicher vorausgesetztes Sollen erweisen; an sich betrachtet ist es eine Urtatsache, über die wir vielleicht psychologisch, aber nicht mehr logisch hinausfragen können.
Kein Schluss könnte uns lehren, dass wir etwas sollen, wenn wir dieses Sollen nicht wenigstens anderweitig empfunden hätten; er lehrt es uns, wenn nun die Bedingungen des damaligen Empfindens an dem jetzigen Falle so aufgezeigt und zu Bewusstsein gebracht werden, dass die gleiche Gefühlsfolge sich einstellt; und dieses eintretende Gefühl ist nun nicht etwa ein solches, aus dem erst geschlossen würde: also soll ich dies und jenes - sondern es ist unmittelbar das Gesolltwerden der Vorstellung selbst.
Ist so das Sollen eine ursprüngliche Kategorie wie das Sein und das Vorstellen und nimmt es an der ganzen Unerklärlichkeit dieser letzten Tatsachen Teil, so verdeutlichen sich von hier aus die verschiedenen Erscheinungen, die mit der Unbegründbarkeit der Moral zusammenhängen.
Alle Versuche, die Vielheit der Inhalte des Sollens auf ein einheitliches Prinzip zurückzuführen, mögen im günstigsten Falle nachweisen können, dass unter der Voraussetzung jener höchsten und allgemeinsten Pflicht sich die Verpflichtung zu den einzelnen Handlungen logisch und psychologisch erklärt; umgekehrt mögen diese Handlungen auf jenes Prinzip dadurch hinweisen, dass ihre Mannigfaltigkeit keiner andern Gleichheit Raum gibt, als einerseits dem formalen Charakter des Sollens, andrerseits der gemeinsamen Zweckbeziehung, so dass die Zusammengehörigkeit dieser beiden nahe gelegt wird.
Dass sie aber zusammen gehören, dass jener höchste Gedanke, sei er die Glückseligkeit der Gesamtheit, oder der Wille Gottes, oder die Ausbildung der Individualität, oder die Rationalität der Handlungen - dass dieser gesollt wird, ist und bleibt unbewiesen.
Immer nur ein Inhalt des Sollens kann auf einen andern zurückgeführt werden, aber an irgend einem bleibt es schliesslich als an dem ursprünglichen haften, von ihm entlehnen alle andern die Würde des Sollens, ohne dass er selbst sie von einer andern Instanz herleitete.
Identifizieren wir das Sollen mit irgend einem Inhalt und sei es selbst nur der des kategorischen Imperativs, so nimmt dieser an der ganzen Unbegründbarkeit teil, die dem Sollen selbst eigen ist.
Wenn der Metaphysiker eine letzte Substanz aufgefunden hat, aus deren Wesen sich alle Erscheinungen des Kosmos folgern lassen; wenn wir eine ursprünglichste Summe der Kraft entdeckt haben, die die Quelle für alle aufzeigbaren Kraftwirkungen im Weltgeschehen bildet: so können wir weder fragen woraus sich das Wesen jener Substanz erklären lässt noch was die Ursache dieser Kraft sei, ohne unsre eben gewonnene Erkenntnis selbst wieder in Frage zu stellen.
Und ganz ebenso können wir nicht fragen, woher der letzte gesollte Inhalt, auf den wir kommen, sein Sollen begründen könne.
Auch operiert alle Zurückführung der sittlichen Mannigfaltigkeit auf ein letztes Prinzip nicht eigentlich mit dem Sollen; sie schiebt es vielmehr von einem Inhalt auf den andern, indem sie nachweist, dass die einzelne Pflicht ihr Sollen nicht in sich, sondern von jenem tiefsten zu Lehen trägt, zu dem sie im Verhältnis des Mittels steht.
Nicht dass irgend eine bestimmte Handlung, z. B. Fürsorge für die Familie, an sich Pflicht sei, beweist der monistische Ethiker, z. B. der Utilitarier; sondern nur dies, dass jene Handlung das Glück der Gesamtheit steigern helfe und sein soll, weil diese Glückssteigerung sein soll; das Gesolltwerden dieser aber lässt sich nirgendwo herleiten, sondern nur als Tatsache oder als Dogma aussprechen.
Das Sollen begleitet die ganze Reihe von Ursachen und Wirkungen, die etwa von dem Geldverdienst für die Familie bis zur Glückssteigerung für die Allgemeinheit oder zur Erfüllung der kantischen Formel oder zur Realisierung einer Herbartschen Idee führt, ohne in ihr selbst eine Erklärung zu finden.
Jedes Glied vielmehr erklärt sein Sollen aus dem Gesolltwerden des folgenden, und wo wir an dasjenige kommen, welches das Sollen nicht wieder von sich abwälzen, seine Dignität nicht mehr von einem andern herleiten kann, da bricht die Reihe ab und lässt es an diesem genau so unerklärt, wie es an dem ersten war: das Letzte, das wir erklären können, ist das Vorletzte.
Die Hauptfrage, weshalb denn die einzelne Tat gesollt wird, ist auf diese Weise nicht gelöst, sondern nur zurückgeschoben.
So schiebt jeder höhere mathematische Satz die Forderung seine Wahrheit zu beweisen auf einen vorhergehenden einfacheren, und dieser wieder weiter bis zurück zu den Axiomen, von denen alle andern ihre Wahrheit borgen und mit deren unbeweisbarer Gültigkeit sie stehen und fallen.
So kann auch das Recht den Beweis für die Gerechtigkeit seiner höheren Bestimmungen nur so führen, dass es dieselben als logische Folge gewisser letzter Prinzipien aufzeigt, die einfach als Recht hingenommen, aber nicht bewiesen werden können.
Liesse sich ein Inhalt finden, dessen Erfüllung unmittelbar mit Sittlichkeit zusammenfällt, so wäre die Frage, weshalb wir ihn denn erfüllen sollen, allerdings sinnlos; denn sie hiesse dann nur: weshalb sollen wir überhaupt sittlich sein? Diese aber können wir nicht stellen, weil sittlich sein ja nichts anderes bedeutet, als tun was wir tun sollen, so dass sie nur fragte: weshalb sollen wir tun was wir tun sollen? Oft genug freilich ist der Skeptizismus auch zu ihr vorgeschritten; oft genug hat man gefragt, worauf denn das Gebot sich gründe, das der Sittlichkeit den Vorzug des Seinsollenden vor der Unsittlichkeit gibt.
Wo so gefragt wurde, war es immer schon ein bestimmter Inhalt der Sittlichkeit, der subintelligiert und in seiner Berechtigung ein Sollen darzustellen angezweifelt wurde, eine bestimmte Handlungsweise, die selbstverständlich als mit dem Begriff der Sittlichkeit synonym vorausgesetzt wurde.
Dass wir niemanden beschädigen, uns keinen unrechtmässigen Vorteil verschaffen, unseren Mitmenschen so viel wie möglich nützen sollen - das scheint der stets sich gleichbleibende Inhalt der Sittlichkeit zu sein, und immer hat man diese materialen Pflichtgebote vor Augen gehabt, wenn man nach der Begründung des sittlichen Sollens überhaupt fragte.
In dieser Beschränkung ist die Frage auch stets berechtigt, wenn sie einerseits von der Erfahrung ausgeht, dass bis jetzt kein einziges materiales Pflichtgebot dem sittlichen Bewusstsein der Menschheit immer und unbedingt entsprochen habe, andrerseits von der Überlegung, dass das Sollen, welches an diesem höchsten Inhalt haftet, unbegründet und unbegründbar ist.
Löst man aber diese enge psychologische Verbindung, die dem Sollen sogleich einen bestimmten Inhalt unterlegt, und fragt, weshalb das Seinsollende als solches einen Vorzug vor dem Nichtseinsollenden hat, so behandelt man einen analytischen Satz wie einen synthetischen: das Seinsollen bedeutet ja nichts andres, als einen solchen Vorzug, beides sind nur verschiedene Ausdrücke für eine und dieselbe Qualität von Handlungsweisen, und jene Frage ist ebenso leer wie die, weshalb A denn wirklich A ist; denn wenn der Begriff des Sittlichen einmal da ist, so kann er schon an und für sich nur bedeuten, dass wir ihm nachleben sollen.
Wir könnten deshalb vielleicht fragen, weshalb wir sittlich sind, keinesfalls aber, weshalb wir es sein sollen.
Wenn schon der Moralphilosoph das Sollen nicht erklären, sondern nur unter Voraussetzung seines Haftens an einem letzten Inhalt es auf andre Inhalte überleiten kann, so reisst die Kette der Erklärungsgründe dem praktischen Moralbewusstsein natürlich noch früher ab; die logische Grundlosigkeit des Sollens überhaupt spiegelt sich in der psychologischen Grundlosigkeit seiner einzelnen Inhalte.
Bedeutsame und unbedingte, aber auch schon niedrigere sittliche Vorschriften beruhen auf so langer Vererbung, dass die Reihe der Erfahrungen und Überlegungen, die einst zu ihnen hinführte, immer mehr verdichtet wurde und schliesslich nur noch ihr Resultat dem Bewusstsein übrig blieb; wie der Kulturmensch eine Fülle von Einrichtungen und Produkten jeder Art benutzt, ohne sich darum zu kümmern oder auch nur immer verstehen zu können, wie sie hergestellt seien, so hält sich sein sittliches Leben an Vorschriften, deren Ursprung ihm gleichgültig, unauffindbar oder unverständlich ist.
Die arbeitssparende Tendenz organischer Entwicklung entlastet das Bewusstsein von der Vorstellung der Gründe einer Sittenregel, sobald diese selbst durch Vererbung und Überlieferung fest genug geworden ist.
Die Würde, welche die einzelne materiale Vorschrift durch Beziehung auf tiefere und weitere Zwecke erhielt, bleibt als selbständige Tatsache bestehen, wenn jene Beziehungen auch längst verdunkelt und vergessen sind.
Aber es ist gleichsam nicht nur die Länge, sondern auch die Breite der Beziehungen, die auf diesen Erfolg hinwirkt; nicht nur so lange vererbt sind die Gründe einer Sittenregel, dass sie durch Verdichtung ihren Raum im Bewusstsein verlieren, sondern auch so weit verzweigt, so mannigfaltig, in so viele Gebiete eingreifend, dass sie sich für das Bewusstsein des Einzelnen wie der Gattung gegenseitig verdunkeln und paralysieren.
Bedenkt man, dass es doch durchgehend die soziale Wirkung einer Handlungsweise ist, von der ihre sittliche Schätzung irgendwie ausgeht, dass diese Wirkung sich auf die umfänglichsten, kompliziertesten, oft gegensätzlichen Interessenkreise zu erstrecken und mit ihnen sich auseinander zu setzen hat, so begreift man, dass in dieser Fülle der ins Bewusstsein drängenden Gesichtspunkte einer dem andern den Raum darin streitig macht.
Die Zweckmässigkeit unserer sittlichen Normen stellt sich aus dem Kampf unzähliger Interessen, dem Kompromiss unzähliger Ansprüche, dem Gestaltet- und Umgestaltetwerden durch unzählige Kräfte her; in keinem Bewusstsein kann jede Phase und jedes wirkende Moment dieser Entwicklung haften, sondern wie es überall zu keinem bestimmten Vorstellen kommt, wo das Bewusstsein sich an eine zu grosse Anzahl von Vorstellungen verteilen muss, oder wo der Schwingungsradius zwischen diesen ein allzuweiter ist, so drücken sich die Gründe selbst für eine einfachere Sittenregel durch ihre Fülle gegenseitig unter die Schwelle des Bewusstseins herab und bringen eben dadurch den Anschein der Grundlosigkeit hervor.
Ja, gerade wie im Denken das Einfachste das Letzte ist, so im Sittlichen; denn je mehr Interessen in ihm zusammen strömen, desto allgemeiner muss es sein.
Daher zeigen die letzten Imperative hochstehender Menschen eine gewisse Einfachheit, die zwar nicht den Konflikt ausschliesst, aber sich charakteristisch von den krausen und komplizierten Imperativen abhebt, an denen das sittliche Bewusstsein unkultivierter Völker - besonders im Religiös-Sittlichen - Halt macht.
Diese Unerklärtheit des Sollens, mag sie nun seinen abstrakten Begriff, oder seine höchste prinzipielle Ausgestaltung, oder seine einzelnen und konkreten Inhalte betreffen, trägt zweifellos zu seiner Würde und psychologischen Kraft erheblich bei.
Je dunkler und unverständlicher der Ursprung und die Berechtigung einer ethischen Norm ist, um so viel heiliger pflegt sie zu gelten, wozu der angeführte Gesichtspunkt von der Fülle der unbewussten Motive mitwirken mag.
Wie dieselben objektiv und für die Gattung die Norm zustande bringen, so veranlassen sie subjektiv den Einzelnen zu deren Erfüllung; und je massenhafter und mannigfaltiger nun innerliche Triebe und Gründe uns bewegen, desto lebhafter und tiefer wird unser Gefühlsleben überhaupt erregt.
Jene alte Lehre, die das Gefühl mit einer Fülle von Vorstellungen, deren keine für sich zu klarem Bewusstsein zureicht, identifizieren wollte, hatte psychologisch wenigstens so weit recht, als die Einfachheit und Deutlichkeit der Gedanken und Motive im umgekehrten Verhältnis zu der Stärke des begleitenden Gefühles zu stehen pflegt.
Darum erklärt sich gerade aus dem sozialen Charakter des sittlichen Sollens und der Unzählbarkeit der Fäden, die in ihm zusammenlaufen, das starke und dunkle Gefühl, von dem es begleitet wird.
Wenn allgemeine Erfahrung ein gutes Gewissen das beste Ruhekissen nennt und, über diesen negativen Ausdruck hinaus, die Erfüllung der Pflicht vielfach ein beseligenderes Gefühl bereitet, als alles abseits ihrer liegende Tun, so ist auch diese Gefühlsseite des Sollens aus seinen sozialen Zusammenhängen erklärlich.
Denn wenn es die Interessen einer Allgemeinheit gegenüber denen des Einzelnen sind, die vom Sollen gewahrt werden, so wird der Einzelne in solchen Augenblicken gewissermassen über sein Ich hinausgehoben, die Allgemeinheit stellt sich in ihm dar, erweitert ihn um ihren eignen Umfang.
Durch die Selbstvergessenheit der Pflichterfüllung wird in dem ich Platz für die Interessen der Allgemeinheit, die sich freilich in höheren Kulturverhältnissen oft als Pflichten ganz individueller Art, von Mensch zu Mensch und aus persönlichsten Verhältnissen entsprungen, darstellen; durch diese hindurch wirkt indes offenbar, für das Gefühl noch hinreichend, die Summe gattungsmässiger Interessen und Antriebe, um jene Erhöhung und Erweiterung des Gefühles gelegentlich der Pflichterfüllung hervorzubringen, die vom rein individualistischen Gesichtspunkt völlig rätselhaft ist.
Aus der Geschichte des Individuums ist die Stärke der Gefühlsreflexe nicht erklärbar, die sich an die sittliche Tat heften, und deshalb ist es begreiflich, dass man um dieser Erklärung willen an metaphysische Instanzen appellierte; wie überhaupt die tiefe und dunkle Macht von Gefühlserregungen, die zu mystischen Vorstellungen veranlasst, meistens mit ihrer Herleitung aus sozialen Verhältnissen, aus der Beeinflussung des Individuums durch die Allgemeinheit verständlich werden dürfte.
Denn in der sozialen Gruppe fliessen unzählige Quellen, die auf den Einzelnen durch Vererbung, Tradition, Beispiel einwirken, die ihn gestalten, erschüttern, erheben; aber das gewöhnliche Bewusstsein verfolgt diese Vorgänge nicht bis an ihre wahre Quelle, aus der sich ihre psychologische Eigenheit zulänglich erklärte, sondern genügt seinem Kausalbedürfniss durch Erdichtung einer veranlassenden transzendenten Kraft.
Jene überwältigenden und überraschenden Gefühlsfolgen erklären sich daraus, dass der Einzelne in solchen Augenblicken die Erbschaft der Gattung antritt, deren Wirkung eben jene Plötzlichkeit, jenes Geben von Vielem mit einem Schlage aufweist, wodurch sich das Erben vom Erwerben unterscheidet.
Es ist immer hervorgehoben worden, welches erhebende Gefühl ein Arnold von Winkelried in dem Augenblick gehabt haben müsse, wo er der Freiheit eine Gasse brach, indem er die feindlichen Lanzen in seiner Brust begrub.
Hat ein solches Hochgefühl einen so Handelnden wirklich erfüllt, so bestand es aus der Erweiterung seiner Persönlichkeit um das soziale Ganze, dem er dadurch zum Siege verhalf.
Tieferen Einblick gewinnen wir noch von der Erkenntnis aus, dass die soziale Gruppe im Allgemeinen dasjenige als Pflicht vom Einzelnen fordert, was mehr oder minder tatsächlich und von jeher in ihr geübt wird, weil es die Bedingung ihrer Selbsterhaltung ist; und dass, dieses Moment noch steigernd, solche Handlungsweisen, die heute als besondere sittliche Pflicht gelten, lange Zeit hindurch einfach selbstverständlich geübt wurden: die Hingabe von Gut und Blut für das Ganze, die Unterordnung unter die höheren Stufen der sozialen Leiter, der Verzicht auf individuell-egoistisches Handeln gegenüber den gemeinsamen Aktionen - dies alles sind Charakterzüge, die bei dem Zustande der Homogenität und Undifferenziertheit der sozialen Gruppe sich ganz von selbst verstehen und mit dem höheren Herausarbeiten der Einzelpersönlichkeit zu verschwinden beginnen, um dann erst auf dem Wege bewusster Sittlichkeit wieder gewonnen zu werden.
Lange genug indes walteten jene Zustände des Kommunismus und der Gruppensolidarität, um als dunkle Triebe und Instinkte vererbt zu werden.
Und diese offenbar sind es, die bei der Erfüllung des sittlichen Sollens in uns zur Befriedigung kommen.
Immer sind es wirkliche, historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden; deshalb äussern sich auf niederem Gebiet im Kinde höchst lebhafte Triebe nicht nur nach solchen Betätigungen, die auch im Erwachsenen den Charakter des Verlangens tragen, wie Essen und Trinken, sondern auch nach solchen, die für diesen einfach tatsächliche, oft keineswegs lustvolle Ausübungen sind: Sprechen, Laufen, Aufnehmen von Sinnesempfindungen usw. Entsprechend befriedigen sich mit der Ausübung jener Inhalte des gesellschaftlichen Lebens die altererbten, in den tiefsten Tiefen des Bewusstseins lagernden Sozialinstinkte.
Daher die Zufriedenheit, die Meeresstille der Seele, die uns nach den sittlichen Handlungen überkommt, das Gefühl vollkommenen Sichauslebens und tiefster Ruhe.
Die überwiegende und bindende Kraft, welche die Idee der Allgemeinheit gegenüber der Vorstellung einzelner und enger umschriebener Interessen hat, stammt wenigstens zum Teil sicherlich aus der psychologischen Unklarheit und Verschwommenheit, die vermöge der Fülle der hineinragenden Einzelvorstellungen und Beziehungen jene Vorstellung begleiten.
Je massenhafter, mannigfaltiger und verschlungener die Teilvorstellungen einer Vorstellung sind, desto eher tritt bei ihr jene phantastische Verklärung, jene reizvolle und ahnungsreiche Verschwommenheit ein, welche auch das körperliche und geistige Überblicken grosser Raum- und Zeitmasse charakterisiert.
Wo wir nicht mehr Einzelnes in seiner Bestimmtheit unterscheiden können, fängt sofort der Optimismus unsrer Natur zu wirken an, der alles Undeutliche, Unbekannte, Unbegrenzte zu idealisieren pflegt.
Da nun Sittlichkeit in dem Verhältnis zur Allgemeinheit besteht, aus ihm wenigstens ihren noch stets unbewusst fortwirkenden Ursprung herleitet, so wird auch die Stärke und Unklarheit der Begeisterung für das Sittliche überhaupt zum Teil aus der Massenhaftigkeit der in ihm verdichteten Beziehungen stammen.
Nicht trotzdem wir die Einzelnen nicht kennen, die in unsre Begeisterung für die Allgemeinheit eingeschlossen sind, sondern grade weil wir sie nicht kennen, entsteht die charakteristische Kraft dieser Begeisterung, dieser Vorstellung einer Pflicht, die alles Individuelle und bestimmt Begrenzte überragt.
Dem Zusammenhang zwischen dem Quantum gleichzeitig andrängender Vorstellungen und dem begleitenden Gefühle mag unsre Überlegung zu ihrer Bestätigung noch auf einem andern Gebiet nachgehen.
Wenn wir das künstlerisch Befriedigende, das Wesen der ästhetischen Forderung in der Darstellung des Typischen, Generellen, Allgemeingültigen erblicken, so scheint mir der Reiz davon gerade in der Fülle der in einander verschwimmenden Vorstellungen zu liegen, welche die Allgemeinvorstellung gleichsam als ihren Indifferenzpunkt umspielen; die Undeutlichkeit der unzähligen Einzelvorstellungen, die von der typischen Vorstellung auf eine gewisse niedere Bewusstseinsstufe gehoben werden, bringt die Anregung der Phantasie mit sich, in der jedenfalls ein grosser Teil des eigentlich ästhetischen Genusses beruht.
Wie die organische Entwicklung auf ein Maximum von Leben geht, so geht - in tiefem Zusammenhänge damit, da der Geist jedenfalls die höchste und konzentrierteste Lebensform darstellt - die psychische auf ein Maximum von Vorstellungen, das vermittelst der Verdichtung in typischen Vorstellungen erreicht wird.
Das Mass, bis zu welchem die Verallgemeinerung gehen darf, um noch diese Wirkung hervorzubringen, wird durch die Tatsache bestimmt, dass bei einer allzugrossen Fülle der gehobenen Vorstellungen jeder einzelnen ein zu geringes Mass von Bewusstsein zu Teil wird, um noch einen psychischen Wert zu haben; daher die Interesselosigkeit und das Gefühl der Leere gegenüber allzu allgemeinen, schematischen Darstellungen in der Kunst.
Auch das ethische Interesse hat eine gewisse Grenze für die Grösse der von ihm umfassten Allgemeinheit, wenn es nicht an Kraft verlieren soll.
- Ein ähnliches psychologisches Verhalten wie zu der Gesamtheit pflegt sich auch der Idee der Persönlichkeit gegenüber einzustellen und deren Wert über jede angebbare Eigenschaft hinaus an das Ganze derselben zu heften; durch den Reichtum der mannigfaltigen in diesem Ganzen zusammentreffenden Einzelheiten erregt dasselbe ein Gefühl, das die kausale Beziehung zu irgend einer einzelnen Qualität der Person oft ausdrücklich von sich ablehnt.
Es lässt sich beobachten, dass stolze Naturen sich nichts aus ihnen entgegengebrachten Gefühlen machen, wenn sie dieselben auf bestimmte einzelne Vorzüge ihrer zurückführen können; sie wollen nicht auf diese oder jene Gründe hin - und seien sie noch so umfassend und tief - sondern überhaupt und als ganze Persönlichkeit geliebt und geschätzt werden; tatsächlich pflegen auch die leidenschaftlichsten Neigungen grade die zu sein, die sich durch keine einzelne Eigenschaft der Person erklären lassen.
Der Vergleichungspunkt mit dem Gefühl für die Allgemeinheit liegt darin, dass auch hier die psychologischen Faktoren, die das Gefühl begründen, wegen ihrer Fülle und Verzweigtheit im Unbewussten bleibend, sich als Grundlosigkeit darstellen, und dass der Wert und die Kraft, die dieser Fülle zukommen, sich deshalb auf die anscheinende Grundlosigkeit übertragen und als deren Folge gelten.
Die relative Schnelligkeit im Wechsel der geistigen Vorgänge, die Fähigkeit des Geistes, die Formen seines Inhalts zu konservieren, während dieser letztere selbst wechselt, ebenso wie umgekehrt den gleichen Inhalt unter verschiedenen Formen zu bewahren, begünstigt das Rudimentärwerden seiner Gebilde.
Und nun ist zu bemerken, dass grade solche äusserlichen Vorschriften, deren Gründe vollkommen ins Unbewusste gesunken sind, mit der unausweichlichsten Gewalt wirken: Ritualgesetze, Umgangsformen, Sitten, deren Sinn längst durch veränderte Lebensbedingungen hinfällig geworden und die nur noch als Überlebsel einer nicht mehr angebbaren Zweckmässigkeit fortbestehen.
Und während im Physiologischen die Rudimente ganz besonders veränderliche Teile sind, weil weder Gebrauch noch Zuchtwahl auf ihre Erhaltung in bestimmten Formen hinwirken, ist im Geistigen oft das Gegenteil zu beobachten; gerade das Nicht-Nützliche, dasjenige, dessen eigentlicher Sinn von ihm abgelöst oder verdunkelt ist, nimmt die Dauerformen der Sitte und des Vorurteils an.
Grade weil es der Berührung mit dem Flusse lebendiger Entwicklung entzogen ist, gewinnt es besondere Festigkeit und jenen dämonischen Reiz des Dogmatischen, für das der Verstand keinen Grund kennt, aber einen um so tieferen und mystischeren annimmt.
Was durch Gründe gestützt ist, kann durch Gründe zu Fall gebracht werden, es ist, im älteren Sinne des Wortes, zufällig.
Was dagegen die verstandesmässige Begründung abgestreift hat und dennoch Macht über uns besitzt, die ethische causa sui, gewinnt den Charakter des Absoluten; was keine Stützen hat und braucht, dem können keine fortgezogen werden.
Hier liegt eine der tiefsten Analogien des religiösen mit dem sozial-sittlichen Verhalten.
Was der Frömmigkeit den besonders sittlichen Charakter gibt, ist das Handeln "um Gotteswillen"; wie wir der Allgemeinheit gegenüber nur um ihrer selbst willen pflichtvoll handeln, ohne einen darüber hinausgehenden Grund dazu im Bewusstsein zu haben, so wird durch jene religiöse Gesinnung die teleologische Kette an einem nur durch sich selbst gerechtfertigten Gliede abgeschnitten; das Bezeichnende des sittlichen Handelns: keinen Grund zu haben, ist hier der Form nach vollkommen vorhanden.
Es ist eine Art ethischer Ontologie: wie aus dem Begriff Gottes ohne alles Weitere seine Existenz folgen soll, ebenso die Pflicht ihn zu lieben und seine Gebote zu erfüllen.
Schon in den Sentenzen Isidors und bei Gregor von Nyssa wird es ausgesprochen, dass die sittlichen Vorschriften nicht um einstiger Belohnung oder Bestrafung willen erfüllt werden sollen, sondern einzig und allein um der Liebe Gottes willen, welche letzter, keiner Rechtfertigung weiter bedürftiger Beweggrund ist.
Übrigens war von da aus der Übergang zu dem Ideal, die Tugend um ihrer selbst willen zu lieben, leicht, den Isidor schon andeutet und Chrysostomus vollzieht.
Es ist nur das ganz entsprechende Gegenstück dazu, wenn Abälard meint, dass der Schmerz über die Sünde kein Motiv weiter habe, dass der Gedanke an Lohn und Strafe die Reue verfälsche und diese schlechthin nur sich selber zum Gegenstand habe.
Der Pflicht überhaupt nun gibt dies ihren unbedingten Charakter, dass sie Mittel zu einem Zweck ist, während diejenige Bedingtheit, die das Mittel sonst durch den darüberstehenden Zweck erhält, vermöge der Verdunklung dieses letzteren wegfällt.
Wenn eine Handlungsweise unter einer gegebenen Bedingung notwendig ist, so muss sie den Charakter schlechthin unbedingter Notwendigkeit dann annehmen, wenn jene Bedingung nicht mehr ins Bewusstsein tritt.
Dieser auch an anderen als ethischen Überzeugungen sich vollziehende Prozess wird häufig durch eine Persönlichkeit vermittelt, die als eine Autorität auftritt, über welche nicht weiter hinausgefragt wird.
Viele Prinzipien würden ihre Anhängerschaft und ihre Gemeinde nicht gewinnen, wenn sie nicht durch eine Persönlichkeit geschaffen wären, an die sich der Glaube anschliessen kann; denn diesen zu gewinnen, reicht die abstrakte Vorstellung der Gründe nicht häufig aus; woher es denn kommen kann, dass die Apostel einer Lehre sie rückhalt- und vorbehaltloser und für sicherer annehmen, als der Schöpfer derselben, der dem Objekte unmittelbar gegenübersteht.
Wer nicht tiefer hinabsteigt als bis zu dem einmal gewonnenen Dogma, findet an diesem einen festeren und unfraglicheren Boden, als wer das Dogma selbst auf der Wirklichkeit der Dinge begründen will.
Der Glaube an eine Person als die höchste Instanz, von der es keine Appellation mehr gibt, ist so einerseits die Brücke, über die hinweg gewisse, eigentlich von höheren Prinzipien abzuleitende Lehren ihre Festigkeit entlehnen - eine Festigkeit, die grösser ist als etwa jene höchsten, aber von dein Lehrer nicht ausgesprochenen Prinzipien sie für den Gläubigen besitzen; andererseits ist dieser Vorgang nur die personale Wendung oder eine Analogie des psychologischen Ereignisses, das dem abgeleiteten Imperativ oft eine unfraglichere Würde verschafft als dem höchsten Prinzip, auf das er logisch hinweist.
Wenn gewisse materiale Handlungsweisen für unser Bewusstsein sittliche Verpflichtung mit sich führen, so gründet sich diese rationaler Weise auf ein allgemeines regulatives Prinzip als Obersatz, zu dem die gegebene Lage als Untersatz tritt, damit die Pflicht in dieser als Folge der Verpflichtung durch jenes höchste Gesetz hervorgehe.
Aber eben dieses höchste Gesetz steht uns oft lange nicht so fest, wie das davon Abgeleitete.
Die Wirkung jenes Prinzips ist sicherer als es selbst ist, das Gebäude fester als seine Fundamente.
So machen sich viele Leute nichts daraus, den Staat unmittelbar zu betrügen, z. B. durch Steuerhinterziehung, während sie davor zurückbeben würden, einen Einzelnen zu betrügen oder falsches Geld zu machen, ein Verbrechen, das doch ein solches nur durch viel mittelbarere Rücksicht auf die ökonomischen Verhältnisse des Staates ist, als jenes.
Der Gedanke, die Glückssumme auf Erden zu vermehren, dürfte von Vielen kühl oder gar skeptisch betrachtet werden, die ein konkreter, dieser Glücksmehrung dienender Fall in den zweifelfreisten sittlichen Enthusiasmus versetzt.
Tatsächlich kennen wir keine reale oder moralische Notwendigkeit eines Geschehens, es sei denn als Folge von oder als Mittel zu einem andern, welches andre seine Notwendigkeit gleichfalls wieder nur von einem höher gelegenen entlehnen kann; und so münden wir denn schliesslich an einem höchsten Sein oder Vorstellen, welches wir, da wir nach der Kantischen Kritik der Ontologie kein durch sich selbst Notwendiges begreifen, nur als einfache Tatsache, aber nicht als notwendige hinnehmen können.
Nicht logisch, sondern nur psychologisch kann ein Geschehen zu dem Charakter schlechthin unbedingter Notwendigkeit kommen, wenn jene höheren Stufen, von denen es seine Notwendigkeit logisch zu Lehen trägt, ins Unbewusste sinken, und die von ihnen geschaffene Notwendigkeit gleichsam als ihre Erbschaft im Bewusstsein zurücklassen.
Begründet die Länge der Vererbung die Verdunklung der Gründe einer Pflicht, so begreift man demnach, dass die so verdunkelte, alles Übrige gleichgesetzt, auch in gleichem Verhältnis die mächtigere ist; denn beides, die Macht wie die Verdunklung, gehen von dem gleichen Moment der Vererbungsdauer aus: die ältesten Vererbungen sind auf geistigem wie auf körperlichem Gebiet die am wenigsten variabeln.
Wo eine hervorragend sittliche Tat M geschehen ist, da hören wir leicht, wenn sich später ein egoistisches Motiv als das eigentlich treibende herausgestellt hat: "Nun verstehe ich M erst!" Die Metaphysik der Kantischen Ethik beruht darauf, dass, so lange wir die Handlungen der Menschen verstehen wollen, wir sie nur auf Motive der sinnlichen Erscheinungswelt, d. h. der Selbstliebe, zurückführen können.
Ein ähnliches Verhältnis wie hier zum Ethischen, zeigt das Psychologische auch zum Logischen: die objektive Wahrheit einer Vorstellung wird uns leicht zweifelhaft, wenn wir die psychologische Genesis erkennen, durch welche sie im Bewusstsein entstanden ist, ihre logischen Gründe sind verdächtig, wenn wir statt auf sie nur auf psychologische Ursachen für das Auftauchen der Überzeugung zurückzugehen brauchen; wir werden z. B. von vornherein mit Skeptizismus an eine Lehre herantreten, von der wir wissen, dass gewisse Gefühlsmomente im Gemüte des Urhebers ihr das Leben gegeben haben.
Die Veranlassung dieser Erscheinung ist vielleicht das Misstrauen in den Zufall, dass zwei so heterogene Reihen, wie das Logische und das Psychologische, unabhängig von einander zu demselben Resultate führen sollten.
Eine entsprechende Empfindung mag in unserm Fall herrschen.
Sobald man der Meinung ist, dass die sittlichen Ideale ein in sich geschlossenes, der Wirklichkeit heterogenes Reich bilden, liegt der Gedanke nahe, dass auch ihre Realisierung sich, wenn auch durch ein tatsächliches Bewusstsein, dennoch ausserhalb des Mechanismus psychologischer Naturgesetze vollziehen müsse.
Wo dieser gilt, müsste die Erfüllung der sittlichen Forderung aus vorhergehenden gleichfalls mechanisch hergestellten Bedingungen ohne Rest erklärbar sein.
Es erscheint als ein wunderlicher Zufall, wenn die Naturgesetzlichkeit des Vorstellens mit einer idealen Ordnung der Dinge zusammenfällt, die aus ganz anderen Quellen fliesst als die Wirklichkeit - wobei es dann freilich angesichts des rein zufälligen Verhältnisses zwischen dem mechanisch naturgesetzlichen Geschehen und den menschlichen Ideen und Prinzipien ebenso wunderlich wäre, wenn jener mechanische Verlauf unsres Handelns immer der Idee der Selbstliebe gemäss wäre, die doch auch ein teleologisches Prinzip ist.
Es kommt hinzu, dass das Verständnis der Willensakte nur durch das Kausalgesetz möglich ist und dabei die Freiheit hinwegfällt, die so Vielen für die Sittlichkeit unentbehrlich scheint.
Dieser letztere Gesichtspunkt hilft uns vielleicht noch zu einem weiteren Verständnis für die Grundlosigkeit des Sollens.
Wenn die strenge Kausalität die Freiheit ausschliesst, so folgt analytisch, dass wir diese nur da erkennen können, wo jene unerkennbar ist.
Und zwar ist die Unerkennbarkeit des Mechanismus nicht nur die conditio sine qua non für die Anerkennung der Freiheit, sondern der positive Grund für sie.