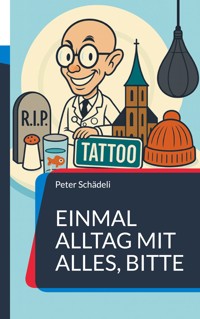
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein farbloser Fisch, ein löschfreudiger Trupp auf Abwegen, ein Weihnachtsmenü mit extra Salz, was kann da schon schiefgehen? Dieses Buch versammelt 22 Geschichten, die zeigen: Das Leben ist seltsamer, als jede Fiktion es je sein könnte. Ob in der Waschküche, beim Tätowierer oder am Boxsack, hier stolpern Menschen über ihre Eigenheiten und über andere. Und während Dr. Phobius seine Patienten analysiert, fragt sich jemand mittendrin: Keine Ahnung, was ich hier tue. Komisch, schräg und überraschend wie das echte Leben. Zum Lachen, zum Stirnrunzeln, immer mit einem Augenzwinkern. Für alle, die den Alltag mit all seinen Ecken lieben, selbst wenn manchmal etwas fehlt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vorwort
Dies ist kein Ratgeber. Auch kein Roman mit Anfang, Mitte und moralischer Erkenntnis am Ende.
Es ist eher wie eine gut gemischte Wundertüte: Man greift hinein – und zieht mal ein Lächeln, mal ein Stirnrunzeln, mal ein „Was zur …?“
Die Figuren stolpern durch Waschküchen, Friedhöfe, Arztpraxen, Fitnesscenter, Weihnachtsfeste und andere Lebensräume – und hinterlassen Spuren. Ob Sie darin einen tieferen Sinn finden? Vielleicht.
Wenn Sie beim Lesen schmunzeln, stutzen oder sich kurz wundern, dann war’s das schon wert. Alles andere liegt nicht mehr in meiner Hand.
Los gehts!
…und Dank
Ein besonderer Dank gilt meiner Partnerin Carola Brack, deren unerschütterliche Geduld und tiefes Verständnis mich durch unzählige Schreibstunden getragen haben. Deine beständige Unterstützung, dein Zuspruch und dein Vertrauen in mich waren eine stetige Quelle der Motivation – besonders in Momenten, in denen das Schreiben zur Herausforderung wurde. Ohne dich wäre dieses Buch vielleicht nie vollendet worden.
Ein herzliches Dankeschön gilt all meinen Leserinnen und Lesern. Eure Begeisterung und euer Interesse an meinen Geschichten sind eine stetige Quelle der Motivation. Es bereitet mir grosse Freude zu wissen, dass euch meine Erzählungen genauso viel bedeuten, wie mir das Schreiben selbst. Eure Rückmeldungen und euer Feedback sind von unschätzbarem Wert und inspirieren mich, weiterzumachen. Schön, dass ihr dabei seid.
Inhalt
Der farblose Fisch
Die letzte Zutat
Der Super-GAU
Als Lukas mich wieder Paul nennt
Ein Raum voller Präzision
Carpe diem war gestern
FC Haushalt gegen Stammtisch 04
Wäschekrieg im Sandhügel 7
Die Mütze sitzt schief
5 Minuten und ein Gong
Eine Liebe auf Zeit
Und plötzlich ist da wer
Keine Ahnung, was ich hier tue
Jenseits des Boxsacks
Tante Lua und Becher Charly
Die seltsamen Fälle des Dr. Fobius
Wer aussteigt, bleibt
Falsch abgebogen
Ein Löschtrupp auf Abwegen
Weihnachten mit extra Salz
Das goldene Buch der Peinlichkeiten
Die Lücke im System
Der farblose Fisch
Es ist ein grauer, trüber Nachmittag, als ich beschliesse, meinem Leben eine neue Richtung zu geben und es mit einem Haustier zu bereichern. Schon länger habe ich mit dem Gedanken gespielt, doch heute scheint der perfekte Moment zu sein. Der Zoohandel, den ich ansteuere, ist das einzige Geschäft seiner Art in der Gegend. Von weitem schon fällt mir seine marode Erscheinung ins Auge. Die Fassade, einst vielleicht in lebendigen Farben gestrichen, ist nun eine Ansammlung von abblätterndem Putz und blassen Grautönen. Über der Eingangstür hängt ein verrostetes Schild mit dem verblassten Schriftzug Zoo-Paradies, das bei jedem Windstoss bedrohlich schwankt. Direkt daneben prangt ein grosses, handgeschriebenes Plakat, das mit Totalausverkauf wirbt. Die Schaufenster, durch die einst wohl bunte Vögel, Fische und andere Tiere beworben wurden, sind so schmutzig, dass sie den Innenraum wie durch einen Nebelschleier verbergen. Was dahinter liegt, bleibt ein Rätsel.
„Hoffentlich gibt es da überhaupt noch Tiere“, murmle ich halblaut, während ich die kühle, metallene Türklinke umfasse. Die Tür ist schwer. Ein gequältes Quietschen dringt aus den Angeln, als ich sie aufstosse. Ein schwacher Duft von Heu, altem Holz und etwas Muffigem schlägt mir entgegen. Drinnen ist es überraschend dunkel, und die einzige Lichtquelle ist eine flackernde Neonröhre, die von der Decke baumelt. Dennoch trete ich ein, neugierig und ein wenig nervös, was mich wohl erwartet. Drinnen wird die düstere Atmosphäre des Geschäfts nur noch verstärkt. Der Boden unter meinen Füssen knarzt bei jedem Schritt, als würde er sich gegen das Gewicht der Jahre und die Vernachlässigung auflehnen. Der muffige Geruch ist hier drinnen noch intensiver. Die Regale entlang der Wände sind schief und wackelig, und die Tablare haben sich unter dem Gewicht zahlloser Dosen und Säcke, die mit einer dicken Staubschicht überzogen sind, verbogen. Einige Etiketten sind so verblasst, dass die Inhalte nur noch zu erahnen sind. Von reichhaltiger Auswahl kann bei den Tieren keine Rede sein. Links von mir steht ein kleiner Käfig, in dem ein Hamster hockt. Eines seiner Augen ist geschlossen, vielleicht fehlt es ganz; ich kann es nicht genau erkennen. Mit einem fast resignierten Blick starrt er mich an, als wüsste er genau, dass niemand ernsthaft in Betracht zieht, ihn mitzunehmen. Daneben, in einem etwas grösseren Käfig, sitzt ein Kaninchen. Es hockt regungslos in einer Ecke. Das Fell fehlt an einigen Stellen und es erweckt den Eindruck, als hätte es jede Freude am Leben und am Möhrenknabbern verloren. Die Karottenreste in seinem Napf sind längst eingetrocknet. Auf dem Boden entdecke ich eine Katze. Ihr Fell ist ungleichmässig zerzaust und wirkt, als hätte jemand eine alte Fussmatte achtlos hingeworfen. Sie ist dick und fast kugelrund. Leise schnarcht sie vor sich hin, ohne sich von meiner Anwesenheit stören zu lassen. Ihr Atem geht in einem langsamen, rhythmischen Takt. Gelegentlich zuckt ein Ohr, als wolle sie sich gegen unsichtbare Fliegen wehren. Die ganze Szenerie wirkt wie ein trauriges Abbild dessen, was dieser Laden einst gewesen sein könnte. Und doch, während ich mich weiter umschaue, spüre ich eine seltsame Faszination. Ein Gefühl, dass vielleicht genau hier, zwischen den Schatten und dem Staub, das richtige Tier auf mich wartet.
Plötzlich fällt mein Blick auf ein trübes Fischglas in einer dunklen Ecke. Darin schwimmt ein farbloser Fisch, so unscheinbar, dass ich ihn fast übersehen hätte. Neugierig trete ich näher heran und beuge mich vor, um ihn genauer zu betrachten. Der Fisch bewegt sich kaum und ein flüchtiger Gedanke schiesst mir durch den Kopf: Lebt er überhaupt noch? Dennoch kann ich den Blick nicht von ihm lösen. Es ist, als ob er mich ansieht. Obwohl er keine Farben zur Schau stellt, scheint etwas in seinen Augen zu glimmen, etwas sehr Lebendiges, beinahe rätselhaftes. Irgendwie Unheimliches. Die seltsame Atmosphäre des Ladens macht mich unruhig, und eine innere Stimme drängt mich, zu gehen. Doch gerade als ich mich abwenden will, durchbricht ein lautes, krächzendes „Nimm mich!“ die Stille. Erschrocken wirble ich herum und sehe einen Papagei in einem viel zu engen Käfig. Sein Gefieder ist zerzaust, sein Blick bohrt sich in meinen. Noch bevor ich etwas sagen kann, tritt der Ladenbesitzer aus dem Halbdunkel hervor. Sein Auftauchen ist so geräuschlos, dass es mich leicht frösteln lässt. Der alte Mann wirkt eigenartig. Seine scharfen, klugen Augen scheinen jede Kleinigkeit wahrzunehmen und in seinen Augen blitzt ein Anflug von Schalk auf. Sein faltiges Gesicht trägt die Zeichen eines langen Lebens. Die abgetragene, aber ordentlich gepflegte Weste, die er trägt, ist mit allerlei seltsamen Dingen geschmückt: kleine Federn, Bonbons und winzige Notizbücher, die seine eigenartige Erscheinung noch merkwürdiger machen.
„Nimm mich, nimm mich“, krächzt der Papagei. Schrill und fordernd durchdringt seine Stimme den Raum.
„Charly, hör auf mit dem Quatsch“, ruft der Ladenbesitzer, sichtlich genervt, „du stehst nicht zum Verkauf.“ Dann wendetet er sich mir zu: „Ignorieren Sie ihn. Er redet viel, wenn der Tag lang ist.“
Der Papagei murmelt etwas Unverständliches, dann senkt er den Kopf und vergräbt ihn in seinem spärlichen Gefieder, als wolle er sich schmollend zurückziehen. Ich lasse meinen Blick nochmals durch den Laden schweifen und merke, wie meine Augen unweigerlich zu dem trüben Fischglas zurückkehren. Bevor ich es mir anders überlegen kann, höre ich mich fragen: „Was kostet der Fisch?“
Der Ladenbesitzer mustert mich mit hochgezogenen Augenbrauen, als könne er kaum fassen, was ich gerade gesagt habe. „Den Fisch?“, wiederholt er ungläubig. „Wollen Sie wirklich ausgerechnet diesen Fisch?“ Sein Blick wandert durch den Raum, bleibt einen Moment lang an dem Kaninchen hängen und schliesslich am kleinen Hamster. Mit einer langsamen, überlegten Bewegung zeigt er auf die beiden Tiere. „Sehen Sie sich doch mal das Kaninchen an“, beginnt er mit leiser, fast väterlicher Überzeugung in der Stimme. „Oder den Hamster. Die beiden könnten Ihnen so viel mehr Freude bringen. Sie können sie streicheln – sie sind warm und kuschelig. Sie sehnen sich nach Zuwendung und nach jemandem, der sich wirklich um sie kümmert. Sie sind genau das Richtige, um ein bisschen Liebe und Geborgenheit in Ihr Leben zu bringen.“ Er hält inne, als wolle er prüfen, ob seine Worte bei mir Anklang finden, doch ich lasse mir nichts anmerken. Nach einem kurzen Seufzen spricht er weiter: „Beide haben ihre besten Tage hinter sich, genau wie ich. Aber gerade deshalb würde ich sie Ihnen sehr günstig überlassen. Überlege Sie es sich gut.“
Ich schüttle nur den Kopf, ruhig, aber entschieden, und antworte mit klarer Stimme: „Ich habe sie gesehen. Aber ich möchte den Fisch.“
Der alte Mann runzelt die Stirn, sichtlich bemüht, mich umzustimmen. „Denken Sie doch noch mal darüber nach. Der Fisch ist … na ja, um ehrlich zu sein, kein Paradebeispiel für ein Haustier. Schauen Sie ihn an: grau, unscheinbar, fast schon langweilig. Ein Kaninchen oder ein Hamster könnten Ihnen so viel mehr geben als dieses stille, einsame Ding in einem Glas.“ Seine Stimme wird eindringlicher, fast flehend. „Bitte, nehmen Sie die beiden. Ich schaffe es kaum noch, sie zu versorgen.“
Doch ich bleibe standhaft. „Ich nehme den Fisch“, sage ich – ruhig, aber unmissverständlich.
Der Mann holt tief Luft, als müsse er sich mit meiner unbeirrbaren Haltung arrangieren und stösst schliesslich einen langen, resignierten Seufzer aus. „Sie überraschen mich wirklich“, murmelt er und betrachtet den unscheinbaren Fisch mit einem prüfenden Blick. „Dieser graubraune Fisch … er hat wirklich nichts an sich, das Sie faszinieren könnte.“ Sein Gesichtsausdruck verändert sich, seine Züge werden melancholisch. „Aber gut, es ist Ihre Entscheidung“, fügt er hinzu und schüttelt den Kopf, als könne er es immer noch nicht recht glauben. Mit einem leisen, belustigten Lächeln sagt er schliesslich: „Ich schenke ihn Ihnen.“ Trotz seiner Worte lege ich ein paar Münzen auf den Tresen. „Nur zur Sicherheit“, murmle ich leise, während ich den Fisch samt Glas vorsichtig aufnehme. Irgendetwas an der ganzen Szene bleibt mir rätselhaft, doch ich schiebe die Gedanken beiseite und mache mich zufrieden mit dem neuen Begleiter und seinem schmuddeligen Glas auf den Heimweg. Zuhause reinige ich das Glas gründlich, fülle es mit frischem Wasser und füge ein paar bunte Steine hinzu, die ich unterwegs gefunden habe. Ich stelle es auf den Küchentisch und taufe meinen neuen Mitbewohner Gustav. Ich füttere ihn exakt nach Vorgabe und wechsle regelmässig das Wasser. Gustav schwimmt fröhlich im Kreis und ich glaube gerade ein Funkeln in seinen Augen gesehen zu haben. Er wirkt immer lebendiger und agiler.
Eines Morgens, kurz nach dem Aufwachen, spüre ich ein besonderes Gefühl in der Luft – kaum fassbar, aber deutlich. Mein Blick wandert wie von selbst zur Küche, wo das Fischglas steht. Das Wasser spiegelt sanft das erste Tageslicht wider, als ob es ein Geheimnis bewahren würde. Gustav, mein stiller Begleiter, zieht mit seinen blassen Schuppen ruhige Bahnen. Alles wirkt vertraut, und doch liegt eine kaum greifbare Veränderung in der Luft – eine leise Magie, die nur ich spüren kann. Zwischen uns ist eine Verbindung gewachsen, tief und beständig. Gustav ist längst mehr als nur ein Haustier. Seine blosse Anwesenheit schenkt mir Ruhe und ein Gefühl, das sich jeder Erklärung entzieht. Ich setze mich zu ihm an den Küchentisch, beobachte ihn und lasse dieses eigentümliche Empfinden in mir nachklingen. Von Tag zu Tag wird es stärker und zu einem festen Ritual: Bevor ich das Haus verlasse, nehme ich mir einen Moment Zeit für ihn. Für uns. Ich lasse mich von seiner stillen Gegenwart umhüllen, als wäre er ein Anker in der hektischen Welt da draussen und so vergeht Tag für Tag.
Zunächst scheint alles seinen gewohnten Lauf zu nehmen, doch irgendwann bemerke ich es: Sein einst lebendiges Gleiten ist einem schwerfälligen Treiben gewichen. Besorgt beobachte ich, wie er kaum noch reagiert und sich nur noch müde bewegt. Etwas stimmt nicht. Ein ungutes Gefühl breitet sich in mir aus, und ich kann den Gedanken nicht abschütteln, dass ihm die Kraft schwindet. Voller Sorge beginne ich, das Wasser in seinem Becken täglich zu wechseln, in der Hoffnung, dass frisches Wasser ihm helfen könnte. Ich füge sogar ätherische Öle hinzu, die für Fische unbedenklich sind, und wechsle sein Futter, aber nichts scheint seine Lage zu verbessern. Jede Veränderung, die ich vornehme, bleibt ohne Erfolg und die Sorge um sein Wohl lässt mich kaum noch los.
Eines Tages kommt mir eine Idee: Vielleicht finde ich im Zoofachgeschäft Rat. Dort angekommen, fällt mir sofort auf, dass der Käfig des prächtigen Papageis, den ich bewundert hatte, leer ist. Ich wende mich an den Besitzer des Geschäfts. „Der Papagei ist verstorben“, sagt er mit einer sanften, bedauernden Stimme. „Er hat sich wohl zu einsam gefühlt.“
Ich erzähle ihm von meinem Fisch und meinen verzweifelten Versuchen, ihm zu helfen. Der Mann hört aufmerksam zu. Dann, nach kurzem Nachdenken, nickt er langsam.
„Ihr Fisch leidet wahrscheinlich unter Einsamkeit“, erklärt er einfühlsam. „Manche Tiere sind empfindsamer, als wir glauben. Fische können das Fehlen von Gesellschaft genauso spüren wie Papageien. Der Papagei, wissen Sie … er ist wohl gestorben, weil er sich einsam fühlte. Vielleicht hat er den Weggang des Fisches nicht verkraftet.“
Seine Worte treffen mich tief. Könnte das wirklich sein, dass der Fisch in meinem kleinen Aquarium unter Einsamkeit leidet? Eilig verabschiede ich mich und eile nach Hause.
Kaum dort angekommen, knie ich mich vor das Aquarium, klopfe sanft an die Glasscheibe und spreche zu ihm. „Es tut mir leid“, flüstere ich. „Ich werde dich nicht mehr allein lassen. Ich verspreche es dir.“ Von diesem Tag an beschliesse ich, mein Leben und das von Gustav zu verändern. Jeden Morgen, bevor ich das Haus verlasse, packe ich ihn vorsichtig in einen kleinen, sicheren Transportbehälter, der mit seinem vertrauten Wasser gefüllt ist. Auf dem Weg zur Arbeit halte ich den Behälter behutsam auf meinem Schoss oder stelle ihn sicher neben mich wie einen wertvollen Schatz. Im Büro angekommen, platziere ich ihn sorgfältig auf meinem Schreibtisch. Dort kann er die geschäftigen Geräusche und Bewegungen um sich herum beobachten: das Klappern der Tastaturen, das gedämpfte Summen der Gespräche, das gelegentliche Lachen. Immer wieder werfe ich einen Blick zu ihm hinüber, und manchmal rede ich leise mit ihm, erzähle ihm von meinem Tag oder frage ihn scherzhaft nach seiner Meinung zu einer schwierigen E-Mail. Es mag für andere seltsam aussehen, aber für mich fühlt es sich natürlich an. Und dann beginnt etwas – Erstaunliches. Es geschieht nicht sofort, sondern ganz allmählich, beinahe unmerklich. Seine einst so matte, graubraune Farbe wird kräftiger, lebendiger. Auch seine Bewegungen verändern sich. Er zieht nicht mehr träge seine Kreise, sondern schwimmt mit einer neuen, fast spielerischen Energie, die ich schon lange nicht mehr bei ihm gesehen habe. Gustav beginnt wieder aufzublühen und mit ihm auch etwas in mir. Unser Leben nimmt eine neue, unerwartete Wendung. Ich kann nicht genau sagen, was den Wandel ausgelöst hat, ob es die Abwechslung ist, die neuen Eindrücke oder einfach die Aufmerksamkeit, die ich ihm schenke. Doch eines weiss ich mit Sicherheit: Es ist, als hätte ich durch den Tod des Papageis und die Weisheit des alten Zoohändlers etwas viel Wertvolleres gelernt – wie stark die Verbindung zwischen Lebewesen sein kann, ganz egal, wie unterschiedlich sie sind.
Die letzte Zutat
Es ist ein ganz normaler Samstagmorgen – und doch stehen wir drei widerwilligen Hobbyköche aufgeregt in der Küche des Ateliers des guten Geschmacks. Wir sind hier, um unseren Ruf als kulinarische Tiefflieger endlich loszuwerden, eine Mission, die unsere Familien längst als überfällig erachtet haben. Sie sind fest davon überzeugt, dass unsere bescheidenen Kochkünste dringend aufgepeppt werden müssen, zum Nutzen und Wohl aller. Ein Argument, dem sich kaum widersprechen lässt, schliesslich geht Liebe bekanntlich durch den Magen.
Doch bevor wir uns auch nur vorstellen können, wie der Kochkurs ablaufen wird, fesselt uns die Umgebung. Das hier ist keine gewöhnliche Küche; das ist ein Hochglanzparadies: Arbeitsflächen glänzen in alle Richtungen, und jedes Gerät sieht aus, als hätte es gerade ein Raumschiff verlassen. In der Mitte thront eine riesige Kochinsel wie ein Altar der Kulinarik, umgeben von makellosen weissen Wänden und moderner Beleuchtung. An den Seiten stehen sorgfältig geordnete Regale, gefüllt mit exotischen Gewürzen und Kochbüchern mit Titeln wie Die Kunst des pochierten Eies oder Soulfood für Mutlose. Die vorgeschlagenen Menüs lassen mich erschaudern.
Doch dann betritt der Kursleiter die Küche. Chef Gaston, eine beeindruckende Erscheinung, die sofort alle Blicke auf sich zieht. Mit seinem akkurat gezwirbelten Schnurrbart, der an längst vergangene Epochen erinnert, und seinem durchdringenden Blick, der jede noch so kleine Bewegung in der Küche erfasst, strahlt er eine Mischung aus Autorität und Leidenschaft aus. Seine Stimme ist tief und resonant, durchzogen von einem leichten französischen Akzent. Seine Bewegungen sind präzise, fast tänzerisch, während er Messer schwingt oder Gewürze abmisst. Trotz seiner imposanten Erscheinung ist er ein Meister darin, Anfänger zu beruhigen. Mit einem kleinen Lächeln oder einem ermutigenden Nicken schafft er es, auch die unsichersten Hände in der Küche zu befähigen. Doch wehe dem, der sich erdreistet, den Kochlöffel falsch zu halten oder Gaston zu widersprechen. Er ist unerbittlich, wenn es um die Kunst des Kochens geht, und seine strenge Miene scheint zunächst keinen Widerspruch zu dulden. Doch kaum betritt er die Küche, verwandelt sich sein ernster Ausdruck in ein breites Grinsen. „Willkommen, meine tapferen Küchenkrieger“, ruft er. Gespannt hängen wir an seinen Lippen – wir, das sind:
Nina, die stolz behauptet, sie könne Toast in der richtigen Farbe bräunen – meistens.
Jonas, der sich selbst als Experten fürs Braten von Spiegeleiern bezeichnet, auch wenn das Eigelb selten die perfekte Form behält.
Und ich, der Dritte im Bunde, der zwar weiss, wie man Spaghetti kocht – aber nie genau, wann sie eigentlich fertig sind.
Chef Gaston stellt sich mit breiter Brust vor uns auf, sein weisser Kochmantel strahlt beinahe so sehr wie sein Lächeln. Auf seinem Kopf thront die traditionelle Toque Blanche – das Wahrzeichen eines jeden Meisterkochs, ein Symbol für Erfahrung und Rang in der Küche. Sein verschmitztes Lächeln ist eines, das Vorfreude und leicht sadistische Genugtuung zugleich verspricht. „Bevor wir loslegen, erkläre ich euch die Spielregeln für heute“, beginnt er mit einer Stimme, die irgendwo zwischen Drill Sergeant und Entertainer pendelt. Er hebt einen Finger, als würde er uns gleich eine göttliche Offenbarung zuteilwerden lassen. „Auf dem Programm steht ein simples Drei-Gänge-Menü: eine einfache Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert. Jeder von euch übernimmt einen Gang. Für diese Aufgabe stehen euch zwei Stunden zur Verfügung – das sollte ausreichen. Natürlich stelle ich euch die passenden Rezepte zur Verfügung und werde während der gesamten Zeit anwesend sein, um euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“ Sein Blick wandert langsam über uns und hält bei jedem von uns kurz inne. Erst bei Jonas, dann bei Nina und schliesslich bei mir. Niemand wagt, zu widersprechen. „Kommen wir nun zum Einkauf der Zutaten“, verkündet er und hebt zwei Finger, als wollte er die nächste goldene Regel verkünden. „Ihr kümmert euch selbst um alle Zutaten. Die passende Einkaufsliste zum Menü bekommt ihr von mir. Das Budget: 20 Franken pro Person – kein Rappen mehr. Und ihr habt genau eine Stunde Zeit, um alles zu besorgen. Jede Minute drüber geht vom Kochen ab.“ Er lässt seinen Blick erneut über uns schweifen, diesmal mit einem Hauch von Strenge, als wolle er sicherstellen, dass wir den Ernst seiner Worte begreifen.
Widerwillig hebe ich die Hand. „Ähm, Gaston?“, beginne ich zögernd. „20 Franken sind, offen gestanden, überaus knapp. Könnten wir das Budget vielleicht auf 30 erhöhen?“
Nina nickt begeistert. Auch Jonas schliesst sich an. „Ja, genau“, murrt er. „Wie sollen wir mit so wenig Geld etwas Anständiges hinbekommen?“
Doch Chef Gaston schüttelt entschieden den Kopf. „Nein, auf gar keinen Fall“, entgegnet er mit der Ruhe eines Mannes, der es gewohnt ist, unter Druck Meisterwerke zu erschaffen. „Die wahre Kochkunst beginnt bereits beim bewussten, sparsamen und gesunden Einkaufen. Also bleibt aufmerksam und nutzt Sonderangebote clever aus.“ Dann hebt er drei Finger und sagt entspannt: „Und nun zu Regel Nummer drei: Wer welchen Gang übernimmt, wird durch ein von mir eigens kreiertes Spiel entschieden – das … äh, Kochlöffelwerfen.“
Mit einer raschen Bewegung zieht er einen übergrossen Kochlöffel hervor und deutet auf einen glänzenden Topf, der in etwa drei Meter Entfernung steht. „Das Spiel ist ganz einfach“, erklärt er mit einem schelmischen Lächeln. „Ihr werft nacheinander den Kochlöffel in den Topf. Wenn ihr verfehlt, versucht ihr es so lange, bis ihr trefft, aber höchstens drei Minuten. Die Zeit wird gestoppt, sobald jeder seinen Löffel im Topf versenkt hat. Der mit der kürzesten Zeit darf als Erster ein Menu auswählen, der Zweitplatzierte folgt direkt. Und der Letzte? Der übernimmt ganz automatisch den letzten, noch verfügbaren Gang. Verstanden?“
Es herrscht einen Moment lang Stille. Wir blicken uns gegenseitig an, jeder wartet auf die Reaktion des anderen. Kein einziges Wort fällt, die Spannung ist förmlich greifbar. Schliesslich durchbricht Gaston die Stille: „Dann sind die Spielregeln wohl klar.“ Er hält einen Moment inne, hebt seine Hände, als wäre er gerade dabei, einen Zauberspruch auszusagen, und schlägt sich heftig an die Stirn. „Natürlich. Das Menü. Wie konnte ich das vergessen?“ Er dreht sich langsam zu uns um, als wolle er die Spannung bis ins Unermessliche treiben. Mit einer theatralischen Geste verkündet er: „Zur Vorspeise gibt es einen erfrischenden Tomaten-Mozzarella-Salat, verfeinert mit einer Balsamico-Vinaigrette.“ Jonas nickt zustimmend, doch man kann ihm die Frage anmerken, die ihm durch den Kopf geht: Was genau ist eigentlich eine Vinaigrette?
„Der Hauptgang wird ein cremiges Pilzrisotto mit Parmesan sein“, erklärt Gaston weiter. Ich schlucke. Risotto? Das Gericht, bei dem man unaufhörlich rühren muss und der Muskelkater am nächsten Tag vorprogrammiert ist.
„Und zum Dessert?“, setzt Gaston nach, „ein klassisches Tiramisu, das ihr mit einer eigenen kreativen Note verfeinern dürft.“
Nina wirft Gaston einen unsicheren Blick zu und flüstert nervös: „Kreative Note?“
Gaston zwinkert und raunt: „Kreativität ist wie Salz – ein Hauch veredelt, eine Prise zu viel kann alles ruinieren.“
Nina schluckt. Ihre Finger spielen nervös am Saum ihrer Schürze, während ihr Blick suchend durch den Raum wandert.
„Jetzt kennt ihr die Mission“, verkündet Gaston mit triumphierendem Ton. „Die Herausforderung steht, meine Gourmet-Gladiatoren. Zeigt, was in euch steckt – oder improvisiert, wenn's brenzlig wird.“ Ein schelmisches Grinsen huscht über sein Gesicht. „Kreativität ist euer bester Freund, besonders, falls ihr beim Einkaufen die Hälfte vergessen habt.“
Dann klatscht er in die Hände. „Genug geredet. Die Zeit läuft – und jetzt ran an den Kochlöffel.“
Nina fängt an: Selbstbewusst tritt sie nach vorne. Sie nimmt den überdimensionalen Kochlöffel in beide Hände, wiegt ihn kurz, als würde sie die Balance und das Gewicht prüfen, und fixiert den glänzenden Topf mit scharfem Blick. Mit einem präzisen Schwung wirft sie den Kochlöffel. Der Flug des Löffels ist beeindruckend. Er segelt in einem perfekten Bogen durch die Luft und landet mit einem dumpfen Klonk direkt im Topf. Triumphierend wirbelt Nina herum, ein stolzes Lächeln auf den Lippen, und reisst die Arme in die Höhe. Mit überschwänglicher Geste verbeugt sie sich vor den anderen, der Jubel in ihren Bewegungen ist kaum zu übersehen. Sie ist sich sicher: Der erste Platz gehört ihr, und damit auch die erste Wahl.
Als Zweiter tritt Jonas an, ein wenig nervös, aber dennoch entschlossen. Er nimmt den Löffel, atmet tief durch und murmelt unhörbar eine kleine Ermutigung zu sich selbst. Der erste Wurf ist kraftvoll, doch der Löffel fliegt knapp am Rand des Topfes vorbei und landet klappernd auf dem Boden. Jonas kneift die Augen zusammen und holt den Löffel zurück. Beim zweiten Versuch setzt er mehr auf Präzision als auf Kraft, doch wieder verfehlt er den Topf. Ein leises Lachen ertönt aus dem Hintergrund, doch Jonas lässt sich nicht beirren. Beim dritten Versuch atmet er tief durch, konzentriert sich auf den Rhythmus und wirft den Löffel schliesslich mit einem sauberen Schwung – diesmal landet er im Gefäss. Er hebt erleichtert die Hände und nickt zufrieden. Vermutlich darf er als Zweiter wählen – kein Wunder, bei meiner Wurfausbeute.
Jetzt bin ich dran und betrachte das Ganze mit einer gelassenen Haltung. „Na, dann wollen wir mal“, rufe ich und werfe den Löffel, ohne mich zu konzentrieren. Natürlich fliegt er weit am Ziel vorbei. „Das war ein Probewurf“, sage ich lachend und hole ihn zurück. Meine nächsten Versuche sind ebenso wenig erfolgreich. Mal ist der Schwung zu schwach, mal zielt der Wurf in eine völlig falsche Richtung. Plötzlich beendet Chef Gaston das fröhliche Kochlöffelwerfen mit einer entschiedenen Geste. Mit verschränkten Armen schaut er mich mit gespieltem Ernst an. „In deiner Lage wären weitere Würfe reine Zeitverschwendung“, bemerkt er mit ungeduldiger Stimme. Ich nicke schuldbewusst, doch ein Schmunzeln kann ich mir nicht verkneifen. Schliesslich steht die Entscheidung fest: Nina darf als Erste wählen und entscheidet sich für das Dessert. Jonas, als Zweitbester, übernimmt die Vorspeise, und ich bin für den Hauptgang zuständig. Mit unseren Aufgaben im Kopf und einer Mischung aus Vorfreude und Nervosität machen wir uns auf den Weg zum Supermarkt.
Dort geht es drunter und drüber – die Suche beginnt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Wo finde ich was? Wir irren durch die Gänge, immer wieder innehaltend, um die Regale zu durchstöbern. Die Orientierung fällt uns schwer und jede Minute, die wir hier überziehen, fehlt uns später beim Kochen. Wir hetzen mit der Einkaufsliste in der Hand voran und versuchen, uns gegenseitig zu helfen, doch das Chaos nimmt schnell überhand.
Jonas, der für die Vorspeise verantwortlich ist, irrt durch die Gemüseabteilung wie ein verlorener Tourist. „Wo sind denn diese Bio-Tomaten? Sind die nicht rot? Warum sehen die hier alle aus wie Miniaturkürbisse?“ murmelt er, während er skeptisch eine Schale Kirschtomaten inspiziert.
Nina steht mit einer Packung Mascarpone in der Hand vor dem Kühlregal und sieht verzweifelt aus. „Ist das die richtige? Und was, wenn sie nicht cremig genug ist?“ fragt sie mich panisch. Ich werfe einen prüfenden Blick auf die Verpackung und sage überzeugt: „Ja, klar. Mascarpone ist Mascarpone. Nimm einfach die günstigste.“
Ich habe es selbst auch nicht besser: Die Suche nach Pilzen für mein Risotto endet in einer Auseinandersetzung mit einer Verkäuferin, die mir höflich erklärt, dass Morcheln mit meinem Budget von ein paar Franken schlicht nicht in Reichweite liegen. Schliesslich kaufe ich Champignons aus der Dose und bilde mir ein, dass niemand den Unterschied merken wird. Die Zeit drängt, und so treffen wir uns an der Kasse – mit Körben, die weniger nach einem Drei-Gänge-Menü als vielmehr nach einem kuriosen Picknick aussehen. Jonas hat Mozzarella in Scheibenform gekauft, weil er dachte, das sei praktischer. Nina hat statt Löffelbiskuits Biskuits mit Schokoladenstückchen gewählt, und ich habe zu wenig Gemüsebouillon eingepackt. Zurück in der Küche gibt es keine Zeit für Klagen. „Los, an die Arbeit“, ruft Chef Gaston, der die Uhr gestartet hat und uns beobachtet wie ein Adler seine Beute.
Jeder bekommt genau einen Meter Platz auf der glänzenden Arbeitsfläche und eine Kochplatte. Das klingt grosszügig, bis man merkt, dass ein Schneidebrett, eine Schüssel und ein Topf zusammen den gesamten Platz einnehmen.
Jonas beginnt mit dem Tomaten-Mozzarella-Salat. Mit viel Aufwand schneidet er die Tomaten in fast gleichmässige Stücke. „Die Mozzarella-Scheiben sind super, sparen Arbeit“, sagt er und versucht, die Scheiben kunstvoll auf den Teller zu drapieren. Die Anordnung wirkt aber eher zufällig als gewollt.
Ich stehe über meinem Risotto und rühre wie ein Besessener, während die Dosenpilze gemächlich vor sich hin köcheln. Der Reis weigert sich hartnäckig, weich zu werden, und die Bouillon reicht bei weitem nicht. Also giesse ich etwas Wasser nach und hoffe inständig, dass mein Risotto als „modern, da wenig Salz und daher gesund“ durchgeht.
Nina hat sich mit dem Tiramisu in die Ecke verzogen. Sie schichtet ihre Kekse mit Mascarpone und Kakao, während ich von meinem Risotto ablasse, um ihr zu helfen. „Hier, lass mich die letzte Schicht machen“, sage ich und greife nach der Zuckerdose. Dummerweise ist es die Salzdose, aber in meiner Hektik bemerke ich das nicht. Ich streue grosszügig, was ich für Zucker halte, über das fertige Dessert und klopfe mir zufrieden auf die Schulter.
„Noch fünf Minuten“, ruft Gaston.
Jonas stolpert beinahe, während er hastig versucht, seinen Salat kunstvoll zu garnieren. Nina bestäubt ihr Tiramisu mit Kakao, und ich richte mein Risotto auf einem Teller an, der für die kleine Portion viel zu gross wirkt.
„Die Zeit ist um“, verkündet Gaston mit fester Stimme. Er schreitet an unseren Menüs entlang, bleibt vor jedem stehen, kneift die Augen zusammen und notiert sich etwas. Dann tritt er beiseite und ruft: „Jury, darf ich bitten?“ Einen Moment später betreten die beiden Experten den Raum: eine ältere Dame und ein Herr mit strengem Blick. Gaston hat bewusst eine externe Jury gewählt, um jede Form von Befangenheit zu vermeiden. Nach einer kurzen Vorstellung unsererseits präsentieren wir unsere Gänge mit so viel Selbstbewusstsein wie möglich.
Die Bewertung startet mit Jonas' Vorspeise. Die gestapelten Tomaten- und Mozzarella Scheiben ziehen sofort neugierige Blicke auf sich. Mit leicht schräg gelegtem Kopf kommentiert die Dame: „Eine interessante Interpretation.“ Ihre Stimme ist schwer einzuordnen. Ein Hauch von Lob, aber auch Skepsis schwingt leise mit. Sie schiebt den Teller näher heran, bevor sie ergänzt: „Minimalistisch.“ Ein Wort, das ebenso gut ein Kompliment wie eine höfliche Umschreibung für etwas einfallslos sein könnte. Jonas lächelt unsicher, während das andere Jurymitglied zustimmend nickt und seine Gabel zückt. Die Spannung im Raum steigt spürbar. Die Gabeln senken sich langsam, und für einen Moment herrscht absolute Stille, nur das Klicken des Bestecks ist zu hören. Nach ein paar Bissen tauschen die beiden Jurymitglieder vielsagende Blicke aus. „Nun“, beginnt die Dame, „die Zutaten sind frisch und die Tomaten haben eine angenehme Süsse.“
Ein kurzes Nicken von der Seite deutet Zustimmung an. Der Mann räuspert sich. „Allerdings fehlt ein wenig Würze. Ein Hauch mehr Salz oder Kräuter hätten dem Ganzen mehr Tiefe gegeben.“
Die Dame fügt hinzu: „Die Balsamico-Vinaigrette ist solide, aber etwas zu sparsam eingesetzt. Insgesamt … einfach gehalten.“ Die Benotung erfolgt schliesslich mit einem sanften Lächeln: „Eine 6 von 10. Frisch und leicht, aber da wäre noch Raum für kreative Akzente.“
Jonas nickt tapfer, obwohl ihm die Erleichterung ins Gesicht geschrieben steht. Es hätte schlimmer kommen können.
Nun ist mein Risotto an der Reihe. Mit vorsichtigem Blick hebt der Herr am Tisch seine Gabel und nimmt einen kleinen Bissen. „Mutig“, sagt er nachdenklich, während er das Risotto langsam kaut. Sein Gesichtsausdruck verrät zunächst wenig, bleibt neutral. Nach einem Moment des Schweigens legt er die Gabel ab und ergänzt mit einem diplomatischen Ton: „Ein Hauch von Einfachheit.“
Die Jurorin nickt, als hätte sie genau das Gleiche empfunden. „Die Pilze haben eine sehr angenehme Textur“, kommentiert sie, „aber man schmeckt, dass sie aus der Dose kommen.“ Ihr Lächeln wirkt freundlich, aber ehrlich. „Der Reis ist noch etwas sehr al dente“, bemerkt der Mann, „nicht unangenehm, aber definitiv rustikaler als erwartet.“
„Und die Würze?“, fragt die Dame weiter nachdenklich. „Eher fad. Vielleicht zu fad.“
Schliesslich verkündet sie ihr Urteil: „Ein solides Risotto mit Verbesserungspotenzial. Für den Einsatz gibt es eine 6 von 10, mehr leider nicht, denn der Teller war eindeutig zu gross für die kleine Portion.“
Ich nicke wortlos, unsicher, ob ich erleichtert oder enttäuscht sein soll. Zumindest haben sie es nicht völlig zerpflückt.
Zuletzt wird Ninas Tiramisu probiert. Die Jury nimmt jeweils einen Löffel. Nach dem ersten Bissen gibt es eine kurze Pause. „Ein … aussergewöhnliches Dessert“, sagt die Jurorin und lächelt gezwungen.
Der Herr räuspert sich und legt seine Gabel ab: „Ein überraschender Twist mit einer – salzigen Note. Fast avantgardistisch.“
Salzige Note? Mein Herz setzt einen Moment aus. Habe ich etwa Zucker mit Salz verwechselt? Ein mulmiges Gefühl steigt in mir auf und ich spüre, wie mir die Röte ins Gesicht schiesst.
Am Ende verteilt Gaston die Kursbestätigungen und die Preise und überrascht mit der Entscheidung der Jury. Zwei zweite Preise gehen an Jonas und mich, da wir beide mit jeweils 6 von 10 Punkten gleichauf liegen.
Der erste Preis jedoch geht an Nina, die mit ihrem aussergewöhnlichen Tiramisu die Jury vollends überzeugt hat und beeindruckende 9 von 10 Punkten erzielt hat.
Ausschlaggebend für ihren Sieg ist ihre bemerkenswerte Kreativität: Sie wagte es, dem klassischen Dessert eine unerwartete salzige Note zu verleihen. Diese kühne und kreative Interpretation beeindruckte die Jury zutiefst und kürte Nina zur verdienten Gewinnerin. Strahlend nimmt sie ihr Diplom entgegen, während wir applaudieren, auch wenn sie nicht genau weiss, wie sie die salzige Note so perfekt hinbekommen hat.





























