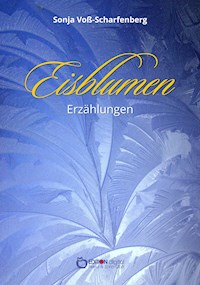
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wieso Eisblumen? Die Erklärung findet sich in einer Erinnerung an ihre Kindheit: Beim Verfolgen des Tanzes der Schattenbäume denkt Thea daran, wie sehr sie es früher genoss, wenn Mutter im Winter frühmorgens den Ofen im Kinderzimmer anheizte, während Thea noch im Bett lag. Wenn das Feuer prasselte und das trockene Holz knisterte und manchmal auch bedrohlich knackte, schaltete die Mutter das Licht wieder aus und hantierte in der Küche mit dem Frühstücksgeschirr. Das Feuer ließ dann durch die halboffen stehende Ofentür ein lebendiges Licht springen, warf ruhelose Silhouetten an die Wand gegenüber und gestaltete einen bezaubernden Reigen schemenhafter Figuren. Es roch nach kalter Asche, nach türkisch gebrühtem Kaffee und nach Gas, weil Mutter für ein paar Minuten alle Flammen des Gasherdes entzündet hatte, damit es in der Küche ein wenig „verschlagen“ wäre, wie sie es nannte. Wenn Thea fröstelnd in die Küche kam, um dort die Morgenwäsche zu verrichten, waren die Eisblumen am Fenster, die der Frost manchmal in sehr kalten Nächten dort gesät hatte, schon angetaut. Thea bedauerte das. Sie dachte darüber nach, wie man wohl das Bild der Eisblumen festhalten könnte. Vielleicht, indem man es aufschrieb? Malen konnte sie sie nicht. „Mutter, wie schreibt man Eisblumen auf?“ Und die Mutter buchstabierte das Wort Eisblumen, und Thea antwortete: „Das meine ich nicht.“ Auch viel später, während des Fernstudiums am Leipziger Literaturinstitut, lernte sie nicht, wie man dieses Bild wohl aufschreiben könnte. Wenigstens aber war Thea in Leipzig schon auf Menschen gestoßen, die nicht davon ausgingen, dass sie das Wort buchstabiert wissen wollte. Die Autorin, die mit Thea augenscheinlich mehr als nur den Jahrgang 1957 gemeinsam hat, berichtet über deren schlaflose Nächte, in denen sie über ihr Leben vor und nach der Wende nachdenkt, über ihre gescheiterte Ehe, über die Mutterschaft und über die Schwierigkeiten mit ihren beiden Kindern, über ihr Studium und über ihren Arbeitsplatz, über den Zwang gemeinsam Weihnachten zu feiern, über Glück und Unglück im Allgemeinen und im Besonderen, über ihre Liebe zu ihrer späten Lebensgefährtin Reida sowie natürlich über das Schreiben, ihren persönlichen Schutz vor Depressionen. Und noch etwas: Aber beiläufig denkt sie, dass ihr das Aufschreiben der Eisblumen noch immer nicht geglückt ist. Sie wird nicht ablassen davon. Auch davon nicht. Schon gar nicht jetzt, da sie eine immer deutlichere Vorstellung davon hat, wie es gehen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Sonja Voß-Scharfenberg
Eisblumen
Erzählung
ISBN 978-3-96521-732-4 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 2014 im freiraum-verlag Greifswald.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1
Es ist eine Stunde nach Mitternacht, als Thea wach wird. Der Rauchmelder an der Decke blinkt kurz auf, und zeigt damit seine Dauerfunktionsbereitschaft an. Eigentlich war Thea gegen die Installation dieser Geräte, aber die Wohnungsgenossenschaft ließ ihr keine Wahl und beteuerte eifrig deren Nützlichkeit. Thea fühlt sich immer, wenn sie diese Stand-by-Einstellung wahrnimmt, beobachtet und abgehört. Flächendeckend verwanzt, denkt Thea, ganz offiziell und verfassungsgeschützt, genehmigt und vom Opfer noch selbst finanziert. Das hätte das verlorene Land sich in seinen besten Zeiten nicht träumen lassen. Sie schaltet das Licht ein und sieht seufzend auf den Wecker. Einuhrfünf. Auf ihrem Nachtschrank stehen der Wecker und die Leselampe, liegen ihr Handy und ein Tonscherben, auf dem ein Frauengesicht eingeritzt ist und die Aufforderung „Pflücke den Tag“.
Den Scherben hat Reida ihr bei einem Weihnachtsmarktbesuch gekauft. Eine Rummelrose liegt noch daneben. Die kitschigste wohl, die Menschen sich ausdenken können. Rote Blütenblätter, die mit silbrigen Glimmersternchen besprüht sind, was ganz zweckmäßig ist, weil man dadurch auf den ersten Blick nicht ausmachen kann, wie eingestaubt sie manchmal sind.
Die Rose hat Theas Gefährtin ihr nicht gekauft, sondern geschossen. Reida schießt gut und ringt den Schießbudenbesitzern, die in ihrer Branche von einer Frau nichts weiter erwarten, immer ein erstauntes „Alle Achtung“ ab. Zehn Schuss — zehn Treffer. Zumeist. Unter acht nie.
2
Thea erhebt sich und stöhnt auf dabei. Sie stützt sich mit der Hand auf den Tisch, um dem schmerzenden Fuß nicht gleich das gesamte Körpergewicht zuzumuten, um einen Ausgleich zu schaffen, bis sie in die Gänge gekommen ist, wie sie es nennt.
Auf dem Tisch liegen Bücher und Zeitschriften, Stifte und Blöcke, Zettel mit Notizen, ein paar Hühnergötter, die Thea in den Jackentaschen vom Meer mit nach Schwerin genommen hat, und unzählige Lesezeichen von einem Kalender. Zum Fenster hin steht eine Vase mit Sommerastern. Ein Foto von Reida lehnt daran.
Und an einer Ecke des Tisches, an die Thea, auf dem Bett sitzend, ohne dass sie aufstehen muss, herankommt, lauert der Anfang vom Alter: Eine Packung Schmerztabletten, die schon zur Hälfte aus der Folie gedrückt sind, ein Glas Mineralwasser und eine Flasche Franzbranntwein zum Einreiben. Manchmal ergänzt noch eine auf dem Boden liegende Wärmflasche, die Thea dann im Halbschlaf aus dem Bett gelegt hat, das Bild der beginnenden Gebrechlichkeit, die die Gesellschaft im eifrigen Bemühen um Verdrängung Fünfzig Plus nennt.
Nebenan hört Thea den Fernseher ihres Sohnes. Also ist Henning da, was sie beruhigt und ihr Hoffnung macht, schnell wieder einschlafen zu können. Zumindest wird sich die Sorge, wann der Junge wohl endlich nach Hause kommt, erübrigen.
Draußen baut sich langsam ein Gewittersturm auf. Am Vorabend hat es im Anschluss an die Nachrichten eine Unwetterwarnung gegeben. Seit Tagen schon steht der Sommer schwer und drückend in der Luft, schlingt sich wie eine Zwangsjacke um die Stadt, und lässt sie mit gefesselten Armen und in phlegmatischer Dumpfheit durch die staubigen Tage torkeln, als habe sie alles Aufbegehren schon hinter sich und füge sich nun müde in ihr Schicksal.
Andernorts haben sich längst Gewitter entladen, haben die Himmelsgeister getobt und gewütet, ihre Ungunst ausgeschüttet und dieses und jenes Unheil angerichtet, zur Strafe wohl, dass der Mensch ihnen so viel Druck macht. Wieder einmal. Aber nachdem sie sich erschöpft und später zurückgezogen haben, sind die Orte erholt und belebt aus der Nacht hervorgekommen, haben durchgeatmet und es war, als habe die Gegend beschlossen, landesweit in wind- und wetterfrischer weißer Bluse in den Tag zu gehen.
In Ungeduld auf einen solchen erquickenden Morgen erwartet Thea zunächst einmal das Unwetter, ohne dass es die Abkühlung nicht geben wird und das schon seine sommerstürmischen Vorboten durch das Laubwerk der Bäume vor ihrem Fenster rauschen lässt. Und natürlich finden die Bewegungen der Äste sofort ihren vertrauten Tanzboden auf Theas Schranktüren.
Schattentanzen. Wie eh und je in all den schlaflosen, verwarteten Stunden. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht …? Ja doch, denkt Thea im Halblicht zum Kleiderschrank hin, wie immer mit dir in den Morgen.
Das wird es nun bald so nicht mehr geben. Das also auch nicht mehr, denkt sie. Die schlaflosen Nächte wohl, aber diese Lichtverhältnisse nicht, die Bäume nicht vor dem Fenster und der Standort des Kleiderschrankes wird nicht wieder so sein, dass alle baumhohe Bewegung von draußen auf ihm Schatten werfen kann. Wenn überhaupt Bäume vor dem Schlafzimmerfenster sein werden. Bäume vor dem Fenster könnte Thea zu den Bedingungen nehmen, die sie an einen Umzug knüpft. Eigentlich sind Bäume vor dem Fenster eine Selbstverständlichkeit. Bedingungen hat sie schon so viele auf der Liste: Die Wohnung soll in Reidas Nähe bleiben, denn die ist schließlich erst vor zwei Jahren in Theas Nähe gezogen. Das Bad soll eine Dusche und keine Wanne haben, die Toilette frei hängend und bitte ein Tiefspüler, die Wohnung soll nicht höher als in der zweiten Etage liegen, am liebsten sowieso in der ersten. Die beiden Zimmer sollen separat sein und die Küche größer als die jetzige. Ein Balkon versteht sich von selbst, ein geräumiger Keller wäre schön, aber kein Muss, dafür ein vernünftiger Parkplatz, der nach Möglichkeit Theas Fahrkünsten entspricht, also nicht seitlich einzuparken, und den man von einem der Wohnungsfenster aus sehen kann. Und die Wohnung soll sich in einem ruhigen Haus befinden, in dem es keine Krawalle und vor allem keine Hunde gibt, die durch das Treppenhaus hecheln. Und die Wohnung soll bezahlbar sein, denn deshalb will oder muss Thea ja überhaupt umziehen.
Thea zieht um, weil Henning geht. Dass Henning geht, ist der Lauf der Welt, ist gesund und gut und richtig. Und außerdem höchste Zeit. Aber erst einmal ist es nur schwer, weil alles durcheinanderkommt. Wenn alles wieder einen Platz gefunden hat, und das, was weg konnte, in Vergessenheit geraten ist, wird es gut sein. Aber bis dahin ist so viel Sorge, so viel Organisation und Planen. Und alles muss mit möglichst geringen Kosten vonstattengehen.
Henning befindet sich in einem Glückstaumel. Auf den Studienplatz hat er lange warten müssen. Jetzt zieht er mit Pauken und Trompeten aus der Stadt und hat keine Ahnung von den Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen. Thea und Reida freuen sich wohl am meisten mit ihm, weil sie am meisten mit ihm gelitten und gewartet haben. Nun ist es soweit, denkt Thea: Hans im Glück zieht in die Welt. Und seine Mutter kann das Heim nicht halten. Sei’s drum.
Irgendwie fügt sich ja doch alles günstig. Immerhin geht Thea im Moment zu einer Arbeit, sodass sie kein Amt bitten muss, umziehen zu dürfen, oder das ihr später, wenn sie mal wieder keine Arbeit hat, auferlegen kann umzuziehen, weil die Wohnung zu groß ist. Also dann doch lieber gleich jetzt und zwar unter Berücksichtigung aller Bedingungen, die Thea so hat, Abstriche inklusive.
Den blöden künstlichen Weihnachtsbaum im Keller, auf dessen Aufstellen Henning all die Jahre noch bestanden hat, wird sie nicht mitnehmen, der wird nun endlich ausrangiert. Und viele Dinge mehr, an denen der Junge einst hing und die er nun leichten Herzens zurücklassen, und sicher nicht vermissen wird. Seine Medaillen und Pokale aus Kinderfußballtagen zum Beispiel, sein erstes Freundschaftsband oder den Schalke 04-Schal oder das Tote-Hosen-Shirt. Wahrscheinlich kann man wirklich nur erwachsen werden, wenn man von Zuhause weggeht. Henning war nie ein Muttersöhnchen, immerhin arbeitet er schon seit einem Jahr auf Montage, war bei der Bundeswehr und hat sich und Thea leider auch diesen und jenen Jugendunfug nicht erspart, aber in seiner unaufgeräumten, verrauchten Jungmännerbude ist noch so viel Kinderzimmer, dass es Thea rührt.
Und sie, wird sie jetzt frei? So wie einst, als sie von Mutters Tisch ging und auszog, das Glück zu suchen und es doch immer nur halb zu fassen kriegte, bis sie endlich begriff, dass es einging, wenn man es gefangen halten wollte, wie die unzähligen Marienkäfer, die sie in Kindertagen in Marmeladengläsern hielt? Jetzt, da der Junge geht, und endlich auch diese unmittelbare Verantwortung aufhört, kann sie jetzt noch mal alle Freiheit wirklich erkennen, spüren, genießen? Und wird das noch die gleiche Freiheit sein wie damals? Natürlich wird sie das nicht sein. Denn die Verantwortungen sind zwar aus dem Sichtfeld und wohl auch aus der unmittelbaren Handlungsverpflichtung, aber sie sind nicht aus dem Gewissen. Und dort ziehen sie auch nicht aus.
Der Wind quält sich in der zäh stehenden Luft, die vor dem Fenster geht wie ein schwerer Hefeteig in der Kuchenschüssel, durch den der Quirl sich nur mühselig Bahn bricht.
Die ersten Blitze zucken am Himmel und ziehen Donnergroll nach sich. Noch halten sich Zeitabstände dazwischen, sodass Thea zählen kann, wie sie’s von der Großmutter gelernt hat, um auszumachen, wie weit weg das Gewitter noch ist, dann folgt aber Donnerschlag auf Donnerschlag, so laut und mächtig, dass Thea sich trotz der Wärme vorsichtshalber die Bettdecke über die Ohren zieht. Das geht so etwa zehn Minuten. Der Wind hat kräftig an Fahrt gewonnen. Irgendwann hört Thea das Martinshorn der Feuerwehr. Regen ergießt sich wie aus Eimern über den Platz.
Thea lauscht den tosenden Geräuschen. Die Baumkronen vor ihrem Fenster werfen bewegte Schatten auf die Front des Kleiderschrankes. Wild huschen sie in unaufhörlichem Tanz auf der glatten Fläche umher und entwerfen nervöse Bilder. In der Ferne schlägt eine Autotür zu, näher, wohl unten vor der Haustür, scheppert etwas über den Asphalt. Die Übergardinen bewegen sich sacht.
Thea empfindet Dankbarkeit für Dach und Bett und Brot. Schon immer empfindet sie die besonders, wenn es draußen unwirtlich ist. Auch zu Zeiten, da sich das Leben nach Theas Verständnis noch oberhalb des Baches befand und es ganz undenkbar war, dass es denselben jemals würde heruntergehen können, hatte Thea oft die Wärme von Sicherheit gespürt. Jetzt, nachdem es sich im Laufe der Jahre hier und da doch auch bachabwärts umgeschaut hat, ist die Sicherheit ungewiss geworden und das Bemühen um sie übt sich in Bescheidenheit.
Wann hatte das angefangen? Es war wohl die Zeit, als Thea auf die 30 zuging und in ihrem Leben alles stagnierte, aber doch irgendwie so weitergehen würde. Also es würde sich schon in einer Bewegung befinden, in einer ebenmäßigen, vorhersehbaren, erwarteten, belanglosen, aber sicheren Bewegung.
Thea hatte alles erledigt. Das Studium war abgeschlossen, der Arbeitsplatz, der fürs ganze Leben sein sollte, war nach dem zweiten Anlauf gefunden, ein Mann, der sie geheiratet hatte, ebenso, wenn auch nicht gleich im zweiten Versuch. Sie hatte Tochter und Sohn gekriegt und zu guter Letzt sogar eine Wohnung erkämpft oder besser, geduldig ausgeharrt, bis sie, Thea, an der Reihe war. Zwar hatte die Wohnung ein Zimmer zu wenig, aber sie würde ausreichend sein, und später, nachdem sich alles ebenmäßig, vorhersehbar, erwartet und belanglos, aber sicher weiterbewegt hätte, bis die Kinder einmal ausziehen würden, um ihrerseits ein eigenes vorhersehbares Leben zu leben, würde die Wohnung für Thea und den Mann ein gutes Tauschobjekt darstellen.
So sollte es sein, so gehörte es sich, so lief seinerzeit anständiges Leben. Deshalb merkte Thea auch lange Zeit nicht, wie ungeeignet das anständige Leben für sie war, oder wie ungeeignet Thea für ein anständiges Leben war.
Sie lebte und lebte und holte kaum Atem dabei, und wenn ihr Gefühl ihr Bauchschmerzen schickte, bevor sie zu einer Familienfeier sollte oder wenn es wieder mal Zeit war, Sex zu haben oder zum Zahnarzt zu gehen, was in etwa die gleichen Unbehaglichkeiten in der Magengegend machte, schließlich aber doch erledigt wurde, dann hielt Thea das für zum Leben dazugehörig, für etwas Unabdingbares, das man nicht ändern konnte. Wenn Beklemmungen sich gar zu sehr bemerkbar machten, dann schob Thea die Unbehaglichkeiten vom Tisch, fegte sie auf und das Beharrliche unter den Teppich, oder sie schluckte eine Tablette dagegen.
Uber die Sexsache konnte man nicht groß reden. Alle hinterließen den Eindruck, als wäre es etwas Wunderbares und als täten sie es unentwegt. Nur ab und an hörte man bei den Kolleginnen heraus, dass diese oder jene es doch auch für eine lästige Pflicht hielt. Fakt war jedenfalls, es wurde in keinem anderen Themenbereich so viel gelogen und so kläglich und verschämt gelacht wie beim Austausch über sexuelle Inhalte, um ein Bild von sich aufrechtzuerhalten, von dem man glaubte, dass die anderen es von einem haben müssten. Selbst innerhalb der Familie, oder gerade da, spielte man sich dieses Schmierentheater vor.
Ein anderes Leben zu führen, konnte Thea sich erst vorstellen, als sie das genormte Familienleben schon am Hals hatte, als alles, was man zu erstreben ihr anerzogen hatte, erreicht war, und eigentlich nichts mehr zu ändern.
Den ganz kurzen Moment, in dem alle Möglichkeiten offen liegen, in dem man vielleicht etwas entscheidet, hatte Thea gar nicht wahrgenommen. Und im Übrigen hatte man ihr von anderen Möglichkeiten nichts gesagt. Das kriegte man irgendwie mit, hatte es für sich selbst aber nie in Erwägung gezogen. Menschen, die allein lebten, taten das nicht freiwillig, und man bemitleidete sie, andere in gleichgeschlechtlichen Beziehungen wurden bestenfalls belächelt und nicht ernst genommen. Bestenfalls.
Thea hatte nichts entschieden. Sie hatte erfüllt, worauf von Anfang an alles hinauslief. Niemand hatte es von ihr verlangt, aber alle haben es erwartet. Thea auch. Sie hatte sich selbst zwangsverheiratet. Da war sie schon 27 Jahre alt und es war nach gesellschaftlichem Gutdünken allerhöchste Zeit. Sie hatte auch einen abhaben wollen, und bei Sonntagsspaziergängen hatten in ihrer Vorstellung gesunde, niedliche Kinder vor ihr herlaufen sollen.
Nicht, dass sie von morgens bis abends gelitten hätte, tagein tagaus, schon gar nicht sichtbar. Sie hatte gar keine Zeit dafür. Das Geschwür des Überdrusses wuchs zunächst unbemerkt und später, als es nicht mehr zu überfühlen war, hielt sie es vorsichtshalber für gutartig, nannte es aber schon insgeheim Zeitverschwendung. Bis es platzte. Aber auch da war noch lange nichts geändert. Die Kinder waren klein, der Mann schließlich war kein böses Untier. Aber Ben hatte immer so gut für sich gesorgt, dass er in allen Situationen am besten wegkam und Thea sich nie unterdrückt fühlen konnte. Allerdings denkt sie heute, dass Ben vielleicht gar nicht so viel dafür zu sorgen hatte, weil er naturgemäß einfach in der besseren Lage war. Ben war Mann. Er steckte zwar gemeinsam mit Thea in der Ehe- und Familienfalle, aber in der Mutterfalle steckte er nicht.
Und so wie die Wende Thea als Mutter relativ kleiner Kinder zum Verhängnis wurde, kam sie Ben zum Segen.
Thea und Ben waren zu Zeiten sicherer Grenzen eine Art theoretische Reformer, die mit Freunden gern die Nächte zum Tag redeten, die sich gern in auf der Liste stehenden Gruppen herumtrieben und dabei auch den leichten Schauder genossen, etwas Verbotenes zu tun, jedenfalls etwas nicht ganz Legales.
Aber bei Thea hätte es nie zum Märtyrer gereicht, schon gar nicht, als die Kinder bereits da waren. Ben war zuweilen etwas waghalsig, unvorsichtig, abenteuerlich. Er war darauf aus, von sich reden zu machen. Und er buhlte ständig um Anerkennung, die sein Vater ihm lebenslang verweigerte.
Thea gab sie ihm, und mehr, als er verdiente, sie verschaffte ihm sogar Möglichkeiten dazu, wenn es sich ergab. Sie führte ihn gelegentlich mit viel Aufmunterung wie ein drittes Kind. Ben brauchte so viel davon.
Er war in den 60er Jahren als Sohn eines Lehrers in einer kleinen Ackerbürgerstadt in Mecklenburg aufgewachsen. Der Beruf des Lehrers galt damals noch was, erst recht in einer Fünftausendseelengemeinde. Man wurde in Halten-zu-Gnaden-Manier gegrüßt, man kam gleich nach dem Arzt und dem Pastor. Und der Lehrer genoss dieses Privileg, war er doch aus einer nicht sonderlich gebildeten Arbeiterklassenfamilie gekommen, einer Familie, die seit Generationen mehr hinter der Stadt als in ihr lebte, in der Armenstraße, in der man sein Schmutzwasser in den Rinnstein kippte, in deren windschiefen Häusern die Fenster so tief lagen, dass ein Kind ohne Mühe von draußen durch die gesamte Wohnung sehen konnte. Durch das Wohnzimmer in die Küche bis zum Plumpsklo auf den Hof hinaus. Der Lehrer hatte überhaupt nur Lehrer werden können, weil der neue deutsche Staat nach dem Krieg auch der Arbeiterklasse, oder gerade ihr, später sogar nur ihr, eine Chance gab. Wem Bens Vater was zu verdanken hatte, würde er nie vergessen, d. h. was er seiner Frau diesbezüglich zu verdanken hatte, die mit ihm für die Abschlüsse gepaukt, Rechtschreibung geübt und die ihm auch politisch ein bisschen den Weg gewiesen hatte, war ihm nicht so bewusst. Aber der Partei würde er nichts vergessen, und der Partei würde er einen guten Sohn heranziehen. Ben.
Ben war nicht so gut in der Schule, wie ein Lehrer es sich für seinen Sohn wünschte. Er war auch kein schlechter Schüler. Ben war Mittelmaß. Er machte nicht von sich reden. Sein Vater war etwas enttäuscht von ihm, ohne dass er das je ausgesprochen hätte.





























