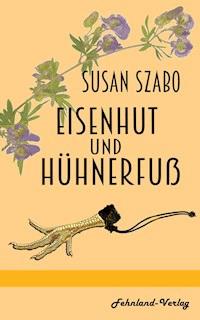
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fehnland-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der autistische Florian spricht nicht und lebt in einer ganz eigenen Welt. Dennoch ist er der Liebling von Carla, seiner Erzieherin, die in ihm eine ganz besondere Herausforderung sieht. Vergebens versucht sie, ihn zum Sprechen zu bringen. Doch seine Begabung liegt woanders, er entwickelt sich zu einem genialen Künstler. Nicht zuletzt deswegen wird Carlas Freund Oliver auf Florian eifersüchtig. Carla muss sich entscheiden, ob sie lieber zu Florian oder zu Oliver hält. Ihr Entschluss hat tragische Konsequenzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eisenhut und Hühnerfuß
Aus dem Leben eines Autisten
Roman
Susan Szabo
Erstausgabe im Februar 2018
Alle Rechte bei Verlag/Verleger
Copyright © 2018
Fehnland-Verlag
26817 Rhauderfehn
Dr.-Leewog-Str. 27
www.fehnland-verlag.de
Coverdesign: Scandals under cover; unter Verwendung eines Bildes von desertsands@Fotolia
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Epilog
1
Carla fieberte ihrer Ankunft entgegen. Sie hatte darauf bestanden, Florian zu übernehmen. Schließlich hatte sie sich durchgesetzt, sie sollte ihre Chance bekommen. Der VW-Bus bog in die geschotterte Zufahrtsstraße ein, und es knirschte unter den Rädern. Aufgewirbelter Staub puderte Gräser, Schafgarbe und Klatschmohn aschgrau. Endlich erreichten sie die geteerte Straße und fuhren im Schritttempo einige Meter weiter, bis sie vor einem wettergegerbten Haus stehen blieben. Carla schwang sich vom Beifahrersitz, nahm ihren Koffer und winkte zum Abschied dem Kollegen, der sie am Bahnhof abgeholt hatte. Sie atmete tief ein und lächelte, weil sie den vertrauten Stallmistgeruch fast wie den Duft eines kostbaren Parfüms genoss. Dann strich sie ein paar Haarsträhnen hinters Ohr und lief entschlossenen Schrittes zum Haus, den Koffer hinter sich herziehend.
Aus der Küche klang Dereks blecherne Stimme. »Deshalb warst du plötzlich so nervös. Du hast den Wagen gehört, du Schlaumeier, hörst und siehst alles.«
Sprach er mit Florian?
Bald drängte sich ihr ein Reigen fröhlicher Menschen entgegen, Derek voran. Alle begrüßten sie, jeder auf seine Art, manche mit einem Wortschwall, andere mit stillem Lächeln. Bis auf den einen, der misstrauisch um sich blickte. Das also war Florian. Ganz hinten neben Kerstin stand er und drückte sich gegen die Wand. Keinesfalls durfte sie ihn erschrecken. Also tat sie vorläufig so, als sähe sie ihn nicht.
Derek fragte, ob sie einen schönen Urlaub gehabt habe. »Ja, wunderbar«, sagte sie und fügte noch ein paar Worte über das Wetter hinzu. Was für Bedenken hatte sie gehabt, als dieser Zivi mit seinem saloppen Benehmen angefangen hatte. Doch Derek wurde trotz seiner schrägen Art eine echte Stütze.
Kevin, fünfzehnjährig und größer als Carla, warf seine Arme um sie, drückte sie fest an sich und ließ sie nicht wieder los. Sie tätschelte seinen Rücken und versuchte erst einmal nicht, sich aus seiner Umklammerung zu lösen.
Florian beobachtete das Geschehen mit weit aufgerissenen Augen. Wieder und wieder sah er auf die beiden, hielt den Anblick nicht aus und blickte zum Boden. Schließlich befreite sich Carla aus Kevins Umarmung. »Derek, möchtest du mir nicht unseren neuen Jungen vorstellen?«
»Komm, Florian, wo steckst du denn?«, bellte Derek.
Florian rührte sich nicht, also nahm ihn Kerstin bei der Hand und begleitete ihn. Er schaute zur Seite, gab Carla jedoch die Hand. Seine schlaffe, kurz vorm Bauch gehaltene Hand war weich und kühl. Als sie »Hallo, Florian!«, sagte, schoss er ihr einen Blick zu und zuckte zurück, als hätte er sich an ihrem Antlitz verbrannt. Trotzdem gelang es ihr, schnell in seine Augen zu sehen. Sie waren scheu und wachsam zugleich, und sie schienen zu flehen, tue mir nicht weh! Dann ging er auch schon wieder nach hinten.
Der Holzboden knarrte. Unaufhaltsam rückte Ben näher an Carla heran, als wolle er sie wie eine Dampfwalze überrollen. Das erste Mal, als er so auf sie zugekommen war, hatte sie aufgehört zu atmen. Wollte er ihr die Kehle zudrücken? Inzwischen wusste sie, Ben konnte niemandem etwas zuleide tun. Für die soziale Distanz, die Menschen gemeinhin untereinander einhielten, hatte er allerdings gar kein Gespür. So blieb er erst eine Handbreit vor ihr stehen und sagte: »Ach, Carla, ohne dich ist das Leben öde und leer.«
Eine solch raffinierte Redewendung hatte sie noch nie von ihm gehört. Sie habe ihn auch sehr vermisst. »Ohne euch alle ist auch mein Leben öde und leer.«
Das war keine Übertreibung. Am Anfang eines jeden Urlaubs fiel sie für gewöhnlich in ein tiefes Loch. Ohne ihre Jungs fühlte sie sich so nutzlos wie die tote Spinne mit den eingeknickten Beinen, die sie in ihrem Strandkorb entdeckt hatte. Nur hier in Waldheim war sie die Carla mit den helfenden Händen, nur hier war das Leben sinnvoll.
Nun blickte sie Ben mit gespitztem Mund an, und sie wusste schon, was er gleich fragen würde. »Wann bist du geboren?«
Das habe sie ihm doch oft genug gesagt. Ben blieb hartnäckig und wiederholte die Frage, während Derek die Augen rollte. Carla lächelte. »Okay. Dritter Juli, 1969.« Ben wiederholte das Datum und stellte die gleiche Frage noch einmal. Das ging ein paar Mal so hin und her, bis sie sagte: »Okay, Ben, jetzt weißt du’s.« Daraufhin marschierte Ben zu Florian und blieb erst stehen, als sich die beiden Nasenspitzen fast berührten. Laut forderte er ihn auf, sein Geburtsdatum zu nennen. Florian sprang einen Schritt zurück, schrie auf und lief davon.
»Mensch Ben, das hast du ihn schon mal gefragt. Der wird dir nie antworten, der kann doch nicht sprechen!«, mahnte Derek.
Spätabends stand Carla am Fenster ihres Dachzimmers und blickte hinunter auf Waldheim. Eins nach dem anderen gingen die Lichter in den Wohnhäusern an, während Schulhaus und Gemeinschaftszentrum dunkel blieben. Der Mond weißte den Glockenturm, ein freistehender, flacher Betonrahmen mit drei übereinander hängenden Glocken. Carla hatte sich inzwischen mit diesem modernistischen Turm angefreundet, sowie auch mit den anderen Waldheimer Bauten. Viele davon hatten überbordende Dächer, versteckte Eingänge und asymmetrische, zumeist fünfeckige Fenster.
Sie wandte sich vom Fenster ab. Die Vorhänge zog sie nicht zu. So konnte sie von ihrem Bett aus den Sternenhimmel betrachten, der in Waldheim so hell leuchtete, wie nirgendwo anders. Nur wenn sie unter diesen endlos vielen Sternen schlief, hatte sie schöne Träume. Im Urlaub dagegen waren nachts ganze Scharen von Dämonen aus dem Meer gestiegen und hatten versucht, sie zu sich hinunterzuziehen. Schauernd zog sie die Decke bis zur Nase.
Sie war froh, wieder an ihrem Arbeitsplatz zu sein, der zugleich ihr zu Hause war. Wie schnell die Zeit vergangen war, seitdem sie vor zwei Jahren hier angefangen hatte. Im Jahre 1992 hatte sie ein halbes Jahr lang in einer anderen Einrichtung gearbeitet, in der so gut wie alle Betreuten mit Psychopharmaka ruhiggestellt und einer eintönigen Routine unterworfen waren. Das muss doch anders gehen, dachte sie und suchte nach Alternativen, bis sie die Waldheimer Stellenanzeige entdeckte.
Zunächst, beim Vorstellungsgespräch, war sie erschrocken gewesen. Ein jeder würde sein nächstes Leben auf der Stufe beginnen, die er vor seinem Tode erreicht hatte, belehrte sie Dr. Weißmüller. Inzwischen fand Carla diese Vorstellung vorteilhaft für ihre Arbeit. Vielleicht war sie auch gar nicht so abwegig. Wenn es schon ein Leben nach dem Tode, also eine unsterbliche Seele geben sollte, warum dann nicht ein Leben nach dem anderen, jedes Mal in einem neuen Körper?
Als Studentin hatte sie einen kleinen autistischen Jungen während ihres Praktikums betreut. Erst gegen Ende der zehn Wochen war es ihr gelungen, seine Mauer aus Misstrauen und Angst ein Stück weit zu durchbrechen. Das Kind hörte auf, sie wegzuschubsen oder gar zu beißen, und ab und zu ließ es sich von ihr sogar an die Hand nehmen. Auch mit Florian würde es nicht einfach sein, aber sie war zuversichtlich.
Tief nach vorne gebeugt stand Florian am Gartentisch und rieb beharrlich über ein und dieselbe Stelle. Schon eine Weile hatten sie ihn durch die offene Tür beobachtet, bis es Kerstin nicht mehr aushielt und hinausging. »Florian, du sollst doch den ganzen Tisch wischen.« Aber es nützte nichts. Er blickte auf, hielt kurz inne und fuhr dann unverdrossen fort. »Okay, dann wird die Stelle halt besonders sauber.« Kerstin kam zurück und seufzte. Auch bei der Küchenarbeit sei er nicht zu gebrauchen. »Der schälte die Kartoffel die ganze Zeit nur an einer einzigen Stelle.« Selbst zu den einfachsten Tätigkeiten müssten sie ihn anleiten.
Carla presste die Nasenflügel zusammen und schniefte. Hatte Kerstin überhaupt nichts Gutes über Florian zu sagen? Sie war eine erfahrene Heilerzieherin. Sie müsste doch wissen, dass sie keinesfalls einem Schützling ein schwarzes Etikett anheften durfte.
»Wie kannst du nur so negativ über ihn reden? Du musst ihn doch so annehmen, wie er ist. Er arbeitet ja ununterbrochen, er bemüht sich doch!« Sie sah ihn eine Weile wieder an und lächelte dann. »Ich glaub, es steckt mehr in ihm, als man denkt.«
»Er sieht gut aus, nicht wahr, mit all den schwarzen Locken. Er hätte Schauspieler werden können«, meinte Kerstin dann versöhnlich.
Carla stimmte ihr zu, auch sie fand den Jungen attraktiv. »Komm Florian, bring den Lappen zurück in die Küche.« Er folgte sofort, mit langen, hüpfenden Schritten, wobei er jedoch einen Bogen um sie machte.
Auch an den folgenden Tagen rannte er immer schnell an ihr vorbei. Manchmal blieb er dabei stumm, vielfach stieß er hohe heulende Laute aus. Oft versteckte er sich in der Toilette und kam erst wieder heraus, nachdem sie weitergegangen war.
»Er braucht dich nicht einmal zu sehen, bevor er die Flucht ergreift«, bemerkte Derek. »Es genügt, dass er deine Schritte hört.« Kannte er das Klacksen ihrer Schuhsohlen auf den Holzdielen, das sich geringfügig von dem der anderen unterschied? Den besonderen Rhythmus ihres Gangs? Nur wenn es nicht anders ging, zum Beispiel bei den Mahlzeiten, hielt er sich in ihrer Nähe auf. Warum hatte Florian ausgerechnet vor ihr Angst?
Als Florian die große Küche mit den hellen Holzmöbeln und den bunten Sitzkissen betrat, die Küche also, worin alle anderen sich wohlfühlten, blieb er mittendrin stehen. Seine Augen feuerten Blicke ab, als wollten sie Feinde abwehren. Auch seine Mitbewohner, die bereits am Tisch saßen, wurden von einem finsteren Blick getroffen. Kerstin grüßte ihn, doch er sah nicht sie an, sondern den Wasserkocher in ihrer Hand.
Schon wieder guckt er auf ein Ding anstatt auf einen Menschen, dachte Carla und seufzte. Dennoch meinte sie, ihn ein Stück weit zu verstehen. Ja, Florian, Menschen findest du undurchschaubar und unberechenbar, das sind sie manchmal auch, aber doch nicht immer.
Zögerlich, wie zur Flucht bereit lief Florian dann doch zu dem Esstisch. Als er ihn erreichte, hielt er inne und verschob die Salz- und Pfefferstreuer. Genau dort hatten sie am vorigen Morgen gestanden. Florian nahm selbst die kleinsten Veränderungen in seiner Umgebung wahr, und sie störten ihn. So musste man den Rollladen in seinem Zimmer immer so herunterlassen, dass ein handbreiter Spalt offenblieb, über einen breiteren oder einen schmaleren regte er sich auf.
Seinen Milchkaffee trank er in einem Zug aus. Danach presste er eine erbsengroße Menge Butter auf sein Brötchen, biss hinein und kaute langsam. Wieder und wieder versuchte Carla, seinen Blick zu erhaschen, doch er ließ ihn durch den Raum zappeln, als verfolge er eine Fliege. Wenn er sie doch nur anschauen würde.
2
Sehnsüchtig sah Florian zu, wie die anderen Jungen Ball spielten und sich einander fröhlich zuriefen. Er ging nicht zu ihnen, sondern hockte am Rand des Gartens und pulte mit einem Stöckchen im Rasen. Niemand rief nach ihm, und von selbst ging er niemals auf Leute zu. Wie ein Gefangener blieb er in seiner Welt und fand nicht aus ihr heraus.
Es tat Carla weh, ihn so einsam zu sehen. Sie wollte zu ihm gehen, mit ihm spielen und schließlich für seine Aufnahme in der Gruppe sorgen. Sie tat es nicht, denn er würde vor ihr fliehen. Das hatte sie oft genug erleben müssen. Doch er würde sich ändern, da war sie sich sicher. Der Drang sich zu entwickeln, mit dem jeder Mensch geboren wird, war auch ihm in die Wiege gelegt worden. Bei ihm dauerte alles nur sehr viel länger.
Seine Furcht vor ihr blieb eine riesige Hürde.
»Ich glaub, er hat Angst vor deinen roten Haaren«, meinte Derek. Solche Haare habe er bestimmt noch nie gesehen. Oder vielleicht habe er mal jemanden mit roten Haaren gekannt, den er nicht mochte. Carla und Kerstin hielten nichts von dieser Hypothese. Doch so schnell wollte sie Derek nicht fallen lassen. »Auf die Haare guckt er immer ganz genau.«
»Ach, Quatsch«, sagte Kerstin und drehte sich zu Carla. »Ich glaub ich weiß, was es ist.« Dann redete sie aber nicht gleich weiter.
»Na, sag schon!«
Kerstin holte tief Luft. »Es stört ihn, dass du ihn immer anschaust.«
Carla schluckte. »Was? Tue ich das?«
»Ja«, sagten Kerstin und Derek gleichzeitig.
Carla musste einsehen, dass sie recht hatten. Es hatte keinen Sinn, es zu leugnen. Jede seiner Regungen, jede Stimmungsschwankung, jede Vorliebe und Abneigung kundschaftete sie aus. »Wir haben noch nie einen Autisten betreut. Ich versuche, ihn zu verstehen.«
»Du versuchst, ihn zu verstehen? Den kann man nicht verstehen.« Derek grinste. »Gib’s doch zu, du hast einfach einen Narren an ihm gefressen.«
Der Zivi konnte ganz schön frech sein. »Natürlich mag ich ihn. Das ist die Voraussetzung dafür, mit jemandem arbeiten zu können.«
Seit fast einer Stunde lag Carla wach im Bett und starrte auf den Sichelmond, der wie das weiße Segel eines unsichtbaren Schiffs von Ost nach West zog. Normalerweise schlief sie schnell ein, doch an diesem Abend kam sie nicht zur Ruhe. Sie hatte versucht, diskret zu sein, aber Autisten merkten alles. Ihre übertriebene Aufmerksamkeit entging Florian nicht und ängstigte ihn. Sie sah keinen anderen Weg, als ihn weniger zu beachten. Nur so konnte sie ihm helfen, seine Scheu vor ihr zu überwinden.
Sie blieb wach, und doch begann sie zu träumen. Florian würde sich wandeln und begreifen, dass Menschen wichtiger sind als Sachen, und dass es Sinn macht, mit ihnen zu kommunizieren. Florian würde sprechen!
Da er ihr noch immer aus dem Weg ging, blieb Derek sein Bezugsbetreuer. Er machte seine Sache gut, obwohl er manchmal etwas fragwürdige Methoden anwendete. Zum Beispiel die eine Gute-Nacht-Geschichte. Eines Abends blieb Carla hinter Florians schlitzbreit offener Tür stehen und hörte, wie Derek erzählte.
»So, und jetzt wird dir der Märchenonkel eine tolle Geschichte erzählen. Da war einmal ein junger Mann, und der hieß … der hieß Kered«, begann Derek. »Kered ging gerne in die Disco. Dort schluckte er meist mehrere E’s, und dann dachte sein Hirn Highspeed. Doch einmal nahm er ein paar zu viele Raver-Zuckerln. Aber das war nicht alles. Er nahm auch eine Nase nach der anderen. Und was passierte?« Hierauf machte er eine kurze Pause. »Komm, du musst nicht die Decke bis zur Nase hochziehen, so gruselig ist die Geschichte auch wieder nicht. Also, was passierte, eh?«, wiederholte er. »Weißt du nicht? Kered ist abgeschissen, und der Krankenwagen musste kommen. Kreislauf. Hätte sterben können. Und die Moral von der Geschichte ist, er beschloss, nie wieder so viele Pillen zu nehmen. Das ganze Leben mit einem zerfressenen Gehirn und Depris, das wollte er nicht.«
Leise trat Carla ein paar Schritte zurück. »Du verstehst alles, nicht wahr? Ich glaub, du bist in Wirklichkeit hochintelligent. Du verstellst dich nur«, sagte der Zivi, wünschte ihm eine gute Nacht, löschte das Licht und kam aus dem Zimmer.
»Hast du mit ihm gebetet?«, flüsterte Carla.
»O ja, gebetet. Wir haben ganz viel gebetet.«
Beide lächelten.
Zwei Jungen kehrten aus dem Urlaub in ihrer Familie zurück. Der eine hieß Jan und war obwohl im gleichen Alter viel kleiner als die anderen Jungen. Insbesondere sein Kopf schien einem kleineren Menschen als ihm selbst zu gehören. Sein Mund glich dem eines Greises, denn er hatte so gut wie keine Oberlippe. Nun bewegte sich der oberlippenlose Mund, während Jan von einem Besuch im Zoo erzählte und alles mehrmals wiederholte. Florian warf ihm finstere Blicke zu.
Stefan, der zweite Rückkehrer, war pummelig, hatte eine platte Nase, Mandelaugen und so gut wie gar keinen Hals. Florian sah aus sicherer Entfernung zu, während Ben ihn mit seiner Geburtsdatumfrage behelligte. Stefan sah sein fettleibiges Gegenüber unerschrocken an und nannte Tag und Monat seiner Geburt: »Thecthe Thuni.«
»Jawohl, sechster Juni«, übersetzte Carla.
Als Florian am nächsten Morgen in die Küche kam und Jan und Stefan am Tisch sitzen sah, ließ er einen gellenden Schrei los.
»He! Was ist das für ’n Begrüßung? Du machst mich noch wahnsinnig«, fuhr Derek hoch. »Nur weil zwei Kerle hinzugekommen sind, musst du doch nicht deine Sirene anschmeißen! Warum bin ich nicht ins Altersheim gegangen, warum, warum? Dort ist’s bestimmt totenstill.«
Das Geschimpfe half nicht gerade, Florian zu beruhigen. Blitzschnell schnappte er sich ein Glas vom Tisch und warf es durch die Küche. Es zerschellte neben Kerstins Fuß, die gerade am Herd stand und Rühreier kochte.
Carla kam einen Augenblick später in die Küche, sah die erschrockenen Gesichter und wurde von Ben mit eindringlicher Stimme aufgeklärt. Sie musste nicht lange überlegen, was zu tun war. Zuerst bat sie Florian, die Scherben aufzukehren, dann schickte sie ihn in sein Zimmer, er solle dort allein essen, unter Dereks Aufsicht.
Während sie frühstückte, grübelte Carla nach. Nun begann Florian also doch zu zeigen, was alles in ihm steckte. Derek kam zwar mit ihm zurecht, machte aber keine Fortschritte. Ganz im Gegenteil, Florian war schwieriger geworden und schrie auf, sobald ihm etwas nicht passte. Vielleicht spürte Florian, dass sie ihn aus seiner abgeschiedenen Welt herausholen wollte. War das sogar der Grund, weshalb er sie mied? Womöglich wollte er an seiner besonderen Welt festhalten, weil er sich immerhin in ihr zurechtfand. Eine einsame, beschränkte Welt zwar, aber dennoch die seine, die einzige, die er kannte. Es schien ihr dringlicher denn je, endlich Florians Bezugsbetreuerin zu werden.
Auch das Mittagessen nahm Florian in seinem Zimmer ein. Kopfschüttelnd sah Derek zu, wie er eine winzige Menge Soße mit der Gabel mühsam von den Bandnudeln abschabte und in den Mund schob. Er dürfe die Soße zusammen mit den Nudeln essen, belehrte ihn Derek. Florian lächelte und aß alle Nudeln samt Soße auf. Doch danach war wieder eins nach dem anderen an der Reihe. Zuerst das ganze Fleisch, dann sämtliche Erbsen und schließlich die verbliebenen Karotten.
»Ach, Florian, was bist du für ’n komischer Vogel«, meinte Derek. »Sonst bist du ein Chaot, und dann beim Essen bist du so pingelig.«
Am Abend durfte Florian wieder in die Küche. Doch nach wie vor saßen Jan und Stefan am Tisch, und darauf reagierte er wieder mit einem markerschütternden Schrei. Diesmal jedoch stand Stefan auf, trat mit gehobenem Zeigefinger ganz nah an ihn heran und mahnte: »Bith jeth till!« Florian starrte ihn verblüfft an und ging dann anstandslos zu seinem Platz. Stefan setzte sich forsch neben ihn. Florian blieb vorerst still und schaute ab und zu verstohlen nach Stefan. Der Pudding wurde serviert, und Florian verschlang ihn im Nu, was ungewöhnlich war, da er sonst langsam aß. Mit Deuten und Brummen verlangte er dann nach mehr. »Bith jeth till! Hath ohn enuk«, wies ihn Stefan zurecht. Florian verstummte sofort.
Auch an den folgenden Tagen nahm Stefan wie selbstverständlich neben Florian Platz und schenkte zuerst ihm und erst danach sich selbst Früchtetee ein. Als Derek dann das Essen verteilte, reichte ihm Stefan nicht nur den eigenen Teller, sondern auch Florians. Während der Mahlzeit redete Florians extrovertierter neuer Freund auf ihn ein, als würde er gar nicht merken, dass dieser nie antwortete. Es stimmte auch nicht ganz, dass er keinerlei Antwort bekam. Florian strahlte ihn an.
3
Das Telefon klingelte, und es meldete sich eine Person, mit der Oliver nie gerechnet hätte. Ina Krug. Seit der Abi-Feier hatte er sie nicht mehr gesehen. Sie besuche gerade ihre Eltern und würde ihn gerne treffen.
Die Blässe wich aus seinem Gesicht. »Wär’ toll. Würde es dir morgen Nachmittag passen?«
Ina wollte ihn wiedersehen. War sie denn wieder solo? Er tauschte seine Pantoffeln gegen auf Hochglanz polierte Schuhe ein und pfiff das Hitmotiv aus Whitney Houstons »I will always love you«. Er sah Ina noch, wie sie vor ihm in die Schule lief. Ein wehender Vorhang flachsblondes Haar, ein superrunder Po in engen Jeans. Doch während er sich tagelang überlegte, wie er sie ansprechen sollte, schnappte sie ihm ein anderer weg.
Hastig zündete er sich eine Zigarette an. Wie lange es doch schon her war, seitdem er sich mit einer Frau getroffen hatte. Monatelang. Und seitdem er mit einer geschlafen hatte? Vor zwei Jahren. Seine Traumfrau tauchte einfach nicht auf. Er meinte, in Germatingen alle zu kennen, die in Frage kämen, und mit keiner konnte er sich vorstellen zusammenzubleiben. Als Hotelier traf er natürlich auch Frauen von anderswo, doch inzwischen sprach er nur selten eine an. Selbst wenn eine Alleinreisende keinen Ehering trug, war sie zumeist schon gebunden. Nicht selten machte ihm ein Zimmermädchen schöne Augen. Aber mit Opportunistinnen und Aufsteigerinnen ließ er sich nicht ein, und ein One-Night-Stand war schon gar nicht sein Ding.
Er sah auf seine Uhr, seufzte und fuhr mit der Hand übers Kinn. Rasieren musste er sich noch. Er nahm noch einen letzten Zug und pustete Rauch gegen sein Spiegelbild, der gleich verpuffte, als wüsste er nicht wohin. Er dachte an seinen Großvater, einen Meister des Rauchringblasens, und wie seine Ringe in Form geheimnisvoller Zeichen in der Luft geschwebt waren. Wie gerne er diese Kunst von ihm gelernt hätte.
Als er das Restaurant betrat, stand seine Mutter auf ihrem Posten hinter der Theke. Bis jetzt sei nicht viel los. Er nickte, nur ein Tisch war besetzt. Seine Mutter räusperte sich.
»Hast du vor, morgen in deinem Atelier zu arbeiten?«
»Warum?«, fragte er misstrauisch.
»Na ja, ich hab diese Deckenlampe gekauft.«
»Und du willst, dass ich sie montiere. Tut mir leid, morgen geht’s nicht. Ich hab Besuch.« Keinesfalls wollte er vor Inas Besuch schwitzend auf einer Leiter stehen.
Seine Mutter hob die Brauen. »Oh, aber nicht von einer Dame?«
»Ja, doch.«
»Mein Junge, du glaubst nicht, wie mich das freut. Du musst doch endlich ein Mädel finden.« Sie grinste breit, zeigte ihre Zähne, als wollte sie ein Stück Mädel abbeißen. »Heiraten sollst du, und Kinder kriegen!«
Das war nicht das erste Mal, dass sie auf diese dreiste Art ihre Vorstellungen über seine Zukunft kundtat.
Ina war noch immer attraktiv, hatte aber inzwischen kurze Haare. Oliver schlug einen Spaziergang vor. Das schien ihm der beste Weg, zwanglos einander näher zu kommen. Also schlenderten sie die Uferpromenade entlang und beobachten, wie kreischende Möwen die Wasseroberfläche als Abflug- und Landebahn benutzten. Während der See sein silbrig funkelndes Kleid gegen ein glattes, zart türkises tauschte, unterhielten sie sich über ihre Schulzeit. Ina erinnerte sich an die Theaterkulisse, die Oliver für Die Physiker entworfen hatte.
Dass sie das noch wusste. Er blieb stehen, drehte sich zu ihr und sah in ihr hübsches Gesicht, um das er am liebsten gleich seine Hände gelegt hätte. »Ach, das war nichts gegen diese Irrenärztin, die du gespielt hast.«
Sie liefen weiter, und Oliver fragte Ina, was sie in letzter Zeit mache. Sie wohne in Freiburg und sei Apothekerin geworden. Hier in Germatingen stehe jetzt die Kur-Apotheke zum Verkauf, das sei ihr Traum, endlich eine eigene Apotheke zu leiten.
»Ihr habt seit Ewigkeiten euer eigenes Geschäft. Es scheint gut zu laufen, das Hotel, ist ja immer voll.«
»Ich kann mich nicht beschweren«, sagte er, »eigentlich sollte ich glücklich sein.« Natürlich wollte sie wissen, warum das nicht der Fall sei. »Ich mag nicht Hotelier spielen. Aber ich hatte keine Wahl. Meine Eltern hatten schon immer von mir erwartet, dass ich das Hotel übernehme.« In Wirklichkeit habe man immer eine Wahl, entgegnete sie. Er stieß ein gequältes Lachen hervor. »Eine Wahl? Was bist du für eine Existenzialistin.«
»Na ja, ich meine nur, du bist doch verantwortlich für das, was du machst.«
Ja, das wusste er, auch wenn er selten darüber nachdachte. Wenn er sich anders entschieden hätte, wäre er jetzt ein anderer Mensch.
»Du hast recht. Als junger Mensch hatte ich nicht genug Mut.«
»Mut, um was zu tun?«
»Um Kunst zu studieren.«
»Aha, darin wärst du bestimmt auch gut gewesen. Aber es ist ein schönes Hotel in herrlicher Lage, insofern hast du Glück.«
Sie setzten sich auf eine Bank und schauten einem alten Mann zu, der von einem Bootssteg aus Schwäne fütterte. Die Vögel streckten ihre Hälse vor, bis sie unglaublich lang wurden, und fraßen ihm aus der Hand. Oliver sog die nach Algen und Nässe riechende Luft ein und legte den Arm um Ina. Er hätte sie gerne geküsst, aber vielleicht war es noch zu früh. Zudem kannte ihn hier jeder, Aldo von der Eisdiele guckte schon.
Sie kehrten zurück, und Ina ließ ihren Blick über die gelb getünchte Jugendstilvilla gleiten. »Ich mochte schon immer eure Villa. Dieses Schmiedegitter mit den zwei Blumen da oben ist wunderschön. Als Kind kamen die mir wie zwei Augen vor, und ich dachte, eure Haustür guckt mich an.« Sie lachte, und er lachte mit.
Oliver schaute die Villa an, als sehe er sie zum ersten Mal, und auf einmal war er auf sie stolz. »Mein Urgroßvater hat die Villa 1903 gebaut. Ich wohne oben, meine Mutter unten.« Er wollte Ina zu sich einladen, spürte fast schon ihre Lippen auf seinem Mund. Da kam so plötzlich wie ein Kuckuck aus der Uhr seine Mutter aus dem Haus und sprang auf die beiden zu. Er stellte ihr Ina vor. »Oh, kommt doch rein auf ein Gläschen Sekt, ich hab einen ganz speziellen aus der Spitalkellerei.« Er wollte schon ablehnen, als er Ina »Ja, gerne«, sagen hörte. War sie verrückt?
Kaum hatten sie sich zugeprostet, wurde Ina mit Fragen gelöchert.
»Freiburg!«, rief Frau Sauter aus, »die Apotheke am Zähringer Tor? Die kenne ich.« Wie lange Ina dort schon arbeite, wie sie ihren Chef fände, wie viele andere Apotheken es in Freiburg gebe. Nachdem das Thema Apotheke erschöpft war, ging es um Oliver. »Ich würde es ohne ihn gar nicht schaffen.« Voll und ganz fülle er die Lücke aus, die sein Vater hinterlassen habe. Vor neuen Bekannten trällerte sie immer Lobesarien auf ihn. Sie, die großartige Mutter, Oliver, ihr großartiger Sohn. Trotz besseren Wissens freute er sich über die preisenden Worte, genauer gesagt, über den guten Eindruck, den diese wohl auf Ina machten. Fast war er versucht zu glauben, dass seine Mutter endlich eingesehen habe, was sie an ihm hatte.
Frau Sauter wollte nachschenken, doch die beiden lehnten ab, also goss sie sich selbst wieder ein und redete weiter. Oliver hörte längst nicht mehr zu. Als Ina schließlich gehen wollte, stand er ebenfalls auf, doch seine Mutter sagte: »Ich muss unbedingt noch mit dir reden.«
»Ja, Mama, nachher«, vertröstete er sie, drehte sich zu Ina und bot ihr an, sie nach Hause zu begleiten. Doch nun bestand sie darauf, alleine zu gehen. »Ich ruf’ dich an«, konnte er ihr gerade noch sagen.
»Also, was ist?«, bellte er.
»Ich muss Morgen zum Zahnarzt, hab ich ganz vergessen, dir zu sagen, und in der Zeit erwarten wir die Handwerker für die neuen Rollläden.
Er würde also nicht wie sonst am Montag ungestört in seinem Atelier arbeiten können. Machte sie das absichtlich, ihn von seiner künstlerischen Arbeit abzuhalten? »Kannst du nicht den Zahnarzttermin verschieben?«
»Ach, Jungchen, es ist doch schwer genug, einen Termin zu bekommen. Du hast doch sonst genug Zeit zum Malen, es ist doch nur ’n Hobby. Da geht manchmal anderes vor.«
Er sagte nichts mehr, schluckte seine Wut hinunter.
Es dauerte keine achtundvierzig Stunden, bis seine Mutter ihr Urteil über Ina verkündete. »Sie ist komisch, irgendwie komisch. Glaub mir, ich hab viel Erfahrung mit Menschen, und etwas stimmt mit ihr nicht.«
»Ich finde sie sehr normal und sehr nett«, knurrte Oliver zurück.
4
Alle waren sie schön. Originell und seltsam waren sie auch. Er liebte jede von ihnen. Wie freundlich Jacquelines großes rechtes Auge ihn heute anblickte. Er lächelte. »Hallo mein Schatz!«
Oliver saß in seinem Wohnzimmer, umgeben von seinen Damen und trank noch einen Kaffee, bevor er los musste. Jeden Tag liebäugelte er mit einer anderen. Mal bevorzugte er Dora, am folgenden Tag Marie-Therese, dann wieder die Amerikanerin Lee Miller. Und heute war es die mit den schwarzen Augen und schön geschwungenen Brauen mit der er kokettierte: Jacqueline.
Zugegeben, es waren nicht wirklich seine Damen, mit denen er sich so intensiv beschäftigte, sondern Picassos. Dicht nebeneinander hingen an einer Wand ihre Porträts. Hier in seinem Damenkreis fühlte er sich wohl, hier war sein Refugium. Hätte er es nur nicht verlassen, so wäre ihm an diesem Tag nichts Schlimmes passiert.
Er blickte auf seine Uhr und sprang auf. Schnell hakte er die Fliege um den Hals, schnappte sein Sakko und stürmte die Treppe hinunter. Zwei Minuten später war er im Hotel Ochsen, einem malerischen Bau mit einem schmucken steilen Giebel und Bogenfenstern.
Er eilte in die Hotelküche, wo es nach gebackenem Fisch roch. Stanko teilte ihm mit, die sechs Gäste am großen Tisch hätten alle Doraden bestellt, gleich seien sie fertig. Seine Mutter hatte den Meeresfisch gerade erst auf die Karte gesetzt, darauf versessen, das Image des Hotels durch französisch anmutende Speisen aufzupolieren. Sein Einwand, es sei vernünftiger, ausschließlich Bodensee-Fische anzubieten, ließ sie nicht gelten. Im Nachhinein ärgerte er sich, die Fremdfische tatsächlich auch eingekauft zu haben. Sie füllten eine halbe Tiefkühltruhe und vergeudeten so Energie und Platz. Am liebsten hätte er sie den Fischreihern zum Fraß vorgeworfen.
Oliver begrüßte die Gäste und prüfte nach, ob sie schon Fischbestecke hatten. Gut, dass sie alle das Gleiche essen wollten, so würde sich die Bedienung einfach gestalten. Es schien sich um ein Elternpaar, Sohn, Großeltern und vielleicht eine junge Tante zu handeln. Die Tante nahm bereits eine Scheibe Baguette. Über ihren Brotteller gebeugt, hielt sie diese mit beiden Händen. Mit der rechten Hand zupfte sie Stückchen ab, stopfte sie mit der Linken, deren kleiner Finger steif abgespreizt, in den Mund und kaute nagetierschnell. Während sie so aß, erzählte sie von ihrer Urlaubsreise in die Türkei.
»Und dann hat mich der Kellner zur Begrüßung auch noch angetatscht. Gleich am Morgen angetatscht.« Na, mit mir wirst du zufrieden sein, dachte Oliver, nie würde ich dich berühren.
Stanko hatte die Doraden auf einer großen ovalen Platte angerichtet. So schön wie gemalt lagen die silbern glänzenden Fische auf ihrem Bett aus Tomatenscheiben und Fenchelspalten, garniert mit Zitronenscheiben und halbierten grünen Oliven. Vielleicht sollten wir Stankos Gehalt erhöhen, überlegte Oliver. Schwungvoll trug er das Gericht zu dem großen Tisch, wo die Gäste sich beeindruckt zeigten.
Oliver setzte die Platte ab, die so groß war, dass sie ein wenig über den Rand des Serviertischchens ragte. Jetzt konnte es ans Filetieren gehen. Zuerst entfernte er die obere Hälfte der Fischhaut, schnitt dann hinter dem Kopf ein und führte das Messer bis zum Schwanz. Vorsichtig löste er das erste Filet von den Gräten, legte es auf einen Teller und entfernte dann Kopf und Rückgrat von dem Übriggebliebenen. Das zweite Filet hob er von der Haut ab und platzierte es neben dem Ersten. Diesen Vorgang wiederholte er mit zwei weiteren Fischen und wurde dabei immer flinker. Doch dann, während er gerade an den Tisch ging, geschah Schreckliches. Eine alte Dame mit Gehstock lief an ihm vorbei und stieß gegen den Serviertisch. Die Platte mit den Fischen krachte zu Boden.
»Nein!« Fassungslos blickte er auf die am Boden verstreuten Doraden. Die Alte entschuldigte sich. Die Tante am Tisch lächelte schadenfroh. Das blasse Auge eines Fischkopfs starrte ihn an. Schnell hatte er sich wieder im Griff. Vor gaffendem Publikum hob er die Platte wieder auf. Mit Stoffservietten deckte er zwei ganze Fische, einen fast heilen Artgenossen und drei Fischköpfe mit skelettiertem Rumpf ab. Dann rannte er in die Küche und bat das Küchenmädchen, die Fischreste zu beseitigen. Stanko erhielt den Auftrag, sofort neue Fische zuzubereiten.
Selbstverständlich gehe das Essen auf Kosten des Hauses, meinte Oliver zur Familie, die zu seiner Erleichterung eher einen belustigten als einen verärgerten Eindruck machte. Während die Küchenhilfe den Boden kehrte, kam seine Mutter ins Restaurant. Sofort erfasste ihr Blick die peinliche Szene und heftete sich dann auf ihn. Schnell machte sie kehrt und lief hinter die Theke, denn wie zumeist war sie verantwortlich für den Ausschank. Er ging zu ihr.
»Ich kann dir sagen, wie das passiert ist.«
»Jetzt nicht!«, zischte sie.
Oliver schlug die Kunstzeitschrift Art auf. »Mit kulinarischen Happenings bringt der Künstler Leben in die Kunst«, las er. Die Abbildung zeigte eine quadratische Platte, darauf schmutzige Teller, Besteck, Tassen und Gläser, Flaschen, zerknüllte Servietten, Brotreste, eine leere Zigarettenpackung, einen vollen Aschenbecher und einen Blumenstrauß, alles von oben gesehen. Das sollte also ein beachtenswertes Kunstwerk sein? Skeptisch hielt er die Zeitschrift auf Armlänge vor sich und kniff die Augen halb zu. Erst jetzt erkannte er, wie ästhetisch die verschiedenen Objekte angeordnet waren. Der Blumenstrauß stand an genau dem richtigen Fleck, das linienförmige Besteck kontrastierte mit den runden Tellern, die dunkle Farbe des Holzes mit der weißen des Geschirrs.
Er hatte ähnlich zugemüllte Tische abserviert, ohne jedoch ein künstlerisches Element darin zu entdecken. Denn das hätte ein kurzes Innehalten vorausgesetzt. Ein Moment, indem ihm ein verspieltes Lächeln über die Lippen gehuscht wäre, während er die Gegenstände auf dem Tisch hin und her rückte. Undenkbar, so etwas bei der Arbeit im Restaurant tatsächlich zu machen. Dort musste man nichts als effizient sein.
Er seufzte. Das, was die anderen als Nebensache betrachteten, war für ihn die Hauptsache. Und umgekehrt. Genauer gesagt, die Kunst war seine Leidenschaft, das Hotel seine Last. Aber auch seine Pflicht. Schließlich war er das einzige Kind einer Mutter, die ihn brauchte und Alleinerbe eines traditionsreichen Familienbetriebs.
Doch wenn er außer der Hotelarbeit nichts anderes gehabt hätte, wäre er depressiv geworden. Aber er hatte ja sein Atelier.
Oliver stand vor seinem neuen Werk. Das Missgeschick mit den Fischen hatte ihn zu einer Collage inspiriert. Es waren keine dicken Doraden, sondern hagere Hechte aus Blechdosen geschnitten, die wie Flugzeuge in einem knallroten Himmel über der Skyline von New York flogen. Links hatte er mit schwarzer Tusche das Chrysler Building gemalt, die mehrbogige Spitze übergroß. Auf der anderen Seite das World Trade Center, beide Türme nach rechts gelehnt, als kippten sie jeden Moment um.
Am folgenden Morgen holte er seine Mutter auf dem Weg ins Hotel ein. Sogleich beschwerte sie sich über den Vorfall mit den Fischen. »Wie konntest du nur so ungeschickt sein?«
Er wollte ihr schildern, wie es zu dem Unglück gekommen war, doch sie ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Mit Fischen rumzuwerfen. Ich hätte vor Scham im Boden versinken können. Zum Glück waren es Touristen und keine Stammgäste.«
Trotzig schob er das Kinn vor. »Ich sag dir, warum das Tablett gekippt ist. Weil deine blöden Doraden viel mehr wiegen als unsere schlanken Felchen.« Mit geballten Fäusten stampfte er weiter.
»Eine idiotische Ausrede«, rief sie ihm hinterher.
5
Oliver machte eine Pause, trank Kaffee und las den Germatinger Anzeiger. Viel lieber las er den Südkurier, aber als Direktor des größten Hotels vor Ort musste er über lokale Ereignisse informiert sein. Doch Größe war eine relative Sache. Mit seinen zweiundvierzig Zimmern wäre das Hotel Ochsen in einer Stadt wie New York klein. Er seufzte. Wie viel lieber er in New York wäre.
Er blätterte um und las einen Artikel über Waldheim, das Behindertenheim oberhalb der Stadt. Dort wollte man die älteren Gebäude renovieren und neue errichten, weil die Zahl der Betreuten stetig zunahm.
Olivers Friseur fuhr regelmäßig nach Waldheim, um den Behinderten die Haare zu schneiden. Auch sein Optiker, sowie Handwerker, Ärzte, Apotheker und nicht zuletzt Banker profitierten von dem Heim. Sogar Oliver hatte von ihm einen Nutzen, denn einige der Angehörigen übernachteten regelmäßig im Hotel. Doch er selbst war nie dort gewesen.





























