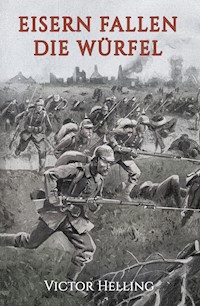
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Etwas Ungeheuerliches lag in der Luft. In unsagbarer Spannung, die nun schon seit Wochen über der ganzen Welt lastete. Deutschland harrte seiner Schicksalsstunde entgegen. "Rußland hat heute Nacht an zwei Stellen deutsches Reichsgebiet angegriffen und damit den Krieg gegen uns eröffnet. Frankreich hat die volle Mobilisierung der französischen Streitkräfte angeordnet! Mit seinen Massenheeren kamen die Söhne des heiligen Rußland, um das kleine Deutschland, das sich nach allen Himmelsrichtungen zu wehren hatte, einfach zu zermalmen. Eine Vorahnung naher Schrecknisse. Ernsten und entschlossenen Mutes geht das deutsche Volk dem Sturm entgegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eisern fallen die Würfel . . .
Roman aus dem Weltkriege 1914
von
Victor Helling
_______
Erstmals erschienen im:
Verlag von Heinrich Minden,
Dresden und Leipzig, 1915
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2018 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-111-0
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
I.
„Eisern fallen die Würfel.“
Schiller,
Etwas Ungeheuerliches lag in der Luft. In unsagbarer Spannung, die nun schon seit Wochen über der ganzen Welt lastete, harrte Deutschland seiner Schicksalsstunde entgegen. In fieberhafter Erregung drängte und wogte die Menge „Unter den Linden“, über die die Sonne des ersten August ihr goldenes Füllhorn ausgegossen hatte.
Das war nicht mehr der gewohnte Pulsschlag des großstädtischen Verkehrs, nicht mehr die Luft, die vom Weltleben der Großstadt bebt, waren nicht mehr die Menschen, die hier im gewohnten Gleis gehen und hasten und dahinfluten, nicht mehr Arbeit und Vergnügen, Streben und Müßiggang, Hass und Liebe, die den Strom der Hunderte und Tausende dahingleiten ließ: — ein Meer der Erregung und der Bewegung brauste durch die Gassen . . .
Seit gestern Mittag hatte der Kaiser, jäh seine Nordlandsfahrt unterbrechend, und nach Potsdam eilend, den Kriegszustand in Deutschland erklärt. Trommelschlag und Trompetenschall hatten es der atemlos harrenden Menge an der Zeughaus-Wache verkündet, und anfangs schien es, als hätte sich damit die elektrische Stimmung lösen wollen, die seit zehn Tagen über der Reichshauptstadt gelegen hatte. Wie eine Lawine hatte sich die Nachricht donnernd durch die sonnenbeschienene Stadt gewälzt, bis dann, nach der ersten wallenden Aufregung der Ernst der Stunde über die Hunderttausende gekommen war, vor denen her durch alle Adern der Riesenstadt die Kunde lief: „Krieg! Kriegszustand!“
Und wie einst, als auch ein Julihimmel über den Linden der deutschen Kaiserstadt blaute, durchzuckte es die Menge. „Wie 70! Genau wie 70!“
Jawohl, er mochte recht haben, der Graubart mit den funkelnden Augen. Es war wie 70, wie an jenem Todestage der unvergesslichen Königin Luise, wo auch das Ungeheuerliche heranrollte, und auch in dem grauen Schloss an der Spree das letzte Wort gesprochen wurde. Und, wie damals, senkte sich die Schwere der Zeit auf alle denkenden und fühlenden Menschen und der laut lärmende Rausch und der Sang verstummte, der die Tage zuvor aus tausend und abertausend Kehlen zum Himmel gedrungen war.
Ernst und schwer hatte man die gewaltige Kunde nach Hause getragen. Und dann war es herausgeströmt aus den Häusern und Höfen, gestern Abend, gestern Nacht, in breiten Zügen nach der alten Berliner Prachtstraße. Und wie gestern, standen sie heute, an des schicksalsschweren Mondes erstem Tage, wieder dichtgekeilt, harrend und bangend unter diesen Linden, wo jeder Stein eine Geschichte hat, wo des Deutschen Reiches Freuden und Leiden sich abgespielt hatten, wo der Gatte, der Vater, der Sohn, der Ernährer hinausgezogen war, wo dereinst helljubelnde Menschen die Heimkehr des greisen Heldenkaisers und seine sieggewohnten Scharen gefeiert hatten, unter diesen Linden, wo Frauen gebetet und Greise und Kinder geweint hatten. Nie ernster als heute hatte der Flügelschlag der Zeit herübergerauscht und sich lastend herniedergesenkt.
„Kronrat im Schlosse!“ Man wusste es. Immer aufs Neue kamen Extrablätter, immer neue Nachrichten brachten die Tausende, die sich heranwälzten. Die Tragödie, die damit begonnen hatte, dass hinten fern im Balkanland ein verschlagenes Slawenvolk unseren treuen österreichischen Bundesgenossen das Schwert in die Hand gezwungen hatte, entwickelte sich mit Blitzesschnelle.
Kronrat im Schlosse! An das insgeheim fieberhaft rüstende und dabei Frieden heuchelnde Russland ein Ultimatum! Die Frist lief ab, war schon abgelaufen. Vor einer Stunde war der Reichskanzler im Auto von der Wilhelmstraße ins Schloss gefahren. Alle Diplomaten und Würdenträger, alle Prinzen sollten im Schlosse versammelt sein. Von Mund zu Mund war’s gegangen. Nun wussten’s alle. Eine Kette von berittenen Schutzleuten schob sich nach dem Lustgarten vor, Offiziere standen vor der Rampe des Schlosses, wo die steinernen Rossebändiger auf hohem Sockel neben dem Standbild des Großen Kurfürsten stehen. Studenten und Knaben klettern über die trennenden Schranken. Aber auch ernste Männer drängen sich vor. Der Kaiser wird sich zeigen — sie wissen’s alle — er wird den Balkon betreten und zu seinem Volke reden!
Der eine junge Offizier in der Uniform des Alexander-Regiments, der dicht neben dem Wachtposten steht, fährt herum: Rief ihn da nicht jemand? Ja, richtig, da hört er’s wieder: „Werner, ich bin’s! Hallo, alter Junge!“
„Onkel Fritz, Du?!“
Der alte Herr mit dem grauen Schnurrbart im Reiseanzug hat den weißen Hut in der Hand und wischt sich die Stirn. „Ja, Werner! Ich seh’ Dich schon ‘ne kleine Ewigkeit. Hab’ Dich sofort erkannt. Aber bis ich ‘rankam, bis ich mich hier durcharbeiten konnte, das war ‘n Kunststück, das gemacht sein will!“ Mit gebräuntem Gesicht steht er nun vor dem Oberleutnant.
„Ich hatte ja keine Ahnung, dass Du — dass Ihr schon zurück seid, Onkel! Mutter schrieb doch noch gestern aus Westerland —“
„Na ja doch! Waren wir auch noch vorgestern. Aber seit vier Stunden sind wir in Berlin. Die Reise vergess’ ich mein Lebtag nicht. Na, ich erzähl’ Dir das später! Jetzt gibt’s Wichtigeres. Du kannst Dir wohl denken, warum ich mich schnurstracks bis hierher durchgewunden hab’. Kronrat, nicht wahr?“
Oberleutnant v. Babenberg nickte. Über das junge, hübsche Gesicht mit dem kleinen, blonden Bartanflug flog ein Schatten. Auch er besann sich, dass jetzt keine Zeit war zu alltäglichem Geplauder. Hier nicht und vor allem in dieser Stunde nicht.
„Gewiss“, sagte er. „Majestät hält Kronrat. Die Russen sollen das Ultimatum gar nicht beantwortet haben.“
„Dacht’ ich mir fast. Na, warte!“ Er machte eine Faust. „Sieht den Kriegshetzern an der Newa ähnlich. Ehrliche Art kennt man da nicht. O über unsere verfluchte Langmut — nimm’s mir nicht übel, aber ich hab’ schon lang’ daran geschluckt, dass wir mit den Kerls so viel Federlesen machen. Und die Franzosen blasen natürlich in dieselbe Trompete. Jetzt lohnen sie unsere Geduld auf ihre Art. Na. sei’s drum! Wann marschiert Ihr los, mein Junge, gegen die „Ehrenmänner“ und Ruhestörer? Oder haste heut’ Abend noch ‘n Sprung Zeit für uns?“
Nun lächelte der andere doch. „Ich glaube — ja“, sagte er, „obwohl ich nicht der einzige bin, der am liebsten gleich direktemang von hier aus loszöge — einerlei, ob gegen die Kosaken oder übern Rhein!“
„Bravo!“ scholl’s als Antwort. Aber es war nicht Onkel Fritz Schmellin, der es rief. Es war einer der Umstehenden, ein Mann im Werktagskleid, grau den Bart und das Haar, aber klare Augen sahen aus den von den Jahren verwitterten Zügen. „Bravo! sag’ ich, und das sollen mir der Herr Oberleutnant nicht übel nehmen. ‘s kommt von Herzen, und jlooben müssen se dran, die Wortbrecher! Un von mir, das sag’ ick Sie, müssen jleich dreie mit, wenn’s nu ans Losschlagen jetzt!“
„Was? Drei Söhne?“ Herr v. Schmellin hatte sich herumgedreht. Jetzt sah er, dass der Berliner im Knopfloch ein buntes Bändchen hatte — gelb zum Teil, zum Teil schwarz-weiß-rot. Also war’s ein alter Kämpfer. Das waren ja die Schnallen von der Kriegsdenkmünze von 70 und von der Hundertjahrfeier des alten Heldenkaisers. Gleich dreie, Mann?“
„Ja, det soll so sein un nich anders, un ich kann’s Ihnen sagen, dass die Jungens ihre Sache jut machen werden. Un der Jüngste — denn ick habe noch ein’ — wo bei Siemens-Schuckert noch lernt“, — fuhr er redselig fort, „der fragt mich ooch schon alle Zeit, ob ich ihm nich ins Feld lassen will. Det is ja wie verhext mit die Leute, — ooch in die Fabrik auf einmal, so hat det jezündet, wat in der Luft liegt. Nischt mehr von Partei, meine Herren, nischt —“
Ein Hurrarufen, das von der Menge am anderen Teil des Schlosses kam, unterbrach ihn. Das Hurraschreien schwoll an, man schwenkte die Hüte, man hob sich auf die Zehenspitzen, aber nur wenige sahen überhaupt, wem die Kundgebung galt. Man war an derartige Huldigungen zu sehr gewöhnt. Spontan pflegten sie bald hier, bald dort auszubrechen. Wo die Luft so geschwellt war mit Ereignissen, war jedes Hurra, das aufbrauste, wie ein großes befreiendes Atmen, das durch die Reihen ging. Die Stimmung, aber auch die Spannung dieser großen Tage war keiner Steigerung mehr fähig.
„Hast Du was gesehen, Werner?“ Onkel Fritz hatte vergeblich den Hals gereckt. Trotz seiner Körpergröße, die bei den Schmellins erb- und eigentümlich war, hatte er nichts erspähen können. Der Leutnant stand etwas höher. „Ein Auto!“ antwortete er. „Es saß ein Generalstäbler drin, wenn ich richtig sah. Er richtete sich im Wagen auf —“ Wieder klangen von ferne die Hochrufe. Aber auf dem Platz vor dem grauen Hohenzollernschloß ward es jetzt still, feierlich hallten vom nahen Dome die mächtigen Glockenklänge. Andere Glocken fielen ein. Wie ein Zittern und Beben lief es durch die schweigenden Hunderttausende.
War das der Krieg? Läuteten die Glocken schon den großen Krieg ein? War das die Entscheidungsstunde für das Ringen einer Welt? „Kriegsgottesdienst!“ sagte Fritz Schmellin leise. „Muttchen und Grete und die anderen sind drin. Ja, Junge, es ist eine Glückseligkeit so eine Stunde als Deutscher zu erleben. . Und lauter, mitten hinein in den Glockenklang kam, gedämpft erst, und dann näher und näher, wie eine unaufhaltsame Woge heranbrausend und anschwellend, das Rufen, das Unter den Linden angefangen hatte. Und in atemraubender Spannung hingen aller Augen an den Fenstern des unheimlich stillen Schlosses . . .
„Und noch eins, Werner! Falls Du Dich frei machen kannst — wir sind im „Kaiserhof“ abgestiegen. Notquartier. Ich werde Muttchen und Grete sagen, dass ich Dich getroffen hab’ —“ Er kam nicht weiter. Eine ungeheure Aufregung warf ihre Wogen über den Platz. Deutlich erscholl das Schicksalswort: „Unser Kaiser ruft sein Volk zu den Waffen! Die Mobilmachung ist angeordnet!“
Wer es zuerst gerufen hat? Woher es kommt, das große Schicksalswort, das den Bann endlich bricht — keiner vermag’s zu sagen. Aber es ist Tatsache. Alle fühlen es! Und da sprengt auch schon ein berittener Schutzmann heran und bestätigt es. Aus dem Schlosstor waren Automobile gekommen, im vordersten hatte ein Generalstabsoffizier gesessen, aber noch ehe er das Denkmal des großen Friedrich und das historische Eckfenster erreicht hatte, war er aufgesprungen und hatte seinen blitzenden Degen geschwungen. „Mobil! Mobil!“ Und die Offiziere im nächsten Auto schwenkten die Mützen. Eine geballte Faust hielt einer empor — das sagte dasselbe. Im Nu hatten’s Hunderte, im nächsten Augenblick hatten’s Tausende erfahren, und orkanartig erfüllten die brausenden Hurrarufe die Luft. „Hoch unser Kaiser! Hoch Deutschland!“ Es gab kein Halten mehr. Wie elektrisiert rannte das Volk durcheinander. Und tausendstimmig schallte die Nationalhymne über Platz und Straßen:
„Heil Dir im Siegerkranz,
Herrscher des Vaterlands!
Heil, Kaiser, Dir . .!“
Und wahrhaft wie Donnerhall brauste von Tausenden dagegen das hohe Lied von der Wacht am Rhein!
Mit elementarster Gewalt drängte der Eindruck der weltgeschichtlichen Stunde der Seele sich ein.
Der Bürgersmann, der vorhin Herrn v. Schmellin von seinen Jungens erzählt hatte, fuhr sich mit der gefurchten Hand über die Augen. Aber dann blitzte und wetterte es in diesen Augen auf, die Hand des Mannes tastete nach dem Geländer der Rampe, und im nächsten Augenblick stand er oben, dicht am Sockel des steinernen Rossebändigers, und weithin schallte seine Stimme: „Nu haben wir die Hand am Säbeljriff, Leute, nu hat’s unser allergnädigster Kaiser uns jesagt —’ ein Hurra antwortete ihm, aber der Alte war noch keineswegs fertig. „Nu sind wir entschlossen, dat Schwert zu zieh’n, sowie der Kaiser dat Zeichen zum Kampfe jibt. Un nu sind wir ein Volk, ein einiges Volk, und es jibt keine Parteien mehr — „Bravo!“ — „Und drum Hut ab, Leute, und eingestimmt: Unser Allergnädigster Kaiser Wilhelm, unser Allergnädigster Kriegsherr — Hurra!“
Noch war das Hurra nicht verklungen, da drängte schon einer der blonden Studenten an die Stelle, wo eben der Alte geredet hatte. — „Halt’ Dir feste, Vater Kräpke“, rief ihm ein kräftiger Mann in den Dreißigern zu und streckte ihm die schwielige Hand entgegen. „Jut haste jesprochen nu lass det junge Deutschland reden.“ — „Sehr schön, lieber Freund! Sein Sie bedankt!“ rief nun auch Schmellin, den eine Menschenwelle von seinem Neffen getrennt hatte. Und der Gutsherr schüttelte dem alten Soldaten die Hand. So waren sie alle. Ihr Teuerstes sollten sie hergeben und dem Kaiser galt ihr erster Gedanke. Und auch damit hatte der Graukopf den Nagel auf den Kopf getroffen: in dieser heiligen Stunde hörte jede Partei auf, weggefegt und ausgelöscht waren Hader und Zank, vergessen die Kleinlichkeiten des Tages vor dem Gedanken an des Deutschen großes, herrliches Vaterland. Ein Band umschlang, ein Ruf vereinte von dieser Stunde an alle Deutschen: „Mit Gott für König und Vaterland, für Kaiser und Reich!“ Entblößten Hauptes stand der Reiche und der Arme, hoch und niedrig, ein einig Volk von Brüdern zusammen. Nie hat ein Volk der Erde solche Wogen edelster Begeisterung erlebt; nie loderte das deutsche Nationalgefühl in lichteren, heiligeren Flammen. Und flammende Worte waren es auch, die dem jungen Sohn der Alma mater von den Lippen flossen. Von Russlands Verräterspiel sprach er, von unseres Kaisers Friedensliebe bis zur letzten, allerletzten Sekunde, von dem entschlossenen Mut, mit dem wir uns nunmehr zu wehren gezwungen wären. Und es war kein Auge trocken, als er endete: „. . . zu Lande und zu Wasser, unter den grünen Wogen des Meeres und in Gottes blauer Luft, überall halten wir Wacht, Wacht für unsere Lieben, Wacht für deutsche Art und Wacht für Deutschlands Ehre: Dem Herrn sei Preis und Dank — wir sind bereit!“ Nur langsam kam Fritz Schmellin vorwärts. Jeder, der Große wie der Kleine, musste sich vom Strome tragen lassen; vom Lustgarten, vom Schloss, vom Dom bis hinunter zum Brandenburger Tor gab es nur eine große zusammenhängende Schar. An der nächsten Ecke bog der Gutsherr von Sierstädt in der Mark in eine Querstraße ein. Hier war wenigstens Luft, obwohl sich auch hier Autos und Droschken, Lastwagen und Fahrräder und Autobusse hinter den lebenden Menschenwällen in beängstigender Fülle stauten und des bekannten Schutzmannspfiffs, der ihnen die Schranken frei gab, harrten. Aber Fritz Schmellin konnte doch den Schritt beschleunigen. Erst jetzt sah man, dass der Mann mit der Kürassierfigur ein wenig hinkte. Vielleicht nicht schlimm, nicht auffällig, aber doch so, dass er den linken Fuß etwas nachzog. Und, wie so oft in seinem Leben, eben jetzt spürte er förmlich einen Schmerz in diesem Beine, das nicht mittun wollte. Das Bein, so schön auch die Schusswunde geheilt war, die er sich selbst als Knabe beim Spielen beigebracht hatte, war wieder einmal schuld daran, dass er zur Untätigkeit verdammt sein würde, wenn jetzt der König sein Volk rief. Denn unwillkürlich war sein erster Gedanke gewesen: Wenn Du bloß um alles in der Welt jetzt den Säbel in die Faust nehmen könntest!“ Und der Gedanke verließ ihn nicht mehr, während er in Eile die Reihe seiner Verwandten überflog, denen heute der Ruf des Königs galt. Denn daran, dass Mobilisieren und Losschlagen immerhin noch nicht ein und dasselbe ist, dachte er nicht eine Sekunde. Keiner dachte mehr daran! So’n Wunder kam nicht in der Nacht, das das Schwert wieder zurückzwang. Gegen eine derartig frevle Herausforderung, wie sie der doppelzüngige Zar sich geleistet hatte, war jetzt alles Diplomatenspiel vergebens. Die Ereignisse konnten sich jetzt nur nach den eisernen Gesetzen des Krieges abrollen!
Da war nun also erstens dieser Werner, seiner Schwester Charlotte Ältester. Na, dass dem die helle Begeisterung aus dem Gesichte geleuchtet hatte, das sah jeder winzige Schuljunge. Aber er war nicht der einzige, den seine Schwester hergeben musste. Der jüngere ‚Gottfried von Babenberg’ würde heute auch zum längsten hinter seinem „Nauticus“ in Mürwik gesessen haben, sicher sagte der Fähnrich z. S. der Marineschule Lebewohl und kletterte auf eines unserer stolzen, blanken Schlachtschiffe. Und dem würde auch das Herz schneller schlagen, wie allen bei des Kaisers Flotte. Wie hatte doch gleich der famose Kapitänleutnant Hermann gesagt, den er auf Westerland sofort in sein Herz geschlossen hatte? „Wir brennen darauf, uns ‘mal zu messen. Fertig sind wir!“ Und der Sierstädter hatte gelacht und gefragt: „Auch, um es mit der sogenannten „Musterflotte“ da drüben aufzunehmen?“ Und er hatte über die blaue See hinüber in eine ungewisse Richtung gewiesen, wo er Firth of Forth, das britische Kiel, vermutete. Und ebenso zuversichtlich hatte der junge Kapitänleutnant, während er lachend Baroness Grete in die Augen gesehen und während sich Miss Scoolfield naserümpfend abgewandt hatte, erwidert: „Auch gegen die Musterflotte, wenn’s kommt. Nicht Schiffe fechten, sondern Menschen!“
Die Schmellins stellten auch ihren Mann ins Feld. Da war der eigne Bruder Kurt, Generalstäbler und zurzeit Korps-Adjutant in Hannover, und Wichard, der Sohn des Majors in Lichterfelde, musste am Ende auch schon mit ‘ran. Notprüfung und so! Ja, und Onkel Theo Schmellin auf Trebnitz, der weit übers Herrenhaus hinaus bekannt war, dem er nun schon 24 Jahre angehörte, musste auch zwei Söhne ziehen lassen: Edgar und Adolf, die beiden Reiterleutnants, sein ganzer Stolz — seit der Älteste den bunten Rock hatte ausziehen und übers große Wasser gehen müssen. Und Jutta Schmellin musste den Bräutigam hergeben. Das nahm ja kein Ende, was da alles zur Fahne eilte! Ja, und so sah’s wohl in jedem deutschen Hause, in jeder Familie, bei hoch und niedrig aus. Und wo gab’s auch nur einen, der nicht freudig bereit war, das Schwert zu ziehen, dass der Halbbarbar ihm aufzwang? Vor einem akademischen Institut musste Fritz Schmellin abermals Halt machen. Ein Zug begeisterter Studenten und Hochschüler wogte hier heran; aus den Kontoren, aus den Geschäften kamen andere gelaufen, Handwerkszeug und Schreibpult und Maschinenraum im Stich lassend. Und wieder und wieder schallten die vaterländischen Weisen. Rufe dazwischen: „Nach dem Schlosse! Nach dem Schlosse!“ Und heller konnten nicht die Augen jener Studenten geleuchtet haben, die vor hundert Jahren mit Friesen und Körner hoch zu Ross durchs blutende Vaterland gestürmt waren.
Wie sie so dahineilten, barhäuptig, mit offener Brust zum großen Teil, wie es der kürzlich erst Mode gewordene Schillerkragen mit sich brachte, glichen sie wirklich den Jünglingen aus der Zeit, wo studentische Freikorps sich auf den Ruf der Schlachthörner bildeten und Lützows schwarze Gesellen wider den Korsen ritten. „Wir treten geschlossen ein!“ hörte Schmellin hinter sich sagen. „Alle in corpore als Kriegsfreiwillige bei den Augustanern. Schließen Sie sich uns an, Helmann?“ Der Angeredete, ein langaufgeschossener Jüngling, dem man unschwer den akademischen Bürger ansah, errötete, als schäme er sich seiner Antwort. „Ich fürchte, es geht nicht. Sie sehen ja, wie schmal ich bin —“ „Ach, Unsinn! Sie werden schon in ‘ne Uniform ‘reinwachsen. Ich bedaure natürlich jeden, der zurückbleibt. Schließlich ist jede Brust breit genug für einen Schwerthieb.“
„Nein, nein! Zurückbleiben natürlich nicht! Das auf keinen Fall!“ antwortete Helmann schnell. „Zum mindesten gehe ich als Krankenpfleger mit. Leider bin ich ja derartig kurzsichtig, dass ich kaum etwas treffen werde, und als Kavallerist müsste ich auch gute Augen haben —“ „Ja, ja, zum ‚Auge der Armee’ passen Sie nicht!“
„Aber versuchen will ich’s gleichwohl, verlassen Sie sich drauf, Fischer!“ „Na, doch ein Wort! Und nun kommen Sie mit. Zum Schloss! Ganz sicher wird der Kaiser reden.“
„Hat schon geredet!“ rief ein anderer. „Komme ja jrade von dort. Det war der weihevollste Augenblick, meine Herren! Ich kann’s freilich nich wiederhol’n, aber es waren jenug da, die det aufjeschrieben hamm.“ „Donnerwetter!“ fuhr es Fritz Schmellin heraus. Er hatte sich zu dem Sprecher vorgebeugt. „Konnt’ ich da nich noch fünf Minuten länger warten! Aber seh’n Sie, meine Herren, solches Pech hab’ ich nu immer! Na, warten Sie ab: morgen weich’ ich nich ‘nen Zoll vom Flecke, bis ich Majestät geseh’n hab’, und wenn ich die Mauern hochklettern soll.“
Er drehte sich um, und die Studenten sahen ihm lachend nach. „Auch einer“, sagte Max Fischer, „dem ich nicht unter die Hände geraten möchte — wenn ich Russe oder Franzose wäre. Solche Hünenfiguren brauchen wir zum Helm zerschroten. War ‘n Junker natürlich —“ „Janz egal! Als ob wir jetzt noch Zeit hätten, an irjend ‘ne Partei zu denken!“ rief der junge Mann, der vom Schlosse gekommen war. „So ‘ne Stunde kennt nur Brüder. Wer das nich einsieht, der hat keine Augen im Koppe!“ „Sie missversteh’n mich“, sagte Fischer, „ich habe ganz und gar nicht an Parteigezänk gedacht. Meine Bemerkung galt nur dem Äußeren des Herrn —“
„Na, denn is jutt!“ Der andere reckte die Schultern. „Jeben Se Obacht, wenn wir den Russen det Fell zausen! Jeder Schuß en Russ’!“ Man lachte. Das Wort flatterte sofort weiter. „Jeder Schuss — ein Russ’!“ Und schlagfertig wie der Berliner ist, klang sofort ein anderer Reim dagegen; niemand konnte sagen, wer’s zuerst gerufen, an wie viel Stellen gleichzeitig der billige und doch so jubelnd aufgenommene Reim geboren worden war: „Jeder Stoß — ein Franzos’!“
U je, die Franzosen! Die soll’n sich man schwer hüten mitzumachen. Die sollten eigentlich von 70 noch de Neese pläng haben!“
„Wenn Russland anfängt, müssen se aber —“
„Un schrei’n sowieso fortjesetzt nach Rewangsche. Die woll’n jerne mal wieder nach Berlin marschieren —“
„Kenn’ se jar nich, Willi! Hamm ja keene Stiebeln nich!“
„Keene Stiebeln? Warte man, denn besohlen wir sei“
„Und Nikolausen woll nich? — Wichtigkeit!“
„Nikolaus, Nikolaus! Wir schmeißen Dich aus Moskau raus!“ Auch der Trägste wurde heute aufgeschreckt und von dem jauchzenden Brausen der Menge mit fortgerissen. Mochte das Schreckenswort „Krieg!“ über den ganzen Erdball dröhnen, heut’ war nicht die Stunde zum Wehklagen. Wie ein Aufatmen ging’s durch die Millionen, die den Frieden gesät und nun den Krieg ernten sollten. In ernsten Kolonnen hatte die organisierte Arbeiterschaft der Großstadt noch vorgestern für den Frieden demonstrierend die „Linden“ durchzogen. Heute sahen sie’s, dass es keinen Frieden mehr geben konnte, nicht mehr geben durfte! Der Russe stand an der Grenze, der Deutsche musste sich seiner Haut wehren. Die Kelle und den Hammer schlug uns der Feind aus der Hand — wohlan! so sollte es denn sein: Deutschland würde dafür einmütig zum Schwert greifen und zu den Gewehren! Das Blut über jene, die das Frevlerische entfacht! Ernsten und entschlossenen Mutes würde das deutsche Volk dem Sturm entgegengehen!
Unaufhörlich, unaufhaltsam wie ein donnerndes Meer, flutete das Volk durch die Straßen. Ganze Züge mit Fahnen marschierten über die Mittelpromenade der Linden, und unaufhörlich, bis tief in die warme Sommernacht hinein, brauste das alte, kernige deutsche Lied aus hunderttausend Kehlen:
„Lieb’ Vaterland magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!“
II.
Nichts deutete darauf hin, dass dieser erste Sonntag des August ein besonderer Tag war, als Grete v. Babenberg gleichzeitig mit Miss Scoolfield das Frühstückszimmer des Kaiserhofes aufsuchte. Der strahlende Morgen schickte seinen Sonnenglanz bis auf die Tische mit den Damastdecken, wo das Geschirr zumeist noch unberührt stand. Ein Page rückte den beiden jungen Damen die Stühle zurecht, ein anderer Angestellter machte sich an den hohen Fenstern zu schaffen.
Der Wilhelmplatz und die Nebenstraßen lagen still und friedlich: ein paar Spaziergänger im Feierstaat; ein halbes Dutzend junge Leute in der „Uniform“ der Straßenkehrer, die den Platz von den letzten zerknüllten Extrablättern säuberten; ein paar Droschken und Autos weniger vorm Hotel — nichts schien die sonntägliche Stille zu stören.
Aber dort an der Ecke der Mauerstraße, an der Litfaßsäule, drängten sich Männer und Frauen und lasen mit ernsten Mienen die Anschläge des Oberkommandierenden und des Oberbürgermeisters, und vor allem das knallrote Papier, auf dem kurz und knapp, in schwerwiegenden Worten, der Mobilmachungsbefehl zu lesen stand.
Und dann in der Wilhelmstraße da drüben selbst, wo des Reiches Kanzler wohnt, jagten schon wieder unablässig die Wagen.
Grete trat vom Fenster zurück. „Der arme Bethmann“, sagte sie, „wieviel Nächte mag er für uns gewacht haben! Wer weiß, ob er überhaupt schon zu Hause ist. Als wir ihn nachts durch die Linden fahren sahen, wie furchtbar bleich sah er aus!“
Miss Grace Scoolfield zuckte die Achseln. „Es ist dies das Los von Ministern, es ist bei uns genauso. Wir haben auch für unsere Minister das größte Interesse.“
„Ja, ja doch — aber wie er gestern umjubelt wurde! Wie er ernst aus dem Wagen heraus grüßte — alles wird mir unvergesslich sein. Ich habe vor Aufregung kein Auge zu tun können!“
„Ich fand den Lärm furchtbar verletzend, bei uns würde man weniger schreien, aber ich habe trotzdem außerordentlich gut geschlafen. Ich bin immer über diese guten Berliner Hotels entzückt.“
Grete v. Babenberg überhörte die Worte der Miss, die in ihrem knapp sitzenden Reisekleid schon am Tische Platz genommen hatte. Ein Gegensatz hatte sich gestern zwischen ihr und der englischen Freundin aufgetan, der einfach nicht zu überbrücken war. Klar und deutlich hatte sie das gestern Abend gefühlt, als die Familie noch bis Mitternacht hier im Hotel zusammengesessen hatte, ganz erfüllt und durchdrungen vom heiligen Ernst der Stunde. Hier gab es einen Wendepunkt in der Freundschaft. Jede, auch die scheinbar nebensächlichste Bemerkung der Engländerin, die nun schon seit Jahr und Tag auf Haus Müncheberg wie ein Gast gehalten wurde, obwohl sie eigentlich die Stelle einer Gouvernante für den zehnjährigen Heinz innehatte, hatte Grete gestern verletzt. Ihre Wege gingen auseinander, sie verstand die Miss nicht mehr und Miss Grace, die den ganzen Abend in einer Haltung dagesessen hatte, die ein Gemisch von Nachlässigkeit und Gefallsucht war, verstand nicht die große, erschütternde Bewegung und Begeisterung, die die Herzen jedes Deutschen rasender schlagen ließ.
Der Kellner kam und fragte, ob er das Frühstück auftragen dürfe oder ob die Damen auf die anderen Herrschaften warten wollten. „Nein, bringen Sie den Tee“, antwortete Grete. Es sollte keine Minute Zeit verloren werden, und die Mutter musste jeden Augenblick kommen. Man hatte ja noch so unendlich viel vor und zu besorgen! Für Bruder Werner und für Gottfried, der selbstverständlich sofort auf seine Marineschule nach Mürwik oder gleich aufs Schiff musste. Und Werner, der sich also richtig gestern Abend, nachdem ihn Onkel Fritz am Schloss erwischt hatte, auf eine knappe Stunde hatte freimachen können, musste natürlich auch jede Minute darauf gefasst sein, dass es fortging. „Ein Glück, dass heute die Sonntagsruhe aufgehoben ist“, sagte sie wie in Gedanken. Miss Scoolfield schürzte die Lippen. „Das ist mir unbegreiflich. Die Herren, besonders Dein Bruder, der in diesem russischen Regiment steht, betonten, dass sie keinen Krieg gewollt hätten, und nun rüsten sie ganz unbändig an einem Sonntag —“
Grete war blutrot geworden, aber sie sagte ruhig: „Das dürftest Du, wie so manches, doch etwas missverstanden haben, und ganz dringend muss ich Dich bitten, nicht noch einmal von einem russischen Regiment meines Bruders Werner zu reden. Er ist Alexandriner, das ist ein alter historischer Name, der mit dieser unseligen Überrumpelung, die uns Russland bereitet, nicht das Geringste zu tun hat!“
„Dein Herr Bruder hätte den Ausdruck sicher nicht übel genommen — wenigstens nicht, wenn ich ihn gebraucht hätte.“
„Das bezweifle ich sehr!“
„Ich habe mich mit diesem Oberleutnant ausgezeichnet unterhalten.“
Mit geheimer Freude gewahrte sie, dass ein Schatten über Gretes Gesicht flog. Die törichte Närrin! Ein harmloser Flirt, ein ganz klein wenig Koketterie war das gewesen, als sie sich mit dem blonden, lachenden Gardeleutnant unterhalten hatte, und nun fiel die Schwester genauso darauf herein, wie gestern der gute Junge, und dabei dachte sie doch nicht im entferntesten daran, sich einem Offizier, und ausgerechnet einem deutschen Offizier, an den Hals zu werfen! Überaus komisch hatte sie das Pathos gefunden, mit dem gestern dieser Werner und sein eben flügge gewordener Bruder Gottfried und gar noch der Oheim und schließlich alle, die am Tisch gesessen hatten, von diesem großen Kriege und ihren künftigen Heldentaten gesprochen hatten. Die Offiziere waren zweifellos mit Leib und Seele Soldat, und die Uniform stand ihnen wirklich prächtig, mit dem Munde aber schlug man keine Schlachten. Hinter der russischen Grenze stand ein Millionenheer, der riesige Bär, der seine Tatzen zum gewaltigen Schlag reckte! und das blieb höchstwahrscheinlich nicht der einzige Feind, mit dem die Deutschen abrechnen mussten. Hinter den Vogesenpassen, im Schutze seiner uneinnehmbaren Festungen und Sperrforts, so hieß es allgemein, wartete ja der treue Bundesgenosse der Russen nur auf den längst ersehnten Augenblick, um die große Revanche nehmen zu können und sein geliebtes „Alsace-Lorraine“ mit kühnem Handstreich wieder zurückzuholen. Nein, so simpel, wie diese Herren Deutschman sich das dachten, war die Lage gewiss nicht! Und es blieb nur gut, dass vorläufig England sich völlig abwartend verhielt, denn das ging aus der „Times“ und den „News“ doch wohl unverhüllt hervor, die sich Miss Scoolfield gestern auf dem Bahnhof Friedrichstraße erstanden hatte. Aber wenn es doch, was sie nicht für möglich hielt, anders kommen sollte, was dann? Würden die deutschen Offiziere dann auch noch so zuversichtlich und fast tollkühn sich gebärden. Nein, dann würden sie kleinlaut werden, dachte sie. Wie lächerlich war ihr das vor wenigen Tagen vorgekommen, als der blonde Kapitänleutnant Hermann auf Westerland das Loblied der deutschen Flotte gesungen hatte, und nun gar erst gestern der junge Fähnrich z. S., dem noch nie die richtige Seeluft um die Wangen geblasen hatte. Wirklich lächerlich — sie fand keinen andern Ausdruck dafür — war diese Großmannssucht des Volkes mit der „Luxusflotte“. Wenn die Musterflotte ihre eisernen Flossen nur regen würde, da würden sich die winzigen Fischchen, die auf der Nord- und Ostsee schwammen, eiligst verkriechen, aber zu diesem erschütternden Ende brauchte es ja nicht gleich zu kommen. Im Grunde hatte Miss Grace die braven Deutschen mit ihrem unbesiegbaren Idealismus, ihren hausbackenen Ansichten und mit ihrem Fleiß und dem guten Willen, es den Engländern gleich zu tun — was sich natürlich letzten Endes im Köpfchen der hübschen Miss Grace als ein Ding der Unmöglichkeit malte — so etwas wie achten gelernt.
Der gestrige Abend, vorausgesetzt, dass die „Hurrastimmung“ nicht ebenso schnell verpuffte, wie sie entzündet worden war, hatte sogar zu denken gegeben. Dieses Volk, das von Parteien zerrissen sein sollte, wo immer und ewig ein heilloses Nichtverstehen zwischen den Besitzenden und den vielen, vielen Arbeitern herrschte, hatte sich gestern als die einmütigste Masse gezeigt, die sich denken ließ.
Unwillkürlich musste Miss Grace an ihr Vaterland denken, und sie fragte sich betroffen, ob man dort dieses selben Begeisterungstaumels fähig sei, wie sie ihn hier miterlebt hatte.
In England neigte die große Masse nicht zum Kriege. Der Kaufmann und die Heere der Arbeiter hatten nicht den Wunsch, ihre Geschäfte stillstehen und ihren Verdienst fahren zu lassen. Eine Kriegsstimmung, wie sie dieses „Volk in Waffen“ zeigte, war bei ihren Landsleuten undenkbar.
Grete hatte die Tassen gefüllt. Die Engländerin dankte.
„Es ist gut“, sagte sie, „ich werde es vermeiden von einem russischen Regiment zu sprechen, schon weil es zu Verwechslungen führen würde. Aber es ist trotzdem richtig, dass der Zar Nikolaus der Chef des Alexander-Garde-Regiments ist.“
„Aber die längste Zeit gewesen! Mein Bruder hatte einen russischen Orden und hat nichts eiliger gehabt, als ihn zu entfernen —“ „Bravo! Davon weiß ich ja noch gar nichts!“ Onkel Fritz Schmellin reichte den beiden jungen Damen die Hand. „Morjen, Greteken! Morjen, meine verehrte Miss Grace! Ja, selbstredend! Die russischen Orden müssen ‘runter! Auf die Heldenbrust gehört ein Kreuz von Eisen. Denn ein eiserner Krieg wird’s. Hier bitte: Feind Nummero zwei!“ Er schwang ein Extrablatt in der Hand. „Hab’ ich grade einem Chauffeur aus der Hand gerissen.“ In der Halle des Hotels hörte man lautes Stimmengewirr. „Der Krieg von Russland und von Frankreich eröffnet!“ stand in fetten Buchstaben über dem Blatte. Onkel Fritz las vor: „Russland hat heute Nacht an zwei Stellen deutsches Reichsgebiet angegriffen und damit den Krieg gegen uns eröffnet. Frankreich hat die volle Mobilisierung der französischen Streitkräfte angeordnet!1 — Na, was sagste nu, Greteken?“
„Lass sehen, was steht denn noch darunter?“
„Na, dass wir sie, wie zu erwarten war, abgeschmiert haben. Unsere Leutchens an der Grenze sind doch nicht von gestern! Hier hast Du’s: Heute Nacht hat ein Angriff russischer Patrouillen gegen die Brücke über die Warthe bei Eichenried stattgefunden, der Angriff ist abgewiesen. Kosaken reiten auf Johannisburg. — Schöne Geschichte! Hiernach steht’s also bombenfest, dass die Moskowiter deutsches Gebiet anzutasten wagten. Na warte, Euer frevles Spiel soll Euch teuer zu stehen kommen, und der Schlag, den sie gegen uns zu führen versuchen, wird auf die Friedensstörer zurückfallen. Das besorgen schon unsere ostpreußischen Jungen!“
„Also ist auch die letzte Hoffnung hin, dass noch Frieden bliebe?“
„Endgültig! Jetzt reden lediglich noch die Flinten und Kanonen — an der Weichsel, wie am Rhein! Denn der gallische Hahn spektakelt ja auch schon, wie wir das nicht anders erwartet hatten. Krieg gegen zwei Fronten! Längst vorgesehen! Bleibt noch England —“
„Darüber kann ich Sie beruhigen, Herr von Schmellin“, unterbrach ihn die Miss. „England wird sich nicht einmischen. Ich kann es Ihnen vorlesen.“ Tatsächlich erschien diese Meldung, soweit sie die Kriegseröffnung durch Russland betrifft, erst am 2. August mittags 1 Uhr. Die Mobilisierung Frankreichs wurde 1 Uhr 30 nachts gemeldet und in Morgenausgaben der Tageszeitungen vom 2. August zuerst bekanntgegeben.
„Danke sehr!“ Er wehrte lächelnd ab. „Und zu beruhigen brauchen Sie mich nicht. Sie haben gehört, dass wir uns nicht fürchten, weder vor zwei Gegnern, noch auch vor mehr — wenn’s sein muss. Und ob wir zur See auch noch unsere Ehre verteidigen sollen, uns soll die Welt unserer Feinde und Neider auch da gerüstet finden. Wenn sich Ihr schönes Britannien neutral hält, umso besser! Sein Schade ist’s nicht, wenn’s nicht mit den Slawen und Königsmördern gemeinsame Sache macht.“
„Nein, das tut es niemals! England wird sich seiner Ehre bewusst bleiben. England wird Schiedsmann sein!“
„Hoffen wir’s! Stolz lob’ ich — die Briten mir! Warten wir also ab und trinken wir Tee! Wo steckten denn Gottfried?“
„Er ist schon in der Stadt, es ließ ihm keine Ruhe.“
„Versteh’ ich! Und Mama? — Ah, da ist sie ja selbst!“ Er erhob sich und ging den beiden eintretenden Damen entgegen. Es war seine Schwester Charlotte v. Babenberg und seine Schwägerin, die Gattin des Majors Kurt v. Schmellin, die gestern keinen Anschluss mehr nach Hannover bekommen hatte. Der Gatte war schon drei Tage früher als die übrige Familie von Westerland abgereist. Eine geheime Depesche des Kommandierenden Generals v. Emmich, dessen Stab der Major Kurt Schmellin angehörte, war das erste Sturmzeichen gewesen, das die friedlich an der blauen See weilenden Verwandten aufgeschreckt hatte. Auch andere von den Herren, Mit denen man an der See bekannt geworden war, waren Hals über Kopf abgereist; als einer der ersten der Kapitänleutnant Hermann. Und schließlich war der Sierstädter, er, der Junggeselle und „Vaterlandskrüppel“ (wie er sich selbst verspottete), Fritz Schmellin, mit den Damen und den jüngeren Söhnen allein gewesen. Aber der drohende Kriegszustand hatte auch ihrem sonnigen Aufenthalt an der Nordsee wenige Tage später ein Ende gemacht. Fast fluchtartig hatten alle Badegäste die Insel verlassen, und unter ihnen, die mit genauer Not in drangvoller Enge gestern nach Berlin geeilt waren, waren auch die sieben Personen gewesen, die jetzt am Frühstückstische saßen: Onkel Fritz, die Majorin mit ihrem Sohn Wichard, Charlotte v. Babenberg mit Grete, dem zehnjährigen Heinz und der Miss, und als achter kam noch Gottfried Babenberg hinzu, der, wie der Kadett Wichard sagte, ins Reichsmarineamt an der Königin Augusta-Straße gefahren war.
Man beeilte sich mit dem Frühstück. Die Damen waren ruhig und gefasst, oder verbargen wenigstens ihre Unruhe. Es ist auch für eine Offiziersfrau nichts Leichtes, über den plötzlichen Trennungsschmerz hinwegzukommen. Die Majorin sah den Gatten, vielleicht auch ihren Wichard in den Kampf gehen, und Frau Charlotte hatte zwei Söhne, die zu den Fahnen eilten. Aber es war doch wieder etwas Schönes, wie diese beiden Frauen ihr Leid nicht laut werden ließen, sondern tapfer und demütig und voll frohen Gottvertrauens dem Unabwendbaren ins Auge sahen.
„Auf keinen Fall möchte ich den Frühgottesdienst im Dom versäumen“, sagte Frau v. Babenberg.
„Und ich schließe mich an“, setzte die Schwägerin hinzu. „Vor ein Uhr geht auch mein Zug nicht nach Hannover. Ich habe soeben an Kurt telegraphiert.“ „Recht so! Und Wichard willst Du doch nicht wieder mitnehmen?“ „Ich fürchte fast, dass er hierbleiben muss. Hast Du noch keine telephonische Verbindung mit Lichterfelde, mein Sohn?“ Der große, blonde Junge schüttelte den Kopf. „War nich zu machen — hier im Hotel wenigstens nicht. Die Fernsprecher sind ja förmlich belagert, und da ich das Frühstück in diesem Hotel unbedingt nicht versäumen wollte, habe ich mir die große Frage an das Schicksal aufgespart.“
„Nu seh’ einer diesen Ausbund an! Jeder andere in Deiner Lage würde Essen und Trinken vergessen!“ „O bitte! Der berühmte Feldherr Julius Caesar hat gesagt, dass die Siege durch den Magen gehen! Und außerdem ist die Antwort, die mir der Feldwebelleutnant geben wird, ziemlich sicher, die lautet natürlich: Sofortige Rückkehr — das Vaterland braucht seine Helden!“
„Na pass’ auf! Ich wünsch’ Dir zwar von ganzem Herzen, dass Du mit unter denjenigen bist, die als Fähnrich eingereiht werden, aber ob Du auch wirklich schon dran kommst und nicht vielleicht bloß als Schildwache irgendwo verwendet wirst, ist noch gar nicht heraus. Wärest Du nicht, dank Deinem ausgeprägten Sitzfleisch, zu Ostern in Sekunda B zurückgeblieben —“
„Hat im Kriegsfalle durchaus nichts zu sagen, lieber Onkel Fritz! Inter arma silent musae, auf gut deutsch: Lebe wohl, Hörsaal der Königlichen Sekunda! Jetzt entscheidet nur das Lebensalter und der Brustumfang und beides ist zufriedenstellend.“
„Meinst Du wirklich, dass Du ein Notexamen machen kannst?“ fragte die Cousine.
Der Kadett warf sich in die Brust. „Ich werde Dir Gelegenheit geben, mich binnen heute und drei Tagen in der feldgrauen Uniform eines Fähnrichs bewundern zu können. Ich nehme Wetten entgegen.“ Da stürmte der Fähnrich z. S. in den Frühstücksraum. Sein Gesicht strahlte. Die Blicke der Gäste an den anderen Tischen wandten sich auf die geschmeidige Gestalt. Jeder schien es zu ahnen, welche Botschaft es war, die die Augen des Jünglings leuchten ließ. Mit drei Schritten war er an der Seite seiner Mutter. „Ich reise heute Nachmittag, Muttchen! Kiel! Schiff ist geheim.“ Er wandte sich um. „Wenigstens für die Allgemeinheit. Meinem guten Muttchen werde ich es noch unter vier Augen anvertrauen.“
In Frau Charlottes Augen schimmerte eine Träne. Sie perlte die Wange hinunter, aber die Lippen versuchten ein Lächeln zu formen. Sie stand auf. Auch in Onkel Fritzens Augen glänzte es. „Mittags? Eine kurze Frist! Wohlan denn! Aber eins möchte ich noch vorschlagen. Im Dom wird ein unglaublicher Andrang sein. Ich höre eben vom Geschäftsführer, dass am Bismarckdenkmal ein Gottesdienst unter freiem Himmel abgehalten wird. Da hätten wir es sogar näher, und wenn wir keine Zeit verlieren, können wir noch einen guten Platz bekommen.“
Der Vorschlag fand den Beifall der Damen. Wenige Minuten später waren alle schon auf dem Wege. Ein stiller entschlossener Ernst lag auf den Gesichtern der Menschen, die ihnen entgegenkamen und an ihnen vorbeidrängten. Eine ununterbrochene Kette von Droschken mit riesenhaften Koffer und Gepäckstücken kam von den Bahnhöfen. Das war kein ungewohntes Bild, gestern hatte man den ungeheuren Rückstrom, der aus den Bädern stattfand, selbstbeteiligt an sich vorbeifluten sehen. Heute war dieser Verkehr noch gewachsen. Wie manches, aus entlegener Sommerfrische herbeigeeilte Ehepaar war in den Droschken zu sehen! Müde und übernächtig, erschöpft von endloser Fahrt, drängten manche Mutter, mancher alte, weißbärtige Vater fiebernd nach Hause, von dem einen Gedanken beseelt, den geliebten Sohn noch einmal zu sehen und zu umarmen. Und daneben junge, wettergebräunte, in den Seebädern oder auf den Feldern wie die Nubier braungebrannte Gestalten, die selbst dem Mobilmachungsbefehl Folge leisteten und zu ihren Regimentern eilen mussten. Reisende mit Bergstöcken dazwischen, Reservisten und Landwehrleute, die mit Köfferchen und Pappkasten zu ihren Truppen“ teilen wollten. Und inmitten der Scharen der Ankommenden und Abreisenden, die von und zu den Bahnhöfen drängten und jede Droschke, jeden Kraftwagen mit Beschlag belegt hatten, den kriegerischen Charakter des flutenden Bildes noch erhöhend, Offiziere aller Waffengattungen und aller Stämme, viele schon feldmarschmäßig, in der grauen oder grünen Einheitstracht, den Stoffbezug über Helm oder Tschako. Und je näher man dem Reichstagsgebäude kam, umso mehr drängten sich die Menschen, die einander wildfremd waren und doch eine selbstverständliche Zusammengehörigkeit hatten. Manche deutsche Frau, manches Mädchen hatte verweinte Augen, aber es war ein stiller, in sich gekehrter, würdiger Schmerz. Die Frauen und Mädchen wussten, wofür ihre Männer und Ernährer, ihre Söhne und Brüder ins Feld ziehen mussten. Niemand unter allen, die hier zusammengeströmt waren, um den allmächtigen Gott um Hilfe für unser braves Heer anzuflehen, der nicht gefasst sich der Bedeutung dieser Stunden für das bedrohte Vaterland bewusst war. Ein einziger, machtvoller Wille und unverrückbarer Glaube beseelte alle diese großen und kleinen, jungen und alten, reichen und armen Menschen, die, welche auf ihren Posten eilten, wie die anderen, deren daheim die ernsten Pflichten harrten: der Wille, den aufgezwungenen großen Kampf aufzunehmen, hinzunehmen und alles einzusetzen für das von hinterhältigen Feinden angegriffene deutsche Vaterland!
Und so traten sie vor ihren Gott. So standen sie vom Reichstagsgebäude bis zur Siegessäule, vom Tiergarten bis zur Roonstraße, Kopf an Kopf, Schulter an Schulter, ein unzählbares Heer von Andächtigen. Die Treppe zum Reichstag, zum Bismarckdenkmal, zur Siegessäule, die Sockel und Mauervorsprünge der stolzen Gebäude und Denkmäler waren dicht besetzt und von vielen mit Mühe erklettert worden. Die große Freitreppe war der Altar, die Regimentskapelle der Garde- Füsiliere ersetzte die Orgel. Als klare, strahlende Kuppel wölbte sich, groß wie das Schicksal, das auf diesen Männern und Frauen lag, der wolkenlose, blaue Himmel.
Fast war kein lautes Wort zu hören. Weihevoll, ehrfurchtsvoll standen die Hunderttausende zu den Füßen des schwarzbronzenen Siegfried, zu Füßen des Schmiedes vom Sachsenwald, der dieses Volk im blutigen Waffentanz vor 43 Jahren zur Einheit zusammengeschweißt hatte. Einig, nie, niemals einiger harrte die unvergleichbare Menschenmenge zu den Füßen ihres unvergleichlichen Nationalhelden.
Dicht bei der Kapelle hatte Fritz Schmellin mit seinen Verwandten Platz gefunden. Nur die Miss fehlte, die es vorgezogen hatte, zu ihrem Konsul zu fahren. Und dann klangen wuchtig anschwellend die Klänge der Regimentsmusik, deren Helmspitzen und messingene Instrumente über den unendlichen Platz mit seinen Riesenchören funkelten. Und diese Riesenchöre, einander zugewandt, sangen es mit, was die Orgel intonierte. Nie wurde in heiligerer Stimmung von Preußen und Deutschen ein Gotteslied gesungen.
„Wir treten zum Beten, vor Gott, den Gerechten,
er waltet und haltet ein strenges Gericht,
er lässt von den Schlechten die Guten nicht knechten;
sein Name sei gelobt, er vergisst unser nicht!“
Auf den oberen Stufen stand ein junger Priester. Der Licentiat und Hofprediger Doehring. Seine Gestalt reckte sich hoch, seine Augen blitzten. Er schien, als er die Hände faltete, seinem Gott inbrünstig dafür zu danken, dass er ihn auserwählt hatte, an solchem Tage zu solcher Gemeinde zu reden.
„Dein Name sei gelobt, o, Herr, mach’ uns frei!
Herr, mach’ uns frei!“
schloss das Niederländische Dankgebet. Gleich darauf begann der Streiter Gottes im schlichten Talar und predigte den Tausenden. Es waren Gottesworte, die nicht den Schmerz schonten und nicht die drohende Trauer umgingen, aber Worte, die jeder verstand, der ein Deutscher war; Worte, die auch der hätte sprechen können, der dort auf granitnem Sockel als Bronzebildnis stand. Der Name des Mannes, in dessen Schatten die Predigt gehalten wurde, schwebte auf aller Lippen. „Fürchte Dich vor keinem, das Du leiden musst“, hieß es in den Offenbarungsworten, die die Rede einleiteten, Treue, Gläubigkeit an Gott, an König und Kaiser und die Führer, Getrostheit vor dem Schicksal, das waren die Grundgedanken, die des Predigers helltönende Stimme behandelte. „Wir Deutschen fürchten Gott, und sonst nichts in der Welt!’ schien es auf den Lippen des Geistes zu stehen, den sein Volk in dieser Stunde heraufbeschwor.
In Andacht versunken lauschten die Menschen. Wohl gab es viele, viele, deren Herzen von herbem Weh zerrissen waren, deren Tränen flossen, Frauen und Männer, Mütter und Väter, die die Schrecken des Krieges schon miterlebt hatten, denen alte Wunden, die sie längst vernarbt geglaubt hatten, wieder zu brennen begannen, aber auch die Jungen und die Jüngsten, die Zurückbleibenden, die die so nahe bevorstehenden bitteren Szenen kaum vom Hörensagen oder nur aus Kriegsschilderungen kannten — keines von allen brauchte sich seiner Tränen edelster Rührung zu schämen. Aber keiner sandte seine Klage laut zum Himmel. Ein Volk, ein Gott, ein Glaube beseelte sie alle, der Glaube an den Sieg — und wenn die Welt voll Teufel wär’! Barhäuptig sprachen, als der Prediger endete, all diese ungezählten Brüder und Schwestern in leisem Chor die Worte des Vater Unsers. Dann sangen sie das alte Luthersche Schlachtlied.
Und als es verbraust war, quoll aus der Mitte die stolze, in diesen Tagen so oft gesungene Nationalhymne zum Himmel empor. Im Nu ergriff sie den ganzen, riesigen Platz. Und Märsche folgten und die alten Lieder, und, während lauter die Füsiliere die Weisen schmetterten, kam Feuer und Leben in die Augen, die eben noch den Worten des Geistlichen nachgeweint hatten. In Begeisterung, Hoffnungsfreudigkeit und Siegeszuversicht klang diese große, erhabene Stunde aus, und diese Stimmung blieb haften.
Fritz v. Schmellin hatte den Arm seiner Schwester genommen. „Nicht bange sein, Lotte! Sieh Deinen Jungen an, steh sie alle an, die hier auseinanderströmen. Da ist keiner, der mit stockendem Fuß in den heiligen Krieg geht. Neben mir stand ein Mütterchen, dass sich an ihren Sohn schmiegte; unter Tränen lachte sie ihm zu, wenn sie in seine stolzen Augen sah. Und bei dem jungen Pärchen rechts von mir, das gerade von der Nottrauung zu kommen schien — denn das nette Weibchen hatte noch die Myrrhe im Haar — war’s nicht viel anders. Herzhafter ist nie ein Volk in den Kampf gezogen, als dieses. Wenn ich’s gestern noch hätte bezweifeln können, die heutige Feier hätte mir’s gezeigt.“
Frau v. Babenberg nickte. „Wie Gott will!“ Weiter sagte sie nichts.
„Geht da nicht“, sagte plötzlich der Sierstädter und blieb stehen, „geht da nicht unser Amtsrichter aus Westerland? Aber natürlich, er ist’s! Den muss ich unbedingt begrüßen, und wenn’s bloß wär’, um wieder sein gemütliches Münchnerisch zu hören! — Hallo, Herr Dr. Sedlmayr!“
Der Angerufene drehte sich um. „Ah so!“ sagte er. „Dös is fei net schlecht! Der Herr Baron!“ Und er arbeitete sich zu Schmellin durch. Er kam nicht allein. „Erlauben’s — ich derf Eahna bekannt machen — Herr Baron v. Schmellin — Herr Hauptmann Hering.“
„Freut mich, freut mich! Also, bitte! Wer hatte nu recht?“





























