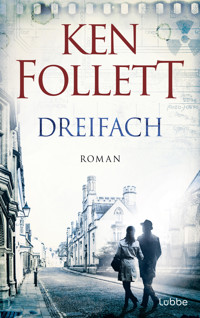Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Virus verschwindet aus einem privaten Forschungslabor. Für die junge Sicherheitschefin Toni Gallo ist dies eine Katastrophe. Sie ahnt nicht, dass der Dieb aus dem engsten Kreis um den Firmengründer Stanley Oxenford kommt. In dessen verschneitem Landhaus im schottischen Hochland entbrennt ein dramatischer Kampf, bei dem mehr auf dem Spiel steht als ein einzelnes Leben ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 50 min
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Heiligabend
01.00 Uhr
03.00 Uhr
07.00 Uhr
07.30 Uhr
08.00 Uhr
08.30 Uhr
09.00 Uhr
09.30 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
12.00 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
16.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
20.30 Uhr
21.30 Uhr
22.30 Uhr
23.30 Uhr
Erster Weihnachtsfeiertag
Mitternacht
00.30 Uhr
00.35 Uhr
00.45 Uhr
00.55 Uhr
01.15 Uhr
01.30 Uhr
01.45 Uhr
02.00 Uhr
02.30 Uhr
03.30 Uhr
03.45 Uhr
04.15 Uhr
04.30 Uhr
05.00 Uhr
05.30 Uhr
05.45 Uhr
06.00 Uhr
06.15 Uhr
06.30 Uhr
06.45 Uhr
07.00 Uhr
07.15 Uhr
07.30 Uhr
07.45 Uhr
08.05 Uhr
08.15 Uhr
08.30 Uhr
08.45 Uhr
09.00 Uhr
10.00 Uhr
Zweiter Weihnachtsfeiertag
19.00 Uhr
Ein Jahr später
17.50 Uhr
Danksagung
Über dieses Buch
Madoba-2: ein Virus, tödlicher noch als Ebola. Entsprechend groß ist die Unruhe bei Oxenford Medical, als ein infiziertes Kaninchen aus dem Hochsicherheitslabor verschwindet. Wenige Tage später überfallen maskierte Männer das Labor, erbeuten den Virus. Die Polizei ist wegen eines Schneesturms zur Untätigkeit verdammt, Sicherheitschefin Toni Gallo jedoch nimmt die Verfolgung der Täter auf. Es steht viel auf dem Spiel, und noch ahnt sie nicht, dass der Dieb aus dem engsten Familienkreis des Firmengründers kommt …
Über den Autor
Ken Follett zählt zu den beliebtesten Autoren der Welt. Von seinen siebenunddreißig Romanen wurden bereits mehr als 195 Millionen Exemplare verkauft. Seinen Durchbruch erlebte er mit DIE NADEL, einem in der Zeit des Zweiten Weltkriegs angesiedelten Spionageroman. Im Jahr 1989 erschien DIE SÄULEN DER ERDE, der schnell zu Folletts populärstem Werk wurde. Er erreichte weltweit Platz eins der Bestsellerlisten und wurde von OPRAH’S BOOK CLUB empfohlen. Die Fortsetzungen DIE TORE DER WELT, DAS FUNDAMENT DER EWIGKEIT und DIE WAFFEN DES LICHTS sowie das Prequel KINGSBRIDGE – DER MORGEN EINER NEUEN ZEIT erwiesen sich als ebenso beliebt. Insgesamt hat sich die KINGSBRIDGE-Reihe weltweit inzwischen mehr als 50 Millionen Mal verkauft. Ken Follett lebt mit seiner Frau Barbara in Hertfordshire, England. Zusammen haben sie fünf Kinder, sechs Enkelkinder und drei Labradore.
KEN FOLLETT
EISFIEBER
ROMAN
Aus dem Englischenvon Till R. Lohmeyer und Christel Rost
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe:
© 2004 by Ken Follett
Titel der englischen Originalausgabe: »Whiteout«
Übersetzung aus dem britischen Englisch
von Till R. Lohmeyer und Christel Rost
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2005/2025 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder von Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven von © JeromeCronenberger – stock.adobe.com; milkyway_galaxy – stock.adobe.com; paladin1212 – stock.adobe.com
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0345-9
luebbe.de
lesejury.de
HEILIGABEND
01.00 Uhr
Zwei müde Männer sahen Antonia Gallo mit feindseligen, ja hasserfüllten Blicken an. Sie wollten nach Hause, aber das ließ Antonia nicht zu. Beiden war klar, dass sie Recht hatte – und das machte die ganze Sache noch schlimmer.
Alle drei befanden sich im Personalbüro der Pharmafirma Oxenford Medical, eines kleinen, aber feinen Unternehmens, das im Börsenjargon »Boutique Company« genannt wurde. Antonia – Rufname Toni – war Abteilungsleiterin und Sicherheitsbeauftragte. Bei Oxenford Medical wurden Viren erforscht, die unter Umständen tödlich sein konnten. Sicherheit war daher eine todernste Angelegenheit.
Bei einer unangemeldeten Bestandskontrolle hatte Toni festgestellt, dass zwei Proben aus einer Experimentierreihe fehlten – und das war eine schlimme Sache: Die Substanz, ein Reagens mit antiviraler Wirkung, unterlag größter Geheimhaltung, und die dazugehörige Formel war unbezahlbar. Gut möglich, dass die Proben mit der Absicht gestohlen worden waren, sie an eine Konkurrenzfirma zu verkaufen. Die dunklen Ringe um Tonis grüne Augen und der Ausdruck finsterer Betroffenheit in ihrem sommersprossigen Gesicht hatten jedoch eine andere Ursache. Es gab nämlich noch eine weitere Möglichkeit, und die war ungleich prekärer: Womöglich hatte der Dieb die Proben gestohlen, weil er sie für sich selber brauchte. Dafür aber gab es nur einen einzigen plausiblen Grund: Irgendjemand hatte sich mit tödlichen Viren infiziert, mit denen in den Labors von Oxenford Medical gearbeitet wurde.
Die Labors befanden sich in einem riesigen Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert, das einst als schottisches Ferienhaus für einen viktorianischen Millionär errichtet worden war. Weil es sich hinter zwei Zaunreihen aus NATO-Draht verbarg, die Eingänge von uniformierten Wachposten kontrolliert wurden und auch die elektronischen Sicherheitsvorkehrungen stets dem neuesten Stand entsprachen, hieß es im Volksmund »der Kreml«. Dabei sah es mit seinen Spitzbögen, den Türmchen und den zahlreichen Wasserspeiern, die das Dach säumten, eigentlich eher wie eine Kirche aus.
Das Personalbüro war in einem Raum untergebracht, der einst als Schlafgemach gedient hatte. Die Fenster mit den Spitzbögen und die Faltwerk-Paneele stammten noch aus den Zeiten der ehemaligen Besitzer, doch deren Kleiderschränke waren inzwischen durch Aktenschränke ersetzt worden, und dort, wo sich einst Kristallfläschchen und Haarbürsten mit Silbergriffen gegenseitig den Platz auf der Frisierkommode streitig gemacht hatten, standen nun Computer und Telefone auf Büroschreibtischen.
Toni und die beiden Männer waren damit beschäftigt, alle Mitarbeiter anzurufen, die zum Betreten der Hochsicherheitslabors berechtigt waren. Es gab vier Sicherheitsstufen, so genannte Bio Safety Levels. In der höchsten, BSL-4, arbeiteten die Wissenschaftler mit Viren, gegen die es keinen Impfschutz und keinerlei Gegenmittel gab, und mussten daher Schutzkleidung tragen, die an die Raumanzüge von Astronauten erinnerte. BSL-4 war naturgemäß die am besten gesicherte Abteilung im Hause, daher waren die verschwundenen Proben auch dort gelagert gewesen.
Nur ein kleiner Kreis von Mitarbeitern hatte zum BSL-4-Labor Zugang. Selbst für die Wartungscrew der Luftfilter und Autoklaven war ein spezielles Sicherheitstraining für biologische Störfälle unbedingte Voraussetzung. Auch Toni hatte sich dieser Ausbildung unterzogen, damit sie jederzeit die Sicherheitsvorkehrungen innerhalb des Labors überprüfen konnte.
Insgesamt waren nur siebenundzwanzig der achtzig Firmenangehörigen berechtigt, das Hochsicherheitslabor zu betreten, doch viele von ihnen hatten sich schon für die Weihnachtsfeiertage verabschiedet, und der Montag war bereits zum Dienstag geworden, als die drei für die Klärung des Falles Verantwortlichen endlich auch den Letzten von ihnen aufspürten.
Toni fragte sich bis in ein Feriencamp namens Le Club Beach auf Barbados durch, erwischte dort den Assistenten der Geschäftsleitung und überredete ihn mit Engelszungen, eine junge chemisch-technische Laborantin namens Jenny Crawford ausfindig zu machen und ans Telefon zu holen.
Während sie wartete, betrachtete Toni ihr Spiegelbild im Fenster. Dafür, dass es schon so spät war, hielt sie sich ganz gut. Ihr schokoladenbrauner Anzug mit Kreidestreifen wirkte immer noch geschäftsmäßig, ihr volles Haar nach wie vor gepflegt, und auch ihrem Gesicht war die Müdigkeit kaum anzusehen. Ihr Vater war Spanier gewesen, doch sie hatte die blasse Haut und das rotblonde Haar ihrer Mutter geerbt. Sie war groß gewachsen und sportlich fit. Nicht schlecht für eine Achtunddreißigjährige, dachte sie.
Endlich meldete sich Jenny Crawfords Stimme am Telefon. »Das muss doch mitten in der Nacht sein bei euch!«, sagte sie.
»Wir haben einen Fehlbestand im BSL-4«, erklärte Toni.
Jenny war ein wenig beschwipst. »Das kommt doch immer wieder mal vor«, sagte sie ohne erkennbare Beunruhigung. »Und bisher hat noch nie jemand ein großes Drama gemacht.«
»Ja, weil es bisher nicht mein Job war«, erwiderte Toni gereizt. »Wann waren Sie das letzte Mal im BSL-4?«
»Am Dienstag, glaub ich. Aber das muss Ihnen doch eigentlich der Computer sagen, oder?«
Doch, dachte, Toni, aber ich möchte wissen, ob Jennys Aussage mit den Computerdaten übereinstimmt … »Und wann waren Sie zum letzten Mal am Tresor?« Der so genannte Tresor war ein verschlossener Kühlschrank innerhalb des Labors.
Jennys Tonfall verriet, dass ihr die Befragung allmählich auf die Nerven ging. »Das weiß ich nicht mehr genau, aber das wird doch alles aufgezeichnet.« Das Touchpad-Kombinationsschloss des Tresors aktivierte eine Videokamera, die so lange lief, wie die Tür geöffnet war.
»Erinnern Sie sich daran, wann Sie das letzte Mal mit Madoba-2 zu tun hatten?« Madoba-2 war das Virus, mit dem die Wissenschaftler gegenwärtig arbeiteten.
Jenny erschrak. »Au, verdammt – gehört die fehlende Probe etwa dazu?«
»Nein. Trotzdem …«
»Ich hab, glaube ich, niemals konkret mit einem echten Virus zu tun gehabt. Meistens arbeite ich im Labor für Gewebekulturen.«
Das stimmte mit den Informationen überein, die Toni vorliegen hatte. »Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass sich ein Kollege oder eine Kollegin in den letzten Wochen ungewöhnlich benommen oder dass sich sein oder ihr Verhalten plötzlich geändert hat?«
»Das klingt ja wie ein Verhör«, protestierte Jenny.
»Mag sein. Trotzdem …«
»Nein, mir ist nichts dergleichen aufgefallen.«
»Eine Frage noch: Haben Sie Fieber oder erhöhte Temperatur?«
»Verdammt noch mal, soll das etwa heißen, ich könnte Madoba-2 haben?«
»Sind Sie erkältet?«
»Nein!«
»Dann ist alles in Ordnung. Sie haben das Land vor elf Tagen verlassen – wenn irgendwas nicht stimmen würde, hätten Sie inzwischen grippeartige Symptome. Ich danke Ihnen, Jenny. Vermutlich handelt es sich bloß um einen Irrtum im Protokollbuch. Trotzdem müssen wir der Sache nachgehen.«
»Mir haben Sie jedenfalls die Nacht gründlich verdorben«, erwiderte Jenny und beendete das Gespräch.
»Pech für dich«, sagte Toni in die tote Leitung, legte den Hörer auf und fügte hinzu: »Jenny Crawford scheidet aus. Dumme Kuh, aber ehrlich.«
Howard McAlpine war der Leiter des Labors. Sein buschiger grauer Bart zog sich über die Wangenknochen hinauf, sodass die Haut um seine Augen herum wie eine rosa Maske wirkte. McAlpine war ein sorgfältiger Mann, aber kein Pedant. Toni arbeitete normalerweise recht gern mit ihm zusammen, doch diesmal war er alles andere als gut gelaunt. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Sie können doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Material, für das Ihnen der Nachweis fehlt, von einer dazu berechtigten Person benutzt wurde, die lediglich vergessen hat, die Entnahme ins Protokollbuch einzutragen.« Seine Stimme klang gereizt, denn er hatte dieses Argument bereits zwei Mal vorgebracht.
»Ich hoffe, Sie haben Recht«, erwiderte Toni unverbindlich, erhob sich und trat ans Fenster. Vom Personalbüro aus konnte man den Anbau sehen, in dem das BSL-4-Labor untergebracht war. Mit seinen verschnörkelten Schornsteinen und einem Uhrturm fügte er sich nahtlos ins Gesamtbild des Kremls ein, sodass es einem Fremden aus der Entfernung sicher nicht leicht gefallen wäre zu sagen, wo genau in dem ganzen Komplex sich das Hochsicherheitslabor befand. Aber die Fenster mit den hohen Bögen waren mit Milchglas versehen, die Eichentüren mit ihrem Schnitzwerk ließen sich nicht öffnen, und aus den monströsen Köpfen der Wasserspeier spähten einäugig Videokameras herab. Der Anbau war ein einstöckiger Betonkasten in viktorianischer Verkleidung. Die Labors nahmen das gesamte Erdgeschoss ein. Außer den Arbeitsplätzen für die Forscher und den Vorratsräumen gab es eine intensivmedizinische Quarantänestation für Personen, die sich mit einem gefährlichen Virus infiziert hatten. Bisher war sie allerdings noch nie in Anspruch genommen worden. Im ersten Stock waren die Luftfilteranlagen untergebracht, und im Keller eine komplizierte Anlage für die Sterilisierung aller Abfallstoffe, die in den Labors anfielen. Außer den Menschen blieb dort unten nichts am Leben.
»Wir haben eine ganze Menge aus dieser Geschichte gelernt«, sagte Toni in einem um Versöhnung bemühten Tonfall. Ihr war bewusst geworden, dass sie sich in einer nicht unkritischen Lage befand, denn die beiden Herren in den Fünfzigern bekleideten von Rang und Alter her höhere Positionen als sie. Obwohl Toni nicht berechtigt war, ihnen Anweisungen zu erteilen, hatte sie darauf bestanden, dass das Verschwinden der Proben als Krisenfall eingestuft wurde. Zwar mochten die beiden sie durchaus, doch mit ihrem Verhalten strapazierte sie deren guten Willen bis zur Belastungsgrenze. Dennoch hatte sie das Gefühl, dass ihre Vorgehensweise notwendig war und sie gar nicht anders handeln konnte: Die öffentliche Sicherheit, das Ansehen der Firma und ihre eigene Karriere standen auf dem Spiel.
»Künftig muss jeder, der Zugang zum BSL-4 hat, rund um die Uhr telefonisch erreichbar sein, wo immer er sich aufhält«, forderte sie. »Das kann, wenn Gefahr im Verzug ist, entscheidend sein. Außerdem müssen wir die Protokollbücher öfter als einmal im Jahr kontrollieren.«
McAlpine räusperte sich. Die Bestandsverzeichnisse fielen in seine Zuständigkeit als Labordirektor, und der wahre Grund für seine schlechte Laune lag darin, dass Toni und nicht er selbst den Fehlbestand entdeckt hatte. Ihre Sorgfalt warf ein schlechtes Licht auf ihn.
Sie wandte sich an den anderen Mann, James Elliot. Er war der Personalchef. »Sind wir mit der Liste durch, James?«, fragte sie ihn.
Elliot sah von seinem Computermonitor auf. Er war gekleidet wie ein Börsenmakler, in Nadelstreifen und gepunkteter Krawatte, als lege er Wert darauf, sich deutlich von den Wissenschaftlern abzuheben, die lieber in Tweedanzügen herumliefen. Die Sicherheitsvorschriften schien er für lästige bürokratische Kleinkrämerei zu halten, was daran liegen mochte, dass er selber niemals direkt mit Viren zu tun gehabt hatte. Toni hielt ihn für eingebildet und dumm.
»Wir haben mit sechsundzwanzig von siebenundzwanzig Mitarbeitern gesprochen, die zum BSL-4 Zugang haben«, sagte er mit übertriebener Deutlichkeit und klang dabei wie ein müder Lehrer, der dem dümmsten Schüler der Klasse etwas erklären will. »Alle sechsundzwanzig haben wahrheitsgemäß geantwortet, als wir sie fragten, wann sie zum letzten Mal im Labor waren und den Tresor geöffnet haben. Keinem von ihnen ist aufgefallen, dass sich ein Kollege oder eine Kollegin merkwürdig verhielt. Und Fieber hat auch keiner.«
»Wer ist der Siebenundzwanzigste?«
»Michael Ross, ein Laborant.«
»Ich kenne ihn«, sagte Toni. Er war ungefähr zehn Jahre jünger als sie, ein schüchterner, intelligenter Mann. »Ich war sogar schon einmal bei ihm. Er hat ein Haus im Grünen, etwa fünfundzwanzig Kilometer von hier.«
»Er arbeitet seit acht Jahren für uns und ist noch niemals negativ aufgefallen.« McAlpine fuhr mit dem Finger über einen Computerausdruck und ergänzte: »Sonntag vor drei Wochen war er zum letzten Mal im Labor. Es ging um eine Routineüberprüfung der Versuchstiere.«
»Und was hat er seitdem getan?«
»Er hatte Urlaub.«
»Wie lange? Drei Wochen?«
»Er hätte heute zurückkommen müssen«, meinte Elliot und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Oder nein, gestern. Am Montagmorgen. Aber er ist nicht aufgetaucht.«
»Hat er sich krank gemeldet?«
»Nein.«
Toni zog die Brauen hoch. »Und er ist nicht erreichbar?«
»Bisher nicht. Er meldet sich weder unter seiner Privat- noch unter seiner Handynummer.«
»Kommt Ihnen das nicht seltsam vor?«
»Dass ein unverheirateter junger Mann seinen Urlaub eigenmächtig verlängert, ohne sich beim Arbeitgeber abzumelden? Das ist allenfalls so seltsam wie ein Regenschauer im schottischen Hochland.«
Toni wandte sich wieder an McAlpine. »Aber Sie sagten doch, dass er als zuverlässig gilt.«
Der Direktor machte aus seiner Betroffenheit keinen Hehl. »Er ist sehr gewissenhaft. Unentschuldigtes Fehlen würde mich bei ihm sehr wundern.«
»Welcher Kollege ist das letzte Mal bei ihm gewesen?«, fragte Toni. Dass Michael nicht allein im Labor gewesen sein konnte, lag an der »Zwei-Personen-Regel«: Wegen des hohen Risikos war es niemandem gestattet, allein im BSL-4 zu arbeiten.
McAlpine überprüfte die Liste. »Dr. Ansari.«
»Den kenne ich nicht, glaube ich.«
»Die. Es ist eine Frau. Dr. Monica Ansari, eine Biochemikerin.«
Toni griff zum Telefon. »Nummer?«
Monica Ansari sprach schottischen, genauer gesagt Edinburgher Dialekt und klang, als habe man sie aus dem Tiefschlaf geweckt. »Howard McAlpine hat mich vorhin schon angerufen«, sagte sie.
»Tut mir Leid, dass ich Sie noch einmal behelligen muss.«
»Ist was passiert?«
»Es geht um Michael Ross. Wir können ihn nicht erreichen und wissen nicht, wo er steckt. Wenn ich richtig informiert bin, waren Sie am Sonntag vor drei Wochen mit ihm im BSL-4.«
»Ja, das stimmt … Augenblick, ich muss erst mal Licht machen …« Nach kurzer Pause fuhr sie fort: »Drei Wochen ist das schon her?«
»Michael ist am nächsten Tag in Urlaub gefahren«, fügte Toni in drängendem Ton hinzu.
»Er wollte zu seiner Mutter in Devon. Hat er mir jedenfalls erzählt.«
Plötzlich fiel es ihr ein: Toni erinnerte sich, warum sie Michael damals in seinem Haus besucht hatte. Vor etwa einem halben Jahr hatten sie sich in der Kantine unterhalten, und Toni hatte dabei zufällig erwähnt, wie sehr ihr Rembrandts Bildnisse von alten Frauen gefielen, all die mit großer Liebe und Sorgfalt gemalten Runzeln und Falten. »Daran lässt sich ersehen, wie sehr Rembrandt seine Mutter geliebt haben muss«, hatte sie damals gesagt – und bei Michael offene Türen eingerannt. Er habe eine ganze Sammlung von Rembrandt-Radierungen daheim, hatte er gesagt, ausgeschnitten aus Kunstzeitschriften und Auktionskatalogen. Sie waren dann nach der Arbeit zu ihm gefahren und hatten sich die Bilder angesehen – lauter Porträts von alten Frauen in geschmackvollen Rahmen, die eine ganze Wand in Michaels kleinem Wohnzimmer bedeckten. Hoffentlich bittet er mich nicht, mit ihm auszugehen, hatte Toni damals gedacht – sie mochte ihn ja, aber eben nicht so. Zu ihrer großen Erleichterung war ihr eine entsprechende Frage erspart geblieben. Michael hatte offenbar wirklich nichts anderes im Sinn, als ihr voller Stolz seine Sammlung zu präsentieren. Ein Mamakind, hatte sie damals gedacht.
»Das ist ein guter Tipp«, sagte sie jetzt zu Monica. »Bleiben Sie dran, ja?« Toni wandte sich an James Elliot. »Haben wir die Anschrift und die Telefonnummer seiner Mutter gespeichert?«
Elliot bewegte seine Maus und klickte etwas an. »Ja, sie ist als nächste Verwandte registriert.« Er nahm den Telefonhörer ab.
Toni wandte sich wieder an Monica. »Hat Michael an jenem Nachmittag normal gewirkt?«
»Vollkommen.«
»Haben Sie das BSL-4 gemeinsam betreten?«
»Ja. Aber dann haben wir uns natürlich in getrennten Umkleidekabinen umgezogen.«
»Als Sie dann ins eigentliche Labor kamen – war er da schon dort?«
»Ich glaube, ja. Ja, er hatte sich schneller umgezogen als ich.«
»Haben Sie Seite an Seite gearbeitet?«
»Nein. Ich war in einem Nebenraum und habe mich mit Gewebekulturen beschäftigt. Michael hat sich um die Versuchstiere gekümmert.«
»Haben Sie das Labor gleichzeitig mit ihm verlassen?«
»Er ging ein paar Minuten vor mir raus.«
»So, wie es klingt, hätte er leicht an den Tresor gehen können, ohne dass Sie etwas davon bemerkt hätten.«
»Ohne weiteres, ja.«
»Was haben Sie für einen Eindruck von Michael?«
»Der ist in Ordnung … harmlos, würde ich sagen.«
»Ja, das beschreibt ihn ganz gut. Wissen Sie, ob er eine Freundin hat?«
»Soviel ich weiß, nein.«
»Finden Sie ihn attraktiv?«
»Hübscher Kerl, aber nicht sexy.«
Toni lächelte. »Genau! Gibt es sonst irgendwelche Merkwürdigkeiten oder Besonderheiten, die Ihnen an ihm aufgefallen wären?«
»Nein.«
Toni glaubte ein gewisses Zögern in Monicas Stimme zu hören und sagte nichts, um ihrer Gesprächspartnerin Zeit zum Nachdenken zu geben. Neben ihr telefonierte Elliot mit irgendjemandem und bat darum, mit Michael Ross oder seiner Mutter sprechen zu können.
Monica meldete sich wieder zu Wort. »Also, ich meine, bloß deshalb, weil jemand allein lebt, ist er ja noch nicht verrückt, oder?«
Neben Toni sagte Elliot: »Sehr seltsam, ja. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät in der Nacht noch belästigt habe.«
Die Gesprächsfetzen, die sie von nebenan mitbekam, erregten Tonis Neugier. Sie sagte: »Nochmals vielen Dank, Monica. Ich hoffe, Sie können wieder einschlafen.«
»Mein Mann ist Arzt«, erwiderte Monica. »Wir sind daran gewöhnt, mitten in der Nacht angerufen zu werden.«
Toni legte auf. »Michael Ross hatte genug Zeit, den Tresor zu öffnen«, sagte sie. »Außerdem lebt er allein.« Sie sah Elliot an. »Haben Sie seine Mutter erreicht?«
»Es war ein Altenheim«, sagte Elliot, und man sah ihm an, dass ihm der Schreck noch in den Knochen steckte. »Mrs. Ross ist im vergangenen Winter gestorben.«
»Au, verflucht«, sagte Toni.
03.00 Uhr
Die Türme und Giebel des Kremls waren taghell erleuchtet. Aus Sicherheitsgründen wurde der gesamte Komplex nachts von starken Scheinwerfern angestrahlt. Die Außentemperatur betrug minus 5 Grad Celsius, doch der Himmel war klar und es lag kein Schnee. Dem Gebäudekomplex gegenüber breitete sich ein viktorianischer Garten mit alten Bäumen und Sträuchern aus. Ein drei viertel voller Mond warf graues Licht auf nackte Nymphen, die sich, von steinernen Drachen bewacht, in wasserlosen Brunnen tummelten.
Plötzlich erschütterte Motorengedröhn die nächtliche Stille. Zwei Lieferwagen, die mit vier durchbrochenen schwarzen Kreisen auf leuchtend gelbem Grund, dem internationalen Symbol für Biogefährdungen, gekennzeichnet waren, verließen die Garage. Die Torwache hatte die Schranke an der Einfahrt bereits geöffnet. Mit halsbrecherischer Geschwindigkeit rollten die beiden Fahrzeuge auf die Straße hinaus und fuhren in südlicher Richtung davon.
Den ersten Wagen steuerte Toni Gallo, und sie fuhr ihn wie ihren Porsche. Sie beanspruchte die gesamte Breite der Fahrbahn für sich, jagte den Motor auf Hochtouren und nahm die Kurven mit atemberaubender Geschwindigkeit, denn sie fürchtete, zu spät zu kommen. Bei ihr im Wagen saßen drei erfahrene Dekontaminations-Experten. Das zweite Fahrzeug war eine mobile Quarantänestation mit einem Sanitäter am Steuer und Dr. Ruth Solomons, einer Ärztin, auf dem Beifahrersitz.
Toni hatte Angst, sie könne mit ihrem Verdacht Unrecht haben. Doch die Vorstellung, sie könne Recht behalten, erweckte reinstes Entsetzen in ihr.
Auf einen bloßen Verdacht hin hatte sie Alarmstufe »Rot« ausgelöst. Dabei war es durchaus möglich, dass Howard McAlpines Vermutung stimmte: Irgendein Forscher hatte die Probe völlig legal benutzt und nur den entsprechenden Entnahmevermerk im Protokollbuch vergessen. Genauso gut war es möglich, dass Michael Ross seinen Urlaub eigenmächtig um ein paar Tage verlängert hatte und dass es sich bei der Geschichte mit seiner Mutter um ein Missverständnis handelte. In all diesen Fällen wäre Tonis Vorgehen eine maßlose Überreaktion – typisch weibliche Hysterie eben, wie James Elliot süffisant bemerken würde. Kann schon sein, dass Michael Ross friedlich schlummernd in seinem Bett liegt und sein Telefon abgestellt hat, dachte Toni und zuckte bei dem Gedanken, wie sie das am kommenden Vormittag ihrem Chef Stanley Oxenford erklären sollte, unwillkürlich zusammen.
Andererseits: Sollte sie mit ihren Befürchtungen am Ende doch Recht behalten, so wäre alles noch viel, viel schlimmer.
Ein Angestellter blieb unentschuldigt dem Arbeitsplatz fern. Er hatte falsche Angaben über sein Reiseziel gemacht, und zwei Proben des neuen Medikaments waren unauffindbar. Hatte Michael Ross etwas getan, wodurch er sich dem Risiko einer tödlichen Infektion aussetzte? Das Medikament befand sich noch in der Erprobungsphase und wirkte keineswegs gegen alle Viren – aber vielleicht dachte Michael, es sei allemal besser als gar nichts. Was immer er im Schilde führte – auf jeden Fall hatte er großen Wert darauf gelegt, dass ihn ein paar Wochen lang niemand in seinem Hause störte, und deshalb vorgegeben, er wolle nach Devon fahren, um dort eine Mutter zu besuchen, die schon lange tot war.
»Bloß deshalb, weil jemand allein lebt, ist er ja noch nicht verrückt, oder?«, hatte Monica Ansari gesagt. Das war eine jener Bemerkungen, mit denen eigentlich das genaue Gegenteil des Gesagten ausgedrückt wurde. Die Biochemikerin hatte gespürt, dass mit Michael etwas nicht stimmte, auch wenn sie als rational denkende Wissenschaftlerin zögerte, sich auf intuitive Eingebungen dieser Art zu verlassen.
Toni war dagegen überzeugt, dass Intuitionen niemals ignoriert werden sollten.
Welche Folgen es haben würde, wenn das Madoba-2-Virus tatsächlich auf irgendeine Weise freigesetzt worden wäre, daran wagte Toni Gallo kaum zu denken. Es war hochansteckend und verbreitete sich rasch durch Tröpfcheninfektion, also vor allem durch Husten und Niesen. Und es war absolut tödlich. Sie schauderte bei dem Gedanken daran und trat unwillkürlich das Gaspedal durch bis zum Anschlag.
Da die Straße völlig frei war, dauerte es nur zwanzig Minuten, bis sie das einsam gelegene Haus von Michael Ross erreichte. Die Zufahrt war nicht leicht zu erkennen, doch Toni konnte sich noch gut daran erinnern. Der schmale Weg führte zu einem niedrigen Steinhaus hinter einer Gartenmauer. Nirgendwo brannte ein Licht. Toni hielt neben einem VW Golf, von dem sie annahm, dass er Michael gehörte. Dann drückte sie auf die Hupe. Lang und laut schallte es durch die Nacht.
Nichts geschah. Weder gingen irgendwelche Lichter an, noch öffnete sich ein Fenster oder eine Tür. Toni stellte den Motor ab.
Stille.
Wenn Michael nicht hier war – warum stand sein Wagen dann vor der Tür?
»Volle Montur, bitte, meine Herren«, sagte Toni.
Alle Beteiligten stiegen in ihre orangefarbenen Schutzanzüge, auch die Insassen des zweiten Lieferwagens. Das war gar nicht so einfach: Die Schutzkleidung bestand aus schwerem Kunststoff, der sich nur mühsam biegen oder falten ließ und mit einem luftdichten Reißverschluss zugezogen wurde. Man half sich gegenseitig, die Handschuhe mit Isolierband um die Handgelenke zu binden. Zum Schluss wurden die Plastikfüße in große Gummistiefel gezwängt.
Die Schutzanzüge waren absolut dicht. Die Träger atmeten durch so genannte HEPA-Filter, hochwirksame Luftpartikelfilter mit einem elektrischen Ventilator, der seinen Strom aus mehreren am Gürtel befestigten Batterien bezog. Der Filter hielt sämtliche lungengängige Teilchen fern, die mit Bazillen oder Viren verseucht sein und über die Atemluft aufgenommen werden konnten. Auch die stärksten Gerüche wurden weitgehend ausgefiltert. Das ständige Surren des Ventilators empfanden manche allerdings als nervtötend. Über einen in den Helm eingebauten Kopfhörer und ein Mikrofon konnte man sich auf einer verschlüsselten Frequenz sowohl untereinander als auch mit der Vermittlung im Kreml verständigen.
Als alle ordnungsgemäß ihre Schutzanzüge angelegt hatten, konzentrierte sich Toni wieder auf das Haus. Wer jetzt dort aus dem Fenster schaute, hätte die sieben Personen wahrscheinlich für Aliens aus einem UFO gehalten.
Nur – sofern sich überhaupt jemand in dem Haus aufhielt, so schaute er jedenfalls nicht aus dem Fenster.
»Ich gehe voran«, sagte Toni.
Mit steifen Schritten stakste sie in der unförmigen Plastikverkleidung zur Eingangstür, klingelte und ließ den Türklopfer scheppern.
Als sich nichts rührte, ging sie um das Gebäude herum. Hinter dem Haus lag ein gepflegter Garten mit einem Gartenhäuschen. Toni stellte fest, dass die Hintertür nicht verschlossen war, und betrat das Haus. Es war die Küche; sie erinnerte sich, wie Michael damals bei ihrem Besuch hier Tee gekocht hatte. Rasch durchquerte sie das Haus und schaltete die Lichter ein. Die Rembrandts hingen nach wie vor an der Wand im Wohnzimmer. Das Haus war sauber, ordentlich aufgeräumt – und menschenleer.
»Niemand zu Hause«, ließ sie die anderen über Kopfhörer wissen und merkte selbst, wie bedrückt ihre Stimme klang.
Warum hat er das Haus verlassen, ohne die Türen abzuschließen, fragte sie sich. Vielleicht will er gar nicht mehr zurückkommen …
Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Wenn sie Michael angetroffen hätten, so wäre das Rätsel vermutlich schnell gelöst worden. Nun aber mussten sie ihn erst suchen. Er konnte praktisch überall sein, und kein Mensch konnte voraussagen, wann man ihn fand. Die nervtötende, angstvolle Warterei konnte Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern – die reinste Horrorvorstellung!
Toni ging wieder hinaus in den Garten. Um nichts unversucht zu lassen, probierte sie die Türklinke am Holzschuppen. Er war ebenfalls unverschlossen, und als Toni die Tür öffnete, nahm sie einen ganz schwachen, unangenehmen, aber doch irgendwie vertrauten Geruch wahr. Er muss verdammt stark sein, dass ich ihn durch den Filter hindurch riechen kann, dachte sie, und im selben Moment erkannte sie ihn: Blut. In dem Gartenhäuschen roch es wie in einem Schlachthaus. »O Gott!«, murmelte sie.
Ruth Solomons, die Ärztin, hörte sie und fragte: »Was ist los?«
»Augenblick!« In der Gartenhütte war es stockdunkel; Fenster gab es keine. Toni tastete nach dem Schalter, fand ihn, knipste das Licht an – und stieß einen Schrei des Entsetzens aus.
Die anderen sprachen alle gleichzeitig und wollten wissen, was passiert war.
»Alles hierher, schnell!«, sagte Toni. »Ins Gartenhäuschen. Ruth zuerst.«
Michael Ross lag mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden. Er blutete aus allen Körperöffnungen: aus Augen, Nase, Mund und Ohren. Das Blut bildete kleine Lachen auf den Holzdielen. Toni benötigte keine Ärztin, um zu erkennen, dass Michael an einer massiven multiplen Blutung litt, einem klassischen Symptom von Madoba-2 und ähnlichen Infektionen. Er war höchstgradig ansteckend, sein Körper eine Zeitbombe voller tödlicher Viren. Aber er lebte. Sein Brustkorb hob und senkte sich, und aus seinem Mund drang ein blubberndes Geräusch. In einer klebrigen Pfütze aus frischem Blut kniend, beugte sich Toni über ihn. »Michael!«, schrie sie, damit er sie durch ihren Plastikhelm hindurch verstehen konnte. »Ich bin’s, Toni Gallo aus dem Labor.«
In Michaels blutunterlaufenen Augen blitzte es auf; er hatte sie offenbar erkannt. Er öffnete den Mund und stammelte irgendetwas.
»Was?«, wollte Toni wissen und beugte sich noch näher zu ihm hin.
»Unheilbar«, sagte Michael, bevor er sich übergab. Aus seinem Mund spritzte eine schwarze Flüssigkeit und klatschte gegen Tonis Visier. Sie zuckte zurück und stieß einen Schrei aus, obwohl sie wusste, dass ihr Anzug sie schützte.
Dann wurde sie beiseite geschoben, und Dr. Ruth Solomons beugte sich über den Kranken.
»Der Puls ist sehr schwach«, sagte die Ärztin über den Sprechfunk. Sie öffnete Michaels Mund und fischte mit dem behandschuhten Finger Blut und Erbrochenes aus seinem Hals. »Ich brauche ein Laryngoskop!«, rief sie. »Schnell!« Sekunden später stürzte ein Sanitäter herbei und brachte ihr das gewünschte Instrument. Ruth intubierte Michael und räumte seinen Rachen aus, sodass er wieder besser atmen konnte. »Holt jetzt so schnell wie möglich die Tragbahre aus der Quarantäne-Station!« Sie öffnete ihren Arztkoffer, entnahm ihm eine Spritze, die, wie Toni vermutete, bereits mit Morphium und einem Blutgerinnungsmittel gefüllt war, stach die Injektionsnadel in Michaels Hals und drückte den Kolben herunter. Als sie die Nadel wieder herauszog, blutete die winzige Wunde stark.
Eine Welle des Mitleids und der Trauer überkam Toni. Sie sah Michael in ihrer Erinnerung wieder durch den Kreml schlendern, sah ihn in seinem Haus beim Teetrinken, hörte wieder, wie er voller Begeisterung über die Radierungen sprach. Der Anblick seines so grauenvoll mitgenommenen Körpers machte alles noch tragischer, noch schmerzhafter.
»Okay«, sagte Ruth. »Bringen wir ihn hier raus.«
Zwei Sanitäter hoben Michael auf und schleppten ihn zu einer Bahre, über die sich ein durchsichtiges Plastikzelt wölbte. Sie ließen den Patienten durch eine Schleuse ins Innere des Zelts gleiten und verschlossen die Öffnung sorgfältig. Dann rollten sie die Bahre durch Michaels Garten zurück. Bevor sie jedoch den Krankenwagen betreten durften, mussten sie sich und die Bahre dekontaminieren. Ein Mann aus Tonis Team hatte bereits eine flache Plastikwanne geholt, die aussah wie ein Kinderplanschbecken. Dr. Solomons und die Sanitäter stellten sich der Reihe nach hinein und ließen sich mit einem Desinfektionsmittel absprühen, dass alle Viren zerstörte, indem es ihr Eiweiß oxidierte.
Obwohl sie wusste, dass Michaels Überlebenschancen mit jeder Sekunde Verzögerung geringer wurden, sah Toni der Prozedur wortlos zu. Ihr war nur allzu klar, dass die Dekontaminierungsvorschriften peinlich genau beachtet werden mussten, um weitere Todesfälle zu verhindern. Es traf sie bis ins Mark, dass ein tödliches Virus aus ihrem Labor entwichen war; so etwas war in der Geschichte der Firma Oxenford Medical noch nie geschehen. Und dass sie recht daran getan hatte, um die fehlenden Proben einen solchen Wirbel zu machen, während die Kollegen die Angelegenheit nach Kräften heruntergespielt hatten, war auch nur ein schwacher Trost. Ihre Aufgabe bestand darin, zu verhindern, dass es zu solchen Pannen kam – also hatte sie versagt. Musste deshalb jetzt der arme Michael sterben? Und andere vielleicht auch noch?
Die Sanitäter verfrachteten die Bahre in den Krankenwagen. Dr. Solomons schwang sich hinten in den Kasten, um bei ihrem Patienten zu bleiben. Die Türen wurden zugeworfen, und schon fuhr der Wagen an und verschwand mit aufheulendem Motor in der Nacht.
»Halt mich auf dem Laufenden, Ruth«, sagte Toni. »Du kannst mich über den Helmfunk erreichen.«
Ruths Stimme klang wegen der wachsenden Entfernung schon viel schwächer. »Er ist ins Koma gefallen«, sagte sie und fügte noch etwas hinzu, das Toni kaum mehr verstand. Die Stimme der Ärztin wurde rasch leiser, und kurz darauf war sie überhaupt nicht mehr zu hören.
Toni schüttelte sich, um sich aus ihrer düsteren Erstarrung zu lösen. Es gab genug zu tun. »An die Arbeit«, sagte sie. »Machen wir sauber!«
Einer ihrer Mitarbeiter entrollte ein gelbes Band mit der Aufschrift »Biologischer Unfall – Betreten verboten!« und begann das gesamte Grundstück damit abzusperren – das Haus, den Garten mitsamt der Hütte sowie Michaels Wagen. Glücklicherweise waren keine anderen Häuser betroffen. Hätte Michael in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinsamen Lüftungsschächten gelebt, wäre eine Dekontamination schon zu spät gekommen.
Andere Mitarbeiter holten Rollen mit Müllsäcken, Gartensprinkleranlagen, die mit Desinfektionsmitteln gefüllt waren, Kartons voller Reinigungstücher und große, weiße Plastiktonnen herbei. Sämtliche Oberflächen mussten besprüht und abgewischt werden. Lose Gegenstände und Wertsachen wie Schmuck mussten in versiegelten Behältern in den Kreml gebracht und dort in einem Dampfdruck-Autoklaven sterilisiert werden. Alles andere verschwand in doppelten Müllsäcken, um später in der Verbrennungsanlage für medizinische Abfälle unterhalb des BSL-4-Labors entsorgt zu werden.
Toni bat einen der Männer, die schwarze Substanz, die Michael erbrochen hatte, von ihrem Schutzanzug zu wischen und sie abzusprühen. Es kostete sie Überwindung, sich den besudelten Anzug nicht einfach vom Leib zu reißen.
Während die Männer mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt waren, sah Toni sich um und versuchte Hinweise auf die Hintergründe des Geschehens zu finden. Wie von ihr befürchtet, hatte Michael die Probe gestohlen, weil er wusste – oder zumindest vermutete –, dass er mit dem Madoba-2-Virus infiziert war. Aber wie war es zu dieser Infektion gekommen?
In der Gartenhütte befand sich ein Glasbehälter mit einer Wasserstrahlpumpe zur Erzeugung eines Vakuums wie in einem improvisierten Sicherheitslabor. Während sie sich um Michael kümmerte, hatte sie dieser Einrichtung kaum Beachtung geschenkt, doch jetzt entdeckte sie, dass in dem Behälter ein totes Kaninchen lag. Es sah aus, als sei es an der gleichen Krankheit verendet, mit der Michael sich infiziert hatte. Ob das Tier aus dem Labor stammte?
Neben dem Kadaver stand ein Trinknapf mit der Aufschrift »Joe«. Das war ein wichtiger Hinweis. Wer im Labor arbeitete, gab den Versuchstieren nur selten Namen. Man verhielt sich den künftigen Opfern der Experimente gegenüber freundlich, achtete aber darauf, dass sich keine persönliche Zuneigung zu den Todgeweihten entwickelte. Michael hatte seinem Kaninchen dagegen eine Identität gegeben, es wie ein Haustier behandelt. Hatte er seines Berufs wegen etwa ein schlechtes Gewissen?
Toni verließ die Hütte. Neben der mobilen Quarantänestation hielt gerade ein Streifenwagen der Polizei. Toni hatte damit gerechnet. In Übereinstimmung mit dem von ihr selbst entwickelten Krisenplan hatte der Werkschutz im Kreml nach dem Alarm automatisch die zuständige Polizeiwache in Inverburn informiert, und diese hatte einen Streifenwagen geschickt, um vor Ort zu überprüfen, wie ernst die Lage war.
Bis vor zwei Jahren war Toni selber bei der Polizei gewesen. Es war ihr Beruf, und lange Zeit galt sie sogar als Vorzeigefrau, die rasch Karriere machte und den Medien als Prototyp der modernen, bürgernahen Polizistin präsentiert wurde. Viele sahen in ihr schon die künftige erste Polizeipräsidentin Schottlands. Doch dann hatte sie sich mit ihrem Chef überworfen. Es ging um ein brisantes Thema: Rassismus in der Truppe. Der Chef meinte, es handele sich um bedauerliche Einzelfälle, nicht um ein allgemeines Problem. Toni hielt dagegen, dass Polizisten rassistische Übergriffe routinemäßig vertuschten – und damit sei das »Problem« die Regel und nicht die Ausnahme. Die Presse hatte von der Auseinandersetzung Wind bekommen und darüber berichtet. Toni weigerte sich, ihre Vorwürfe, von deren Berechtigung sie fest überzeugt war, zu dementieren, und wurde daraufhin zur Kündigung ihres Dienstverhältnisses genötigt.
Sie war nicht verheiratet, lebte damals aber schon seit acht Jahren mit Frank Hackett zusammen, auch er ein Polizist. Als Toni in Ungnade fiel, trennte er sich von ihr. Es tat noch immer weh.
Zwei junge Polizisten verließen den Streifenwagen, ein Mann und eine Frau. Toni kannte hier in der Gegend die meisten Beamten ihrer Generation, und einige der Älteren konnten sich sogar noch an Tonis verstorbenen Vater erinnern, Sergeant Antonio Gallo – den alle natürlich den »Spanier-Tony« nannten. Die beiden, die jetzt vor Michaels Haus aufkreuzten, waren ihr allerdings unbekannt. Über den Sprechfunk sagte sie: »Jonathan, die Polizei ist jetzt da. Bitte, dekontaminieren Sie, und kümmern Sie sich um die beiden. Sagen Sie ihnen, wir haben festgestellt, dass ein Virus aus dem Labor entkommen ist. Sie werden dann Jim Kincaid anrufen. Wenn er hier ist, informiere ich ihn.«
Superintendent James Kincaid war zuständig für »CBRN«, das heißt für chemische, biologische, radiologische und nukleare Unfälle. Er hatte Toni bei der Ausarbeitung ihres Notfallplans geholfen. Mit ihm wollte sie das weitere Vorgehen besprechen; es kam jetzt darauf an, mit aller gebotenen Sorgfalt, aber ohne Panikmache zu handeln.
Wenn Kincaid eintraf, wollte sie ihm gleich ein paar Informationen über Michael Ross geben. Sie ging ins Haus. Michael hatte das zweite Schlafzimmer zu einem Büro umfunktioniert. Auf einem kleinen Tisch standen drei gerahmte Fotos seiner Mutter: als schlanker Teenager in einem engen Pullover, als glückliche Mutter mit einem Baby im Arm, das wie Michael aussah, und als Frau in den Sechzigern mit einer dicken schwarzweißen Katze auf dem Schoß.
Toni setzte sich an den Schreibtisch, fuhr den Computer hoch und las Michaels E-Mails. Mit den unförmigen Gummihandschuhen die Tastatur zu bedienen war gar nicht so leicht. Er hatte bei Amazon ein Buch mit dem Titel Animal Ethics bestellt und sich über Studienangebote in Moralphilosophie informiert. Der Internet-Browser verriet ihr zudem, dass er in jüngster Zeit wiederholt die Homepages von Tierschutzverbänden angeklickt hatte. Es lag auf der Hand, dass ihm Zweifel an der moralischen Rechtfertigung seiner Tätigkeit gekommen waren. Bei Oxenford Medical war allerdings niemandem aufgefallen, dass er sich in einem seelischen Dilemma befand.
Toni konnte ihn gut verstehen. Es gab ihr jedes Mal einen Stich ins Herz, wenn sie in einem Käfig einen Beagle oder einen Hamster sah, den Wissenschaftler bewusst mit einer Krankheit infiziert hatten. Doch dann musste sie immer wieder an den Tod ihres Vaters denken: Der Mittfünfziger war an einem Gehirntumor erkrankt und am Ende geistig verwirrt, würdelos und unter großen Schmerzen gestorben. Eines Tages könnten solche Leiden vielleicht geheilt werden – dank der Versuche, die an Affenhirnen durchgeführt wurden.
In einem Pappkarton bewahrte Michael, sorgfältig beschriftet, seine wichtigsten Papiere auf: Rechnungen, Garantien, Kontoauszüge, Gebrauchsanweisungen. Unter »Mitgliedschaften« fand Toni eine Karte, die ihn als eingetragenes Mitglied einer Organisation namens Animals Are Free auswies: »Tiere sind frei.« Allmählich schälte sich ein klares Bild heraus.
Die Arbeit beruhigte Toni ein wenig. Kriminalistische Arbeit war immer eine ihrer Stärken gewesen, und dass man sie dazu gezwungen hatte, den Polizeidienst zu quittieren, empfand sie nach wie vor als schweren Schlag. Aus der Tatsache, dass sie ihre alten Talente und Fähigkeiten noch nicht verlernt hatte, schöpfte sie allerdings eine gewisse Befriedigung.
In einer Schublade fand sie Michaels Adressbuch und seinen Terminkalender. Der Letztere wies für die vergangenen beiden Wochen keinerlei Einträge auf. Während Toni das Adressbuch aufschlug, blitzte es draußen vor dem Fenster blau auf. Sie sah hinaus und erblickte einen grauen Volvo mit rotierendem Blaulicht auf dem Dach. Das musste Jim Kincaid sein.
Sie verließ das Haus und ließ sich von einem ihrer Mitarbeiter dekontaminieren. Dann nahm sie ihren Helm ab, um den Superintendenten zu begrüßen. Doch der Mann im Volvo war nicht Jim. Im Mondlicht erkannte sie Superintendent Frank Hackett, ihren Ex-Freund.
Schlagartig war es um ihre gute Stimmung geschehen. Obwohl die Trennung von ihm ausgegangen war, tat er stets, als wäre er derjenige gewesen, der am meisten darunter zu leiden gehabt hatte.
Toni beschloss, ihm gegenüber ruhig, freundlich und professionell aufzutreten.
Er stieg aus dem Wagen und kam auf sie zu. »Bitte beachte die Absperrung!«, rief sie ihm zu. »Ich komme gleich!« Im selben Augenblick wurde ihr klar, dass sie mit dieser Aufforderung gegen die Hackordnung verstoßen hatte: Er war der Polizist, sie die Zivilperson. Seinem Verständnis zufolge hatte er ihr Befehle zu geben, nicht sie ihm. Sein Stirnrunzeln verriet, dass er die Kränkung durchaus als solche empfand. Toni bemühte sich um mehr Verbindlichkeit. »Wie geht’s dir, Frank?«
»Was geht hier vor?«
»Ein Laborangestellter ist offenbar von einem Virus befallen worden. Wir haben ihn gerade in einem Quarantänefahrzeug abtransportieren lassen und sind jetzt dabei, das Haus zu dekontaminieren. Wo ist Jim Kincaid?«
»Im Urlaub.«
»Wo?« Toni hoffte, Jim erreichen und ihn wegen des Notfalls zurückholen zu können.
»In Portugal. Er und seine Frau haben zufällig gerade mal gemeinsam frei.«
Schade, dachte Toni. Kincaid versteht was von Biogefährdungen, Frank hat keine Ahnung.
Er schien ihre Gedanken zu lesen. »Keine Angst«, sagte er und verwies auf ein mindestens zwei Zentimeter dickes fotokopiertes Dokument, das er in der Hand hielt. »Ich habe das Protokoll hier.« Es handelte sich um den Notfallplan, den Toni mit Kincaid ausgearbeitet hatte. Frank hatte offenbar während der Fahrt darin gelesen. »Zunächst einmal muss ich den Unglücksort sichern«, sagte er und blickte in die Runde.
Toni hatte den Ort des Geschehens längst sichern lassen, verzichtete aber auf einen Kommentar. Frank brauchte etwas zur Selbstbestätigung.
»He, Sie da!«, rief er den beiden uniformierten Beamten im Streifenwagen zu. »Parken Sie den Wagen vor der Einfahrt, und lassen Sie niemanden ohne Rücksprache mit mir rein!«
»Gute Idee«, sagte Toni, obwohl diese Maßnahme in Wirklichkeit völlig unnötig war.
»Als Nächstes müssen wir dafür Sorge tragen, dass niemand das Gelände verlässt.« Frank bezog sich wieder auf den Notfallplan.
Toni nickte. »Außer meinem Team ist niemand hier – und meine Leute tragen alle Schutzanzüge.«
»Mir gefällt das Protokoll nicht. Hier werden Zivilpersonen mit der Verantwortung für einen Verbrechensschauplatz betraut.«
»Wie kommst du darauf, dass es sich um den Schauplatz eines Verbrechens handelt?«
»Es wurden Proben eines Medikaments gestohlen.«
»Nicht von hier.«
Frank ließ ihr die Spitze durchgehen. »Wie hat euer Mann dieses Virus denn aufgeschnappt? Ich dachte, ihr tragt im Labor immer eure Schutzanzüge.«
»Das muss die Gesundheitsbehörde rausfinden«, erwiderte Toni, um eine Ausrede bemüht. »Es hat keinen Sinn, jetzt darüber zu spekulieren.«
»Habt ihr hier irgendwelche Tiere vorgefunden?«
Toni zögerte.
Frank genügte das. Er war ein guter Kriminalbeamter, weil ihm nur selten etwas entging. »Dann ist also so ein Versuchstier ausgekommen und hat den Angestellten infiziert, der gerade keinen Schutzanzug trug?«
»Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist – und ich möchte nicht, dass irgendwelche unausgegorenen Theorien in Umlauf kommen. Könnten wir uns vorerst einmal auf die Belange der öffentlichen Sicherheit konzentrieren?«
»Okay. Aber die öffentliche Sicherheit ist nicht das Einzige, was dich umtreibt. Du willst auch deine Firma schützen – und deinen hochverehrten Herrn Professor Oxenford.«
›Hochverehrter Herr Professor‹ – was soll denn das schon wieder, dachte Toni, doch bevor sie reagieren konnte, hörte sie ein Klingeln aus ihrem Helm. »Ein Anruf für mich«, sagte sie zu Frank, nahm den Kopfhörer aus dem Helm und setzte ihn auf. Wieder klingelte es, dann rauschte es, bis die Verbindung stand. Schließlich meldete sich die Stimme eines Wachmanns in der Telefonzentrale des Kreml. »Ich habe hier Frau Dr. Solomons für Ms. Gallo.«
»Hallo?«, sagte Toni.
Jetzt war die Ärztin am Apparat. »Michael ist tot, Toni.«
Toni schloss die Augen. »O Gott, Ruth, das tut mir so Leid.«
»Er wäre auch gestorben, wenn wir ihn vierundzwanzig Stunden früher gefunden hätten. Ich bin mir fast sicher, dass er Madoba-2 hatte.«
»Wir haben getan, was wir konnten«, erwiderte Toni mit tränenerstickter Stimme.
»Haben Sie eine Ahnung, wie das geschehen konnte?«
Toni wollte in Gegenwart von Frank nicht zu viel sagen. »Michael empörte sich über die grausame Behandlung von Tieren. Außerdem hat ihn der Tod seiner Mutter vor ungefähr einem Jahr möglicherweise sehr belastet und ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht.«
»Armer Kerl.«
»Ruth, die Polizei ist gerade bei mir. Ich rufe Sie später zurück.«
»Okay.« Die Leitung wurde unterbrochen. Toni nahm den Kopfhörer ab.
»Dann ist er also tot«, sagte Frank.
»Der Mann hieß Michael Ross. Er hat sich anscheinend mit einem Virus angesteckt, der die Bezeichnung Madoba-2 trägt.«
»Und was war das für ein Tier?«
Aus einer Eingebung heraus beschloss Toni, Frank eine kleine Falle zu stellen. »Ein Hamster namens Fluffy«, sagte sie.
»Ist es möglich, dass sich auch andere Personen infiziert haben?«
»Das ist jetzt die Frage Nummer eins. Michael lebte hier allein; er hatte keine Familie und nur wenige Freunde. Wer ihn vor Ausbruch der Krankheit besucht hat, dürfte ungefährdet sein, es sei denn, die beiden wären einander sehr nahe gekommen, indem sie zum Beispiel ein und dieselbe Injektionsnadel benutzt hätten. Wer ihn dagegen aufgesucht hat, als sich bereits die Symptome zeigten, hätte sicher sofort einen Arzt gerufen. Es besteht also durchaus die Chance, dass Michael das Virus gar nicht weitergegeben hat.« Toni spielte die Sache herunter. Kincaid gegenüber wäre sie aufrichtiger gewesen, weil sie sich bei ihm darauf hätte verlassen können, dass er alles tat, um den Ausbruch einer Panik zu vermeiden. Bei Frank lagen die Dinge anders. »Aber wie dem auch sei«, fuhr sie fort, »wir müssen jetzt so schnell wie möglich alle Personen aufspüren, die mit Michael in den vergangenen sechzehn Tagen Kontakt hatten.«
Frank versuchte es auf einem anderen Weg. »Wie ich hörte, war der Mann ein großer Tierfreund. Gehörte er einer entsprechenden Organisation an?«
»Ja – Animals Are Free!«
»Woher weißt du das?«
»Ich habe seine persönlichen Unterlagen überprüft.«
»Das ist Aufgabe der Polizei.«
»Richtig. Aber ihr dürft nicht ins Haus.«
»Ich kann doch auch so einen Schutzanzug anziehen.«
»Mit dem Anzug allein ist es nicht getan. Ehe man so ein Ding überhaupt anziehen darf, muss man eine entsprechende Ausbildung nachweisen.«
Frank begann sich wieder aufzuregen. »Dann bringt mir halt das Zeug hierher«, sagte er.
»Ich kann dir von einem Mitarbeiter alle Papiere zufaxen lassen, was hältst du davon? Außerdem können wir dir den gesamten Inhalt seiner Festplatte kopieren.«
»Ich will keine Kopien, sondern die Originale. Was verbirgst du in dem Haus?«
»Nichts, Ehrenwort. Aber das Haus und alles, was sich im Haus befindet, muss dekontaminiert werden, entweder mit einem Desinfektionsmittel oder einem Hochdruckreiniger. Bei beiden Vorgängen wird Papier zerstört, und natürlich können auch Computer beschädigt werden.«
»Ich werde dafür sorgen, dass dieser Notfallplan geändert wird. Ich frage mich wirklich, ob der Polizeipräsident überhaupt weiß, was Kincaid euch alles durchgehen lässt.«
Toni war müde. Es ist mitten in der Nacht, und ich muss eine hochbrisante Krise in Griff kriegen, dachte sie – und da kommt auch noch diese beleidigte Leberwurst von Ex-Lover daher und erwartet, dass man auf seine Empfindlichkeiten Rücksicht nimmt … »Herrgott, Frank, kann ja sein, dass du Recht hast, aber so ist die Lage nun mal. Können wir die Vergangenheit nicht endlich ruhen lassen und vernünftig zusammenarbeiten?«
»Deine Vorstellung von Zusammenarbeit besteht darin, dass alles nach deiner Pfeife tanzt.«
Toni lachte. »Du hast’s erfasst! Also, was sollen wir deiner Meinung nach als Nächstes tun?«
»Ich werde das Gesundheitsamt informieren. Laut Plan liegt die Federführung in solchen Fällen dort. Sobald das Amt seinen Experten für Biounfälle aufgetrieben hat, wird er einen Krisenstab einberufen, voraussichtlich gleich heute Morgen. Bis es so weit ist, sollten wir schon damit anfangen, die möglichen Kontaktpersonen von Michael Ross ausfindig zu machen. Ich werde ein paar Kollegen ans Telefon setzen und sämtliche Nummern in seinem Adressbuch anrufen lassen. Du solltest unterdessen alle Angestellten eurer Firma befragen. Es wäre sehr hilfreich, wenn wir das alles schon erledigt hätten, bevor der Krisenstab zusammentritt.«
»Einverstanden …« Toni zögerte. Sie musste Frank noch um etwas bitten. Sein bester Freund war Carl Osborne, ein Reporter beim Lokalfernsehen, der mehr von Sensationen hielt als von seriöser Berichterstattung. Wenn Carl von der Geschichte Wind bekam, würde er für einen Aufstand sorgen.
Toni wusste, wie man bei Frank etwas erreichen konnte: Man musste ihm klipp und klar sagen, was man wollte. Wer allzu selbstbewusst Forderungen stellte oder gar an sein Mitleid appellierte, hatte schlechte Karten bei ihm. »Es gibt da im Protokoll noch einen Punkt, auf den ich dich aufmerksam machen wollte«, begann sie. »Dort heißt es, dass gegenüber der Presse keine Stellungnahmen abgegeben werden sollen, ohne dass die beteiligten Organisationen, darunter die Polizei, das Gesundheitsamt und die Firma, sich zuvor darüber abgestimmt haben.«
»Kein Problem.«
»Ich erwähne das, weil wir die Öffentlichkeit nicht über Gebühr verunsichern sollten. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass niemand mehr in Gefahr gerät.«
»Gut.«
»Wir wollen nichts verheimlichen, aber die offiziellen Statements sollten ruhig und gemäßigt sein. Es besteht keinerlei Anlass zu Panik.«
Frank grinste. »Ich weiß schon, du hast Angst, die Revolverblätter könnten Storys über Killerhamster bringen, die durchs schottische Hochland streifen.«
»Du bist mir noch was schuldig, Frank. Ich hoffe, du hast das nicht vergessen.«
Seine Miene verdüsterte sich. »Was schuldig? Ich dir?«
Obwohl niemand in der Nähe war, senkte Toni die Stimme: »Du erinnerst dich doch an Farmer Johnny Kirk …« Kirk war ein dicker Fisch im Kokainschmuggel gewesen. Eine Farm hatte der im rauen Milieu der Glasgower Garscube Road aufgewachsene Mann nie gesehen, doch weil er wegen seiner Hühneraugen immer übergroße grüne Gummistiefel trug, hatte man ihm den Spitznamen »Farmer« verpasst. Frank hatte gegen Farmer Johnny ermittelt. Während des Prozesses war Toni zufällig auf Beweismaterial gestoßen, das der Verteidigung gerade recht gekommen wäre. Sie informierte Frank darüber – doch der unterließ es, dem Gericht darüber Mitteilung zu machen. Johnny hatte ohne jeden Zweifel genug Dreck am Stecken, und Franks Meinung dazu war klar – nur: Sollte jemals die Wahrheit herauskommen, war es um seine Karriere bei der Polizei geschehen.
»Willst du mir etwa drohen für den Fall, dass ich nicht tue, was du sagst?«
»Nein. Ich will dich bloß daran erinnern, dass es mal eine Zeit gab, in der du auf mein Schweigen angewiesen warst. Und da hab ich geschwiegen.«
Wieder änderte sich Franks Verhalten. Einen Augenblick lang war ihm mulmig geworden, doch schon kehrte er zur gewohnten Arroganz zurück. »Jeder von uns verstößt mal gegen die eine oder andere Regel. So ist das Leben.«
»Ja. Und deshalb bitte ich dich jetzt, weder deinem Freund Carl Osborne noch irgendwelchen anderen Medienvertretern etwas von diesem Fall zu erzählen.«
Frank grinste. »Aber Toni!«, sagte er in gespielter Empörung. »Du weißt doch, dass ich so etwas nie tun würde.«
07.00 Uhr
Kit Oxenford erwachte früh am Morgen. Eine gespannte Erwartung beherrschte ihn, aber er hatte auch Angst. Ein seltsames Gefühl war es allemal.
Heute war der Tag, an dem er Oxenford Medical bestehlen würde.
Allein der Gedanke daran erregte ihn. Es versprach ein Geniestreich zu werden, wie es ihn noch nie gegeben hatte, Thema für Bücher mit Titeln wie Das perfekte Verbrechen und dergleichen, vor allem aber: Er nähme Rache an seinem Vater. Die Firma würde diesen Schlag nicht überleben, und Stanley Oxenford wäre finanziell ruiniert. Und dass der alte Herr nie erfahren würde, wer ihm das angetan hatte, setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Kit versprach sich davon eine klammheimliche Befriedigung, von der er sein Leben lang würde zehren können.
Aber es mischte sich auch Sorge in seine Euphorie, und das war eigentlich eher ungewöhnlich für ihn. Er war von Natur aus nie ein großer Bedenkenträger gewesen. Geriet er in Schwierigkeiten, so redete er sich im Allgemeinen schon irgendwie heraus. Es kam nur selten vor, dass er etwas plante.
Das, was heute geschehen sollte, hatte er allerdings geplant – und vielleicht lag sein Problem gerade darin.
Er lag mit geschlossenen Augen im Bett und dachte darüber nach, welche Stolpersteine es noch zu überwinden galt.
Da waren zunächst einmal die physikalischen Sicherheitsvorkehrungen im Kreml: der doppelte Zaun mit messerscharfem NATO-Draht, die Scheinwerfer, die Alarmanlage, der kein Eindringling entging. Die Anlagen waren geschützt durch Kontaktschalter, Bewegungsmelder und Abschlusswiderstände mit Programmroutinen, denen auch ein Kurzschluss nicht entging. Darüber hinaus war die Alarmanlage über eine Telefonleitung, die vom System kontinuierlich auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft wurde, direkt mit der regionalen Polizeidirektion in Inverburn verbunden.
Doch das alles waren keine Hindernisse für Kit und seine Komplizen.
Dann gab es natürlich noch den Werkschutz, der neuralgische Punkte über eine interne Videoanlage im Auge behielt und stündlich das Gelände patrouillierte. Die Monitore der Videoüberwachung waren mit Sabotagekontakten versehen, die auch einen möglichen Geräteaustausch bemerken würden – zum Beispiel wenn jemand auf die Idee käme, das Kamerabild durch die Aufnahmen eines Videorecorders zu ersetzen.
Auch für dieses Problem hatte sich Kit eine Lösung ausgedacht.
Darüber hinaus wurde der Zutritt zum Gebäude und zu den sicherheitsrelevanten Bereichen durch eine ausgeklügelte Personenkontrolle geregelt: Alle Mitarbeiter hatten Plastikausweise im Kreditkartenformat, die nicht nur mit einem Foto des Benutzers, sondern auch mit den gespeicherten Daten seines Fingerabdrucks versehen waren.
Dieses System auszutricksen war außerordentlich schwierig – aber Kit wusste, wie es ging.
Er war studierter Informatiker und hatte die Abschlussprüfungen als Jahrgangsbester bestanden. Viel wichtiger jedoch und vorteilhafter war ein anderer Umstand: Die Software für die Sicherheitsvorkehrungen im Kreml hatte er selbst geschrieben; sie war gewissermaßen sein eigenes Geisteskind. Damit hatte er seinem undankbaren Vater ein fantastisches Sicherheitssystem eingerichtet, das für Außenstehende praktisch unüberwindbar war. Nur er, Kit, kannte die Geheimnisse des Systems.
Heute Nacht, ungefähr zur Geisterstunde, würde er mit seinem Kunden, einem in seiner stillen Art etwas bedrohlich wirkenden Londoner namens Nigel Buchanan, und zwei Komplizen ins Allerheiligste vordringen – ins BSL-4-Labor, das der vermutlich am besten bewachte Raum in ganz Schottland war. Dort würde er mit einem einfachen vierstelligen Code den Kühlschrank öffnen, und Nigel würde Proben des wertvollen neuen Anti-Viren-Medikaments von Stanley Oxenford entwenden.
Lange würden sie die Proben nicht behalten. Nigel hatte rigorose Zeitvorgaben: Bis zehn Uhr vormittags am ersten Weihnachtsfeiertag musste er die Proben abliefern. Die Gründe für dieses strenge Terminkorsett kannte Kit nicht. Er wusste auch nicht, wer der Endabnehmer der Proben war, obgleich er es sich denken konnte, denn im Grunde kam nur ein internationaler Pharmakonzern in Frage, dem eine Analyse der Probe jahrelange Forschungsarbeit ersparen würde. Der Konkurrent wäre dann imstande, binnen kürzester Zeit eine eigene Version des Medikaments zu entwickeln, und Oxenford Medical würden Lizenzgebühren in Millionenhöhe entgehen.
Dergleichen war natürlich unredlich und illegal, doch je höher der Einsatz, desto erfinderischer werden die Leute mit ihren Ausreden. Kit konnte sich durchaus einen Konzernchef vorstellen, würdevoll mit Silberhaar und Nadelstreifenanzug, wie er heuchlerisch fragt: »Können Sie mir hundertprozentig zusichern, dass von keinem Mitarbeiter unserer Firma bei der Beschaffung dieser Probe gegen ein Gesetz verstoßen wurde?«
Am besten gefiel Kit an seinem Plan, dass der Einbruch erst bemerkt würde, wenn er und Nigel längst über alle Berge waren. Heute, Dienstag, war Heiligabend. Die beiden folgenden Tage waren arbeitsfreie Feiertage. Es würde also frühestens am Freitag Alarm geschlagen, wenn der eine oder andere arbeitswütige Forscher ins Labor käme. Ob der aber den Diebstahl überhaupt bemerken würde, stand auf einem ganz anderen Blatt. Gut möglich, dass Kit und seinen Komplizen noch bis Montag in einer Woche Zeit blieb, ihre Spuren zu verwischen. Das war mehr als genug.
Woher also die Angst? Vor Kits geistigem Auge tauchte plötzlich das Gesicht von Toni Gallo auf, der Sicherheitsbeauftragten seines Vaters. Er fand die sommersprossige Rothaarige in ihrer robusten Art sehr attraktiv, doch war ihre Persönlichkeit zu dominant, jedenfalls für seinen Geschmack. War sie der Grund für seine Befürchtungen? Er hatte sie schon einmal unterschätzt – mit katastrophalen Folgen.
Aber diesmal war sein Plan schlichtweg brillant. »Brillant«, sagte er laut, wie um sich selbst davon zu überzeugen.
»Was ’n los?«, murmelte eine weibliche Stimme neben ihm.
Kit räusperte sich überrascht. Er hatte ganz vergessen, dass er nicht allein war, und öffnete rasch die Augen. Es war stockfinster im Schlafzimmer.
»Was is’ ›brillant‹?«, wollte die Stimme wissen.
»Na … wie du tanzt, meine ich«, improvisierte Kit. Er hatte sie am vergangenen Abend in einem Nachtklub aufgegabelt.
»Du tanzt auch nicht schlecht«, sagte sie mit starkem Glasgower Akzent. »Gute Beinarbeit …«
Wie hieß sie doch bloß? Endlich fiel es ihm ein. »Maureen«, sagte er und dachte: Sie muss Katholikin sein, bei dem Namen. Er drehte sich zu ihr und nahm sie in den Arm, während er sich vergeblich zu erinnern versuchte, wie sie aussah. Sie hatte angenehm rundliche Formen, das gefiel ihm. Zu dünne Mädchen mochte er nicht. Maureen kuschelte sich an ihn. Ist sie blond oder brünett, fragte er sich und fand es irgendwie pervers, mit einer Frau zu schlafen, von der er nicht einmal wusste, wie sie aussah. Er fingerte nach ihren Brüsten, als ihm wieder einfiel, was er heute noch alles vorhatte, und schon war es um seine amourösen Absichten geschehen.
»Wie spät ist es?«, fragte er sie.
»Zeit für eine kleine wilde Nummer«, erwiderte Maureen erwartungsvoll.
Kit wandte sich von ihr ab. Die Digitaluhr an seinem Stereogerät zeigte 07:10 Uhr. »Ich muss aufstehn«, sagte er. »Hab viel zu tun heute.« Er wollte rechtzeitig zum Mittagessen bei seinem Vater sein – offiziell zu einem Weihnachtsbesuch, in Wirklichkeit aber, um etwas zu stehlen, das er für den Einbruch am Abend dringend benötigte.
»Wie kann man an Weihnachten so viel arbeiten?«
»Vielleicht bin ich der Weihnachtsmann.« Kit setzte sich auf die Bettkante und knipste das Licht an.
Maureen war enttäuscht. »Meinetwegen«, erwiderte sie beleidigt, »dann wird der kleine Kobold hier eben ausschlafen, wenn’s dem Herrn Weihnachtsmann recht ist.«
Er sah sie an, doch Maureen hatte sich die Bettdecke über den Kopf gezogen. Noch immer wusste er nicht, wie sie aussah.
Nackt schlurfte er in die Küche und setzte Kaffee auf.
Sein Apartment bestand aus zwei großen Räumen. Der eine war ein Wohnzimmer mit einer offenen Küche, der andere das daran anschließende Schlafzimmer. Das Wohnzimmer war voll gestopft mit elektronischen Geräten: einem großen Flachbildschirm, einer Stereoanlage mit allem Drum und Dran sowie mehreren Computern samt Zubehör, die durch einen wahren Dschungel an Kabeln und Drähten miteinander verbunden waren. Es hatte Kit schon immer großen Spaß gemacht, die Sicherheitssysteme anderer Computerbesitzer zu knacken. Wer Experte für Software-Sicherheit werden wollte, musste zuvor Hacker gewesen sein, so viel stand fest.
Einen seiner besten Coups hatte er abgezogen, als er für seinen Vater das Sicherheitssystem für das BSL-4-Labor entwickelte und installierte. Mithilfe von Ronnie Sutherland, dem damaligen Sicherheitsbeauftragten von Oxenford Medical, hatte er eine Methode ausgetüftelt, mit der sich unbemerkt die Firmenkonten anzapfen ließen. Er hatte die Buchhaltungssoftware so manipuliert, dass der Computer beim Zusammenzählen von Lieferantenrechnungen immer ein Prozent der Gesamtsumme aufschlug und dieses Prozent automatisch auf Ronnies Konto überwies, ohne dass diese Transaktion in irgendeinem Bericht auftauchte. Der Betrug konnte nur funktionieren, solange niemand auf den Gedanken kam, die Rechenkünste des Computers zu überprüfen – und das war auch nie passiert, bis Toni Gallo eines Tages Ronnies Frau dabei beobachtet hatte, wie sie vor Marks & Spencer in Inverburn aus einem brandneuen Mercedes-Coupé stieg.
Die verbissene Hartnäckigkeit, mit der Toni in diesem Fall ermittelte, hatte Kit an den Rand der Verzweiflung getrieben. Toni hatte eine Unstimmigkeit entdeckt, und dafür musste sie unbedingt eine Erklärung finden. Sie ließ einfach nicht locker, ja schlimmer noch: Als sie Kit schließlich auf die Schliche gekommen war, ließ sie sich durch nichts und niemanden davon abbringen, seinen Vater von den Vorgängen in Kenntnis zu setzen. Kit hatte sie beschworen, einem alten Mann solchen Kummer zu ersparen. Er hatte sogar versucht, ihr weiszumachen, Stanley Oxenford würde in seinem Zorn eher sie feuern als seinen eigenen Sohn. Am Ende hatte er ihr sachte eine Hand auf die Hüfte gelegt, ihr mit seinem besten Böse-Buben-Lächeln tief in die Augen geschaut und in verführerischem Ton gesagt: »Wir beide sollten eigentlich keine Feinde sein, sondern Freunde.«
Nichts davon hatte geholfen.
Stanley Oxenford hatte seinen Sohn sofort entlassen, und seitdem hatte Kit keine neue Anstellung mehr gefunden. Seiner Spielleidenschaft hatte das jedoch leider keinen Abbruch getan. Ronnie führte ihn bei einem illegalen Casino ein, wo man ihm großzügig Kredit einräumte – nur deshalb vermutlich, weil bekannt war, dass sein Vater ein berühmter, schwerreicher Wissenschaftler war. Kit versuchte, die Höhe der Schulden, die inzwischen aufgelaufen waren, zu verdrängen; die Zahl machte ihn geradezu krank vor Angst und Selbstverachtung. Schon beim bloßen Gedanken daran hätte er sich am liebsten von der Brücke über den Forth gestürzt. Doch der Lohn für die Tat, die er heute Abend begehen wollte, würde nicht nur seine Schulden decken, sondern auch noch für einen neuen Start reichen.
Er nahm seinen Kaffee mit ins Badezimmer und sah in den Spiegel. Vor Jahren, als er noch zum britischen Team für die olympischen Winterspiele gehörte, hatte er jedes Wochenende beim Skifahren oder beim Training verbracht. Schlank und fit wie ein Windhund war er damals gewesen. Jetzt fiel ihm auf, dass seine Konturen weicher geworden waren. »Du hast zugenommen«, sagte er zu seinem Spiegelbild. Sein Haar war allerdings nach wie vor schwarz und voll und fiel ihm keck in die Stirn. Seinem Gesicht war die Anspannung anzumerken. Er probierte die Hugh-Grant-Pose: den Kopf verschämt gesenkt, die blauen Augen schräg nach oben blickend, dazu ein gewinnendes Lächeln … Doch, es klappte noch. Mochte Toni Gallo auch dagegen immun sein – Maureen war erst gestern Abend noch darauf geflogen.
Er drehte das Fernsehgerät im Badezimmer an und begann sich zu rasieren. Der britische Premierminister war in seinem schottischen Wahlkreis eingetroffen, um dort die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Die Glasgow Rangers hatten neun Millionen Pfund für einen Mittelstürmer namens Giovanni Santangelo bezahlt. »Guter, alter schottischer Name«, murmelte Kit vor sich hin. Das Wetter sollte so bleiben, wie es war: kalt, aber klar. Ein heftiger Schneesturm über der Nordsee wanderte von Norwegen aus Richtung Süden, sollte aber westlich an Schottland vorbeiziehen.
Es folgten die Lokalnachrichten – und mit ihnen ein Bericht, der Kit das Blut in den Adern gefrieren ließ.