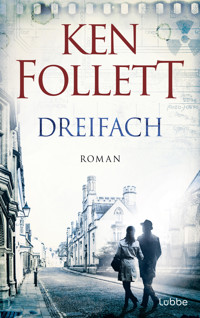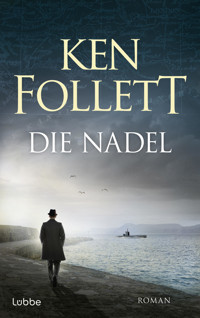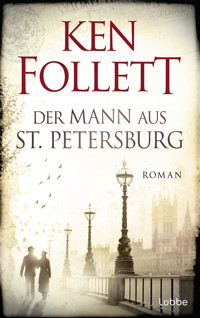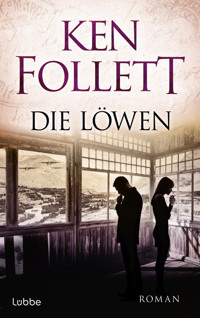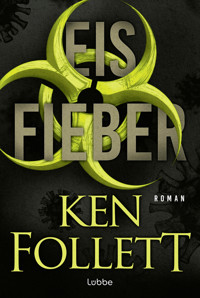9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom alten England bis in die Neue Welt spannt sich der große Bogen des abenteuerlichen Lebens zweier Menschen auf der Suche nach Freiheit.
In den schottischen Kohlengruben herrscht das Gesetz der Sklaverei. Doch Mack McAsh, ein junger Bergmann, träumt davon, frei zu sein. Er flieht nach London - und gerät in eine andere Form von Knechtschaft: Als Aufrührer verurteilt, wird er in Ketten nach Virginia verschifft.
Dort trifft er auf Lizzie Jamisson, die Frau, die ihm einst zur Flucht verholfen hat und dabei ihr eigenes Glück als Preis zahlte...
Ein großer Auswandererroman aus der Feder von Großmeister Ken Follett
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Erster Teil SCHOTTLAND Kapitel 1
Erster Teil Kapitel 2
Erster Teil Kapitel 3
Erster Teil Kapitel 4
Erster Teil Kapitel 5
Erster Teil Kapitel 6
Erster Teil Kapitel 7
Erster Teil Kapitel 8
Erster Teil Kapitel 9
Erster Teil Kapitel 10
Erster Teil Kapitel 11
Erster Teil Kapitel 12
Zweiter Teil LONDON Kapitel 1
Zweiter Teil Kapitel 2
Zweiter Teil Kapitel 3
Zweiter Teil Kapitel 4
Zweiter Teil Kapitel 5
Zweiter Teil Kapitel 6
Zweiter Teil Kapitel 7
Zweiter Teil Kapitel 8
Zweiter Teil Kapitel 9
Zweiter Teil Kapitel 10
Zweiter Teil Kapitel 11
Zweiter Teil Kapitel 12
Zweiter Teil Kapitel 13
Dritter Teil VIRGINIA Kapitel 1
Dritter Teil Kapitel 2
Dritter Teil Kapitel 3
Dritter Teil Kapitel 4
Dritter Teil Kapitel 5
Dritter Teil Kapitel 6
Dritter Teil Kapitel 7
Dritter Teil Kapitel 8
Dritter Teil Kapitel 9
Dritter Teil Kapitel 10
Dritter Teil Kapitel 11
Dritter Teil Kapitel 12
Dritter Teil Kapitel 13
Dritter Teil Kapitel 14
Dritter Teil Kapitel 15
Dritter Teil Kapitel 16
Dritter Teil Kapitel 17
Danksagung
Ken Follett
DIE BRÜCKENDER FREIHEIT
Roman
Aus dem Englischen vonTill R. Lohmeyer und Christel Rost
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 1995 by Ken Follett Titel der englischen Originalausgabe: »A Place Called Freedom«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 1996 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: ©Johannes Wiebel, punchdesign, München,
unter Verwendung von Motiven von Dragon30/photocase.com
und Shutterstock.com
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0339-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Gewidmet der Erinnerung anJOHN SMITH
INDERERSTEN ZEIT nach meinem Einzug in High Glen House habe ich viel im Garten gearbeitet, und dabei fand ich den eisernen Halsring.
Das Haus war arg baufällig und der Garten eine Wildnis. Zwanzig Jahre lang hatte hier eine kauzige alte Dame gelebt und der Fassade nicht einen Pinselstrich Farbe gegönnt. Nach ihrem Tod erstand ich Haus und Garten von ihrem Sohn, der in Kirkburn, der nächsten Stadt – ungefähr achtzig Kilometer von hier –, eine Toyota-Niederlassung besitzt.
Sie werden sich fragen, was einen Menschen wie mich dazu veranlasst, achtzig Kilometer von der Zivilisation entfernt eine solche Bruchbude zu kaufen. Ich liebe ganz einfach dieses Tal. In den Wäldern ringsum gibt es scheues Wild, und oben auf dem Kamm des Berges nisten die Adler. Die Hälfte meiner Arbeitszeit draußen im Garten verging damit, dass ich, auf meinen Spaten gestützt, die blaugrünen Hänge betrachtete.
Ich habe natürlich trotzdem einiges umgegraben. Das Toilettenhäuschen – ein fensterloser Bretterverschlag – war nicht gerade eine Augenweide, weshalb ich es hinter ein paar Sträuchern verbergen wollte. Beim Ausheben des Grabens stieß ich auf eine Kiste.
Sie war nicht sehr groß – ungefähr so groß wie jene Kisten, in denen guter Wein verpackt wird, ein Dutzend Flaschen vielleicht –, und sie war obendrein völlig schmucklos, aus schlichtem Holz, das mit rostigen Nägeln zusammengehalten wurde. Ich brach sie mit meinem Spaten auf.
Die Kiste enthielt zwei Gegenstände.
Der eine war ein großes, altes Buch. Ich fand das sehr aufregend: Vielleicht war es eine Familienbibel mit einer interessanten, handschriftlichen Geschichte auf dem Vorsatzblatt – Geburten, Eheschließungen, Sterbedaten von Menschen, die vor hundert Jahren in meinem Haus gelebt hatten … Doch zu meiner Enttäuschung musste ich beim Aufschlagen des Buches feststellen, dass seine Seiten zu einer breiigen Masse zerfallen waren. Kein einziges Wort mehr war lesbar.
Der zweite Gegenstand war ein Beutel aus Wachstuch. Er war ebenfalls verrottet und zerfiel, als ich ihn mit meinen Gartenhandschuhen berührte. Darin befand sich ein Eisenring mit einem Durchmesser von ungefähr fünfzehn Zentimetern. Er war trübe und fleckig, dank der Wachstuchhülle aber nicht verrostet.
Der Ring war ziemlich primitiv gearbeitet, wahrscheinlich das Werk eines Dorfschmieds. Zunächst hielt ich ihn für ein Teil von einem Karren oder einem Pflug. Aber warum hatte man ihn dann sorgfältig in Wachstuch eingewickelt, damit er erhalten blieb? Der Ring hatte einen Sprung und war verbogen. Allmählich dämmerte es mir, und ich erkannte darin einen Halsring, wie man ihn Gefangenen umzulegen pflegte. Der Gefangene war entkommen, und bei seiner Befreiung war der Ring mit schwerem Schmiedewerkzeug gebrochen und verbogen worden.
Ich nahm ihn mit ins Haus und begann ihn zu reinigen. Es war eine mühsame Arbeit, weshalb ich ihn über Nacht in Rost-Frei legte und erst am nächsten Vormittag weitermachte. Als ich ihn mit einem alten Lumpen polierte, kam eine Inschrift zum Vorschein.
Es dauerte eine Weile, bis es mir gelang, die altmodische, verschnörkelte Schrift zu entziffern. Der Text lautete:
Dieser Mann ist das Eigentumvon SIR GEORGE JAMISSONaus Fife.A. D. 1767
Jetzt liegt der Ring hier auf meinem Schreibtisch, gleich neben dem PC. Ich benütze ihn als Briefbeschwerer. Oft nehme ich ihn in die Hand, drehe ihn hin und her und lese die Inschrift nochmals durch. Wenn dieser Eisenring reden könnte, denke ich bei mir – was könnte er wohl erzählen?
ERSTER TEILSCHOTTLANDKAPITEL 1
SCHNEEKRÖNTEDIE HÖHENVON HIGH GLEN und lag in perlweißen Flecken auf den bewaldeten Hängen wie Geschmeide auf dem Mieder eines grünen Seidenkleids. Auf der Talsohle schlängelte sich ein hurtiger kleiner Fluss zwischen vereisten Felsen hindurch. Mit dem scharfen Wind, der von der Nordsee her über das Land heulte, fegten Graupel- und Hagelschauer heran.
Die Zwillinge Malachi und Esther McAsh gingen an diesem Morgen über einen Zickzackpfad, der am östlichen Abhang der Schlucht entlangführte, zur Kirche. Malachi, den alle Mack nannten, trug einen karierten Umhang und Kniehosen aus Tweed, doch unterhalb der Knie waren seine Beine bloß. Die nackten Füße in den Holzschuhen waren eiskalt, aber Mack war jung und heißblütig und störte sich daran nicht.
Der Weg, den sie eingeschlagen hatten, war nicht der kürzeste zur Kirche, doch High Glen begeisterte ihn immer wieder. Die hohen Berge, die stillen, geheimnisvollen Wälder und das fröhlich plätschernde Wasser bildeten eine Landschaft, die ihm seelenverwandt war. Hier hatte er drei Jahre lang ein Adlerpärchen bei der Aufzucht seiner Brut beobachtet. Wie die Adler hatte er die Lachse des Lairds aus dem fischreichen Wasser gestohlen, und wie die Hirsche hatte er sich still und reglos zwischen den Bäumen verborgen, wenn die Wildhüter kamen.
Der Laird von High Glen war eine Frau, Lady Hallim, eine Witwe mit einer Tochter. Das Land auf der anderen Seite des Berges gehörte Sir George Jamisson und war eine andere Welt. Dort hatten Ingenieure große Löcher in die Flanken des Berges gerissen; von Menschenhand aufgehäufte Schlackehalden entstellten das Tal. Schwere Kohlekarren durchpflügten die schlammige Straße, und der Fluss war schwarz vom allgegenwärtigen Kohlenstaub. Dort lag das Dorf namens Heugh, das aus einer langen Reihe geduckter Steinhäuschen bestand, die sich wie eine Treppe den Hügel hinaufzog, und dort lebten die Zwillinge.
Mack und Esther boten die männliche und die weibliche Version ein und desselben Bildes: Beide hatten sie blondes, vom Kohlenstaub geschwärztes Haar und auffallend blassgrüne Augen. Beide waren sie untersetzt, mit breitem Kreuz und starken, muskulösen Armen und Beinen. Beide waren sie eigensinnig und streitsüchtig.
Die Streitsucht war eine Familientradition. Der Vater der Zwillinge war ein unbeirrter Nonkonformist gewesen, stets bereit, sich mit der Regierung, der Kirche und jedweder anderen Autorität anzulegen. Die Mutter hatte vor ihrer Heirat bei Lady Hallim gearbeitet und sich, wie so viele Hausbedienstete, mit der Oberklasse identifiziert. In einem bitterkalten Winter, als die Grube in der Folge einer Explosion einen Monat lang geschlossen blieb, war Vater am schwarzen Auswurf gestorben, jenem Husten, der so viele Bergarbeiter dahinraffte. Mutter bekam eine Lungenentzündung und folgte Vater innerhalb weniger Wochen in den Tod. Doch die Streitereien gingen weiter, gewöhnlich an den Samstagabenden in Mrs. Wheighels Salon, der in dem Dörfchen Heugh einer Schenke noch am nächsten kam.
Die Gutsarbeiter und die kleinen Pächter waren der gleichen Meinung wie Mutter. Sie sagten, der König sei von Gott eingesetzt und deshalb habe ihm das Volk zu gehorchen. Die Grubenarbeiter hatten inzwischen schon neuere Ideen gehört. John Locke und andere Philosophen meinten, die Autorität einer Regierung setze die Zustimmung des Volkes voraus. Diese Theorie gefiel Mack.
Nur wenige Kumpel in Heugh konnten lesen. Macks Mutter konnte es, und ihr Sohn hatte sie so lange bearbeitet, bis sie’s ihm endlich beibrachte. Sie hatte beide Kinder Lesen und Schreiben gelehrt und die Sticheleien ihres Ehemanns, der meinte, sie habe Flausen im Kopf, die über ihrem Stand seien, geflissentlich überhört. Bei Mrs. Wheighel wurde Mack aufgefordert, aus der Times, dem Edinburgh Advertiser und politischen Journalen wie dem radikalen North Briton vorzulesen. Die Zeitungen waren immer schon mehrere Wochen, mitunter sogar Monate alt, doch die Männer und Frauen aus dem Dorf lauschten begierig den langen, im Wortlaut wiedergegebenen Redeprotokollen, satirischen Glossen und Berichten über Streiks, Proteste und Aufstände.
Nach einem Samstagabendstreit bei Mrs. Wheighel hatte Mack den Brief geschrieben.
Sie hatten lange darüber diskutiert, über jedes einzelne Wort, denn keiner der Bergarbeiter hatte je einen Brief geschrieben. Adressat war Caspar Gordonson, ein Anwalt in London, der in seinen Zeitungsartikeln über die Regierung herzog. Dann war der Brief Davey Patch, dem einäugigen Hausierer, zur Postaufgabe anvertraut worden, und Mack hatte sich gefragt, ob er seinen Bestimmungsort wohl jemals erreichen würde.
Gestern nun war die Antwort gekommen, und das war das Aufregendste, was Mack in seinem bisherigen Dasein widerfahren war. Es wird mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, dachte er. Vielleicht macht es mich sogar frei …
So lange er zurückdenken konnte, hatte er sich nach Freiheit gesehnt. Als Kind hatte er Davey Patch beneidet, der, Messer, Bindfaden und Balladen feilbietend, von Dorf zu Dorf zog. Was dem kleinen Mack an Daveys Leben so wunderbar erschien, war der Umstand, dass der Hausierer erst bei Sonnenaufgang aufstehen musste und sich schlafen legen konnte, wenn er müde war. Mack war seit seinem siebten Lebensjahr kurz vor zwei Uhr morgens von seiner Mutter wachgerüttelt worden, hatte dann fünfzehn Stunden lang in der Grube geschuftet und war nach Feierabend um fünf Uhr nachmittags wieder nach Hause gewankt, wo er dann nicht selten über seinem Porridge einschlief.
Hausierer zu werden, wünschte er sich schon lange nicht mehr, doch die Sehnsucht nach einem anderen Leben beherrschte ihn nach wie vor. Er träumte davon, ein eigenes Haus zu bauen, in einem Tal wie High Glen und auf einem Stück Land, das ihm selbst gehörte. Dort wollte er von morgens bis abends arbeiten, die Nachtstunden hindurch jedoch ruhen. Er träumte auch von der Freiheit, an sonnigen Tagen zum Fischen gehen zu können – und zwar an einem Ort, wo die Lachse nicht dem Laird gehörten, sondern demjenigen, der sie fing.
Der Brief in seiner Hand bedeutete, dass seine Träume vielleicht in Erfüllung gehen würden.
»Ich weiß immer noch nicht genau, ob es richtig ist, ihn in der Kirche vorzulesen«, sagte Esther, als sie über den gefrorenen Berg wanderten.
Mack wusste es ebensowenig, doch er gab zurück: »Warum denn nicht?«
»Es wird Scherereien geben. Ratchett wird schäumen vor Wut.« Harry Ratchett war der Obersteiger, der Mann, der die Grube im Auftrag des Besitzers leitete. »Vielleicht erzählt er es sogar Sir George, und was werden sie dann mit dir machen?«
Er wusste, dass seine Schwester recht hatte, und in seinem Herzen war er voller Angst. Doch das hielt ihn nicht davon ab, weiterhin mit ihr zu streiten. »Warum sollte ich den Brief für mich behalten?«, fragte er. »Das gibt doch keinen Sinn.«
»Nun, du könntest ihn doch Ratchett unter vier Augen zeigen. Dann lässt er dich vielleicht laufen, ohne großen Wirbel zu machen.«
Mack streifte seine Zwillingsschwester mit einem Blick aus dem Augenwinkel. Diesmal widersprach sie ihm nicht einfach aus Prinzip, da war er sich ganz sicher. Sie wirkte eher besorgt als trotzig. Eine Woge der Zuneigung überkam ihn. Was immer auch geschehen mochte – Esther würde auf seiner Seite stehen.
Und doch schüttelte er eigensinnig den Kopf. »Ich bin nicht der Einzige, den dieser Brief betrifft. Da sind mindestens noch fünf andere, die gern von hier fortgehen würden, wenn sie wüssten, dass das geht. Und denk doch einmal an die kommenden Generationen!«
Sie sah ihn prüfend an. »Das mag ja alles stimmen – aber darum geht’s dir doch gar nicht. Du willst bloß in der Kirche deinen Auftritt haben und beweisen, dass der Grubenbesitzer im Unrecht ist.«
»Nein, will ich nicht!«, protestierte Mack. Dann überlegte er einen Augenblick und fügte grinsend hinzu: »Na ja, da mag schon was dran sein. Wie oft hat man uns strenge Gesetzestreue und Respekt vor den Oberen gepredigt! Und jetzt kommen wir auf einmal darauf, dass sie uns über das Gesetz, das unser Leben bestimmt, von Anfang an belogen haben. Natürlich will ich aufstehen und das laut hinausschreien.«
»Gib ihnen bloß keinen Anlass, dich zu bestrafen«, erwiderte Esther ängstlich.
Er versuchte, sie zu beruhigen. »Ich werde es mit aller gebotenen Höflichkeit und Demut sagen«, erklärte er. »Du wirst mich kaum wiedererkennen.«
»Du und Demut!«, gab seine Schwester skeptisch zurück. »Das möcht’ ich sehen!«
»Ich will ja nur erzählen, was das Gesetz besagt – was soll daran falsch sein?«
»Es ist unvorsichtig.«
»Aye, das ist es«, gab er zu. »Aber ich mach’s trotzdem.«
Sie überquerten eine Bergkuppe und stiegen auf der anderen Seite hinab ins Tal der Gruben. Auf halber Höhe wurde die Luft ein klein wenig milder, und kurz darauf kam auch schon die kleine Steinkirche in Sicht. Sie stand gleich neben einer Brücke, die über den verschmutzten Fluss führte.
Jenseits des Kirchhofs standen dicht gedrängt ein paar Pächterhäuschen. Es waren runde Hütten mit einer offenen Feuerstelle in der Mitte des Fußbodens, der aus gestampftem Lehm bestand. Im Dach darüber war ein Loch, das als Rauchabzug diente. Im Winter mussten sich Mensch und Vieh den einzigen Raum der Hütte teilen. Die Häuschen der Bergarbeiter, etwas höher, nahe den Gruben gelegen, waren besser. Zwar standen auch sie auf nacktem Boden und hatten ebenfalls nur Grasdächer, doch besaß jedes einen Herd und einen ordentlichen Schornstein sowie eine Glasscheibe in dem kleinen Fenster neben der Tür. Außerdem waren die Grubenarbeiter nicht gezwungen, sich ihren Wohnraum mit den Kühen zu teilen. Dessen ungeachtet betrachteten sich die kleinen Pächter als frei und unabhängig und sahen auf die Bergarbeiter herab.
Es waren aber nicht die Bauernhütten, die Macks und Esthers Aufmerksamkeit auf sich zogen und die Geschwister zum Innehalten veranlassten. Vielmehr stand vor dem Kirchenportal eine geschlossene Kutsche mit einem feinen Paar Grauer im Geschirr. Mehrere Damen in Reifröcken und Pelzen stiegen aus und hielten ihre mit modischer Spitze verzierten Hüte fest. Der Pastor half ihnen heraus.
Esther packte Mack am Arm und deutete auf die Brücke. Auf einem großen braunen Jagdpferd, den Kopf gegen den Wind geneigt, ritt der Besitzer des Bergwerks heran – Sir George Jamisson, der Laird des Tales.
Seit fünf Jahren hatte man Jamisson hier nicht mehr gesehen. Er lebte in London, eine einwöchige Schiffsreise oder eine zweiwöchige Kutschfahrt entfernt. Einst war er ein kleiner Krämer in Edinburgh gewesen, erzählten sich die Leute, der in einem Eckladen Kerzen und Gin verkaufte, ein Pfennigfuchser und um keinen Deut ehrlicher als unbedingt nötig. Dann war ein junger Verwandter von ihm kinderlos gestorben. George hatte das Schloss und die Kohlegruben geerbt und darauf ein geschäftliches Imperium errichtet, das sich bis in so unvorstellbar ferne Gegenden wie Barbados und Virginia erstreckte. Und mit dem Wohlstand war die Würde gekommen: Jamisson war inzwischen Baron, war Friedensrichter und Ratsherr von Wapping und in dieser Eigenschaft verantwortlich für Recht und Ordnung im Londoner Hafenviertel.
Und heute stattete er, offensichtlich in Begleitung seiner Familie und illustrer Gäste, seinen schottischen Gütern einen Besuch ab.
»Nun, das war’s dann wohl«, sagte Esther erleichtert.
»Was soll das heißen?«, fragte Mack, wiewohl er es sich denken konnte.
»Jetzt kannst du deinen Brief nicht mehr vorlesen.«
»Warum nicht?«
»Malachi McAsh, sei kein solcher Esel!«, rief sie aus. »Nicht vor dem Laird höchstpersönlich!«
»Ganz im Gegenteil«, gab Mack halsstarrig zurück. »Das ist sogar noch viel besser.«
ERSTER TEILKAPITEL 2
LIZZIE HALLIMWEIGERTESICH, mit der Kutsche zur Kirche zu fahren. Das war doch blödsinnig, fand sie. Die Straße, die von Jamisson Castle aus dorthin führte, war von Fahrrinnen durchfurcht und mit Schlaglöchern übersät, deren schlammige Ränder beinhart gefroren waren. Die Fahrt versprach, ein fürchterliches Gerüttel zu werden; die Kutsche würde allenfalls im Schritttempo fahren können, und die Insassen würden durchgefroren, voller blauer Flecken und obendrein wahrscheinlich zu spät ankommen. Lizzie ließ sich nicht davon abbringen, zur Kirche zu reiten.
Ihre Mutter trieb dergleichen undamenhaftes Benehmen regelmäßig zur Verzweiflung. »Wie willst du jemals einen Mann bekommen, wenn du dich immer so unweiblich benimmst?«, pflegte sie zu fragen.
»Ich kriege einen Mann, sobald ich einen will«, antwortete Lizzie dann. Und es stimmte: Die Männer verliebten sich reihenweise in sie. »Hauptsache, ich finde einen, in dessen Gesellschaft ich es länger als eine halbe Stunde aushalte.«
»Hauptsache, es findet sich einer, den du mit deinem Benehmen nicht verschreckst«, murmelte ihre Mutter verhalten.
Lizzie lachte. Sie hatten beide recht. Auf den ersten Blick schienen sich alle Männer in sie zu verlieben. Doch wenn sie Lizzie dann näher kennenlernten, zogen sie sich schleunigst zurück. Ihre ungeschminkten Kommentare sorgten seit Jahren für Skandale in der guten Gesellschaft von Edinburgh. Auf ihrem allerersten Ball hatte sie gegenüber einem Trio alter Witwen die Bemerkung fallen lassen, der Oberste Richter habe einen dicken Hintern – ein Fauxpas, von dem sich ihr Ruf nie wieder erholte. Erst im vergangenen Jahr hatte Mutter sie im Frühling nach London begleitet und in die englische Gesellschaft eingeführt. Es wurde eine Katastrophe. Lizzie hatte zu laut gesprochen, zu viel gelacht und sich zu offenherzig über das gezierte Benehmen und die eng sitzende Bekleidung der dandyhaften jungen Männer amüsiert, die ihr den Hof zu machen versuchten.
»In deiner Jugend hat der Mann im Haus gefehlt«, sagte ihre Mutter gerade. »Deshalb bist du so ein Wildfang geworden.« Sie stieg in die Kutsche, und damit war die Diskussion fürs Erste beendet.
Über den gekiesten Vorplatz von Jamisson Castle ging Lizzie zu den Pferdeställen. Ihr Vater war gestorben, als sie drei Jahre alt war, sodass sie sich kaum an ihn erinnern konnte. Auf ihre Frage, woran er gestorben sei, hatte ihr ihre Mutter nur eine unbestimmte Antwort gegeben: »Die Leber, die Leber …« Er hatte ihnen keinen Penny hinterlassen. Jahrelang hatte sich Mutter irgendwie durchgewurstelt, hatte immer wieder neue Hypotheken auf den Hallim’schen Besitz aufgenommen und jahrelang darauf gewartet, dass Lizzie erwachsen würde und einen reichen Mann heiratete, der alle ihre Probleme löste. Lizzie war nun zwanzig Jahre alt, und es wurde Zeit, dass sie ihre Bestimmung erfüllte.
Hierin lag zweifellos der Grund dafür, dass die Jamissons nach all diesen Jahren wieder einmal ihren schottischen Besitz besuchten und Lizzie mit ihrer Mutter, ihre nur zehn Meilen entfernt lebenden Nachbarn, als erste Hausgäste geladen hatten. Äußerer Anlass für die Einladung war der einundzwanzigste Geburtstag des jüngeren Jamisson-Sohns Jay, doch dahinter steckte die Absicht, Lizzie mit Robert, ihrem Ältesten, zu verheiraten.
Mutter war dafür, weil Robert einst ein großes Vermögen erben würde. Sir George war dafür, weil er den Hallim’schen Besitz den Ländereien der Jamissons zuschlagen wollte. Auch Robert schien nichts dagegen zu haben, was Lizzie aus der Aufmerksamkeit schloss, die er ihr seit der Ankunft der Jamissons zuteil werden ließ, wenngleich sie darüber, wie es in seinem Herzen aussah, allenfalls Vermutungen anstellen konnte.
Sie sah ihn im Stallhof stehen, wo er darauf wartete, dass die Pferde gesattelt wurden. Er ähnelte dem Porträt seiner Mutter, das in der Schlosshalle hing; es zeigte eine ernste, unauffällige Frau mit hübschem Haar, hellen Augen und einem entschlossenen Zug um den Mund. Über Robert gab es nichts Nachteiliges zu sagen: Er war weder besonders hässlich noch zu dünn oder zu dick, er hatte keinen unangenehmen Körpergeruch, noch war er ein Trinker oder kleidete sich weibisch. Er ist eine gute Partie, sagte sich Lizzie. Wenn er um meine Hand anhält, werde ich wahrscheinlich Ja sagen …
Sie war nicht in ihn verliebt, aber sie kannte ihre Pflicht.
»Es ist wirklich höchst pflichtvergessen, dass Sie in London leben«, sagte sie, in der Absicht, ihn ein wenig zu necken.
»Pflichtvergessen?« Er runzelte die Stirn. »Wieso?«
»Sie lassen uns hier ohne Nachbarn.« Er sah noch immer aus, als begriffe er nicht. Anscheinend besaß er nicht allzu viel Humor. »Wenn Sie nicht da sind«, erklärte Lizzie, »gibt’s zwischen hier und Edinburgh keine Menschenseele mehr.«
»Abgesehen von hundert Bergarbeiterfamilien und mehreren Dörfern voller Pächter«, bemerkte eine Stimme hinter ihr.
»Sie wissen genau, was ich meine«, entgegnete Lizzie, während sie sich umdrehte. Der Sprecher war ihr fremd. Mit der ihr eigenen Direktheit fragte sie: »Wer sind Sie?«
»Jay Jamisson«, antwortete der junge Mann mit einer Verbeugung. »Roberts klügerer Bruder. Wie konnten Sie das vergessen?«
»Ach so!« Sie hatte gehört, dass er gestern am späten Abend angekommen war, doch sie hatte ihn nicht wiedererkannt. Vor fünf Jahren war er noch ein ganzes Stück kleiner gewesen, hatte Pickel auf der Stirn und nur einen dünnen blonden Haarflaum am Kinn gehabt. Besonders gescheit war er ihr damals freilich nicht vorgekommen, und Lizzie hatte ihre Zweifel, dass er sich in dieser Hinsicht geändert hatte. »Ich erinnere mich an Sie«, sagte sie. »Genauso eingebildet wie eh und je!«
Er grinste. »Hätte ich doch nur Ihr leuchtendes Bespiel an Bescheidenheit und Zurückhaltung zum Vorbild gehabt, Miss Hallim.«
Robert sagte: »Hallo, Jay. Willkommen auf Schloss Jamisson.«
Jay setzte eine verdrießliche Miene auf. »Du brauchst noch nicht den Gutsbesitzer hervorzukehren, Robert. Du magst ja der älteste Sohn sein, aber noch hast du den Kasten hier nicht geerbt.«
»Meine Glückwünsche zu Ihrem einundzwanzigsten Geburtstag«, sagte Lizzie.
»Danke.«
»Ist heute der große Tag?«
»Ja.«
Robert fragte ungeduldig: »Willst du mit uns zur Kirche reiten?«
Lizzie sah Hass in Jays Augen, aber seine Stimme blieb neutral. »Ja. Ich hab mir ein Pferd satteln lassen.«
»Dann wird’s Zeit, dass wir uns auf den Weg machen.« Robert wandte sich dem Stall zu und rief: »Beeilung da drinnen!«
»Alles bereit, Sir!«, rief ein Stallbursche. Im nächsten Augenblick wurden auch schon drei Pferde herausgeführt: ein kräftiges schwarzes Pony, eine braune Stute und ein grauer Wallach.
»Ich nehme an«, sagte Jay in kritischem Ton, »diese Tiere sind Mietpferde von einem Händler in Edinburgh.« Er trat an den Wallach heran, tätschelte ihm den Hals und ließ ihn an seinem blauen Reitrock schnuppern. Lizzie erkannte, dass er Pferde mochte und gut mit ihnen umgehen konnte.
Sie bestieg das schwarze Pony, dem ein Damensattel auflag, und trottete aus dem Hof hinaus. Die beiden Brüder folgten ihr, Jay auf dem Wallach, Robert auf der Stute. Der Wind trieb ihr Graupel in die Augen. Der frisch gefallene Schnee ließ den Untergrund trügerisch sicher erscheinen, deckte er doch die oft fußtiefen Löcher zu, welche die Pferde zum Stolpern brachten. »Reiten wir durch den Wald!«, schlug Lizzie vor. »Dort sind wir vor dem Wind geschützt, und der Boden ist nicht so uneben.« Ohne auf Zustimmung zu warten, lenkte sie ihr Pferd von der Straße fort, hinein in den uralten Forst.
Unter den hohen Kiefern gab es kein Gestrüpp. Die kleinen Rinnsale und sumpfigen Senken waren hart gefroren, der Boden weiß überstäubt. Lizzie trieb ihr Pony zu einem leichten Galopp an. Wenige Augenblicke später stob der Graue an ihr vorbei. Als Lizzie aufblickte, gewahrte sie ein herausforderndes Grinsen in Jays Miene: Er wollte mit ihr um die Wette reiten. Das war ganz nach ihrem Geschmack. Sie stieß einen Begeisterungsschrei aus und trat ihrem Pony in die Flanke. Das Tier war sofort bei der Sache.
Sie sprengten durch den Wald, duckten sich unter niedrigen Ästen, sprangen über gestürzte Stämme und platschten wagemutig durch die Bäche. Jays Pferd war größer und hätte einen Galopp im offenen Gelände fraglos gewonnen, doch in dem schwierigen Terrain tat sich das weniger schwerfällige Pony mit seinen kurzen Beinen leichter, sodass Lizzie langsam, aber sicher einen kleinen Vorsprung gewann. Erst als das Hufgetrappel von Jays Wallach nicht mehr zu hören war, hielt sie an.
Jay hatte sie bald eingeholt, doch von Robert war weit und breit nichts zu sehen. Lizzie nahm an, dass er zu vernünftig war, um in einem Wettrennen um nichts und wieder nichts Kopf und Kragen zu riskieren. Sie und Jay ritten im Schritt weiter, Seite an Seite, immer noch atemlos. Die von den Pferdeleibern aufsteigende Hitze hielt die Reiter warm. Schließlich keuchte Jay: »Ich würde zu gerne einmal auf gerader Strecke mit Ihnen um die Wette reiten.«
»Im Herrensattel würde ich Sie schlagen«, gab Lizzie zurück – eine Antwort, die Jay als einigermaßen skandalös empfand. Eine wohlerzogene junge Dame ritt ausschließlich seitwärts, wie es der Damensattel vorschrieb. Frauen im Herrensitz galten als vulgär. Lizzie hielt diese Sitte für albern; wenn sie allein war, ritt sie stets wie ein Mann.
Sie musterte Jay mit einem kritischen Seitenblick. Alicia, seine Mutter und die zweite Frau von George, war eine blonde Kokotte. Jay hatte nicht nur ihre blauen Augen, sondern auch ihr gewinnendes Lächeln geerbt.
»Was treiben Sie denn so in London?«, fragte Lizzie.
»Ich gehöre dem Dritten Regiment der Fußgarde an.« Und mit unüberhörbarem Stolz in seiner Stimme fügte er hinzu: »Bin kürzlich erst zum Captain befördert worden.«
»Und was, Captain Jamisson, habt ihr tapferen Soldaten derzeit zu tun?«, fragte sie spöttisch. »Herrscht vielleicht Krieg in London? Gibt’s irgendwelche Feinde, die getötet werden müssen?«
»Wir haben alle Hände voll zu tun, den Mob in seine Schranken zu weisen.«
Bei dieser Bemerkung fiel Lizzie urplötzlich wieder ein, was für ein gemeiner Kerl der Knabe Jay einst gewesen war, und sie fragte sich unwillkürlich, ob ihm seine Tätigkeit gefiel. »Und wie stellen Sie das an?«
»Ich eskortiere zum Beispiel Verbrecher zum Galgen und sorge dafür, dass ihre Spießgesellen sie nicht befreien, bevor der Henker seine Arbeit getan hat.«
»Sieh an, er befördert Engländer vom Leben zum Tode! Sie haben das Zeug zum schottischen Volkshelden, Jay!«
Ihr Spott schien Jay nicht zu stören. »Eines Tages«, antwortete er gelassen, »würde ich gern meinen Abschied nehmen und nach Übersee gehen.«
»Ach ja? Warum?«
»Weil in diesem Lande hier ein jüngerer Sohn nichts gilt«, sagte er. »Sogar die Dienstboten überlegen sich jedes Mal von Neuem, ob sie seinen Anweisungen gehorchen sollen.«
»Und Sie glauben, anderswo wäre das nicht so?«
»In den Kolonien ist alles anders. Ich habe Bücher darüber gelesen. Die Menschen dort sind freier und nehmen das Leben leichter. Man wird so genommen, wie man ist.«
»Was wollen Sie dort tun?«
»Meine Familie besitzt eine Zuckerrohrplantage auf Barbados. Ich hoffe, dass mein Vater sie mir zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag überschreibt, sozusagen als Erbteil.«
Lizzie empfand bitteren Neid. »Sie Glückspilz!«, sagte sie. »Nichts täte ich lieber, als in ein anderes Land zu ziehen. Es muss furchtbar aufregend sein!«
»Das Leben da draußen ist ziemlich rau«, erwiderte Jay. »Ihnen würden sicher verschiedene Annehmlichkeiten fehlen, an die Sie sich hierzulande gewöhnt haben – Läden, Opernaufführungen, die neueste französische Mode und so weiter.«
»Das kann mir alles gestohlen bleiben!«, rief Lizzie voller Verachtung. »Ich hasse diese Kleider!« Sie trug einen gerafften Rock und ein eng geschnürtes Mieder. »Am liebsten würde ich mich anziehen wie ein Mann – Hose, Hemd, Reitstiefel …«
Jay lachte. »Das ginge vermutlich sogar auf Barbados ein bisschen zu weit.«
Lizzies Gedanken überschlugen sich. Angenommen, Robert würde mich nach Barbados bringen, dachte sie. Ich würde ihn auf der Stelle heiraten!
»Die Arbeit wird Ihnen dort natürlich von Sklaven abgenommen«, ergänzte Jay.
Ein paar Meter oberhalb der Brücke erreichten sie den Waldrand. Am anderen Ufer waren Grubenarbeiter zu erkennen, die im Gänsemarsch zur Kirche gingen.
Lizzie bekam Barbados nicht aus ihrem Kopf. »Sklaven besitzen und mit ihnen machen können, was man will, ganz als wären es Tiere! Das muss ein komisches Gefühl sein. Finden Sie nicht auch?«
»Aber ganz und gar nicht«, erwiderte Jay lächelnd.
ERSTER TEILKAPITEL 3
DIEKLEINE KIRCHEWARRANDVOLL. Die Familie Jamisson und ihre Gäste – die Frauen in weiten Röcken, die Männer mit Schwertern und dreieckigen Hüten – beanspruchten einen Großteil des verfügbaren Platzes. Die Kumpel und Pächter, die sonst die sonntägliche Kirchengemeinde bildeten, wahrten gebührenden Abstand, als fürchteten sie, die feinen Kleider zu berühren und sie mit Kohlenstaub oder Kuhdung zu beschmutzen.
Gegenüber Esther hatte Mack den kleinen Helden hervorgekehrt, doch innerlich war er voller Furcht. Die Grubenbesitzer hatten das Recht, Bergarbeiter auspeitschen zu lassen. Sir George Jamisson war obendrein Richter, was bedeutete, dass er andere Menschen an den Galgen bringen konnte. Niemand würde es wagen, ihm zu widersprechen. Für jemanden wie Mack war es in der Tat äußerst töricht, den Zorn eines so mächtigen Mannes auf sich zu lenken.
Aber Recht war Recht. Mack und die anderen Bergarbeiter wurden ungerecht, ja, illegal behandelt, und jedes Mal wenn Mack daran dachte, stieg ihm die Zornesröte ins Gesicht. Am liebsten hätte er es ihnen von allen Hausdächern aus entgegengeschrien. Es widerstrebte ihm, die Neuigkeit heimlich unter die Leute zu bringen, als wäre sie gar nicht wahr. Entweder er fasste sich ein Herz – oder er fing gar nicht erst damit an.
Vorübergehend zog er ernsthaft einen Rückzieher in Betracht. Warum sollte er den Aufrührer spielen? Dann stimmte die Gemeinde das erste Lied an, und der harmonische Gesang der Kumpel erfüllte die Kirche. Mack hörte hinter sich den schwellenden Tenor Jimmy Lees, des besten Sängers im Dorf. Der Gesang ließ ihn an High Glen denken, an seinen Traum von der Freiheit. Er riss sich zusammen und beschloss, seinen Plan wie vorgesehen auszuführen.
Der Pastor, Reverend John York, war ein sanfter Mann von vierzig Jahren mit schütterem Haar. Er sprach zögernd, sichtlich befangen vom Glanz des hohen Besuchs. In seiner Predigt ging es um die Wahrheit. Wie wird er reagieren, wenn ich den Brief vorlese, dachte Mack. Gefühlsmäßig zieht es ihn gewiss auf die Seite des Grubenbesitzers. Wahrscheinlich hat man ihn zum Mittagessen aufs Schloss geladen … Andererseits ist er Pfarrer und von daher auch unabhängig von dem, was Sir George vielleicht sagen mag, der Gerechtigkeit verpflichtet – oder?
Das einfache Mauerwerk der Kirche war nackt und kahl. Natürlich brannte nirgendwo ein Feuer. Während sein Atem in der kalten Luft kleine Nebelwolken bildete, beobachtete Mack die Menschen aus dem Schloss.
Die Angehörigen der Familie Jamisson waren ihm zum größten Teil bekannt. Als kleiner Junge hatte er viel Zeit dort verbracht. Der fette, rotgesichtige Sir George war unverkennbar. Seine Gattin trug ein rosafarbenes Rüschenkleid, das an einer jüngeren Frau vielleicht ganz hübsch ausgesehen hätte. Auch Robert, der ältere der beiden Söhne, war da. Sein Blick war hart und humorlos. Obwohl erst sechsundzwanzig, sah er mit seinem Bauchansatz dem Vater bereits ziemlich ähnlich. Neben ihm saß ein hübscher blonder Jüngling, ungefähr in Macks Alter – das musste Jay sein, der jüngere Sohn. Als Mack sechs Jahre alt war, hatte er den ganzen Sommer über mit Jay in den Wäldern um Schloss Jamisson gespielt. Damals hatten sie beide geglaubt, Freunde fürs Leben zu sein, doch dann, im folgenden Winter, begann für Mack die Arbeit unter Tage, und von da an fehlte ihm die Zeit zum Spielen.
Er kannte auch einige der Gäste der Jamissons. Lady Hallim und ihre Tochter Lizzie waren ihm vertraut. Über Lizzie Hallim gab es immer wieder skandalöse Gerüchte im Tal. Sie stromere in Männerkleidung und mit einem Gewehr über der Schulter durchs Gelände, sagten die Leute. Sie schenkte einem barfüßigen Kind ihre Stiefel – nur um danach dessen Mutter auszuzanken, weil sie es versäumt hatte, ihre Türschwelle zu schrubben. Mack hatte Lizzie schon jahrelang nicht mehr gesehen. Das Gut der Hallims hatte seine eigene Kirche, weshalb die Bewohner nicht Sonntag für Sonntag ins Dorf zu kommen brauchten. Sie kamen nur, wenn die Jamissons im Lande waren. Mack erinnerte sich an seine letzte Begegnung mit Lizzie. Das Mädchen war damals ungefähr fünfzehn Jahre alt gewesen und wie eine feine Dame gekleidet, hatte aber wie ein Junge die Eichhörnchen mit Steinen beworfen.
Macks Mutter war früher einmal Zofe in High Glen House gewesen, dem Wohnsitz der Hallims, und nach ihrer Heirat an Sonntagnachmittagen des Öfteren dorthin zurückgekehrt, um ihre alten Freundinnen zu besuchen und stolz ihre Zwillinge vorzuführen. Bei diesen Gelegenheiten hatten Mack und Esther – wahrscheinlich ohne Wissen von Lady Hallim – mit Lizzie gespielt. Das Mädchen war ein richtiges kleines Luder gewesen: dickköpfig, rechthaberisch und verwöhnt. Einmal hatte Mack sie geküsst, worauf sie ihn so heftig an den Haaren zog, dass er zu weinen anfing. Allzu sehr schien sie sich nicht verändert zu haben: Sie hatte ein kleines, koboldhaftes Gesicht und einen dunkelbraunen Lockenkopf. Ihr Mund bildete einen rosa Bogen, und in ihren dunklen Augen saß der Schalk.
Mack starrte sie an. Jetzt würde ich sie gerne küssen, dachte er, und genau in diesem Moment hob sie den Kopf und blickte ihn an. Er fühlte sich ertappt und sah rasch weg; ihm war, als habe sie seine Gedanken gelesen.
Die Predigt ging zu Ende. Zusätzlich zu dem herkömmlichen presbyterianischen Gottesdienst stand heute eine Taufe an: Macks Kusine Jen hatte ihr viertes Kind geboren. Wullie, der Älteste, arbeitete bereits im Pütt. Mack war zu dem Schluss gekommen, dass die Taufe der günstigste Zeitpunkt zur Verkündung seiner Botschaft wäre. Der Augenblick rückte unaufhaltsam näher, und der junge Mann spürte ein Schwächegefühl im Magen.
Sei kein Frosch, schalt er sich. Unten in der Grube setzt du jeden Tag dein Leben aufs Spiel! Was ist schon dabei, einem feisten Kaufmann die Stirn zu bieten?
Jen stand neben dem Taufbecken. Sie sah müde aus. Sie war gerade dreißig, doch nach vier Geburten und dreiundzwanzig Jahren Arbeit unter Tage schon ausgebrannt. Nachdem Reverend York den Kopf des Babys mit Wasser benetzt hatte, wiederholte Jens Mann Saul jene Worte, mit denen die Söhne aller schottischen Bergleute zu Sklaven gemacht wurden: »Ich gelobe, dass dieses Kind in Sir George Jamissons Gruben arbeiten wird – als Knabe und als Mann, bis ihn seine Kräfte verlassen oder bis zu seinem Tode.«
Das war das Stichwort für Mack.
Er stand auf.
An diesem Punkt der Taufzeremonie trat normalerweise Obersteiger Harry Ratchett vor und überreichte dem Vater das »Handgeld«, die traditionelle Bezahlung für das geleistete Versprechen. Die Summe betrug zehn Pfund. Zu Macks Überraschung war es jedoch Sir George, der das Ritual diesmal persönlich durchführen wollte.
Der Laird erhob sich. Die Blicke der beiden Männer trafen sich. Sekundenlang starrten sie einander an.
Dann schritt Sir George auf das Taufbecken zu.
Mack trat in den Mittelgang der kleinen Kirche und sagte mit lauter Stimme: »Das Handgeld hat keine Bedeutung mehr.«
Sir George blieb unvermittelt stehen. Alle Köpfe drehten sich nach Mack um. Es herrschte betroffenes Schweigen. Mack hörte den Schlag seines eigenen Herzens.
»Diese Zeremonie hat keine bindende Kraft«, verkündete er. »Der Junge kann dem Bergwerk nicht versprochen werden. Man darf ein Kind nicht versklaven.«
»Setzen Sie sich hin, Sie junger Narr, und halten Sie Ihren Mund!«, sagte Sir George.
Die herablassende Zurechtweisung ärgerte Mack so sehr, dass er alle Bedenken vergaß. »Setzen Sie sich hin!«, erwiderte er in einem forschen Ton, der die schockierten Gemeindemitglieder die Luft anhalten ließ, und deutete mit dem Zeigefinger auf Pfarrer York. »Sie sprachen in Ihrer Predigt doch über die Wahrheit, Pastor! Werden Sie jetzt auch dafür einstehen?«
Der Gottesmann sah Mack beunruhigt an. »Um was geht es Ihnen denn, McAsh?«, fragte er.
»Um Sklaverei!«
»Sie kennen doch gewiss das schottische Recht«, antwortete York, in einem Ton, der erkennen ließ, dass er sich um Verständnis bemühte. »Der Arbeiter in den Kohlegruben ist Eigentum des Bergwerksbesitzers. Nach einem Jahr und einem Tag in der Grube verliert er seine Freiheit.«
»Aye«, bestätigte Mack. »Das ist übel, aber es ist Gesetz. Ich sage jedoch, dass das Gesetz keine Kinder versklavt – und ich kann es auch beweisen!«
»Wir brauchen das Geld, Mack!«, protestierte Saul.
»Nimm es ruhig an, Saul«, sagte Mack. »Dein Junge wird bis zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag für Sir George arbeiten, und das ist die zehn Pfund durchaus wert. Doch danach …« Er hob die Stimme. »Danach ist er frei!«
»Hüten Sie Ihre Zunge!«, sagte Sir George drohend. »Das ist gefährliches Geschwätz!«
»Aber es stimmt«, gab Mack trotzig zurück.
Sir George lief purpurrot an; so hartnäckigen Widerspruch war er nicht gewohnt. »Um Sie kümmere ich mich nach dem Gottesdienst«, sagte er wütend. Er überreichte Saul die Geldbörse und wandte sich dann an den Pfarrer. »Bitte fahren Sie fort, Pastor York!«
Mack war völlig durcheinander. Das durfte doch nicht wahr sein! Wollten sie einfach so tun, als wäre nichts geschehen?
Der Pfarrer sagte: »Lasset uns singen. Das letzte Lied.«
Sir George kehrte auf seinen Platz zurück. Mack blieb stehen; er konnte es immer noch nicht fassen, dass anscheinend alles bereits vorbei war.
»Der zweite Psalm«, sagte der Pfarrer. »›Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich?‹«
Eine Stimme hinter Mack unterbrach ihn: »Nein, nein – noch nicht!«
Mack drehte sich um. Es war Jimmy Lee, der junge Bergmann mit der schönen Singstimme. Er war schon einmal davongelaufen und trug zur Strafe einen Eisenring um den Hals, auf dem die Worte Dieser Mann ist das Eigentum von Sir George Jamisson aus Fife eingraviert waren. Ich danke Gott, dass er uns Jimmy gegeben hat, dachte Mack.
»Sie können jetzt nicht einfach aufhören«, sagte Jimmy. »Ich werde nächste Woche einundzwanzig. Ich möchte wissen, ob ich freikommen kann.«
Ma Lee, Jimmys Mutter, ergänzte: »Wir alle wollen das wissen.« Sie hatte keine Zähne mehr im Mund, war aber eine unbeugsame Frau, deren Wort in der Gemeinde etwas galt. Mehrere andere Gläubige, Frauen wie Männer, stimmten ihr zu.
»Davon kann überhaupt keine Rede sein!«, fauchte Sir George und erhob sich wieder.
Esther zerrte an Macks Ärmel. »Der Brief!«, zischte sie. »Zeig ihnen den Brief!«
»Was ist das für ein Papier, McAsh?«, fragte Pastor York.
»Das ist der Brief eines Londoner Rechtsanwalts, bei dem ich mich erkundigt habe.«
Sir George sah aus, als wolle er jeden Augenblick platzen, so wütend war er. Mack war heilfroh, dass mehrere Bankreihen zwischen ihnen lagen; andernfalls wäre ihm der Laird womöglich an die Gurgel gesprungen.
»Sie haben sich bei einem Anwalt erkundigt?«, blubberte Sir George. Nichts schien ihn mehr zu ärgern als das.
»Was steht denn in dem Brief?«, fragte York.
»Ich les ihn vor«, sagte Mack und fing sofort damit an: »›Für die Handgeld-Zeremonie findet sich weder im englischen noch im schottischen Recht eine Grundlage.‹« Dieser Satz löste unter den Gemeindemitgliedern ein überraschtes Murmeln aus: Das stand in krassem Gegensatz zu allem, was man ihnen bisher beigebracht hatte. »›Eltern können nicht verkaufen, was ihnen nicht gehört, schon gar nicht die Freiheit eines erwachsenen Mannes. Sie können ihre Kinder bis zu deren einundzwanzigstem Geburtstag zur Arbeit in den Bergwerken zwingen, doch danach …‹« Mack hielt inne, um den dramatischen Effekt zu erhöhen, und las die folgenden Worte besonders langsam:
»› … doch danach sind die jungen Männer frei und können gehen!‹«
Es entstand Unruhe. Alle wollten etwas sagen, hundert Menschen gleichzeitig. Sie hoben die Stimmen, manche wollten Fragen stellen, andere wiederum sich nur mit einem lauten Ruf Gehör verschaffen. Ungefähr die Hälfte der anwesenden Männer waren schon als Kind der Bergwerksleitung versprochen worden und betrachteten sich folglich als Sklaven. Jetzt erfuhren sie, dass man sie betrogen hatte, und wollten die ganze Wahrheit wissen.
Mack hob die Hand, und prompt verstummten die Leute wieder. Einen Augenblick genoss er seine Macht. »Lasst mich noch eine Zeile vorlesen«, sagte er. »›Sobald ein Mann erwachsen ist, untersteht er wie jeder andere Schotte auch dem Gesetz: Nach einem Jahr und einem Tag Arbeit als Erwachsener verliert er seine Freiheit.‹«
Empörung und Enttäuschung machten sich breit. Nein, eine Revolution ist das nicht, erkannten die Männer. Die meisten von ihnen waren nicht freier als zuvor. Aber vielleicht hatten ihre Söhne eine Chance.
»Zeigen Sie mir mal diesen Brief, McAsh«, sagte Pfarrer York.
Mack ging vor und reichte ihm das Schreiben.
Sir George, noch immer rot vor Wut, fragte: »Wer ist dieser sogenannte Rechtsanwalt?«
»Er heißt Caspar Gordonson«, sagte Mack.
»Ach ja«, bemerkte der Pfarrer, »von dem habe ich schon gehört.«
»Ich auch!«, blökte Sir George verächtlich. »Ein in der Wolle gefärbter Radikaler! Ein Spießgeselle von John Wilkes!« Den Namen Wilkes kannten alle. Der gefeierte Führer der Liberalen lebte im Pariser Exil, drohte jedoch ständig mit seiner Rückkehr und der Destabilisierung der Regierung. »Wenn ich auch nur ein kleines Wörtchen mitzureden habe, kommt Gordonson dafür an den Galgen!«, fuhr Sir George fort. »Dieser Brief ist Hochverrat!«
Das Wort ›Galgen‹ erschreckte den Pastor. »Ich glaube kaum, dass hier von Hochverrat …«
»Kümmern Sie sich um das Himmelreich!«, fuhr Sir George ihn an. »Die Entscheidung darüber, was Hochverrat ist und was nicht, überlassen Sie gefälligst Männern dieser Welt.« Er riss York den Brief aus der Hand.
Entsetzt über die brutale Zurechtweisung ihres Seelsorgers, verstummten die Gläubigen und warteten gespannt auf dessen Reaktion. York hielt Jamissons Blick stand, und Mack war sicher, der Pastor würde dem Laird die Stirn bieten. Doch da schlug der Gottesmann auch schon die Augen nieder. Jamisson grinste triumphierend und nahm wieder Platz, als wäre alles geklärt.
Pastor Yorks Feigheit empörte Mack. Die Kirche galt als moralische Autorität. Auf einen Pfarrer, der sich vom Grundherrn Befehle erteilen ließ, konnte man verzichten. Er sah den Mann mit unverhohlener Verachtung an und sagte spöttisch: »Sollen wir nun das Gesetz respektieren oder nicht?«
Da erhob sich Robert Jamisson. Auch sein Gesicht war vom Zorn gerötet.
»Sie respektieren das Gesetz, und Ihr Laird wird Ihnen sagen, was Recht und Gesetz ist«, sagte er.
»Das ist genauso gut wie überhaupt kein Gesetz«, erwiderte Mack.
»Was Sie betrifft, mag das sogar stimmen«, sagte Robert. »Sie sind Arbeiter in einer Kohlegrube: Was haben Sie mit dem Gesetz zu schaffen? Und was Ihre Korrespondenz mit Anwälten betrifft …« Er nahm seinem Vater den Brief aus der Hand. »Ich zeige Ihnen jetzt, was ich von Ihrem Rechtsanwalt halte.«
Er riss den Brief mittendurch.
Die Kumpel hielten die Luft an. Auf diesem Papier stand ihre Zukunft – und jetzt wurde es zerrissen.
Robert Jamisson zerfetzte den Brief und warf die Schnipsel in die Luft. Wie Konfetti bei einer Hochzeitsfeier flatterten sie auf Saul und Jen hinab.
Mack empfand tiefe Trauer wie bei einem Todesfall. Der Erhalt dieses Briefes war das bedeutendste Ereignis seines bisherigen Lebens gewesen. Er hatte ihn allen Menschen im Dorf zeigen wollen, ja, er hatte sogar erwogen, ihn auch in anderen Bergbaugemeinden bekannt zu machen. Ganz Schottland sollte Bescheid wissen. Und jetzt hatte Robert ihn im Laufe weniger Sekunden vernichtet. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Robert genoss seinen Triumph und machte daraus keinen Hehl. Dies wiederum brachte Mack in Rage. Nein, so schnell wollte er nicht klein beigeben. Der Brief mochte nicht mehr existieren, doch das Gesetz hatte weiterhin Bestand. »Sie müssen große Angst haben, sonst hätten Sie diesen Brief nicht zerrissen«, sagte er zu Robert und war selbst überrascht von der abgrundtiefen Verachtung, die in seiner Stimme lag. »Das Gesetz dieses Landes können Sie nicht so leicht in Stücke reißen.«
Robert Jamisson erschrak und wusste im ersten Moment nicht, wie er auf diese schlagfertige Antwort reagieren sollte. Nach kurzem Zögern sagte er nur ein Wort: »Raus!«
Mack sah Pastor York an. Auch die Blicke der Jamissons richteten sich auf den Pfarrer. Kein Laie besaß das Recht, ein Gemeindemitglied aus der Kirche zu weisen. Würde der Pastor erneut in die Knie gehen und sein Hausrecht an den Sohn des Laird abtreten? »Ist dies ein Haus Gottes, oder gehört es Sir George?«, wollte Mack wissen.
Es war ein kritischer Augenblick, und es zeigte sich, dass Pastor York ihm nicht gewachsen war. »Sie gehen jetzt am besten, McAsh«, sagte er.
Mack wusste, dass es töricht war, aber er konnte sich eine Erwiderung nicht verkneifen. »Ich danke Ihnen für Ihre Predigt über die Wahrheit, Pastor«, sagte er. »Ich werde sie niemals vergessen.«
Er wandte sich zum Gehen. Auch Esther stand auf, um ihn zu begleiten. Durch den Mittelgang schritten sie auf den Ausgang zu. Da erhob sich hinter ihnen ein dritter. Es war Jimmy Lee. Ein oder zwei andere standen zögernd auf, dann auch Mrs. Lee. Und plötzlich erhoben sich alle. Stiefel scharrten, Kleider raschelten. Mack hatte den Ausgang noch nicht erreicht, da waren sämtliche Bergarbeiter schon auf den Beinen und trafen Anstalten, mitsamt ihren Angehörigen die Kirche zu verlassen. Als Mack erkannte, dass er nicht mehr allein war, fühlte er sich von der Gemeinschaft getragen und spürte, dass er einen großen Sieg errungen hatte. Tränen stiegen ihm in die Augen.
Draußen auf dem Friedhof sammelten sie sich um ihn. Der Wind hatte sich gelegt, dafür schneite es jetzt. Langsam und behäbig taumelten die großen Flocken durch die Luft und legten sich auf die Grabsteine.
»Den Brief hätte er nicht zerreißen dürfen«, sagte Jimmy empört. »Das war ein Fehler.«
Andere stimmten ihm zu. »Wir schreiben dem Rechtsanwalt noch einmal«, sagte ein Kumpel.
»Es wird diesmal nicht so leicht sein, den Brief aufzugeben«, entgegnete Mack. Er war nicht ganz bei der Sache, fühlte sich erschöpft und keuchte sogar ein wenig, als hätte er gerade die steilen Hänge des Tals erklommen. Andererseits erfüllte ihn große Freude.
»Gesetz ist Gesetz«, sagte ein Kumpel.
»Aye. Aber der Laird ist der Laird«, gab ein anderer zu bedenken.
Nachdem er sich einigermaßen beruhigt hatte, begann Mack sich zu fragen, was er mit seinem Auftritt tatsächlich erreicht hatte. Gewiss, er hatte für Unruhe gesorgt, aber dadurch allein änderte sich nichts. Die Jamissons hatten sich brüsk geweigert, das Gesetz anzuerkennen. Angenommen, sie stellten sich stur – was konnten die Bergarbeiter dagegen schon unternehmen? Hatte es je einen Sinn gehabt, für die Gerechtigkeit zu kämpfen? War es nicht besser, dem Laird zu salutieren und insgeheim darauf zu spekulieren, eines Tages Harry Ratchett als Obersteiger nachfolgen zu können?
In diesem Moment schoss wie ein von der Leine gelassener Jagdhund eine kleine Gestalt im schwarzen Pelzmantel durch das Kirchenportal und lief geradewegs auf Mack zu. Es war Lizzie Hallim. Bereitwillig öffneten ihr die Kumpel eine Gasse.
Mack starrte das Mädchen an. Schon in Ruhe und Gelassenheit war dieses Mädchen eine Schönheit – doch jetzt, in höchster Empörung, war sie schlichtweg hinreißend. Ihre schwarzen Augen funkelten.
»Wer bilden Sie sich eigentlich ein, dass Sie sind?«, fuhr sie ihn an.
»Ich bin Malachi McAsh …«
»Der Name ist mir bekannt«, erwiderte Lizzie. »Wie können Sie es wagen, in diesem Ton zu dem Laird und seinem Sohn zu sprechen?«
»Wie können die beiden es wagen, uns zu versklaven, obwohl das Gesetz es ihnen ausdrücklich verbietet?«
Unter den Arbeitern erhob sich zustimmendes Gemurmel.
Lizzie sah in die Runde. Schneeflocken hefteten sich auf ihren schwarzen Pelz. Eine Flocke landete auf ihrer Nase und wurde von ihr mit einer ungeduldigen Handbewegung fortgewischt. »Ihr könnt von Glück reden, dass ihr eine bezahlte Arbeit habt«, sagte sie. »Und ihr solltet Sir George dafür dankbar sein, dass er seine Bergwerke weiter ausbaut und euch und euren Familien ein Auskommen gibt.«
»Wenn wir schon so glückliche Menschen sind – wozu braucht man dann Gesetze, um uns hier im Dorf zu halten? Warum verbietet man uns dann, anderswo Arbeit zu suchen?«
»Weil ihr zu dumm seid, euer eigenes Glück zu erkennen!«
Mack merkte, dass er an der Auseinandersetzung Gefallen fand – und nicht nur deshalb, weil sie mit dem Anblick einer schönen Frau aus höheren Kreisen verbunden war. Sie war auch ein gewandterer Widerpart als Sir George oder Robert.
Er senkte die Stimme und fragte in forschendem Ton: »Sind Sie schon einmal in einer Kohlengrube gewesen, Miss Hallim?«
Ma Lee kicherte bei dieser Vorstellung.
»Machen Sie sich doch nicht lächerlich!«, erwiderte Lizzie.
»Sollten Sie einmal die Gelegenheit dazu haben, dann garantiere ich Ihnen eines: Sie werden keinen von uns mehr für glücklich halten.«
»Ich habe jetzt genug von Ihren Unverschämtheiten. Man sollte Sie auspeitschen!«
»Wird man wahrscheinlich auch tun«, gab er zurück, doch er glaubte nicht daran: Seitdem er auf der Welt war, hatte man im Dorf keinen Bergarbeiter mehr ausgepeitscht. Sein Vater konnte sich allerdings noch an solche Fälle erinnern.
Ihre Brust hob und senkte sich. Es kostete ihn einige Mühe, nicht auf ihren Busen zu starren. »Sie haben eine Antwort auf alles«, sagte Lizzie. »Aber das war ja schon immer so.«
»Aye, nur haben Sie noch nie darauf gehört.«
Er spürte einen schmerzhaften Ellbogenstoß in seiner Seite. Es war Esther, die ihm auf diese Weise zu verstehen gab, dass er aufpassen musste. Klüger sein zu wollen als die Gentry, der Landadel, hatte sich noch nie ausgezahlt. »Wir werden über das, was Sie uns gesagt haben, nachdenken, Miss Hallim, und danken Ihnen sehr für Ihren guten Rat«, sagte sie.
Lizzie nickte herablassend. »Sie sind doch Esther, nicht wahr?«
»Aye, Miss.«
Lizzie wandte sich an Mack. »Sie sollten mehr auf Ihre Schwester hören. Esther hat ein besseres Gespür als Sie.«
»Das ist der erste richtige Satz, den Sie heute zu mir gesagt haben.«
»He, Mack, halt den Rand!«, zischte Esther.
Lizzie grinste, und plötzlich war ihre Arroganz wie fortgeblasen. Ein Lächeln hellte ihre Miene auf, und sie war wie verwandelt, eine nette, fröhliche junge Frau. »Diesen Ausdruck habe ich schon lange nicht mehr gehört«, sagte sie und lachte – und Mack musste unwillkürlich mitlachen.
Noch immer kichernd, wandte sie sich zum Gehen.
Mack sah ihr nach. Im Kirchenportal erschienen in diesem Augenblick die Jamissons, und Lizzie gesellte sich zu ihnen.
»Mein Gott«, sagte er. »Was für eine Frau!«
ERSTER TEILKAPITEL 4
DIE AUSEINANDERSETZUNGINDER KIRCHE empörte Jay. Leute, die sich über ihren Stand erhoben, regten ihn maßlos auf. Dass Malachi McAsh zeitlebens unter Tage Kohle hauen musste und er, Jay Jamisson, eine höhere Existenz führen durfte, war Gottes Wille und entsprach dem Gesetz des Landes. Jedes Aufbegehren gegen die natürliche Ordnung der Dinge war lästerlich und von Übel. Hinzu kam, dass der Ton, den dieser McAsh am Leibe hatte, ihn zur Weißglut bringen konnte; es klang fast so, als hielte er sich für einen Gleichen unter Gleichen, ganz egal, wie hochgeboren die Leute waren, zu denen er sprach.
In den Kolonien war das anders. Sklave war dort Sklave. Von Arbeitslöhnen war nicht die Rede, und auf einen solchen Unsinn wie »nach einem Jahr und einem Tag Arbeit« kam dort keiner. So sollte es überall sein, dachte Jay. Ohne Zwang arbeiten die Menschen nicht, und der Zwang darf ruhig gnadenlos sein – Hauptsache, er erfüllt seinen Zweck.
Draußen vor der Kirche gratulierten ihm nur ein paar Pächter zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag. Die Bergarbeiter hatten sich am Rand des Friedhofs zusammengerottet und waren in ein heftiges, raunendes Streitgespräch verwickelt. Jay ärgerte sich furchtbar darüber, dass sie ihm mit ihrem Auftritt seinen Ehrentag verdarben.
Eilig ging er durch das Schneetreiben zu den Pferden, die ein Stallknecht für sie bereithielt. Robert war bereits dort, doch Lizzie fehlte noch. Jay drehte sich um und hielt nach ihr Ausschau. Er freute sich auf den gemeinsamen Heimritt. »Wo ist Miss Elizabeth?«, fragte er den Stallknecht.
»Dort drüben, beim Portal, Mr. Jay.«
Jetzt entdeckte Jay sie. Sie unterhielt sich angeregt mit dem Pastor.
Robert wandte sich zu seinem Bruder und tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Brust. Er war sichtlich aggressiv. »Hör mir mal gut zu, Jay«, sagte er. »Lass die Pfoten von Elizabeth Hallim, verstanden?«
Seine Miene zeigte, dass er es ernst meinte. Wenn er in dieser Laune war, reizte man ihn besser nicht, das konnte gefährlich werden.
Doch aus seiner Wut und Enttäuschung erwuchs Jay ungewohnter Mut.
»Wovon redest du eigentlich, zum Teufel?«, fragte er.
»Du wirst sie nicht heiraten, Jay. Sie gehört mir.«
»Ich will sie doch gar nicht haben.«
»Dann poussier nicht mit ihr herum.«
Jay wusste, dass Lizzie ihn anziehend fand, und die harmlose Neckerei mit ihr hatte ihm Spaß gemacht, aber er hatte nie daran gedacht, ihr Herz zu erobern. Als er vierzehn und sie dreizehn gewesen war, hielt er sie für das hübscheste Mädchen der Welt, und es hatte ihm schier das Herz gebrochen, dass sie sich nicht für ihn interessierte (sie wollte allerdings auch von den anderen Jungen nichts wissen). Doch das war lange her. Vater hatte die Absicht, Robert mit Lizzie zu verheiraten, und weder Jay noch sonst jemand in der Familie würde sich den Wünschen Sir Georges widersetzen. Dass sich Robert trotzdem so aufregte, wunderte Jay. Es verriet eine Unsicherheit, wie man sie weder von ihm noch von seinem Vater gewohnt war.
Jay genoss das seltene Vergnügen, seinen Bruder so verwundbar zu sehen. »Wovor hast du denn Angst?«, fragte er.
»Du weißt verdammt gut, worum es mir geht. Du hast mir schon immer alles weggenommen, schon als kleiner Junge. Mein Spielzeug, meine Kleider – alles …«
»Weil du immer alles bekommen hast, was du wolltest, und ich nie etwas.« Hinter der Antwort steckte jahrelang aufgestauter Groll.
»Quatsch.«
»Was soll ich denn machen?«, lenkte Jay ein. »Miss Hallim ist Gast in unserem Hause – ich kann sie doch nicht wie Luft behandeln.«
Ein störrischer Zug lag um Roberts Mund. »Willst du, dass ich mit Vater darüber spreche?«
Das waren die Zauberworte, die viele Streitereien in ihrer Jugend beendet hatten, denn beide Brüder wussten nur zu genau, dass Vater immer nur Robert recht geben würde.
»Schon gut, schon gut«, sagte Jay, während ihm eine nur allzu bekannte Bitterkeit fast den Hals abschnürte. »Ich halt mich aus deiner Brautwerbung heraus.«
Er schwang sich auf sein Pferd und ritt davon. Sollte Robert doch Lizzie zum Schloss eskortieren!
Schloss Jamisson, eine hohe Festung aus grauem Stein mit Türmen und zinnenbewehrtem Dach, wirkte so streng und abweisend wie viele schottische Herrenhäuser. Es war vor siebzig Jahren errichtet worden, nachdem die erste Kohlegrube im Tal den Hausherrn reich gemacht hatte.
Sir George hatte das Gut von einem Vetter seiner ersten Frau geerbt. So weit Jay zurückdenken konnte, war sein Vater von der Kohle wie besessen gewesen und hatte all seine Zeit und all sein Geld in die Erschließung neuer Gruben investiert. Am Schloss war dagegen kaum etwas getan worden.
Obwohl er hier aufgewachsen war, fühlte sich Jay nicht wohl im Schloss. Die riesigen, zugigen Räume im Erdgeschoss – Halle, Speisesaal, Salon, Küche und Dienstbotenzimmer – umschlossen einen großen zentralen Innenhof mit einem Brunnen, der von Oktober bis Mai eingefroren war. Das Gebäude war einfach nicht warm zu bekommen. Dass in jedem Schlafzimmer reichlich Kohle aus den Jamisson’schen Gruben verheizt wurde, beeindruckte die kalte, klamme Luft in den Gemächern wenig, und auf den Gängen war es meist so frostig, dass man sich einen Mantel anziehen musste, wenn man von einem Raum in den anderen gehen wollte.
Vor zehn Jahren war die Familie dann nach London gezogen. Im Schloss verblieb nur eine kleine Gruppe von Bediensteten, um das Gebäude in Ordnung zu halten und das Wild zu schützen. Eine Zeit lang kehrte man Jahr für Jahr mit Gästen und Personal zurück. In Edinburgh mietete sich die Familie Pferde und eine Kutsche. Pächterfrauen scheuerten für einen geringen Lohn die Steinfliesen, sorgten dafür, dass die Feuer nicht ausgingen, und leerten die Nachttöpfe. Doch mit der Zeit fiel es Vater immer schwerer, sich von seinen Geschäften loszureißen, und so reisten sie immer seltener nach Schottland. Dass sie ausgerechnet in diesem Jahr die alte Gewohnheit wieder aufgenommen hatten, gefiel Jay überhaupt nicht, doch empfand er bei allem Verdruss die Begegnung mit der herangewachsenen Lizzie Hallim als angenehme Überraschung – und dies nicht nur, weil er durch sie die Chance bekam, den ansonsten stets vom Glück begünstigten älteren Bruder ein wenig zu quälen.
Er ritt zu den Ställen hinter dem Haus, saß ab und tätschelte dem Wallach den Hals. »Für Hindernisrennen taugt er nicht viel, aber er ist ein braves Pferd«, sagte er zu dem Stallknecht, während er ihm die Zügel in die Hand drückte. »Ich wäre froh, wenn ich ihn in meinem Regiment hätte.«
Der Stallknecht freute sich über das Lob. »Danke, Sir.«
Jay betrat die große Halle, einen riesigen, düsteren Raum mit noch dunkleren Ecken und Winkeln, die vom Kerzenlicht kaum erreicht wurden. Auf einem alten Fell vor dem Kohlenfeuer lag ein schläfriger Jagdhund. Jay stieß ihn mit der Stiefelspitze an und scheuchte ihn fort, um sich die Hände zu wärmen.
Über dem Kamin hing das Porträt von Roberts Mutter Olivia, der ersten Frau Sir Georges. Jay hasste das Gemälde. Da hing sie nun, feierlich und fromm, und schaute an ihrer langen Nase vorbei auf die Nachwelt herab. Mit neunundzwanzig Jahren war sie an einem plötzlichen Fieber gestorben. Vater hatte ein zweites Mal geheiratet, seine erste Liebe aber nie vergessen können. Alicia, die Mutter seines zweiten Sohnes, behandelte er wie eine Mätresse; sie war nur ein Spielzeug für ihn, eine Frau ohne Rang und Rechte, und Jay hatte manchmal das Gefühl, er selbst sei nichts weiter als ein illegitimer Sohn. Robert war der Erstgeborene, der Erbe, der Liebling. Es gab Momente, da hätte Jay am liebsten gefragt, ob Robert durch unbefleckte Empfängnis und Jungferngeburt das Licht der Welt erblickt hatte.
Er wandte dem Gemälde den Rücken zu. Ein Diener brachte ihm einen Becher Glühwein. Dankbar schlürfte er ein paar Schlucke und hoffte insgeheim, sie könnten ihn von der nervösen Spannung befreien, die sich in seiner Magengrube breitgemacht hatte. Heute war der Tag, an dem Vater die Entscheidung über sein Erbteil bekannt geben wollte.
Er wusste, dass er nicht die Hälfte des väterlichen Vermögens bekommen würde, ja, nicht einmal ein Zehntel. Das Gut und die ertragreichen Gruben würde Robert erhalten, ebenso die Handelsflotte, für die er schon jetzt verantwortlich war. Jays Mutter hatte ihrem Sohn geraten, deswegen keinen Streit anzuzetteln; sie wusste, dass Vater einschnappen und dann unversöhnlich sein konnte.
Robert war nicht einfach nur der älteste Sohn. Er war ein Duplikat seines Vaters. Jay war das nicht, und deshalb wollte Vater auch nichts von ihm wissen. Robert war, wie Vater, ein cleverer, aber herzloser und geiziger Mann, Jay dagegen umgänglich und verschwenderisch. Vater hasste Menschen, die zu viel Geld ausgaben; vor allem, wenn es sein eigenes war. Mehr als einmal hatte er Jay angebrüllt: »Ich schwitze Blut und Wasser, um das Geld zu verdienen, das du dann zum Fenster hinauswirfst!«
Erst vor wenigen Monaten hatte Jay die Lage durch Spielschulden in Höhe von neunhundert Pfund noch verschlimmert. Er hatte seine Mutter gebeten, Vater um die Begleichung zu bitten. Es war ein kleines Vermögen, das ausgereicht hätte, Schloss Jamisson zu kaufen, aber Sir George konnte es ohne Weiteres verschmerzen. Dennoch hatte er getobt, als wolle man ihm ein Bein abschneiden. Inzwischen waren schon wieder neue Spielschulden aufgelaufen, von denen Vater noch gar nichts wusste.
Mutter riet ihm: »Lass es nicht auf einen Streit mit deinem Vater ankommen, sondern bitte ihn um einen bescheidenen Anteil.« Nachgeborene Söhne gingen oft in die Kolonien, und es bestand durchaus die Chance, dass Vater ihm die Zuckerplantage auf Barbados mit Haus und Negersklaven übereignen würde. Sowohl er als auch seine Mutter hatten Sir George darauf angesprochen, und der hatte zwar nicht Ja gesagt, aber auch nicht Nein. Jay machte sich nach wie vor große Hoffnungen.
Ein paar Minuten später kehrte sein Vater zurück. Er trat sich den Schnee von den Reitstiefeln und ließ sich von einem Diener aus dem Mantel helfen. »Benachrichtigen Sie sofort Ratchett«, sagte er zu dem Mann. »Ich möchte, dass die Brücke rund um die Uhr von zwei Mann bewacht wird. Wenn McAsh versucht, das Tal zu verlassen, soll er sofort festgenommen werden.«
Es gab nur eine Brücke über den Fluss, doch konnte man das Tal auch noch auf einem anderen Weg verlassen. »Und was ist, wenn McAsh über den Berg geht?«, fragte Jay.
»Bei diesem Wetter? Soll er’s ruhig versuchen! Sobald wir hören, dass er verschwunden ist, schicken wir auf der Straße eine Patrouille los, um den Berg herum; die wird dafür sorgen, dass der Sheriff und die Soldaten ihn schon erwarten, sobald er drüben auftaucht. Aber ich denke, er wird es gar nicht schaffen.«
Jay war sich da nicht so sicher – diese Bergarbeiter waren zäh wie Hirschleder, und McAsh war ein ganz besonders durchtriebener Bursche –, aber er hütete sich, seinem Vater zu widersprechen.
Lady Hallim traf als Nächste ein. Sie hatte dunkles Haar und dunkle Augen wie ihre Tochter, doch nichts von deren Feuer und Temperament. Sie war rundlich und untersetzt, und ihr fleischiges Gesicht war tief gefurcht von Falten, die verrieten, dass sie mit vielem, was sie sah und hörte, nicht einverstanden war.