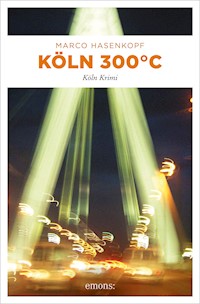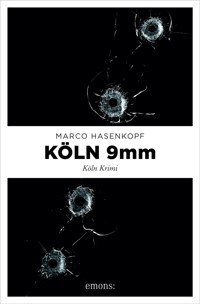Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historischer Kriminalroman
- Sprache: Deutsch
Ein faszinierender Kriminalroman inmitten der größten Naturkatastrophe der frühen Neuzeit. Cöln 1784: Mitten im härtesten Winter seit Menschengedenken geht ein Serienmörder in der Stadt um. Amtmann Henrik Venray und die eigenwillige Apothekerwitwe Anna-Maria Scheidt begeben sich auf die Jagd nach ihm und müssen nicht nur gegen eine Bestie in Menschengestalt, sondern auch gegen Kälte und Hunger kämpfen. Zu allem Überfluss droht eine Schmelzwasserflut von unvorstellbarem Ausmaß über Cöln und das Rheinland hereinzubrechen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marco Hasenkopf, geboren 1973 in Hamm/Westfalen, studierte Archäologie und war viele Jahre als Drehbuchautor für Theater- und Filmproduktionen tätig. Er ist Preisträger des Kurt-Hackenberg-Preises für politisches Theater und lebt heute als freischaffender Schriftsteller und Theaterproduzent mit seiner Familie in Köln.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/mycteria
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-770-5
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Sie begehren von mir, lieber Graf, unglücksvolle Abschilderungen einer Stadt, wovon ich Augenzeug gewesen; könnte in diesem Augenblick der berühmtesten Schriftsteller ihre Feder entlehnet werden, so würde sie dennoch zaghaft sein, alles Schreckliche, alles Traurige in jener Lage zu entwerfen, die zwar ein Mitmensch sehen und fühlen, aber nicht fühlbar genug entwerfen kann; ich glaube mit großem Fug vom 27. Hornung ihnen zu schreiben: Una nox interfuit inter Urbem Maximam et nullam.
Ja, lieber Graf! Diese Stadt war am Rande, unter den wütenden Eiswellen ihr Grab zu finden (…).
Auszug aus dem Brief eines nicht namentlich genannten Kölner Ritters an einen ebenfalls nicht genannten Grafen
Damit die Leser, welche unseren Ort nicht kennen, sich einigermaßen eine Vorstellung davon machen, und die Erzählung eines und andern merkwürdigen Vorgangs besser verstehen mögen: so will ich versuchen, seine Lage, so viel mir ohne Zeichnung möglich ist, deutlich zu machen.
Mülheim, ein offenes Städtchen von vierhundertzwanzig Häusern, liegt eine kleine Stunde unterhalb Köln, am rechten Rheinufer in einer Ebene. Doch diejenigen Häuser, wo man auf dem Wege von dem, Köln gegen über liegenden Städtchen Deutz zu erst anlangt, liegen merklich niedriger als die übrigen Gebäude des Orts; so, daß man hier gewöhnlich diese Gegenduntenzu nennen pflegt, ob sie gleich nach dem Laufe des Rheinsobenzu liegt. (…)
Das beweinenswürdige Schicksal, welches vor kurzem Mülheim am Rhein, durch die verheerende Wasser- und Eisfluten vor anderen Orten her so hart getroffen hat, ist zwar in der Nähe und Ferne bekannt geworden. Allein die Nachrichten davon sind durchgehend zu unvollständig, als daß sie, zumal ausländischen Freunden, eine hinlängliche befriedigende, und der Größe des ganzen schrecklichen Vorgangs würdige Idee beibringen sollten. Und obschon man nicht hoffen darf, diesen Zweck durch gegenwärtige Blätter ganz zu erreichen: so hoffet man dennoch mit Grunde, daß folgende umständliche, möglichst getreue und zuverläßige Beschreibung dem theilnehmenden Publikum nicht unwillkommen sein werde. (…)
Auszug aus: »Beschreibung der schrecklichen Überschwemmung und Eisfahrt wodurch den 27. und 28. Februar ein großer Theil von Mülheim am Rhein verwüstet worden ist, verfasst von einem der selbst vieles mit gesehen, gehöret und empfunden hat, J.W.B.«
Johann Wilhelm Berger, Französischlehrer
Móðuharðindin – Nebelnot
Island, Sommer 1783
Sigrun Olafsdottir spähte über das, was einmal ihr Weideland gewesen war.
Die alte Bäuerin konnte nicht verstehen, was hier vor sich ging. Der Schrecken saß tief. Ihre faltigen Hände zitterten, die Lippen bebten. Rastlos hetzten die schreckgeweiteten Augen hin und her.
Ein Donnerknall, urgewaltig wie aus Walhalla selbst, hatte sie beim Rübenschälen erschrocken auffahren lassen. Tief unter ihr begann die Erde zu beben. Und hörte nicht mehr auf. Eilig hatte sie die armselige Bauernkate, die sie ihr Heim nannte, verlassen. Nun blickte sie sich um. Wo einst zwischen den kegeligen Hügeln das Vieh weidete und sie dem harten Land mit Mühsal ein karges Überleben abrang, herrschte ein unbeschreibliches Chaos aus Feuerströmen, Nebel, Rauch und Asche. Der Himmel war schwarz, und die Luft war erfüllt von Ascheflocken, als würde es schneien.
Zwei Kinder hatte sie zur Welt gebracht, beide waren noch im Kindesalter verstorben. Danach hatte sie keine Kinder mehr bekommen können, und sie hatten sich damit abgefunden, für ihren Hof keine Nachkommen zu haben. Aber wo war ihr Mann? Wo das Vieh?
Von irgendwo hörte sie ein Schaf brüllen, dann verstummte es jäh. Ein seltsamer Gestank lag in der Luft. Scharf und beißend. Noch nie gerochene Gerüche. Verzweifelt beschirmte sie ihre Augen, denn etwas verätzte ihr die Haut und ließ die Augen ungewöhnlich stark tränen. Kaum konnte sie etwas sehen. Was ging hier vor? Waren die alten Vulkane ausgebrochen? Das war doch zeit ihres Lebens noch nicht passiert!
Ein noch nie gehörtes Bersten und Krachen ließ sie herumfahren. Ein rot glühender Lavastrom wälzte sich durch ihr zerstörtes Haus. Das moosbewachsene Dach trieb noch einen Moment an der Oberfläche, dann versank es zischend im Fluss aus Feuer. Sigrun empfand Todesangst, doch die währte nur kurz. Es gab kein Entkommen. Unaufhaltsam wurde die Bäuerin von der Lavawalze verschluckt.
Einen Todesschrei hat die Welt von Sigrun Olafsdottir nicht mehr vernommen.
Teil I – Fimbulwinter
Donnerstag, 29. Hartung – Mittwoch, 4. Hornung 1784
1
Einmal begonnen, schien der Winter nicht wieder enden zu wollen.
Die Kälte war so unausweichlich wie der Tod. Schon im Sommer hatte sich auf unerklärliche Weise der Himmel verdunkelt. Die Ernte verdarb. Früh im Herbst waren die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gesunken. Eis und Schnee legten sich unheilvoll über das ganze Land und begruben Mensch und Natur unter sich. Ein schier ewiger Winterschlaf begann. Gott – so schien es – hatte die Menschen verlassen.
Im Hartung, dem ersten Monat des Jahreslaufs, wurden die Äpfel in den frostigen Vorratskammern schrumpelig und verfaulten. Dann gingen den Menschen die Vorräte aus, und das Vieh schrie vor Hunger in den Ställen. Die Eiseskälte lähmte auch noch vier Wochen später das ganze Land. Allmorgendlich blickten die Menschen aus ihren Fenstern und sahen: Nachts hatte es erneut geschneit, und der Winter trug wieder ein knitterfreies Kleid.
Mit bangem Hoffen und Gebeten wurde der Frühling erwartet. Doch nichts geschah. Wann würde es endlich tauen? Mit der Schmelze drohte auch die alljährliche Verdammnis, dass das Hochwasser die Städte an den deutschen Flüssen überflutete. Angesichts des schier ewigen Winters herrschte große Furcht vor der zu erwartenden Flut, dem Zorn Gottes.
Und so nahm ein gottloses Grauen die gebeutelten Menschen im Rheinland in seinen Bann. Ein Grauen, so schrecklich, dass es nirgends verzeichnet wurde.
Dies trug sich zu im Schmelzmond im Jahre des Herrn 1784. Auf ausgelassenes Maskentreiben folgte die schwerste Naturkatastrophe jener Menschenzeit.
2
Die junge Frau rannte, wie es ihre Beine hergaben. Schmerz und Grauen entstellten ihr verdrecktes Gesicht. Blonde Strähnen kamen unter ihrer Haube hervor, klebten auf den tränennassen rot gefärbten Wangen. Panisch blickte sie zurück zur Scheune, aus der sie eben entflohen war. Die Holzpantinen verfingen sich im Saum ihres Kleides. Es riss sie zu Boden. Im Schnee liegend, weinte die junge Frau herzzerreißend und laut. Von Todesangst getrieben, richtete sie sich wieder auf. Kaum achtete sie darauf, dass die Fetzen, die ihr Kleid, aus grobem Stoff gewebt, gewesen waren, sie nur notdürftig bedeckten. Dabei verlor sie einen Holzschuh. Barfuß setzte sie ihre Flucht fort.
Im Scheunentor, keine zwanzig Schritt hinter ihr, tauchte ein Mann auf. Er trug eine abgewetzte dunkelbraune Redingote. Ein krauser, ungepflegter Bart beschattete sein Gesicht, das im Dunkel des Tores kaum zu erkennen war. Der Dreispitz auf seinem Kopf war mit einem Federbusch verziert, dessen Rot kräftig leuchtete. Kaum war er im Tor aufgetaucht, richtete er den Lauf seines Gewehrs auf die Fliehende. Ebenso schnell erfolgte der Schuss. Sein Knall hallte weit durch das Tal.
Selbst für ungeübte Schützen wäre die junge Frau ein leichtes Ziel gewesen. Es blieb ihr keine Gelegenheit, Schutz zu suchen. Die Kugel bohrte sich in ihren Rücken. Die Wucht des Schusses ließ sie herumwirbeln, als risse eine unbekannte Macht mit aller Gewalt an ihr. Erneut stürzte sie in den Schnee. Dieses Mal stand sie nicht wieder auf.
Der Mann mit dem Federbusch spuckte verächtlich aus, dann verschwand er wieder im Dunkel der Scheune.
Henrik Freiherr van Venray, Amtmann für policeyliche Wohlfahrterei im Dienst des bergischen Herzogs, ließ das Fernrohr sinken. Kaum konnte er glauben, was er gerade mitansehen musste. Vielerlei Verbrechen hatte er in den langen Jahren als Amtmann erlebt, doch dieser feige Mord kam einer Hinrichtung gleich. Bis auf den Knall des Gewehrs war es lautlos und schnell vonstattengegangen. Das Weinen und Wimmern der jungen Magd hatte Venray in der Vergrößerung des Fernrohrs nur erahnen können.
Wütend legte er seine Muskete an. Doch anstatt zu schießen, besann er sich eines Besseren und löste langsam den Zeigefinger vom Abzug. Schließlich legte er das Gewehr ganz beiseite. Auf die Entfernung hätte er keinen Treffer erzielt. Außerdem hätte es dem Mann mit dem Federbusch seine Position und darüber hinaus die Anwesenheit der Policey verraten.
»Wir sehen uns noch«, presste Venray zwischen den Zähnen hervor. Grimmig biss er aufs Mundstück seiner Pfeife und drehte sich auf den Rücken. Er lag, hinter einer Schneewehe verborgen, auf einer Anhöhe im Wald oberhalb des Weilers, den er mit seinen Männern umstellt hatte, und sah in die blätterlosen Bäume über sich. Die dürren Äste griffen in den matten, wolkenverhangenen Himmel über dem Oberbergischen Land. Er blickte den Schwaden seines Atems hinterher. Zur Ruhe kam er nicht. Das Bild der ermordeten Magd würde er sein Lebtag nicht mehr vergessen.
Was ging nur in solchen Menschen vor? Was trieb Verbrecher an? Warum hatte der Federbusch einer davonlaufenden wehrlosen Frau in den Rücken geschossen? Welche unvorstellbar schlimme Tat müsste die junge Frau zuvor begangen haben, um diesen Schuss auch nur im Ansatz zu rechtfertigen? Venray versuchte, sich in die Gedankenwelt des Mörders zu versetzen, seine Beweggründe zu erforschen, die Hintergründe, die ihn zu dieser Tat angetrieben haben könnten, und stellte einmal mehr fest, dass es ihm nicht möglich war. Er war nicht willens. Er sah nur Feigheit und unnötige Brutalität darin. Und dagegen war er machtlos. Aber er konnte etwas anderes tun!
Entschlossen drehte sich Venray wieder auf den Bauch, spähte über den Rand der Wehe und betrachtete den unterhalb liegenden Bauernhof, um sich alles gut einzuprägen. Auf der gegenüberliegenden nördlichen Seite des Tals floss ein Bach, der Dhünn genannt wurde. Aufgrund des Schnees sah man das Gewässer nicht. Es gab das Gutshaus, eine mehrstöckige, große Wohnscheune, zwei kleinere Scheunen und Lager, ein Gebäude am Fluss, das eine Mühle sein konnte, sowie ein kleines Wohnhaus. Der Weiler mit seinen im Tal verstreuten Gebäuden sah an sich friedlich aus. Läge nicht mitten auf dem Hof eine halb nackte Frauenleiche, von deren Ermordung er, Venray, soeben Zeuge geworden war.
Eine unbekannte Anzahl marodierender Soldaten und anderes Gesindel hatten sich zu einer Räuberbande zusammengeschlossen. Seit Wochen zogen sie raubend und mordend durchs Bergische Land. Diese und andere sinnlose Gewalttaten mussten ein Ende haben, deshalb war Venray hier. Außerdem wurde es ihm in der Amtsstube oftmals einfach zu eng.
Fast zwei Klafter weit rutschte er die Schneewehe hinunter und stand kurz darauf zwischen seiner fünfzehnköpfigen Policeytruppe. Eine Schar aus Landreitern, Vögten, Bütteln und anderen Ordnungskräften, die er für diesen Einsatz rekrutiert hatte. Bis auf seine Landreiter wirkten die übrigen Männer, die alle aus der Umgebung kamen, nervös. Gewaltverbrecher zu stellen, die im Weiler die Gegend unsicher machten, war sonst nicht ihre Aufgabe. Dabei sah manch einer genauso hinterhältig und durchtrieben aus wie die Räuber, die sie jagten. Das traf nicht auf das Landreitercorps zu, das unter seinem direkten Befehl stand. Doch das Oberbergische galt als besonders rau und wild. Die Höfe waren abgelegen. Die Menschen blieben unter sich.
Insgesamt bestand das bergische Landreitercorps aus hundertfünfzig Reitern, die keine einheitliche Uniform trugen. Das Corps war paramilitärisch organisiert. Pferd und Waffen waren ihr höchstes Gut, der Herzog zahlte ein eher mageres Grundsalär. Einfache Soldaten, wie der junge Leutnant Carl, mussten sich durch Verhaftungen Geld dazuverdienen. Die Anfälligkeit für Bestechung oder andere Gefälligkeitsdienste war daher enorm hoch und ganz normale Praxis.
Landreiter Carl kam gerade mit verfrorenem Gesicht und in Begleitung eines anderen jungen Mannes auf ihn zu. »Der hier hat eine Frage an Euch, wenn Ihr erlaubt«, sagte er.
Von dem anderen wusste er, dass er Gerichtsdiener im oberbergischen Städtchen Altenberg war. Ihm nickte er auffordernd zu.
»Mit Verlaub, darf ich fragen, was habt Ihr gesehen, Euer Hochgeboren?«, sagte er.
»Wir nennen im Feld keine Titel«, entgegnete Venray hart, »oder willst du mich zur Zielscheibe machen?« Dann drückte er seinem Landreiter das Fernrohr in die Hand und sagte zu beiden: »Geht rauf und seht selbst! Kein schöner Anblick. Und haltet verdammt noch mal eure Köpfe unten!«
Der Gerichtsdiener blickte Venray überrascht an. Doch der Landreiter zog ihn mit sich und meinte: »Gaff den Kommandanten nicht so blöde an! Jetzt weißt du, warum ich so gern mit Venray reite.«
Der Gerichtsdiener nickte eifrig, froh darüber, dass ihr Kommandant ihnen diese Erlaubnis erteilt hatte. Augenblicklich robbten die zwei die Schneewehe hinauf und blickten über den Rand auf den Weiler.
Als sie kurz darauf wieder zurückkamen, bemerkte Venray den veränderten Gesichtsausdruck des Gerichtsdieners. »Du kommst aus der Gegend hier, nicht wahr? Kanntest du die Frau?«
Der junge Mann nickte stumm, die Tränen konnte er kaum beherrschen.
»Sprich!«
»Else war ihr Name. War Magd beim Ludwig. Auf dem Jahrmarkt hat sie allen Kerlen den Kopf verdreht.«
Er klang, als wäre er selbst einer der Kerle gewesen.
Räuber, Diebe und Soldaten, die sich zu Banden zusammentaten, gab es zuhauf. Doch dieser Verbrecherhaufen hier fiel durch seine gottlose Skrupellosigkeit auf. In einem Nest im Sauerland hatten sie eine Müllerin ermordet und kaum einen Stüber erbeutet. Anderenorts zwei Bauernburschen für ein bisschen Butter erdolcht. Nun hielt die Bande den Großbauern Ludwig, dem der Weiler unter ihnen gehörte, mit seiner Familie und dem Gesinde, insgesamt knapp zwanzig Personen, in ihrer Gewalt. Keiner wusste Genaueres.
Venrays Entschluss stand. Das Risiko war hoch, aber es musste gewagt werden. Vielleicht konnte er noch Leben retten. Sie mussten den Schutz der einbrechenden Dämmerung ausnutzen. Seinem Leutnant Winand Prins gab er das Zeichen zum Angriff. Nach langen Dienstjahren und viel Erfahrung verstand Prins seinen Befehlshaber nahezu wortlos.
»Ladet eure Karabiner«, erhob Leutnant Prins seine Stimme, um der Truppe Order zu erteilen. »Wenn wir unten den Wald verlassen, zieht die Handschuhe aus, damit ihr erst einmal besser zielen könnt. Eure Finger werden dann schnell eisig und taub, das wird euch beim Schießen behindern. Und denkt auch immer daran: Den anderen geht es nicht besser als euch, auch der Gegner friert! Jetzt legt die weißen Laken um. Macht euch bereit. Wir stürmen.«
Venray zog an seiner Pfeife, doch die war schon seit Stunden kalt. Der kalte Rauch schmeckte bitter. Venray vertrat die Überzeugung, dass eine Pfeife nahezu jederzeit geraucht werden konnte. Nur nicht eben dann, wenn man Gefahr lief, Räubern dadurch seine Anwesenheit zu verraten.
Noch heute Morgen hatte er am Ofen gesessen und Zeitung gelesen. Nun stand er im eisigen Nirgendwo im Angesicht eines bevorstehenden Gefechts mit ungewissem Ausgang. Egal, wie gut man sich vorbereitete, wie routiniert oder gar abgebrüht man darin war, in den Kampf zu ziehen, es gab keine Gewissheit, ob man das Ende dieser Auseinandersetzung erleben würde. Ob er sich jemals wieder einer guten Pfeife samt Lektüre erfreuen würde. Das war eines der ungeschriebenen Policeygesetze, das eigene Risiko, das man in Kauf nehmen musste. Oder ob er dieses Risiko sogar suchte? In diesem Moment aber dachte er wehmütig an den heutigen Morgen zurück.
Eine Zeitung ohne Pfeife, das kam nicht in Frage. Es war noch nicht ganz Mittag gewesen, aber es drang kaum Helligkeit in den dämmrigen Raum. Um besser lesen zu können, hatte Venray eine Kerze entzündet. Er hatte dem Knistern des Holzes im Ofen gelauscht und über den Rand seiner Zeitung aus dem Fenster hinausgeblickt. Eisblumen zierten die Scheiben. Auf dem Fensterbrett draußen hatten sich einige Fingerbreit Schnee gesammelt.
Venray rückte näher an den Ofen und genoss die wohlige Wärme. Er sog am Mundstück seiner Pfeife. Nichts geschah. Der Tabak war kalt. »Wittib«, zitierte Venray seinen Diener herbei.
Im Vorraum der Stube wurde ein Schleifgeräusch unterbrochen. Noch bevor sein Diener erschien, nahm Venray den Husten und den strengen Geruch des Alten wahr.
»Du weißt doch, wie sehr ich die kalte Pfeife hasse«, meinte er, als Wittib neben ihm auftauchte und eine frisch gestopfte Pfeife entzünden wollte. Der Alte hatte ein hochrotes fiebriges Gesicht. »Lasst, mein Guter«, sagte Venray wohlgesonnen, »ich rauche sie selbst an.«
Wortlos reichte Wittib seinem Herrn die Pfeife und nahm ihm die erkaltete ab. Dann entzündete er einen Kienspan im Ofen und reichte das brennende Holz seinem Herrn weiter. Venray paffte, bis sich dicke Schwaden in der Stube verteilen.
»Was ist das für ein entsetzliches Kraut?«, brachte der Freiherr hustend hervor.
»Oberbergische Wiesenkräuter«, erklärte Wittib.
»Willst du mich vergiften, Wittib?«
»Nur stückweise«, erwiderte der Alte, was Venray mit einem verblüfften Geschichtsausdruck quittierte.
Während Wittib die erkaltete Pfeife reinigte, erklärte er, dass er den guten Originaltabak aus Indonesien mit heimischen Kräutern vermengt habe. Grund dafür sei natürlich lediglich die dringend notwendige Sparsamkeit, nicht der Genuss. Denn der Tabak gehe – wie alles andere auch – aus, und man wisse nicht, wann oder ob überhaupt neuer nachgeliefert werde. Und bei der Menge Pfeifentabak, die der Amtmann tagtäglich in die Luft pustete, könne es zu einem ernsthaften Engpass kommen.
»Aber Euer Hochwohlgeboren meinen ja, ich wolle ihn vergiften«, maulte Wittib beleidigt weiter. »Kerzen bei Tag, den feinsten Tabak und was sonst noch – für Euch herrscht ja immer noch Überfluss.«
Venray ließ den Alten reden. »Ach, ein Bad und ein saftiger Braten«, tagträumte er dann, »das würde dir auch guttun.«
»Was?«
»Beides, vor allem aber wohl baden«, tadelte Venray seinen Diener.
»Euer Hochwohlgeboren können ja selber in den kalten Schnee springen.«
Nach einer Weile fuhr Wittib fort: »Ich habe schon mal gebadet, da hat Euer seliger Herr Vater, der Freiherr, noch in die Windeln geschissen.«
»So alt bist du nun auch wieder nicht«, presste Venray zwischen den Lippen hervor, ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen.
»Ihr müsst es ja wissen.«
»Wittib, weißt du, der Trick – wenn man das so nennen kann – beim Baden ist der, dass man es öfters macht, also um genau zu sein, regelmäßig und nicht bloß einmal.«
»Nein«, beharrte der Alte stur, »wie gesagt, ich habe es ausprobiert, dieses Baden ist nichts für mich.«
Venray blickte seinen Diener an, und um sich ein Lachen zu verkneifen, begann er damit, seine Zeitungen zu ordnen. »Was würde ich nur ohne dich tun, mein lieber Wittib.«
»Vermutlich genauso durch die Welt tingeln wie jetzt und Schnitzeljagd mit Halunken spielen, statt daheim in Düsseldorf im behaglichen Amtmannhaus zu speisen«, spielte sein Diener auf die gegenwärtige Situation an. »Ihr solltet endlich wieder heiraten und die Füße stillhalten. Der Jüngste seid Ihr auch nicht mehr«, belehrte Wittib seinen Herrn weiter.
»Nun ist es aber genug«, entgegnete Venray dem Alten, »du alter Murrkopf. Nicht schon wieder diese Leier.«
Auf seiner Räuberjagd hatte sich Venray mitsamt seiner kleinen Schar Landreiter im bergischen Odenthal im Haus des Pulvermachers Franziskus Thelen einquartiert. Thelens Schwarzpulver war über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Jederzeit erwartete Venray die Rückkehr seines Kundschafters, der ihm nähere Informationen zum Aufenthaltsort der Räuberbande bringen sollte.
Als Amtmann für gute Wohlfahrt war Venray für die öffentliche Ordnung und Sicherheit im gesamten Herzogtum Jülich-Berg zuständig. Die vereinten Herzogtümer Jülich und Berg unter ihrem Herzog Carl Theodor, der als Kurfürst auch die Pfalz und Bayern regierte, kesselten territorial die freie Reichsstadt Cöln von allen Seiten ein. Venrays Zuständigkeitsbereich erstreckte sich im Nordwesten vom Niederrhein nach Osten bis ins Sauerland und nach Süden weit über Bonn hinaus. Er kümmerte sich um eine Vielzahl von Gemeinden und Landkreisen. Daher war er auch viel unterwegs. Er war der höchste Policeybeamte im Herzogtum. Verbrecherjäger und Richter in einer Person. Nicht nur daran hätte Venray gerne Veränderungen vorgekommen. Im Rang über ihm stand – neben dem Herzog, Kurfürst Carl Theodor selbst – nur der Statthalter als der offizielle Vertreter des Herzogs: Hofrat Graf Melchior von Gollstein, Spross einer uralten Adelsfamilie. Der Graf hasste Veränderungen. Venrays Reformbemühungen waren ihm so willkommen wie eine tödliche Seuche. Die Abschaffung der alten Zeiten absoluter Willkür war in Venrays Augen längst überfällig, doch wann immer er mit Vorschlägen kam, winkte der Graf ab, egal ob er damit die Meinung des Herzogs vertrat oder nicht.
Wissenschaften und Vernunft waren dem Hofrat ein Graus. Mit großer Vorliebe trug er altmodische Perücken, momentan ließ er sich von einem niederländischen Maler im Hermelinmantel porträtieren. Dieses Vorrecht, weißen Pelz zu tragen, stand eigentlich nur dem Herzog in seiner Funktion als Kurfürst selbst zu, sprach aber Bände über Gollstein. Venray hatte bei seinem letzten Gespräch mit ihm einen Blick auf das noch unvollendete Werk werfen können. Eine gewisse Ähnlichkeit zum unlängst vom Herzog und Kurfürsten entstandenen Porträt desselben Malers konnte nicht geleugnet werden. Selbst der Wittelsbacher Hubertusorden sowie der Marschallstab durften auf dem Bildnis nicht fehlen. Dass er damit seine Befugnisse klar überschritt, kümmerte Graf Gollstein offenbar wenig.
Die Eitelkeit des Hofrats kannte keine Grenzen. Auf niemanden hätte die Bezeichnung »eitler Pfau« wohl besser gepasst. Gollstein bevorzugte gepuderte Perücken und schwelgte auch sonst gern im althergebrachten feudalen Prunk. Zwar ließ der Kurfürst seinem Statthalter bei vielen Fragen freie Hand, aber Venray wusste nur zu gut, dass beide nicht in allen Punkten einer Meinung waren. Denn Carl Theodor war durchaus bestrebt, Modernisierungen in seinem gesamten Fürstentum einzuführen.
Doch auch ohne ihn konnte Venray sowohl Recht ausüben als auch Urteile fällen. Der Herzog, sein Oberbefehlshaber, hatte ihn persönlich in das Amt des höchsten Policeyvertreters in seinem Herzogtum berufen. Kurioserweise hatte Venray tausend Reichstaler bezahlen müssen, um die Berufung antreten zu dürfen – auch für ihn war das eine beachtliche Investition. Ein solches Amt konnten nur diejenigen bekleiden, die über finanzielles Vermögen verfügten. Das alles schrie so sehr nach Reformen, dass es Venray immer öfter regelrecht schmerzte. Und das nicht nur, weil er Rousseau, Voltaire, Montesquieu oder die Werke des preußischen Völkerrechtlers Samuel von Pufendorf studiert hatte.
Venrays Lieblingszitat von Pufendorf war: »Der Mensch ist von höchster Würde, weil er eine Seele hat, die ausgezeichnet ist durch das Licht des Verstandes, durch die Fähigkeit, Dinge zu beurteilen und sich frei zu entscheiden, und die sich in vielen Künsten auskennt.« Das hatte dieser großartige Denker schon vor einhundert Jahren geschrieben. Die Monarchie und den deutschen Staat dagegen bezeichnete er als Monstrum. Und was war seitdem passiert? Veränderungen traten, wenn überhaupt, nur äußerst langsam ein. Generell gab es bei den Herrschenden, den weltlichen wie kirchlichen Fürsten, kaum ernsthaftes Interesse an sozialen Verbesserungen im Sinne der oft notleidenden Bevölkerung, gar nicht zu sprechen davon, für Gerechtigkeit zu sorgen. Es war einfacher, die zunehmende Verarmung zu verleugnen, als etwas dagegen zu unternehmen. Es war noch ein sehr weiter Weg, bis Reformen Fuß fassen konnten. Die Allmacht der Aristokratie war ungebrochen. Veränderungen auf Kosten des eigenen Wohlstands waren nahezu undenkbar. Wie der König von Frankreich vom ländlichen Versailles aus regierte, so bestimmte gleich ihm eine kleine Elite an Monarchen und Territorialfürsten von ihren luxuriösen Landgütern aus über das Schicksal der gesamten Welt!
»Ich liebe die Tat und die Tatsache«, begann Venray, und sein tadelnder Blick wanderte zum alten Wittib, doch dann brach er seine Ausführungen jäh ab. Kalter Schweiß stand auf der Stirn seines Dieners. Die Nase triefte, und die Wangen schienen zu glühen. Er fieberte. Sein Diener war krank, und was das in diesem Winter bedeutete, bereitete Venray augenblicklich Sorgen. »Setz dich zu mir und wärm dich.«
Das ließ sich Wittib nicht zweimal sagen und sackte auf eine Bank neben dem Ofen. Doch er ruhte nur kurz und holte aus seinem Umhang einen ellenlangen Parierdolch hervor, den er mit Geduld und Sorgfalt über einen Schleifstein zog. An den Schaft des Dolchs hatte man zwei Einkerbungen geschmiedet, die dazu dienten, die Klinge eines feindlichen Rapiers einzufangen und zu brechen.
Derweil vertiefte sich Venray wieder in seine Lektüre. Er überlegte, welchem Blatt er sich als Nächstes widmen sollte. Seine Wahl fiel auf ein Wochenblatt aus Cöln. »La Tribune Colonaise« war für ihren kaisertreuen Konservativismus bekannt. Venray las einen Artikel auf Französisch, der sich als ein reines Loblied auf Gottes Allmacht erwies: Güte und Allmacht des göttlichen Herrn seien auch dafür verantwortlich, Gerechtigkeit zu üben. Denn was sonst könnte Ursache für das sein, was die Menschen diesen Winter erlitten? Dieser besondere Winter drücke die besondere Schwere der Vergehen aus, die der Mensch büßen müsse. Man müsse beten, um den Winter zu beenden. Gottes Zorn – in Gestalt eines ewigen Winters – war gerecht. Arme und Mittellose litten besonders, während es bei den Reichen, Adligen und Kirchenfürsten oft genügte, sich einzuschränken.
Die Armen waren dieser Theorie folgend also die größten Sünder. Sie starben wie die Fliegen an Hunger und Krankheiten, was niemanden interessierte. Das meiste Unrecht aber wurde in Wahrheit durch Absprachen innerhalb der Obrigkeit begangen.
Der Verfasser war der Verleger selbst, der Cölner Papierfabrikant Johann-Nepomuk Dupois. Der fragwürdige religiöse Sermon riss nicht ab, und Venray legte die Zeitung kopfschüttelnd beiseite. Ein Minimum an Lesevergnügen sollte das Zeitungsstudium ja dann doch bereiten!
Auf Reisen wie in der Amtsstube waren diverse Zeitungen und Wochenblätter seine ständigen Begleiter. Er hielt mehrere Abonnements sogar von in Übersee erscheinenden Blättern. Sie verschlangen geradezu ein kleines Vermögen. Doch nichts hätte ihm das ausreden können. Die »Tribune Colonaise« war mit vier Reichstalern pro Jahr noch erschwinglich. Natürlich, die an dem kaiserlichen Hof in Wien orientierte »Tribune« spiegelte ganz das Bedürfnis ihrer Leserschaft in Cöln. Von aufklärerischen Gedanken wollte man dort nicht viel wissen. Doch Venray empfand Zeitungen, auch wenn sie nicht seine Meinungen und Auffassungen vertraten, als einen besonderen Gewinn des Fortschritts, da er so vieles an Nachrichten und Befindlichkeiten erfuhr.
Allerdings waren die Zeitungen seit Winterbeginn nur noch sehr unregelmäßig gekommen. Seit Jahresbeginn dann gar nicht mehr. Schon im November war der Postkutschenverkehr eingestellt worden. Das hieß, der gesamte Verkehr zu Land wie zu Wasser stand seit drei Monaten still.
Die »Amsterdamer Zeitung«, die Venray nun anstelle des Cölner Blattes zur Hand nahm, schätzte er besonders. Nicht nur, weil sie in seiner Muttersprache Niederländisch erschien und nicht wie sonst üblich auf Französisch, sondern vor allem widmeten sich die Redakteure der Zeitung besonders gern historischen und naturwissenschaftlichen Themen. Eine beständige Freude für sein wissensdurstiges Gehirn! Gab es eine neue Erfindung, eine Entdeckung oder eine kühne philosophische Theorie – die »Amsterdamer« berichtete mit Sicherheit darüber.
Neugierig blätterte er durch die Zeitung und blieb bei einem Bericht von einem amerikanischen Naturforscher namens Benjamin Franklin hängen. Franklin stellte einen Zusammenhang zwischen einem Vulkanausbruch auf Island im vergangenen Sommer und der veränderten Wetterlage her. Von Amerika bis Europa herrschte ein strenger Winter. Sogar aus Japan lagen Berichte über Missernten vor. Vor allem hatte es sich bei dem Vulkanausbruch nicht um einen einzigen Vulkan, sondern um Hunderte gehandelt.
Venray paffte und riss erstaunt die Augenbrauen hoch, während er jeden Satz des Artikels begierig verschlang. Die isländischen Laki-Krater waren noch nie zuvor ausgebrochen. Nun hatte diese Vulkankette im Südosten Islands ungeheure Mengen Asche und Staub in den Himmel geschleudert. Das schließlich habe den Himmel verdunkelt und das Wetter verändert, deshalb sah man seit dem Herbst die Sonne nicht mehr! Eine ebenso abenteuerliche wie gewagte Theorie! Beides gefiel Venray außerordentlich.
Die Klinge eines Dolchs schob sich Venray ins Gesichtsfeld und pikste durch das Zeitungspapier. Wittib!
»Pass doch auf«, meinte Venray, »am Ende spießt du mehr als ein paar Buchstaben auf!«
»Die müsste jetzt scharf sein«, murrte der Alte, dem selbst krank noch der Schalk im Nacken saß. »Schärfer, als wenn der Teufel selbst sie auf seinem Wetzstein im siebten Kreis der Hölle geschliffen hätte.«
»Du musst es ja wissen«, spottete Venray und überprüfte zufrieden die Klinge. »Deiner bissigen Zunge nach zu urteilen, warst du doch sicherlich schon dort.«
»Meiner Treu, spottet nur; wenn der Winter noch länger anhält, werde ich mit Sicherheit Gelegenheit bekommen, es für Euch herauszufinden.«
Im Vorraum wurde die Haustür geöffnet. Die Kälte drang wie eine Welle bis in die Stube vor. Stimmen erhoben sich. »Der Kundschafter ist zurück«, meinte Wittib.
Kurz darauf betrat ein Landreiter den Raum. Seine Kleidung war über und über verkrustet mit Eis und Schnee. Ohne zu fragen, stellte er sich an den Ofen und erstattete Rapport. Anfangs fror er so stark, dass er kaum sprechen konnte. Venray rückte beiseite, ließ den Mann gewähren und sich aufwärmen. Er hatte es wahrlich verdient.
Der Landreiter berichtete von einem kleiner Weiler, einen halben Tagesritt östlich gelegen, in dem sich die Räuberbande verschanzt haben musste. Näheres war nicht herauszufinden gewesen. Venray entließ den Kundschafter und dachte nach.
»Es ist so kalt, wie es in der Hölle heiß ist«, meinte Wittib. »Was belieben Euer Hochwohlgeboren zu befehlen?«
Venray paffte einige Male an seiner Pfeife. »Der Teufel hat viel zu schaffen in diesen Tagen«, sagte er und faltete die Zeitung zusammen. »Es ist Zeit, aufzubrechen.«
»Vergesst nicht, Ihr werdet dringend in Rheinmülheim erwartet.«
Venray, von Berufs wegen nicht nur Amtmann, sondern auch Wasserbauingenieur, war ausgeschickt worden, um in Mülheim am Rhein einen Deich zu errichten, der die prosperierende Stadt vor der drohenden Flut schützen sollte. »Das muss noch zwei Tage warten«, sagte er.
Wittib wollte sich ohne Verneigung entfernen, um die Befehle weiterzutragen, doch Venray hielt ihn auf. »Besorg mir weiße Bettlaken. Zwanzig Stück.«
Der Alte nickte und ging, um die Aufträge seines Herrn zu erledigen. Venray raffte sich auf und verließ das Haus des Pulvermachers.
Draußen griff ihn die Kälte an. Ein schneidender Wind drang innerhalb von Minuten durch sämtliche Kleidungsschichten und biss wie Nadelstiche in die Haut. Das Atmen tat beinahe weh, so kalt war die Luft, die in die Lunge drang. Venray holte ein kleines Messinstrument hervor und blickte auf ein mit Alkohol gefülltes Glasröhrchen.
»Bei Gott, vierzehn Grad Reaumur! Bleibt hier!«, bettelte Wittib, der sich zu ihm gesellt hatte.
»Und was ist mit denen, die unsere Hilfe brauchen?«, erwiderte Venray.
»Wir brauchen doch selber Hilfe!«
Venray blickte in das schniefende und von Fieber gerötete Gesicht seines Dieners. »Wittib, du bleibst hier und passt auf meine Pfeifen auf.«
»Aber –«, widersprach der Alte.
»Keine Widerrede jetzt!«
So zum Schweigen gebracht, reichte Wittib seinem Herrn eine Gugel, die Venray dankbar aufsetzte. Die fellbesetzte Kapuze mit Schulterüberwurf wärmte ihn. Es war ein längst aus der Mode gekommenes Kleidungsstück, das aber angesichts der Kälte einen überaus sinnvollen Nutzen hatte.
Die Männer des Corps trugen alles, was die Kleidertruhen hergaben. Manches davon wärmte, eine Lederschürze beispielsweise, anderes, wie der Dreispitz, eher nicht. Venray befahl ihnen, alle freien Körperteile wie Hände und Gesicht mit Tüchern oder in Streifen gerissenen Decken zu umwickeln. Ein Mann, der sonst als Bettelvogt dafür zuständig war, Bettler und Hausierer zu vertreiben, war gar barfüßig in den Holzpantinen erschienen. Der Mann würde Erfrierungen erleiden, und das konnte Venray nicht dulden. Er schickte ihn heim. Die Motivation, den Amtmann auf dem Ritt zu begleiten, war hoch. Denn Venray hatte den Leuten für jeden gefassten Räuber ein hohes Entgelt versprochen.
Er selbst war gut gerüstet. Alle seine Kleidungsstücke waren gefüttert. Er trug lange Wollunterwäsche und die Kleidung in mehreren Schichten. Über dem Rock eine mit Fell gefütterte Redingote, einen wadenlangen Reitermantel – ein sehr teures Kleidungsstück. Auch andere trugen eine Redingote, nur selten war sie wie bei Venray gefüttert. Zu guter Letzt bedeckte seine Gugel nun den Kopf und die Schultern. Die Kapuze gab ihm ein mönchisches Aussehen. Das Gesicht umwickelte er mit einem Wollschal. Die Hände steckten in Fäustlingen, die mit flauschigem Kaninchenfell gefüttert waren.
Den Pferden legte man bei langen Ritten, wie dem geplanten, grobe Decken über, damit die Tiere nicht zu sehr auskühlten. Aber das alles würde bei dem, was sie vorhatten, wenig nützen. Venray fror bereits jetzt. Wie würde es nach einem stundenlangen Ritt durch die Berge sein? Wasser konnten sie nicht mit sich führen, es begann innerhalb von Minuten zu gefrieren. Das Auftauen über dem Feuer dauerte ungleich länger. Aus ihm unerklärlichen Gründen war der frisch gefallene Schnee, über dem Feuer zu Trinkwasser aufgetaut, oft ungenießbar. Das Wasser schmeckte faulig, schwefelig, wurde aber oft genug trotzdem getrunken. Nicht selten führte es zu Durchfall, Erbrechen oder anderen Erkrankungen.
Es dauerte noch einige Zeit, bis Venray aufsitzen und den Befehl zum Aufbruch geben konnte. Dann endlich setzte sich die sechzehnköpfige bunt gemischte Truppe aus Bütteln, Landreitern und anderen Ordnungskräften samt ihren drei Lastenmaultieren in Bewegung. Die Führung übernahm der Kundschafter, der sich in der Gegend gut auskannte, dicht gefolgt von Venray. Die Pferde waren unruhig, sie spürten die Anspannung ihrer Reiter, und blieben es im Grunde den ganzen Weg über.
Die Wege durch das Bergische Land waren steil und eng, der Wald dicht, und wenn sie von Nadelbäumen umgeben waren, drang kaum Tageslicht zu ihnen. Die Pferde fassten auf dem eisigen Untergrund schlecht Tritt. Oft rutschten oder scheuten sie, weshalb Venray befahl, größere Abstände zwischen den Reitern zu lassen. So zog sich der Treck über eine beachtliche Strecke, und oft war Venray längst um die Biegung einer Serpentine geritten, da hatte der letzte Reiter die vorhergehende noch nicht passiert. Die bereits im Sommer kaum für einen Wagen befahrbaren Wege durch unwirtliches Hinterland wurden nun zu halsbrecherischen Pfaden.
Hin und wieder hielt der gesamte Trupp an, weil die Pferde geführt werden mussten. Das kostete wertvolle Zeit. Aus einem Halbtagesritt wurde ein Gewaltmarsch. In manches Tal führte ein derartig steiler Pfad, dass sie die Pferde nur einzeln hinabführen konnten. Kaum einer der Männer murrte, vornehmlich wohl deshalb, weil der Amtmann bei ihnen war und die gleichen Strapazen erduldete wie sie selbst.
Wenige Augenblicke nachdem Venray eine Talsohle durchquert hatte, entstand Lärm hinter ihm. Ein Pferd war ins Leere getreten. Ross und Reiter stürzten drei, vier Klafter tief und schlugen auf dem Grund der Schlucht auf. Die Verunglückten versanken im Schnee. Venray sah noch ein Zucken der Hufe, das genauso urplötzlich erstarb, wie sich der schreckliche Sturz ereignet hatte. Zwei hinabsteigende Männer konnten nur noch den Tod feststellen.
Venray stieg ab und ging zurück, um die Ursache des Unglücks zu erkunden. Unter der Schneedecke befand sich eine schmale Brücke. Eine Brücke ohne Geländer! Das Pferd war danebengetreten und deshalb gestürzt. Es hätte jedem anderen genauso passieren können. Nur mit Glück hatte er selbst die Brücke getroffen, als er die Stelle zuvor passiert hatte. Er ließ die Brücke mit Ästen markieren, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholte. Die Stimmung war gedrückt. Sie hatten einen Mann verloren.
Erst nach vielen Stunden erreichten sie den Weiler. Lange beobachtete Venray den Hof von der Schneewehe aus. Dann hatte sich der Mord an der jungen Magd ereignet. Ein längeres Zögern war auch allein deshalb nicht mehr möglich, weil die Männer des Trupps durchgefroren waren und sich der Tag dem Ende zuneigte.
Die mit weißen Bettlaken getarnten Männer des Policeytrupps pirschten wie Schneegeister durch den Wald ins Tal hinab. Die Pferde blieben angebunden oben im Wald zurück.
Das schwindende Tageslicht wie auch die Tücher boten ihnen Schutz. Dennoch waren sie entdeckt worden, denn kaum erreichten sie unten den Waldrand und verließen die Deckung des Waldes, um auf die freie Fläche vor der Hofanlage zu treten, da wurde das Feuer auf sie eröffnet. Die Männer duckten sich im Schnee. Venray zählte siebzehn Schüsse, bis Ruhe einsetzte. Folglich mussten sie mit mindestens siebzehn Gewehren rechnen. Dass es genauso viele Schützen waren, musste man zumindest annehmen. Demnach war er mit seiner Mannschaft in der Unterzahl. Natürlich konnte ein Schütze zwei oder gar mehrere Gewehre hintereinander abfeuern. Sehr viel länger dauerte das Nachladen der Vorderlader.
Ein großer Teil der Schüsse war in die Äste über ihnen gekracht. Das war ein Anzeichen dafür, dass die Schützen nicht genau wussten, wo sich ihre Ziele aufhielten. Er hätte den Schießbefehl so nicht erteilt, sondern gewartet, bis sie näher herangekommen wären und eine wandelnde Zielscheibe darstellten. Doch Venray unterschätzte seinen Gegner nicht. Momentan war ihre Tarnung noch ein Vorteil, was sich aber schnell ändern konnte, wenn sie das Feuer erwiderten und somit ihre Positionen preisgaben. Sie wussten nichts über ihren Gegner, und da war es ratsam, besonders vorsichtig zu agieren. Immerhin hatte man seine Leute sehr viel früher entdeckt, als Venray gehofft hatte.
Er schätzte, dass sie ungefähr eine Minute hatten, bis der erste Schütze nachgeladen hatte und erneut schießen würde. Rasch teilte er den Trupp in drei Gruppen ein und trieb die Männer angesichts der äußerst knappen Zeit zur höchsten Eile an. Die erste Gruppe sollte die Mühle am Bach durchsuchen, die zweite Gruppe nahm sich die beiden Scheunen und Ställe zur Linken vor, er selbst eilte mit drei seiner Untergebenen, darunter der Landreiter Carl und der Gerichtsdiener aus Altenberg, auf das unmittelbar vor ihm liegende kleinere der beiden Wohnhäuser des Weilers zu – eine einstöckige Bauernkate mit kleiner Stallung im Erdgeschoss. Eine enge, niedrige Tür teilte das Fachwerkgebäude in zwei Hälften. Links neben der Tür stand unterhalb von zwei kleinen Fenstern eine Bank, auf der sich der Schnee türmte.
Venray rannte los, doch als sie das freie Feld verließen und eine Streuobstwiese mit dürren Apfel- und Birnbäumen betraten, veränderte sich der Schnee unter ihren Füßen. Weicher Pulverschnee ließ sie fast hüfttief versinken. Mittlerweile waren sie dem Bauernhaus so nah, da half auch keine Tarnung mehr. Damit saßen sie wie auf dem Präsentierteller.
Venray sah einen Lauf aus der Tür herausgucken und hatte gerade noch Zeit genug, seine Männer zu warnen. Die zweite Salve Gewehrschüsse kam sehr viel gezielter. Nur knapp verfehlte eine Kugel Venray, der sich tief in den Schnee drückte. Einer seiner Männer hatte nicht so viel Glück. Jetzt eröffnete sich vermutlich ihre allerletzte Chance, die Situation zu ihren Gunsten zu entscheiden. Zwar waren die Banditen im Haus deutlich besser geschützt und damit generell im Vorteil. Doch wenn sie es schafften, die Kate zu erreichen, bevor die Räuber nachgeladen hatten, würden sie die Männer in einem schutzlosen Augenblick überraschen.
Es waren kaum mehr als vier Wagenlängen bis zum Haus. Venray sputete sich, so schnell es der tiefe Schnee eben zuließ. Doch es kostete Zeit und Kraft. Seine Augen ruhten stets auf dem Bauernhaus. Als er im Schatten der Haustür eine Bewegung wahrnahm, schoss er mit der Flinte und erzielte einen Treffer. Der Leichnam eines Räubers kippte aus dem Türrahmen vorwärts in den Schnee. Venray zog seine Pistolen. Nur noch eine Wagenlänge und er hatte es geschafft.
Am Haus angekommen, richtete er die vorgehaltenen Waffen in den Gang, sah aber nur noch, wie zwei im Dämmerlicht des Flurs kaum erkennbare Gestalten auf der anderen Seite des Hauses zur Vordertür hinausflohen. Venray feuerte beide Pistolen ab, traf aber nur die Türpfosten. Er fluchte und drückte sich an die Hauswand, um seine Männer nachrücken zu lassen.
Landreiter Carl schob sich geduckt durch den dichten Schnee und drückte Venray die nachgeladene Flinte in die Hand. Gleichzeitig nahm er ihm die Pistolen ab, um auch die wieder schussbereit zu machen. Carl war flink. Und in den Augen des jungen Gerichtsdieners brannte das Feuer der Rache. Sie waren nur noch zu dritt. Ihr vierter Mann lag tödlich verwundet auf der Wiese im Schnee.
Mit den Waffen im Anschlag arbeitete sich der kleine Trupp weiter in den schmalen Flur des Hauses vor. Links von ihnen im halb offenen Stall raschelte etwas – drei Gewehrläufe richteten sich auf einen abgemagerten Ziegenbock. Nur kurz atmeten sie auf, denn dichter Qualm drang nun aus einem Raum auf den Gang. Die Räuber hatten Feuer gelegt. Venray befahl seinen Männern, das Feuer zu löschen. Er selbst erklomm die schmale Stiege, schon eher eine Leiter als eine Treppe, hinauf ins obere Geschoss.
Den Treppenabsatz hielt er dabei im Visier. Er war noch nicht ganz oben angekommen, da sah er bereits den ersten Toten. Mitten auf dem Gang lag ein alter Mann inmitten einer längst getrockneten Blutlache. Die Hände waren dem Alten auf den Rücken gefesselt. Ein feiger Akt purer Grausamkeit.
Venray musste über den Toten hinwegsteigen, um die anderen Räume durchsuchen zu können. Auf der oberen Etage gab es vier winzige Räumchen, allesamt Schlafkammern, die so niedrig waren, dass er nur gebückt stehen konnte. In den vorderen Räumen entdeckte er drei weitere Leichen. Eine ältere Frau sowie eine Frau und einen Mann in Carls Alter. Anfang zwanzig. Vermutlich eine weitere Magd und ein Knecht des Bauern. Im letzten Raum jedoch verschlug es ihm vollends die Sprache. In der Schlafkammer lagen zwei Kinder, beide erschossen, vor dem Bett ihrer Eltern, die darin lagen. Die Mutter geschändet und mit durchgeschnittener Kehle, dem Mann steckte ein Dolch bis zum Schaft in der Brust. Ein Massaker. Sinnlos und unerklärlich brutal. Was konnte es anderes sein als die pure Lust, zu töten?
Unterhalb des schmalen Fensters, kaum größer als eine Schießscharte, sah er eine Wiege stehen. Mit zitternden Fingern bewegte er sich darauf zu. Er kam dem Fenster immer näher und musste schließlich nachschauen. Venray fand seine schlimmste Befürchtung bestätigt. Ein Säugling lag darin. Das zarte Gesichtchen des kleinen Geschöpfes zeigte die blaugraue Verfärbung der Erfrierung.
Er konnte nicht fassen, was er hier zu sehen bekam. Und kaum konnte er glauben, was dieses sinnlose Massaker in ihm auslöste. Ein alter Schmerz, an den er sich schon fast gewöhnt hatte, brach mit ungeahnter Heftigkeit erneut hervor.
In diesem Moment zersplitterte das Fensterglas, keine Armlänge von ihm entfernt. Ein Bolzen blieb dicht neben seiner Schläfe in der Wand stecken, sodass Venray sogar die Holzmaserung im Schaft des Geschosses erkennen konnte. Rasch spähte er nach draußen, um den Schützen zu suchen, und fand ihn in einer unverglasten Fensteröffnung im gegenüberliegenden Bauernhaus in der dritten Etage. Das musste der Heuboden sein, der sich über das gesamte Gebäude erstreckte. Er sah eine Bewegung, aber es war zu spät, um das Feuer zu erwidern. Der Armbrustschütze war längst wieder in Deckung gegangen.
»Bastarde«, fluchte Venray wutentbrannt. »Verdammte Bastarde!«
Hinter ihm betraten seine Landreiter den Raum. Die Männer bekreuzigten sich angesichts des Schreckens, den sie hier erblickten. Carl pflanzte mit wilder Miene das Bajonett auf sein Gewehr. Venray kannte den entschlossenen Geschichtsausdruck nur zu gut. Fühlte er doch ähnlich. Jedoch verleitete ein überhitztes Gemüt oftmals zu Fehleinschätzungen und leichtsinnigen Kampfaktionen.
Venray wollte sich eben wieder nach unten wenden, als er von draußen einen Schuss hörte, der rasch erwidert wurde. Eine wilde Schießerei folgte. Durch das Fenster beobachtete er, wie die anderen Abteilungen seines Corps von der nördlich gelegen Mühle und Scheune aus eine achtköpfige Räuberschar Richtung Haupthaus trieben. Dabei leisteten die flüchtenden Räuber erbitterten Widerstand und erhielten Unterstützung aus dem Haupthaus. Die Leiche der Magd lag unberührt an derselben Stelle wie zuvor, mitten auf dem Hof. Fünf Räuber lagen ebenfalls tot im Schnee, aber auch sein Corps verzeichnete Verluste.
Aus allen Löchern und Fenstern des Bauernhauses wurde gefeuert. Der Mann mit dem Federbusch und der Armbrustschütze suchten den offenen Kampf und traten ins Freie. Der Federbusch tötete innerhalb weniger Augenblicke einen Gerichtsdiener mit einem Kopfschuss, und einem Büttel trieb er den Säbel in den Bauch. Der Mann war kampferprobt. Sicherlich ein ehemaliger Soldat.
Genau wie der Bandit mit der Armbrust. Zwar war die Waffe aus der Mode gekommen, wurde aber immer noch bei vielen Regimentern und vor allem bei Freischärlern aufgrund ihrer Präzision und enormen Wirksamkeit bei nahezu lautlosem Einsatz abgefeuert. Was auch der Schütze im Hof unter Beweis stellte. Innerhalb weniger Augenblicke hatte er drei Bolzen durch die Luft schwirren lassen. Allerdings setzte die Kälte anscheinend dem Material zu, was sich auf die Treffsicherheit auswirkte. Die Geschosse verfehlten ihre Ziele.
Venray war erleichtert, legte an und erwiderte das Feuer. Er traf nur die Armbrust, nicht den überraschten Schützen. Aber immerhin war die Waffe nun unbrauchbar. Die Räuber zogen sich zurück ins Bauernhaus und schlossen das große Scheunentor. Venray wusste, sie mussten jetzt den Angriff fortsetzen und das Haus überrennen. Die Räuber sollten keine Gelegenheit haben, sich neu aufzustellen.
Während er in Begleitung seiner Landreiter ins Freie trat und auf das Bauernhaus zustürmte, erhielten sie Schützendeckung durch Gewehrsalven des übrigen Corps unter seinem Leutnant Prins, die noch etwas weiter entfernt waren, aber nun nachrückten.
Wie im Bergischen Land üblich, war das Haupthaus des Weilers ein großer Bau, der Scheune, Stall und Wohnhaus in sich vereinte. Die Mauern bestanden aus mindestens zwei Klafter hohen Natursteinen, die weiß gekalkt waren. Darauf waren eine weitere Etage aus Fachwerk sowie das Reetdach gesetzt. Oberhalb des Scheunentors hatte man eine kleine Luke in den weiß gekalkten Mauerstein gelassen, aus der vorhin einer der Räuber einen Schuss abgefeuert hatte. Im Laufen zielte Venray mit den Pistolen auf die Luke und feuerte. Eine kleine Tür weiter rechts, nicht viel mehr als einen Klafter weit entfernt vom großen Scheunentor, war ihr Ziel. Dort wollte Venray ins Haus eindringen.
Zu zweit warfen sie sich gegen die Holztür, die glücklicherweise sogar nachgab. Venray landete mit einem Landreiter neben sich auf dem staubigen Steinboden im Inneren. Sie waren in der offenen Werkstatt. Hämmer, Äxte, Hacken und Piken lehnten an den Außenwänden. Innen war das Fachwerk nicht zugemauert.
Der nachrückende Gerichtsdiener beugte sich durch die Türöffnung in die Werkstatt und feuerte über die Tenne hinweg in die gegenüberliegende Nische, dann duckte er sich, um nachzuladen. Diese Zeit nutzten die Räuber, die sich dort verschanzt hielten, und erwiderten das Feuer. Eine Salve von drei Kugeln schlug in die Holzbalken. Die anschließende Feuerpause nutzte Venray, um durch das offene Gebälk zu spähen und sich bessere Orientierung zu verschaffen.
Das geräumige Speichergebäude war dreigeteilt. Auf der linken Seite, wo sich die Räuber verschanzt hatten, lagen die Stallungen, in der Mitte befand sich die Tenne, eine Wagenhalle mit steinernem Boden, und rechts die Werkstätten, wo Venray mit seinen Männern hockte. Mitten auf der Tenne standen ein Leiterwagen, ein Ochsenkarren und mehrere Heukarren. Ein Teil der Gerätschaften war zerschlagen worden. Zertrümmert boten sie ein besonders beunruhigendes Bild der Verwahrlosung. Wieso hatte man die Karren zertrümmert? War der Räuberbande das Feuerholz ausgegangen?
Im Dunkel der gegenüberliegenden Stallung erspähte Venray eine Bewegung. Sofort feuerte er in die Richtung, seine Begleiter schossen ebenfalls. Um nachzuladen, gingen sie hinter einer Brüstung in Deckung. Die Räuber nutzten nun ihrerseits die Gelegenheit und versuchten, über die Tenne zu den hinteren Wohnbereichen des Hauses zu entkommen. Ihre Fußtritte verrieten sie, sehen konnte man kaum mehr als Schatten.
Anders als Venray war Carl längst mit dem Nachladen fertig. Darin war er sehr geschickt. Urplötzlich sprang der junge Landreiter auf und wagte einen Ausfall. Das war nicht abgesprochen, doch Venray blieb keine Zeit, zu fluchen. Mit einem lauten Schrei griff Carl an und trieb dem letzten Räuber das Bajonett in die Seite. Der Mann war sofort tot. Carl schoss auf den fliehenden zweiten Mann, traf aber nur die Schulter.
Mit abgefeuerter Waffe war Carl angreifbar. Prompt tauchte der Mann mit dem Federbusch am Hut hinter dem Heuwagen auf und holte zu einem gewaltigen Streich aus. Fieberhaft beeilte sich Venray, seinen Ladevorgang zu beenden. Es ging um Sekunden. Kaum hatte er das Pulver auf die Pfanne geschüttet und entzündet, da feuerte er auch schon aus der Deckung der Werkstatt in Richtung des Angreifers. Zwar traf sein Schuss nicht den Mann mit dem Federbusch, wehrte dennoch dessen Streich ab, der Carl getötet hätte. Zum erneuten Nachladen war keine Zeit mehr, und der Gerichtsdiener stocherte noch mit dem Ladestock im Lauf seiner Waffe herum. Ihm fehlte eindeutig die Übung. Venray sprang über die Brüstung, die die Tenne von der Werkstatt trennte, und setzte dem Federbusch nach, der irgendwo im Dunkel des hinteren Wohnbereichs verschwand. Er zog Säbel und Parierdolch und arbeitete sich mit höchster Wachsamkeit vor.
Auf Höhe des Heuwagens sprang ein Schatten auf ihn herab. Venray wurde zu Boden geworfen. Der Angreifer lag direkt auf ihm. Es entstand ein Gerangel, sie wälzten sich über den Boden. Auch Carl war angegriffen worden und befand sich in ähnlicher Situation. Der Gerichtsdiener rückte derweil mit neu geladenem Gewehr vor, konnte aber nicht schießen oder zustoßen, ohne Gefahr zu laufen, die eigenen Leute zu treffen.
Venray blickte in den zahnlosen Schlund seines Angreifers. Er erkannte den Armbrustschützen. Der Mann kämpfte mit todesmutiger Entschlossenheit, der Hirschtöter in seiner Rechten wanderte bedrohlich nah auf Venrays Gesicht zu. Dolch und Säbel hatte er beim Sturz fallen gelassen, um die Hände frei für den Nahkampf zu haben. Jetzt war seine letzte Chance, das eigene Jagdmesser im Stiefelschacht zu erreichen.
Mit einer ruckartigen Bewegung schaffte er es, den auf ihm liegenden Angreifer abzuschütteln. Dann rollte er beiseite, griff in seinen Stiefel, zog das darin verborgene Waidmesser hervor, umklammerte mit beiden Händen den Schaft und warf sich mit voller Wucht auf den Armbrustschützen. Das Metall knirschte, als die Spitze seines Waidmessers auf dem Rücken des Mannes wieder herausdrang und über den Steinboden strich. Doch der Armbrustschütze war noch nicht tot. Er wehrte sich. Venray blickte sich um und sah seinen Parierdolch, konnte ihn jedoch nicht erreichen. Es entstand ein Hin und Her, das jäh unterbrochen wurde, als ein Bajonett in der Brust des Armbrustschützen versenkt wurde. Venray blickte hoch, der Gerichtsdiener war ihm zu Hilfe geeilt.
Weitere Kampfgeräusche lenkten die Aufmerksamkeit auf sich. Carl rang mit dem Räuber, der ihn angegriffen hatte. Beherzt zog der Gerichtsdiener das Bajonett aus der Brust des toten Armbrustschützen und eilte seinem Freund zu Hilfe, indem er es diesmal im Leib von Carls Gegner versenkte. Venray konnte sich nur zu gut denken, was ihn antrieb. Vielleicht war die getötete Magd, die immer noch draußen im kalten Schnee lag, mehr als nur eine Kirmesbekanntschaft gewesen.
Wo sich der Rest der Bande versteckte, war unklar. Sie mussten das gesamte Haus von unten nach oben vollständig durchsuchen. Überall lauerte die Gefahr, in einen Hinterhalt wie gerade eben zu geraten. Im Wohntrakt hinter der Scheune lagen zwei Stockwerke über ihnen, die durchsucht werden mussten. Es gab unzählige Winkel, Türen und Ecken. Dazu kam beständige Dunkelheit, denn hier brannte nirgendwo ein Feuer. Warum die Räuber das Feuer hatten ausgehen lassen, erschloss sich Venray nicht. Fenster waren, so überhaupt vorhanden, klein und ließen auch am Tag nur wenig Helligkeit herein. Und mittlerweile wurde es dunkel draußen.
Unmittelbar hinter dem Heuwagen öffnete sich die Tenne zu einem langen Flur, der über die gesamte Breite des Hauses reichte. Dieser Flur stellte die räumliche Trennung zwischen Scheune und Wohnung dar. Jeweils am Ende des Flurs gab es Türen, die ins Freie führten. Beide Türen standen offen. Verdammt, die hatte Venray übersehen, ein Teil der Bande war sicherlich nach draußen entkommen. Nur gut, dass dort weitere Policeykräfte warteten, denen sie vermutlich in die Arme laufen würden. Kaum gedacht, hörte er draußen Schüsse. Der Ring, den sie um die Räuberbande gelegt hatten, zog sich immer enger.
An der Wand in der Mitte des Flurs befand sich eine große Feuerstelle, die normalerweise als Küche diente. Die Wand oberhalb des erloschenen Feuers war pechschwarz vom Ruß. Fast hätte man meinen können, es sei ein Loch oder ein Eingang, der irgendwo in die Tiefen des Erdreichs führte. Der Boden war teilweise mit Stroh bedeckt, das schon seit Ewigkeiten nicht mehr erneuert worden war. Im spärlichen Licht der Abenddämmerung, das einzig durch die offenen Türen hereinfiel, erkannte Venray Holzbottiche, Kochtöpfe aus Kupfer und andere Kessel, die wahllos verstreut herumlagen. Im Stroh sah er Essensreste und Knochen. Es roch erbärmlich nach Verwesung, und das, obwohl die Kälte den Geruch dämpfte. Venray musste sich instinktiv die Nase zuhalten, sonst hätte er sich übergeben. Links und rechts der Feuerstelle führten Türen in die guten Wohnstuben der Bauern. Es widerstrebte ihm zutiefst, dort einzutreten.
Und tatsächlich bot sich ihnen dort ein ähnlich verstörender Anblick wie zuvor im kleinen Bauernhaus. Egal ob alt oder jung, sämtliche Bewohner waren gemeuchelt worden. Die Abscheulichkeit des Verbrechens machte Venray erst sprachlos, dann tobte wilder Zorn in ihm.
Aus einer verborgenen Bodennische, vermutlich einer Kellertreppe, erfolgte ein Schuss. Die Kugel traf den Gerichtsdiener am Kopf. Der junge Mann war augenblicklich tot. Fast zeitgleich erfolgte ein kurzer heftiger Angriff eines Räubers. Carl, dem der Angriff galt, wehrte sich tapfer, aber es brauchte nur zwei Streiche, um ihn außer Gefecht zu setzen. Er hatte eine üble Verletzung am Bein und ging zu Boden. Wenn er nicht bald versorgt würde, würde der Landreiter verbluten.
Die Pulverwolke vernebelte den Gang und behinderte seine Sicht. Dennoch konnte Venray den Angreifer jetzt erkennen. Es war der Mann mit dem Federbusch am Hut. Dieser Teufel hatte wahrlich genug Unheil angerichtet! Der Mann floh nach draußen, und Venray setzte ihm nach, entschlossen, ihn endgültig zur Rechenschaft zu ziehen.
Mit einem Sprung hechtete Venray ins Freie. Und er tat gut daran, denn kaum war er in der Türöffnung erschienen, wurde ein Pistolenschuss auf ihn abgefeuert. Im Schnee liegend, schoss Venray zurück. Nun hätte er nachladen müssen, um für eine Verfolgung Schusswaffen zur Verfügung zu haben. Doch das war viel zu umständlich und würde dem Federbusch einen enormen Vorsprung verschaffen. Er ließ die Waffen liegen und zog im Laufen seinen Säbel. Der Räuber mit dem roten Federbusch am Hut floh in südlicher Richtung. Er wollte wohl über die zugefrorene Dhünn in den Wald entkommen. Aber bald musste er erkennen, dass seine Flucht ausweglos war. Wie Venray zuvor auf der Streuobstwiese versank auch er nun im hüfttiefen Schnee. Hier befand sich der Garten des Bauernhofs, dessen Beete unter tiefen Schneeschichten begraben lagen.
Wild entschlossen drehte sich der Federbusch um und stellte sich Venray entgegen. Demonstrativ warf er die eben noch abgefeuerten schweren Kavalleriepistolen beiseite, zog Säbel und Parierdolch und forderte zum Duell heraus. Venray, der sonst dem Vergeltungszweikampf aus dem Weg ging, ließ sich nicht zweimal bitten. Beiden Männern war klar, dass es für einen von ihnen das letzte Gefecht sein würde.
Hieb folgte auf Hieb. Der Federbusch schlug mit solch enormer Kraft und Schnelligkeit auf Venray ein, dass er sofort erkannte: Dieser Mann war kein guter Fechter. Er war exzellent! Selbstbewusst und siegessicher. Auf jeden gewaltigen Hieb folgte ein rascher Stoß. Die Klingen schwirrten durch die Luft und sangen in hohen Tönen.
Venray kam bereits nach wenigen Augenblicken zu der bitteren Erkenntnis, dass sein Gegner ihm haushoch überlegen war. Der Federbusch verfügte über eine einzigartige Kampftechnik, die Venray nur von einigen Kürassierregimentern kannte. Der Mann vor ihm war sicherlich ein ehemaliger Angehöriger eines solchen Regiments. Was trieb einen guten Soldaten dazu, ein skrupelloser Räuber und Mörder zu werden? Hunger, Elend und Neid. Denn ein einfacher Mann konnte niemals zum Offizier aufsteigen, egal wie gut er auch war. Der Offiziersrang war einzig Adligen wie ihm, Venray, vorbehalten.
Zu mehr als Paraden kam er nicht. Die Finger wurden taub. Venray befürchtete, er könnte die Waffen verlieren oder aus den Händen geschlagen bekommen. Seine Kräfte schwanden, er wich zurück. Es war eine Frage von wenigen Augenblicken, er musste nur ein einziges Mal zu langsam reagieren, und er würde die Klinge des Gegners spüren. Gnadenlos.
Schweiß lief ihm in die Augen, gleichzeitig biss ihm der kalte Wind in die Finger. Als er einmal dazu kam, einen eigenen Angriff auszuführen, fing sein Gegner geradezu mit Leichtigkeit den Säbel in seinen Klingenfängern und verpasste dem Metall einen gewaltigen, hörbaren Knacks. Zwar gelang es Venray, seinen Säbel zu befreien, aber derartig geschwächt konnte die Klinge bei jedem neuen Hieb brechen. Er zog sich zurück. Dieses Duell konnte er nicht gewinnen. Er konnte von großem Glück sprechen, wenn er es überhaupt überleben würde.
Beim langsamen Rückzug stolperte er über einen unter dem Schnee versteckten Stein, wohl eine Beetbegrenzung im Garten. Es konnte auch ein auf dem Beet vergessener hart gefrorener Kohlkopf sein. Venray verlor seinen Säbel. Er wähnte den Kampf verloren.
Doch die Entscheidung fiel schneller, als man mit den Fingern schnippen konnte. Denn dieser unglückliche Sturz rettete ihm das Leben. Im Angesicht des fallenden Venray beging sein Gegner einen hochmütigen Fehler. Er wähnte sich als Sieger und wäre es wohl auch geworden, wenn er nicht die besonderen Wetterumstände außer Acht gelassen hätte. Der Federbusch holte weit aus, um Venray mit einem gewaltigen Streich zu erlegen. Zu weit. Bei normalem Wetter hätte er die Bodenhaftung gefunden, die sein Schlag benötigte, doch er musste auf eine eisige Stelle getreten sein. Er rutschte aus und fiel vorwärts direkt in Venrays Dolch.
Doch der Kampf war noch nicht vorbei. Der Federbusch gab sich nicht geschlagen. Er lag auf Venray und brüllte ihn an wie ein entfesseltes Raubtier, das keine Gnade kannte. Mit dem Dolch wollte er auf seinen Kopf einstechen, traf aber nur den Schnee. Venrays eigener Dolch saß fest im Leib des anderen, den die Verletzung langsam schwächte. Ihm gelang es, den Federbusch von sich zu wälzen und sein Jagdmesser zu ziehen.
Ein letzter Stoß und es war entschieden. Venrays Klinge fuhr dem Federbusch unter dem Kinn bis in den Schädel. Im Augenblick seines Todes öffnete der Federbusch mit einem seltsam röchelnden Geräusch den Mund. Venray konnte das Messer darin erblicken. Der Räuber bäumte sich nochmals auf und fiel dann seitwärts in den Schnee.
Erschöpft wandte sich Venray ab. Am liebsten wäre er einfach liegen geblieben. Aber der Schnee war viel zu kalt. Er erhob sich, sammelte seinen Säbel ein und ging. Den Mörder würdigte er keines einzigen Blickes mehr.
Schon nach wenigen Schritten holte ihn die Erschöpfung ein. Erst setzte Venray noch zwei-, dreimal einen Fuß vor den anderen zurück Richtung Bauernhaus, dann sank er atemlos in den Schnee. Ausruhen. Es kam Venray wie eine Ewigkeit vor, bis einige seiner Landreiter, unter ihnen Leutnant Prins, auftauchten und verwundert fragten, was vorgefallen war. Seinen Todeskampf mit dem Federbusch hatte niemand beobachtet.
»Der Weiler ist unter unserer Kontrolle«, erklärte Prins.
Venray nickte nur. Die Männer sahen durchgefroren und erschöpft aus.
Prins berichtete, ihre Verluste seien hoch, sie hätten einige Kameraden verloren. Eine Handvoll hatte leichte Verletzungen davongetragen. Von den Räubern waren bis auf vier Schwerverletzte, die wohl kaum die Nacht überleben würden, alle tot. Ebenso wie die Bewohner des Weilers. »Ein einziger Wahnsinn«, schloss der Leutnant seinen Bericht.
Venray blickte in die von Kälte und Kampf gezeichneten verhärmten Gesichter seines Corps. Dieser Winter machte sie alle zu Bestien. Sie hätten viel früher vor Ort sein müssen. So war im wahrsten Sinne des Wortes jede Rettung zu spät gekommen. Was für eine unchristliche Zeit!
Prins kam auf Venray zu und half ihm auf.
»Macht ein Feuer an und kümmert euch um die Toten. Und irgendjemand muss die Pferde holen. Wir bleiben heute Nacht hier.«
Prins gab die Anordnungen weiter.
»Ach, und Leutnant«, ergänzte Venray, »im anderen Bauernhaus habe ich einen halb verhungerten Bock entdeckt. Schlachtet das Tier. Wir müssen was essen.«
3
Er spürte einen harten Schlag gegen den Kopf. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis er richtig wach wurde, dann fuhr er erschrocken hoch. Er musste doch tatsächlich eingenickt sein. Wie leichtsinnig! Aber um sich zu tadeln, war er noch zu verschlafen.
Orientierung suchend blickte sich Venray um, dabei rieb er sich die pochende Stelle am Kopf. Der Schmerz schlug durch. Das würde bestimmt eine Beule geben. Er fühlte sich hundeelend. Zum körperlichen Schmerz gesellten sich die schrecklichen Bilder eines Alptraums, den sein unfreiwilliges Nickerchen geprägt hatte. Die Toten zu vergessen war nicht leicht.
Er griff in die Innentasche seines Justeaucorps und holte ein flaches Metallkästchen hervor, das er aufklappte. Die darin befindliche Miniaturmalerei zeigte auf der linken Seite ein kleines ovales Gemälde einer jungen blonden Adligen, die den Betrachter sowohl streng als auch herausfordernd anschaute. Das goldene Seidenkleid hatte Maayke nur für dieses Bild getragen. Das Gemälde auf der rechten Seite zeigte Maayke mit ihren Kindern Neeltje und Maarten. Venray stand hinter den dreien. Maarten war mit seinen acht Jahren schon ein besserer Schütze mit der Steinschleuder gewesen als sein Herr Papa. Die sechsjährige Neeltje war ein süßer Trotzkopf, er hatte ihr kaum etwas hatte abschlagen können. Nur gut, dass es seiner Frau Maayke gelegentlich gelungen war, unnachgiebig zu bleiben. »Ach, Mama«, hatte die kleine Neeltje dann gebettelt, »ich habe mir diese eine