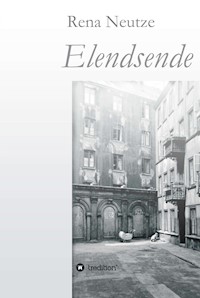
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die goldenen Zwanziger: Musik und Tanz! Aufbruch und Vergnügen! Fortschritt und Hoffnung! Nicht jedoch für Henriette Sienknecht. Juli 1928 - ganz Deutschland liegt seit Wochen unter brodelnder Hitze. Anstatt ausgelassen Charleston zu tanzen oder auf lauschigen Kanälen eine Kahnpartie mit einem Verehrer zu unternehmen, muss sie sich um Haushalt und Geschwister kümmern, mit denen sie in einem Hamburger Arbeiterquartier haust. Drangvolle Enge und bittere Armut. Von der Mutter zur Arbeit angetrieben, von den Nachbarn verdächtigt, ein uneheliches Kind zu haben, vom Hauswart missbraucht. Das Sommerfest in der Gartenkolonie soll eine kleine Abwechslung vom tristen Alltag bringen; statt-dessen wird die Sechzehnjährige des Mordes beschuldigt. Der Behördenwillkür ausgeliefert, hilflos und naiv, beginnt der unaufhaltsame Abstieg, der ihre ganze Familie mitreißen wird. Verzweifelt bemüht, Fuß zu fassen, schließt Henriette sich einem Mann an, der ihr zur Flucht verhelfen kann. August 1934 - ungewollt schwanger, wird Henriette im aufkeimenden Nationalsozialismus zum asozialen Volksschädling gestempelt und verschwindet hinter hohen Mauern. Mai 1955 - nach langer Zeit ein Wiedersehen mit der Familie. Doch die Uhr kann man nicht zurückstellen und erlittenes Unrecht lässt sich nicht wiedergutmachen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 994
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Rena Neutze
Elendsende
www.tredition.de
© 2015 Rena Neutze
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Covermotiv: 5531915 / Conti Press (KEY 9002879)
ISBN
Paperback:
978-3-7323-4505-2
Hardcover:
978-3-7323-4506-9
e-Book:
978-3-7323-4507-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Widmung
Dieses Buch ist für meinen Vater und Natias.
PROLOG –
28. Juli 1928, ca. 20:45 Uhr, Polizeiwache Hoheluft
Teil I
06:15 Frühes Aufstehen
07:30 Morgenstund‘ hat Gold im Mund
07:15 Arbeit, nichts als Arbeit
09:30 Frühstückspause in der Cigarettenfabrik
10:00 Eine hochherrschaftliche Villa
10:15 Grünhöker Plenzke
10:55 Villa Aurora, Grömitz/Ostsee
10:30 „Salon für die Dame“
10:55 Villa Luna, Sommerresidenz der Familie de Breuyn
11:45: Freudige Erwartung
13:15 Hof Butenschön
13:25 Feierabend!
13:30 Sowas gehört fortgesperrt!
13:35 Aus Kindern werden Engel
13:40 Jungenspiele
14:15 Familie Sienknecht sammelt sich
15:15 Minderwertiges Pack
15:30 Sommernachmittag im Stadtpark
15:45 Ein dunkelhaariger Junge
16:15 Gestohlene Zeit
16:30 Nicht für Mädchenohren
16:45 An Kindes Statt
17:45 Niemals könnte ich ihr etwas antun!
18:50 Und alle haben etwas geahnt
19:00 Festvorbereitungen
19:55 Schlechte Stimmung
20:05: Ein großzügiges Angebot
20:20 Heimkehr auf den Hof
Teil II –
10. Oktober 1928 Das perfekte Mädchen
11. Oktober 1928 Die Witwe in der Neustadt
11. Oktober 1928 Ein englischer Gentleman
11. Oktober 1928 Großzügigkeit und Panik
11. Oktober 1928 Neue Papiere sind notwendig
12 Oktober 1928 Veränderungen müssen sein
12 Oktober 1928 Feines Tuch
12 Oktober 1928 Verblichene und Verblasstes
12 Oktober 1928 Ein vielbeschäftigter Mann
12 Oktober 1928 Ein Schreck und eine Beichte
12 Oktober 1928 Gartenwege und Lauben
6. Oktober 1928 Ein guter Freund
7. Oktober 1928 Dreck am Stecken
7. Oktober 1928 Das erste Mal
8. - 10. Oktober 1928 Kreuz und quer durch die Stadt
26. Oktober 1928 SS „Lady Adele“
30. Oktober 1928 Ankunft
23. Dezember 1928 Vorweihnachtszeit
Teil III
13. August 1934 Lang ersehnte Rückkehr
1930 bis Mitte 1934 Kennedys Pub
13. August 1934 Missbrauch
15. August 1934 Tiefste Verzweiflung
15. August 1934 Ausgesiebt
Teil IV
28. Mai 1955 Besuch in der alten Welt
29. Mai 1955 15:30 Wohlhabende Verwandte
20. Oktober 1954 Die Vergangenheit holt ihn ein
28. Mai 1955 – Vorsichtige Annäherung
31. Mai 1955 Die Laube mit der grünen Tür
31. Mai 1955 Der werfe den ersten Stein
4. Juni 1955 Unbehagliches Schweigen
5. Juni 1955 Fahrt aufs Land
5. Juni 1955 Wiedersehen
Nachwort
PROLOG–
28. Juli 1928, ca. 20:45 Uhr, Polizeiwache Hoheluft
Trotz der Hitze, die, auch jetzt am Abend noch, stickig in der mit Aktenschränken vollgestopften holzgetäfelten Wachstube stand, zitterte Henriette am ganzen Körper. Ihre Haare klebten schweißfeucht an den Schläfen, hinter ihren Augen verspürte sie einen bohrenden Schmerz. Ihr Hals war ausgedörrt, krampfhaft versuchte sie, ein wenig Speichel zu sammeln, doch auch ihr Mund war völlig trocken.
Ob sie Walter um ein Glas Wasser bitten konnte?
Scheu musterte sie den jungen Mann, der in seiner strengen Uniform fremd und erwachsen aussah, steif an der Tür lehnte und es geflissentlich vermied, auch nur in ihre Richtung zu schauen. Walter war nur wenige Jahre älter als sie selbst, zwei seiner jüngeren Geschwister waren mit ihr in die Schule gegangen. Und von seinem Bruder, dem neunzehnjährigen Ulrich, hatte Henriette im letzten Sommer ihren ersten Kuss bekommen.
Ulrich.
Dieser schöne Sommertag mit ihm schien so unendlich weit entfernt zu sein.
Er hatte sie auf seinem Fahrrad mitgenommen, um ihr endlich einmal zu zeigen, wo er den ganzen Tag arbeitete. Der warme Wind hatte ihre Haare zerzaust, während sie in Richtung Hafen und Landungsbrücken gerollt waren.
„Hier muss ich jeden Morgen längs“ mit einer weiten Geste hatte Ulrich die Straßen umfasst, bevor er rasch wieder an den Lenker gegriffen hatte, weil der Weg von St. Pauli herunter an die Hafenkante steil abfiel und das Fahrrad gefährlich schaukelte. Als die glänzende Kuppel des Elbtunnels in Sicht gekommen war, hatte Henriettes Herz wild zu klopfen begonnen. Ulrich wollte mit ihr doch nicht etwa durch den Tunnel fahren?
Natürlich wusste Henriette, dass der Tunnel seit vielen Jahren die beiden Elbufer miteinander verband, aber bisher war sie nur mit einer Barkasse von einer Flussseite zur anderen gefahren. Niemals zuvor war sie unter dem Wasser hindurchgefahren.
Über ihren Köpfen würde das dunkle Elbwasser strömen, von ihnen nur getrennt durch Mauerwerk! Und wenn der Fluss nun zu stark für die Wände wurde? Ihr Herz hatte gewummert, Ulrich hätte es doch hören müssen! Doch der junge Mann hatte sich auf die vielen Fußgänger, Radfahrer und Fuhrwerke konzentriert, die bereits vor dem Tunnel warteten, dann das Fahrrad vorsichtig abgebremst und war langsam in die Aufzugskabine gerollt, die sich schnell mit Menschen und Fahrzeugen gefüllt hatte. In der Mitte hatte das Fuhrwerk einer Brauerei gestanden, die beiden gedrungenen Pferde hatten mit ihren stampfenden Hufen den Boden des Fahrkorbes erzittern lassen. Henriette war bebend vom Rad abgestiegen.
„Was ist?“ Ulrich hatte ihr fragend unter das Kinn gefasst. „Angst? Musst nich hebben, ich bün ja ok noch dor…1“
Die Umstehenden hatten amüsiert gelächelt und Henriette war das Blut heiß in die Wangen gestiegen. Nachdem der erste Schrecken überwunden war, hatte es ihr dann aber sogar gefallen, in der hölzernen Kabine langsam abwärts zu ruckeln. Im Tunnel war es ziemlich kühl gewesen und Ulrich hatte sein Rad langsam neben ihr hergeschoben, damit Henriette jeden Meter der gefliesten Tunnelwände bewundern konnte.
„Mien Vadder seggt, dat isn grootes Glück, datt wi nu den Tunnel hebt, makt den Weg bannig körter“.2
Henriette hatte genickt, sie hatte Herrn Böttcher einmal davon erzählen hören, wie voll die Barkassen früher gewesen waren, die die Werftarbeiter zur Arbeit auf der anderen Uferseite und zurück transportierten. Trotzdem war ihr immer noch etwas unbehaglich gewesen, wenn sie an all das Wasser über ihnen dachte.
Am Tunnelende hatte eine Kabine gewartet, die sie wieder nach oben ans Tageslicht befördert hatte. Die Sonne war nach dem kühlen Dämmer im Tunnel so hell gewesen, dass Henriette blinzeln musste. Stolz hatte Ulrich auf die großen eisernen Buchstaben am Werkstor gezeigt.
BLOHM & VOSS
Dann hatte er auf eine Halle gedeutet, die seitlich neben dem Eingangsgebäude aufragte und stolz gesagt: „Dor achtern, dor kloppt wi den leeven langen Dag…“3
Auf dem Rückweg hatten sie am Tunneleingang warten müssen, bis eine freie Kabine kam. Im Schatten des Eingangs hatte es Henriette plötzlich gefröstelt und Ulrich hatte ihr fürsorglich seine Jacke um die Schultern gelegt, ihr Kinn sanft angehoben und sie ganz zart auf die Lippen geküsst. Henriette war ganz komisch geworden, doch danach waren sie schweigsam und verschämt den Weg zurück zur Hoheluft gefahren.
Verlegen hatte Ulrich sie vor der Haustür gefragt, ob sie noch mit ihm in Knopf’s Speise- und Schankwirtschaft gehen würde. Zögernd hatte Henriette gesagt, dass es eigentlich schon zu spät sei und Mutti bestimmt schon ungeduldig auf ihre Rückkehr warten würde. Doch dann hatte er so bittend ihre Hand ergriffen, dass sie rasch genickt hatte. Im Wirtshaus hatten sie sich einen freien Platz gesucht und Ulrich hatte ihr einen Kirschsaft spendiert und selbst ein kleines Bier getrunken. Später, vor der Haustür hatte er ihr noch einen Kuss gegeben und einen kurzen Moment hatte sie sich an ihn geschmiegt, bevor sie in den kühlen Hausflur geschlüpft war.
Es war einer der schönsten Tage ihres Lebens gewesen.
Mit einem lauten Knall schlug die Tür hinter Wachtmeister Soennichsen zu; Henriette schrak zusammen und war augenblicklich zurück in der heißen und beängstigenden Gegenwart. Polizeianwärter Walter Böttcher stand sofort stramm und Henny schluckte trocken. Der verächtliche Blick, der sie aus den blassblauen Augen des dicken Wachtmeisters traf, ließ sie noch ängstlicher in sich zusammenkriechen.
Der bullige Wilhelm Soennichsen setzte sich hinter den großen Schreibtisch, musterte sie ausgiebig und schien sich an ihrem Unglück zu weiden, bevor er endlich polterte: „Nun, Frolleinchen? Ist dir inzwischen mehr eingefallen, außer ‚das war ich nicht‘ und ‚ich weiß nicht, was passiert ist‘? Hab ich doch gewusst, dass ich dich mal hier sitzen haben werde. Dich oder einen anderen von euch Sienknechts!“
Er wandte sich halb zu Walter und fragte barsch: „Oder hat sie in der Zwischenzeit doch was gesagt?“
Walter schien noch weiter zu schrumpfen, bevor er endlich stotterte: „Nee se…. Se hett gunnix seggen deit.“ Und dann gleich nochmal mit hochrotem Kopf auf hochdeutsch: „Nein, Herr Wachtmeister. Sie hat nichts gesagt.“
Aufatmend trat Walter an das kleine Tischchen in der Ecke. Die Erleichterung, dass jemand anderes sich nun um Henriette kümmerte, war ihm deutlich anzusehen. Walter Böttcher setzte sich an die Schreibmaschine, legte die Hände über die Tasten und wartete darauf, dass Soennichsen mit dem Verhör beginne.
Doch der räusperte sich erst einmal ausgiebig, rutschte auf dem knarrenden Stuhl hin und her, häufte Papiere zu kleinen Stapeln und zog an seinen Ärmeln. Genau wie Henriette schrak auch Walter zusammen, als sein Vorgesetzter auf einmal losblaffte: „So, du willst also nicht antworten? Nein? Macht nichts, ich weiß auch so, was du getan hast!“
Henriette schüttelte verzweifelt den Kopf, versuchte etwas zu sagen, aber außer einem heiseren geflüsterten „Nein, ich hab ihr nichts getan“, das sogar für ihre Ohren fast unverständlich war, kam nichts heraus.
Mit einem höhnischen Lächeln stemmte Soennichsen seine kräftigen Arme auf die Schreibtischplatte und beugte sich weiter vor, sie dabei mit zusammengekniffenen Augen musternd, bevor er verächtlich hervorstieß: „Sprich gefälligst laut und deutlich, du kleine…!“
Heiß traten Henriette Tränen in die Augen, der Kloß im Hals tat jetzt richtig weh. Sie richtete sich auf, schluckte mühsam und presste mit leiser Stimme hervor: „Ich habe Margarete nichts getan. Bitte. Sie müssen mir glauben.“
Und brach endgültig in Tränen aus, schniefte und heulte.
Soennichsen hieb mit der Hand auf den Tisch, der Knall ließ Henriette zusammenzucken. „Heulen nützt dir jetzt auch nichts mehr! Du hörst mir jetzt mal genau zu, Frolleinchen. Es gibt jede Menge Zeugen, die dich heute mit deiner Schwester gesehen haben. Geschüttelt hast du sie. Nun ist sie tot. Wer soll es sonst wohl gewesen sein? Du bist doch froh, dass du den oll…“ er unterbrach sich unbehaglich und zögerte, bevor er fortfuhr: „das Kind los bist. Gib‘s einfach zu, das macht es für uns alle leichter!“
Er hatte sich in Rage geredet, war bei seinen letzten Worten sogar aufgesprungen. Henriette schaute verängstigt zu ihm auf, mechanisch schüttelte sie immer schneller den Kopf. Sie musste etwas sagen, aber ihr ganzer Kopf war leer, nur die Worte „ich war es nicht, ich habe Grete nichts getan“ schwappten darin dröhnend von einer Seite zur anderen.
Plötzlich wurde laut und kräftig an die Tür geklopft. Alle drei zuckten zusammen. Wachtmeister Soennichsen fuhr sich nervös durch die verschwitzen Haare, zog hastig seine Uniform glatt und ließ ein donnerndes „HEREIN!“ ertönen.
Polizeianwärter Walter Böttcher sprang verlegen auf: „Herr Wachtmeister, die Kollegen von der Kriminalpolizei…“ Soennichsen schien vor Wut mit den Zähnen zu knirschen, besann sich dann aber und sagte leiser, um einen jovialen Tonfall bemüht: „Es ist gut, Böttcher. Das kann ich ja auch selber sehen.“
Bevor Walter ordentlich Meldung machen konnte, hatte der erste Besucher, ein hochgewachsener blonder Mann, ihn auch schon freundlich, aber bestimmt zur Seite geschoben: „Vielen Dank, Böttcher, wir machen uns selbst bekannt mit Herrn Wachtmeister Soennichsen. Schmahl mein Name.“
Mit diesen Worten stand der Mann auch schon mitten in der Wachstube, direkt vor Soennichsens Schreibtisch, der sich hastig bemühte hochzukommen und ordentlich dazustehen. Ein langer schwarzer Rock raschelte an Böttcher vorbei, verdutzt entdeckte der, dass der zweite Besucher eine weibliche Person war, die hochaufgerichtet hinter ihrem Vorgesetzten Detlef Schmahl her schritt, ohne Walter jedoch zu beachten.
Kriminalkommissar Schmahl deutete knapp auf seine Begleiterin, stellte sie mit einem flüchtigen „Ingeborg Grünlich, eine…“ Er stockte und suchte nach dem richtigen Begriff, Kollegin wollte ihm anscheinend nicht über die Zunge schlüpfen, also sagte er nur lahm: „Auch bei der Polizei.“
Barsch sagte Soennichsen, ohne Walter in die Augen zu schauen: „Wir brauchen Sie im Moment nicht, Böttcher. Fräulein Grünlich kann das Protokoll schreiben. Sie kann auch stenographieren.“ Die Polizistin würdigte auch er keines Blickes.
Die Tür schlug zu, das Letzte, was Walter Böttcher sehen konnte, war die zitternde Henriette Sienknecht, die wie ein Häuflein Elend auf der vordersten Kante des hölzernen Stuhls hockte. War sie nicht im letzten Sommer sogar mal kurz die Freundin seines Bruders Ulrich gewesen?
Henriette stammte, ebenso wie Walter Böttchers Familie, aus dem kleinen Arbeiterquartier, das im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Hoheluftchaussee in Hamburg lag. Wohl auch deswegen verspürte Walter ein unangemessenes Mitleid mit dem Mädchen und schalt sich dafür. Sie wurde schließlich verdächtigt, ihre kleine Schwester getötet zu haben. Vorstellen konnte er sich das allerdings nicht. Doch nicht Henriette. Im Leben nicht! Im Gegenteil, Henny – wie sie meistens genannt wurde – sorgte doch mit unendlicher Geduld und Fürsorge für die Kleine.
Was kaum einer der Nachbarn verstand. Auch Walter nicht. Schließlich war Margarete ein hässliches, sabberndes Idiotenkind. Deshalb begriff Walter auch nicht, warum sein Vorgesetzter sich jetzt auf einmal so aufregte. Hatte er ihn doch zu anderen Gelegenheiten sagen hören, dass sowas am besten ertränkt würde. Und wenn nicht ertränkt, dann wenigstens gut weggesperrt, hinter den hohen Mauern der Irrenanstalten Friedrichsberg oder Langenhorn.
Andererseits konnte Walter sich sehr gut vorstellen, wie Soennichsen sich freute, jemandem von diesem „Lumpenpack“ endlich einmal zeigen zu können, wie die Obrigkeit mit seinesgleichen verfuhr. Henriettes Familie war seinem Vorgesetzten schon lange ein gewaltiger Dorn im Auge.
Die Tür zur Wachstube öffnete sich erneut, die Polizistin trat heraus und bat Walter höflich, aber knapp, einen weiteren Stuhl zu holen. Obwohl er diensteifrig nickte, fühlte er sich in seiner männlichen Ehre gekränkt: Sich von einer Frau durch die Gegend scheuchen lassen! Auch wenn sie zehnmal Polizistin wie er und obendrein bei der Kriminalpolizei war, das ging dann irgendwie zu weit. Weibsleute bei der Polizei – da musste er seinem Vorgesetzten recht geben. Die hatten hier nichts zu suchen.
Trotzdem blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als den verflixten Stuhl aus dem zweiten, kleineren Büro zu holen. Als er damit in das Büro kam, hörte er Henriette Sienknecht mit stockender Stimme ihre Personalien angeben:
„Name?“
Kriminalinspektor Schmahl hatte wie selbstverständlich Soennichsens Platz eingenommen. Dieser stand mit hochrotem Kopf und verdrießlicher Miene seitlich neben seinem eigenen Schreibtisch und winkte Walter unwirsch mit dem Stuhl heran.
Als Henriette nicht sofort antwortete, fuhr Soennichsen sie gereizt an: „Antworte gefälligst. Deinen Nachnamen wirst du ja wohl wissen…du…du!“
Schmahl sah kurz hoch, sagte leise: „Es ist gut, Soennichsen“ und wandte sich wieder seinem kläglichen Gegenüber zu. Er wartete noch einen Moment geduldig ab und wiederholte seine Bitte noch einmal, diesmal jedoch in sanfterem Tonfall: „Bitte, sprich laut und deutlich.“
„Ich heiße Henriette Sienknecht.“
„Geboren?“
Henriette räusperte sich, bevor sie leise antwortete: „Am siebzehnten April neunzehnhundertzwölf. In…in Hamburg.“
„Wohnhaft?“
Ingeborg Grünlich machte sich in rasender Geschwindigkeit Notizen auf einem Block, der Bleistift kratzte hörbar über das Papier.
„Löwenstrasse. Nummero acht.“
Walter sah Soennichsen mit zusammengezogenen Augenbrauen grimmig nicken. Löwenstraße. Falkenriedterrassen. Von da konnte ja auch nichts Gutes kommen.
Walter seufzte unhörbar.
Für Wilhelm Soennichsen war jeder Bewohner der kleinen Arbeiterwohnungen von vornherein suspekt und verdächtig. Gesindel, das am besten mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden sollte.
Sozis.
Rotes Pack.
Proleten.
Verbrecher.
Diese von Soennichsen mit schnarrender Stimme ständig wiederholten Vorurteile kannte Walter inzwischen in- und auswendig. Seine davon abweichende Meinung behielt er jedoch schön für sich. Anwärter Walter Böttcher wollte irgendwann schließlich auch einmal Wachtmeister werden.
1Angst? Muss du nicht haben, ich bin ja auch noch da…
2 Mein Vater sagt, das ist ein großes Glück, das wir nun den Tunnel haben, das macht den Weg viel kürzer
3 Dort hinten, dort klopfen wir den lieben langen Tag
Teil I
06:15 Frühes Aufstehen
Obwohl Gerda Sienknecht in der vergangenen Nacht in dem heißen stickigen Zimmer kaum hatte schlafen können, hätte sie jetzt am frühen Morgen viel darum gegeben, einfach liegenbleiben zu dürfen. Sich im Bett herumdrehen und erst dann aufzustehen, wenn einem wirklich danach zumute war und nicht, weil die verdammte Pflicht einen wieder unerbittlich rief. Und nach dem Aufstehen in ein blitzblankes Badezimmer gehen und dort so lange unter einer kühlen Brause stehen können, wie man Lust und Laune hatte. Sich vom Personal saubere, frischgewaschene Handtücher bereitlegen lassen und in wohlriechende, blitzsaubere Kleidung schlüpfen. Im Esszimmer ein ordentlich gedeckter Tisch mit gekochten Eiern, Brötchen und frisch gebrühtem Bohnenkaffee. War man gesättigt, könnte man sich eine Droschke bestellen, zum Bahnhof bringen lassen und einfach in die Sommerfrische an die Ostsee fahren.
Gerda seufzte. So gut hatten es Familien wie Habermanns. Geld wie Heu und Dienstboten für alles und jedes. Ihre jüngere Schwester konnte davon ein Lied singen, arbeitete Agnes doch seit vielen Jahren dort als Dienstmädchen bei Bankier Habermann in dessen hochherrschaftlicher Villa!
Unerbittlich schlug die Kirchturmuhr sechs und zeigte an, dass es jetzt wirklich höchste Zeit zum Aufstehen war. Ade, schöne Träume von fließendem Wasser, Sauberkeit und Wohlleben. Missmutig setzte Gerda sich auf und strich ihre nassgeschwitzten Haare aus dem Gesicht. Angewidert lauschte sie den Würgegeräuschen, die aus der im vorderen Teil der Wohnung gelegenen Küche kamen und verzog angeekelt ihren Mund. Das konnte nur bedeuten, dass es ihrem jüngsten Kind auch jetzt nicht besser ging als vor einer Stunde, als Gerda zum letzten Mal aufgestanden und in die Küche gegangen war, wo ihre Älteste das Kind aber bereits hochgenommen und von Erbrochenem gesäubert hatte. Gerda seufzte noch einmal, tiefer diesmal. Wie satt sie das alles hatte! Wie leid sie es war, tagein, tagaus eine ganze Familie mit ihrem kargen Lohn ernähren zu müssen. Wie es ihr zum Hals heraushing, dass jeder Tag wie der vorige war, eine einzige Schinderei und Mühsal.
Kräftig gähnend streckte sie sich, erhob sich vom Bett und schalt sich leise. Heute lag doch nur noch ein halber Tag Arbeit vor ihr. Danach gehörte das Wochenende Gustav und ihr! Vielleicht würde er tatsächlich einmal über Nacht bleiben? Und wenn nicht die ganze Nacht, dann wenigstens ein paar Stunden. Stunden, in denen sie in seinen Armen liegen und einmal nur an sich denken durfte.
Ihre Wirbelsäule knackte, als sie mit einer ungeduldigen Bewegung den Kopf nach vorne beugte, um ihre dunklen Haare, die trotz ihrer knapp vierzig Jahre bereits von breiten grauen und weißen Strähnen durchzogen waren, hoch oben auf dem Kopf zu einem unordentlichen Knoten zusammenzudrehen.
Hauptsache, Gustav fing nicht wieder von dem leidigen Thema an!
Sie erhob sich und stieß die kleinen Fensterflügel weit auf, trotzdem kam keinerlei Abkühlung von draußen, nicht der leiseste Luftzug wehte durch den tristen Hinterhof. Aus der Küche war jetzt leises Gemurmel zu hören, wahrscheinlich tröstete Henriette die kranke Schwester. Gerda verzog ihren Mund. Jede Menge Schmutzwäsche war durch den verdorbenen Magen ihrer jüngsten Tochter angefallen, da hatte Henriette später reichlich zu waschen.
Auch in dem schmalen langen Flur stand die Wärme. Aus dem zweiten Zimmer waren jetzt trippelnde Schritte und danach ächzendes Stöhnen zu hören.
Ärgerlich kniff Gerda ihre Lippen zusammen, sie wusste genau, warum ihr ältester Sohn Otto dort drinnen so stöhnte. Geschah ihm ganz recht, wenn ihm der Kopf heute Morgen dröhnte! Es wurde Zeit, dass sie mit dem Bengel ein ordentliches Machtwort sprach. Otto kam und ging, wie es ihm passte – gestern war er wieder einmal mitten in der Nacht betrunken nach Hause gekommen und hatte so herumgelärmt, dass die ganze Nachbarschaft es gehört haben musste! Was für einen Eindruck machte das denn? Als ob Gerda Sienknecht in ihrer Familie nichts zu sagen hatte! Spätestens Morgen beim Sonntagsessen würde sie ihm den Marsch blasen. Leider würde es nicht viel nützen, das wusste Gerda nur zu gut. Mit seinen achtzehn Jahren ließ Otto sich von ihr nichts mehr sagen. In solchen Momenten wünschte Gerda sich sehnlichst einen Vater für ihre Kinder, der mal mit eiserner Faust aufräumte.
Außerdem war es gut möglich, dass Otto sich überhaupt nicht zum Essen hier blicken ließ. Seitdem er diese … diese… Frau kannte, kam er noch unregelmäßiger nach Hause. Die setzte dem Bengel wahrscheinlich auch solche Flausen in den Kopf wie auswandern und abhauen. Zwar dachte Gerda wirklich oft, dass er doch machen solle, was er wollte. Andererseits konnte sie ihn nicht einfach gehen lassen. Wie satt sie das alles hatte!
Durstig ging Gerda in die Küche.
Dort stand Henriette am Herd, Margarete auf der Hüfte und streichelte dem Kind beruhigend den Rücken, während sie auf das Mädchen einsprach. Im Zinkeimer in der Ecke schwammen Wäschestücke, die in der ganzen Küche einen ekelhaft säuerlichen Geruch verströmten.
Als Henriette ihre Mutter erblickte, nickte sie knapp, murmelte leise „Morgen, Mutti“ und drehte ihr den Rücken zu. Gerda ärgerte sich schon wieder. Warum war das Mädchen in letzter Zeit immer so schnippisch? Schließlich tat sie doch wohl alles, damit es der Familie einigermaßen gut ging. Konnte sie irgendwas dafür, dass die kleine Schwester krank war? Aber im Gegensatz zu Otto wurde sie mit ihrer Tochter immer noch fertig, da war Gerda sich sicher. Ein paar harsche Worte genügten und Henny spurte.
„Es geht ihr immer noch nicht besser“, vorwurfsvoll hielt Henriette ihrer Mutter die kleine Schwester hin, bevor sie mit der anderen Hand einen Teller mit einer Scheibe Brot auf den Tisch knallte. Gerda zuckte mit den Schultern und griff nach dem Brot, bevor sie antwortete: „Jo, und? Wat schall ich dorbi moken? Mutt glieks los!4 Weißt doch genau, dass sie mir ne Viertelstunde abziehen, wenn ich zu spät komme.“
Sie biss von ihrem Brot ab und hoffte, dass das Thema nun beendet sei, aber Henriette legte Margarete auf das durchgesessene Sofa, das in der Ecke stand, strich der Kleinen die verschwitzten dünnen Locken aus dem blassen Gesicht und sagte lauernd: „ICH gehe heute Nachmittag aber trotzdem zu Gisela und abends aufs Sommerfest…“
Gerda unterbrach ihre Tochter schroff: „Wie war das eben? Was glaubst du eigentlich…? Wenn es Grete heute Mittag nicht besser geht, wirst du gefälligst zu Hause bleiben und auf sie aufpassen. Und keine Widerrede, mein Frollein!“
Mit einem unterdrückten Schrei sprang Henriette zurück und stieß dabei einen Stuhl polternd gegen den Herd: „Nein! Du hast mir versprochen, dass ich gehen darf. Ich soll auch noch Giselas Kleid nähen und … und … und außerdem ist Grete DEINE Tochter!“
Gerda hob ihre Hand einen Moment zu spät. Bevor sie zuschlagen konnte, war Henriette schon aus der Tür, die mit einem lauten Knall hinter ihr zufiel.
Mit Tränen in den Augen stand Henriette im Flur, als ein gebräuntes rundes Jungengesicht durch den Türspalt des zweiten Zimmers lugte: „Henny, was ist denn los? Gibt es Krach? Ich muss ganz dringend pinkeln.“ Johann, ihr jüngerer Bruder, trat unruhig von einem Fuß auf den anderen, aus dem Zimmer drang der unangenehme Geruch nach abgestandenem Alkohol und männlichem Schweiß. Henriette seufzte: „Halt ja an, Kleiner – ich hol dir den Pott.“
Sie eilte in das Schlafzimmer der Mutter und angelte den halbvollen Nachttopf unter dem Bett hervor.
Durch die dünnen Vorhänge schimmerte ein weiterer sonniger Tag. Bei diesem anhaltenden Schönwetter musste Mutti sich jedenfalls keine Sorgen machen, dass der für heute Nachmittag geplante Ausflug mit ihrem Liebhaber ins Wasser fallen könnte. Und die Laubenpieper auch nicht, dachte Henny und merkte, wie ihre Lippen zu zittern begannen. Seit Wochen hatte sie sich auf das Sommerfest im Schrebergarten gefreut! Ihre Freundin Gisela, die Lehrmädchen im Friseursalon „Für die Dame“ am Eppendorfer Weg war, hatte versprochen, Henriettes lange wellige Haare wenigstens ein bisschen zu glätten. Als Gegenleistung sollte Henny Gisela das von der älteren Schwester abgelegte Kleid ändern. Es musste Grete nachher einfach besser gehen!
Sie reichte ihrem Bruder den Nachttopf hinein und hörte gleich darauf erleichtertes Plätschern.
Heftig klopfte sie von außen an die Zimmertür und mahnte ihren ältesten Bruder: „Otto, steh auf, du kommst sonst noch zu spät“. Das gebrummte „ich komm ja schon“ wartete sie schon gar nicht mehr ab und nahm der Mutter in der Küche die Kleine wieder ab. Gerda fühlte Margarete die Stirn, murmelte „Fieber hat sie nicht, wird ihr nachher wohl besser gehen“ und strich dem Mädchen die verschwitzen Haare aus dem Gesicht. Mit einem flüchtigen Kuss legte Henny die Kleine wieder zurück auf das Sofa, auf dem sie nachts schlief. Die Wohnung bestand nur aus Küche und zwei Zimmern, nachdem Vati gestorben war, hatte Henriette hinten bei Mutti geschlafen. Nach Margaretes Geburt war zuerst Henriette in die Küche gezogen und eines Tages hatte Gerda auch den Korb, in dem Margarete schlief, einfach in die Küche gestellt. Und dabei war es dann geblieben.
Ihre Mutter schöpfte sich eine Handvoll Wasser aus der Schüssel, die auf dem Tisch stand, in den Mund und spuckte ins Spülbecken. „Schmeckt auch nicht, ganz abgestanden und piewarm…“ murmelte sie dabei ärgerlich. Sie goss trotzdem erneut Wasser in ihre Hand und rieb sich flüchtig Gesicht und Achselhöhlen, bevor sie zurück in das Schlafzimmer ging. Henny ärgerte sich schon wieder, sie hatte den unausgesprochenen Vorwurf sehr genau verstanden. Verflixt nochmal! Wann hätte sie denn auch noch frisches Wasser an der Pumpe holen sollen?
Im hinteren Zimmer hingen Rock und Bluse bestimmt schon griffbereit über dem Stuhl, Henny wusste, dass ihre Mutter morgens keine Zeit verlor. Gleich danach kam Gerda auch schon wieder fertig angezogen zurück und band den unordentlichen Haarknoten mit einem Stoffstreifen hoch. Henriette wusste auch, dass der Mann, der bei Mutti in der Küche das Sagen hatte, immer ganz genau darauf achtete, dass kein Härchen unter der Haube hervor sah. „Erbsenzähler“ nannte Mutti ihn immer verächtlich, gab aber andererseits auch zu, dass es schlimmere Chefs als Herrn Mahler geben würde.
Schon im Weggehen verteilte Mutti wieder Aufgaben: „Wir brauchen Brot und Milch. Außerdem musst du dich dringend um die Bügelwäsche kümmern, Blumes warten schon drauf. Ich hab ihnen die Tischwäsche für heute versprochen. Und denk dran, Tante Agnes hat heute ihren freien Nachmittag, du musst vor drei Uhr bei ihr sein, um Kissen und Servietten hinzubringen. Und bring den Rest von der Miete zu Feddersen.“ Das Letzte sagte Gerda mit abgewandtem Gesicht. Henny biss sich auf die Lippen und nickte wortlos, während sie weitere Brotscheiben abschnitt, um Otto die Brote für seine Frühstückspause zu streichen.
Aus dem Zimmer nebenan war erneutes Gerumpel und Gestöhne zu hören. Henriette verzog säuerlich den Mund: „Otto war ja ganz schön spät zu Hause – un weer bannig duhn…“5
Gerda zuckte zusammen und fauchte: „Der Junge arbeitet ja wohl hart, da darf er freitags auch mal was trinken gehen…“
Henriette kniff wütend die Lippen zusammen. Egal, was Johann oder Otto auch anstellten, bei Jungs war alles immer „halb so schlimm“. Deshalb antwortete sie bockig nicht, als ihre Mutter sagte: „Ich geh‘ dann mal.“
Einen Daumen im Mund, lag Margarete teilnahmslos auf dem Sofa, den Blick an die Decke gerichtet. Gerda zuckte achtlos mit den Schultern und Henriette wusste, dass ihre Mutter sich darauf verließ, dass sie schon wissen würde, was das Richtige für die Lütte6 war. Wenn man ehrlich war, hatte Mutti auch nicht allzu viel Geschick mit Kranken und verstand sich nicht auf deren Pflege. Margarete war sowieso ein besonderer Fall, schwächlich und verkrüppelt wie sie war, brauchte sie weitaus mehr Fürsorge als andere Dreijährige.
Mit einem widerwilligen Blick auf ihr jüngstes Kind, dessen vorstehende blassblaue Augen teilnahmslos durch seine Mutter hindurchsahen, ging Gerda Sienknecht zur Tür hinaus.
Otto stolperte leicht schwankend in die Küche, knirschte mit zusammengebissenen Zähnen einen Gruß und nahm seiner Schwester den hingehaltenen Becher Wasser aus der Hand. Mit wenigen Zügen leerte er ihn, raschelte mit dem kleingeschnittenen Zeitungspapier, das als Klopapier diente, und lief rasch in den Hof hinunter zu den Aborten.
Als er sah, dass seine Mutter ihr Fahrrad mühsam aus dem Keller hinaufschleppte, brummte er: „Hättst wat seggt, ich hev di hulfen7“. Doch Gerda schnappte gereizt zurück, dass es schon spät sei und dass sie dringend los müsse und er sich auch beeilen solle. „Un i mütt mi jo omtrecken!8“ Punkt sieben war Arbeitsbeginn in der Küche und vorher musste sie Rock und Bluse in den Spind hängen, in den Kittel schlüpfen und sämtliche Haare fest unter das Häubchen stecken.
Achselzuckend verschwand Otto in einem der Aborte auf dem Hof, den sich die Mieter der Häuser sechs bis zehn teilten.
Gerda stieg schwungvoll auf ihr Rad und radelte durch die Toreinfahrt hinaus auf die Löwenstraße. Dieses Fahrrad war wirklich das beste Geschenk, das Gustav ihr jemals machen konnte! Sie war viel schneller auf der Arbeit, konnte rasch nach Feierabend ihre Schwester Meta in Barmbeck besuchen oder abends mal zu Agnes zu Bankier Habermann am Innocentiapark radeln.
Natürlich waren alle Geschenke von Gustav schön gewesen: das rote Hütchen mit dem schwarzen Samtband, das er ihr zum letzten Geburtstag im April geschenkt hatte. Die Armbanduhr zum Weihnachtsfest, die sie nur sonntags anlegte oder an den Tagen, an denen Gustav zu Besuch kam. An allen anderen Tagen ruhte die zierliche Uhr mit dem feinen Gliederarmband in dem mit rotem Samt ausgeschlagenen Kästchen. Juwelier Brandes, Mönckebergstrasse 3, Hamburg stand in goldenen Buchstaben im Deckel. Ihre Tochter war damals vor Stolz fast geplatzt, als Gustav Henriette vor Weihnachten in die Stadt mitgenommen hatte, damit sie das Geschenk mit ihm zusammen aussuchte. Aber das rote Damenfahrrad mit dem Korb am Lenker war wirklich das Allerbeste!
Sonnabends hatte Gerda schon um halb zwei Feierabend. Gustav hatte versprochen, sie mit den beiden jüngeren Kindern spätestens um drei abzuholen, um einen Ausflug in den Hamburger Stadtpark zu unternehmen. Gerda lächelte. Ein ganzer Nachmittag mit Gustav. Als ihr einfiel, dass er wieder die leidigen Fragen nach Fortgehen und Unterbringung von Grete anschneiden würde, verzog sie böse das Gesicht. Ach was, sagte sie sich. Er wird uns diesen Tag doch auch nicht verderben wollen. Sie würde ihn stattdessen überreden, am Stadtparksee ein Boot zu mieten und in einem Restaurant einzukehren.
Obwohl ihr eigentlich egal war, was sie aß, liebte sie es, unter verschiedenen Sorten Kuchen und Torten auswählen zu können, und später jovial vom Kellner gefragt zu werden, ob es den Herrschaften geschmeckt habe? In solchen Momenten fühlte sie sich endlich mal wie Jemand. Sie konnte nur hoffen, dass Grete sich bis heute Nachmittag erholt hatte. Doch wenn nicht, musste Henriette eben mit der Kleinen zu Hause bleiben. Gerda konnte sich deren Enttäuschung zwar ausmalen, aber das wäre dann eben nicht zu ändern. Auf keinen Fall würde sie auf ihren Ausflug mit Gustav verzichten!
Seit Wochen war das Sommerfest in der Schrebergartenkolonie Henriettes Lieblingsgesprächsthema. Gisela wollte Henriette die „Haare machen“ und Henny sollte irgendwas an Giselas Kleid ändern. Enger oder weiter machen, Gerda hatte nicht hingehört, wenn die beiden kichernd und tuschelnd in der Ecke saßen. Du liebe Güte, die beiden Mädchen waren noch so jung! Gerda erinnerte sich, wie albern sie und ihre Schwestern Meta und Agnes in dem Alter gewesen waren. Allerdings währten diese unbeschwerten Momente nie lang, dafür waren Mutter und Vater zu streng, der elterliche Hof zu arm und die Arbeit dort zu hart gewesen.
Wie glücklich und stolz war die kleine Gerda Meier gewesen, als der „schöne“ Hans Sienknecht, der Sohn des Schmieds aus dem Nachbardorf, endlich um ihre Hand angehalten hatte. SIE hatte ihn bekommen – groß und stattlich hatte ihr Verlobter neben ihr gestanden und jeden aus der kleinwüchsigen Meier-Sippe auf ihrem kärglichen Hof um mehr als zwei Köpfe überragt. Für Gerda war die Heirat damals die einzige Möglichkeit gewesen, dem elterlichen Hof zu entkommen, den der älteste Bruder übernommen hatte und der gerade nur genug abwarf, um dessen Familie und den Altbauern mehr schlecht als recht zu ernähren. Jeder weitere Fresser war lästig. Gerdas Arbeitskraft zur Erntezeit und in den Ställen war natürlich jederzeit hochwillkommen gewesen, aber sowohl Schwägerin als auch Bruder und Eltern zeigten Gerda und deren jüngerer Schwester Agnes, wer auf diesem Hof jetzt das Sagen hatte. Mit Argusaugen wurde jeder Bissen beobachtet, den man sich bei Tisch nahm.
Und dann hatte Hans endlich beim Vater um ihre Hand angehalten. Im September 1909 hatte die einundzwanzigjährige Gerda Meier überglücklich in ihrem besten Kleid neben Hans Sienknecht in der kleinen Dorfkirche in Fahrenkroog gestanden und einen kleinen Feldblumenstrauß an ihre magere Brust gepresst. Mit seinen kräftigen Armen versprach ihr Bräutigam Schutz und Sicherheit. Hans‘ blaue Augen blitzten und er hatte fröhlich gelächelt, bevor er dem Pastor laut und deutlich versprochen hatte, ihr treu bis in den Tod zu sein. Danach hatte er ihr einen herzhaften Kuss mitten auf den Mund gegeben und in die Runde gestrahlt. „Mien seute Gerda is de scheunste Deern9.“ Ihr Herz hatte so laut geklopft wie noch niemals zuvor.
Zur Feier des Tages hatte die Altbäuerin eine Suppe aufgetischt, in der ausnahmsweise ein paar Fleischstücke, kleine Mehlklößchen und Karottenscheiben herumschwammen. Der Vater hatte tatsächlich eine Flasche von seinem kostbaren Selbstgebrannten hervorgeholt, auch wenn er sich selbst dann aber am großzügigsten davon bedient hatte. Ängstlich beobachtet von den Frauen des Hofes, wussten sie doch alle, wie bösartig der alte Meier werden konnte, wenn er einen in der Krone hatte. Doch Gerdas Vater hatte nur stumpf brütend in seiner Ecke gesessen, als die Frischvermählten nach dem Hochzeitsessen die hölzerne Truhe mit der Aussteuerwäsche aus dem Mädchenzimmer in die Kammer trugen, die der Neubauer Schwester und Schwager zugewiesen hatte und die in früheren Jahren vom Großknecht bewohnt worden war.
Gerdas Hochzeit war für ihre älteste Schwester Meta der einzige Grund gewesen, dem elterlichen Hof nach mehreren Jahren Abwesenheit wieder einmal einen Besuch abzustatten. Denn die Älteste hatte schon vor einiger Zeit nach Hamburg geheiratet und war nun die Frau von Tischlermeister Papendieck.
Gut hatte Meta damals bei Sienknechts Hochzeit ausgesehen, mit frohem Gesicht und runden Wangen war sie vom Fuhrwerk gestiegen, auf dessen Seiten der Schriftzug prangte: Tischlerei Papendieck, Hamburg-Barmbeck. Später, an der Tafel beim Hochzeitsessen hatte Meta von ihrem Leben in der großen Stadt geschwärmt und Schwestern und neu angeheirateter Schwager hatten an ihren Lippen gehangen. Schüchtern hatte Gerda immer wieder den guten festen Stoff von Metas Kleid mit ihren schwieligen Händen befühlt, während ihre Schwester wortreich das Haus, das neben der Tischlerei lag, beschrieben hatte. Es klang alles fast märchenhaft!
„Überlegt es euch doch“, hatte Meta gesagt, als sie am nächsten Morgen das Pferd anschirrte, um heimzufahren. „Arbeiten muss man in Hamburg auch, geschenkt kriegst nirgends was. Aber es ist besser, als sich von denen da“ abfällig hatte sie mit dem Kopf auf Bruder und Schwägerin gedeutet, die mit finsterem Mienen unter der Haustür standen, „als sich vom eigenen Bruder als Magd herumschubsen zu lassen.“
Dieser Satz war Gerda wochenlang im Kopf herumgegangen. Einen eigenen Hausstand zu haben und keine Mutter, die ständig herumgiftete, weil Hans mal wieder laut pfeifend über den Hof gegangen war. Misstrauisch beäugt von der Sippe - wie konnte man von früh bis spät hart arbeiten und dabei auch noch fröhlich sein? Hamburg hatte immer mehr wie ein Zauberwort in ihren Ohren geklungen. Keine Schwägerin mehr, die bei jeder Scheibe Brot, die man aß, laut seufzte und zögerte, bevor sie den Brotkorb widerwillig weiter reichte. Nicht nur eine ärmliche Kammer haben, sondern in einer richtigen Wohnung mit einer eigenen Küche wohnen!
Spätabends, wenn sie mit Hans im Bett gelegen hatte, wurde über die Möglichkeit beratschlagt und geflüstert, auch in die Stadt zu ziehen. Ob man dort wirklich so leicht Arbeit finden konnte, wie Meta behauptet hatte?
Der Winter auf dem ärmlichen Hof mit seinen unfreundlichen Besitzern war grau und düster gewesen und sogar der stets fröhliche Hans Sienknecht hatte irgendwann seine gute Laune verloren. Also hatte er im Januar neunzehnhundertzehn seine wenigen Habseligkeiten zusammengeschnürt und war nach Hamburg gefahren. Meta hatte in ihrem Brief zu Weihnachten von ihrem Mann ausrichten lassen, dass Schwager und Schwester jederzeit willkommen wären im Hause Papendieck.
An einem bitterkalten Februartag hatte Hans Sienknecht das erste Mal vor dem großen Tor der Straßenbahnwerkstätten am Falkenried gestanden und zögernd die hineinströmenden Arbeiter beobachtet. „Für einen guten Schmied findet sich da immer eine Stelle!“
Eine halbe Stunde zuvor hatte der Schwager Pfeife rauchend mit ihm auf dem Hof der Tischlerei gestanden und ihm Mut gemacht, bevor er ihm noch einmal ganz genau den Weg von Winterhude nach Hoheluft erklärt hatte. Staunend über das geschäftige Treiben und die Menschenmengen war Hans schließlich am Winterhuder Marktplatz in den Pferdeomnibus gestiegen und an der Haltestelle Lehmweg wieder ausgestiegen, um den kurzen Weg zu den Straßenbahnwerkstätten zu Fuß zurückzulegen.
Hier und da fuhren noch Pferdebahnen in Hamburg, aber als aufstrebende Großstadt wollte man gleichziehen mit anderen Metropolen, deshalb wurde die Straßenbahn elektrifiziert. Neue Waggons wurden dafür gebaut und für diese Arbeiten wurden in den Straßenbahnwerkstätten Falkenried kräftige Männer wie der Schmied Hans Sienknecht gebraucht.
Während Hans in Hamburg arbeitete, bei Schwager und Schwägerin wohnte und eisern jeden Pfennig sparte, wurde am vierten Mai neunzehnhundertzehn sein erstes Kind auf dem Hof in Fahrenkroog geboren. Ein kräftiger Junge, der auf den Namen Ottokar getauft und Otto genannt wurde. Verzweifelt hatte Gerda ihr Kind nach der Geburt an sich gedrückt, doch die wenigen Tropfen Milch aus ihren Brüsten waren viel zu wenig für den hungrigen Jungen gewesen. „Dat ward jo jümmers scheuner – nu schall we ook no diene Görn dorch futtern?10“ hatte die Schwägerin geschimpft, als sie ihr die Milchkanne brachte. Weinend hatte Gerda einen Brief an Meta geschrieben, dass sie es hier auf dem Hof nicht mehr aushalten könne. An einem späten Nachmittag im September 1910 war dann endlich das lang ersehnte Hufgetrappel erklungen und Hans mit dem von Papendiecks geliehenen Fuhrwerk auf dem Hof erschienen, um Frau und Sohn abzuholen, den er vorher nur einmal flüchtig gesehen hatte.
Albert Papendieck hatte Hans geholfen, eine der kleinen Wohnungen zu mieten, die für die Arbeiter der Werkstätten errichtet worden waren.
„Un wenn ich opn Kohlnsack schlopen muss – blots wech vun heer11!“ Mit diesen Worten war Gerda auf den Wagen geklettert. Außer der jüngsten Schwester Agnes hatte Sienknechts niemand beim Aufladen der wenigen Habseligkeiten geholfen und Gerda war froh gewesen, als das Fuhrwerk endlich auf die Chaussee in Richtung Hamburg eingebogen war.
Wie sauber und ordentlich war Gerda die kleine Siedlung in der Löwenstraße beim allerersten Anschauen erschienen! Zweistöckige Häuserzeilen mit acht Eingängen für jeweils sechs Wohnungen standen einander gegenüber, dazwischen frisch angepflanzte winzige Bäumchen, die zukünftig für ein bisschen Grün und Schatten im Hof sorgen würden. Dort befanden sich auch die Wasserstelle, die Gemeinschaftsaborte und die Wäschestangen.
Küche und zwei Zimmer - groß und geräumig war Gerda ihr Heim im ersten Obergeschoß beim Einzug vorgekommen. Otto, die zwei Jahre später geborene Henriette und der Jüngste, Karl, schliefen im hinteren Zimmer, Hans und Gerda im Zimmer neben der Küche. Zum Einzug hatten Hans und Albert Papendieck das getischlerte Ehebett in die Wohnung getragen. „Unser nachträgliches Hochzeitsgeschenk.“ Tischlermeister Albert Papendieck rückte das Möbel hin und her, bis er mit dem Platz zufrieden war und klopfte bedächtig seine Pfeife auf der Fensterbank aus. Meta überreichte den beiden ein selbst besticktes Kissen. Gerdas bescheidene Aussteuer, die aus einigen Betttüchern, Handtüchern und Laken bestanden hatte, wurde in der hölzernen Truhe aus Gerdas Mädchenzimmer aufbewahrt und in der nächsten Zeit nach und nach ergänzt.
In der Küchenecke stand ein Kohleherd, Meta zeigte Gerda die Geschäfte, wo sie Kelle, Sieb und andere Küchenutensilien kaufen konnte. Hans brachte Nägel an und Gerda hängte ihre neuen Küchengeräte über den Spülstein.
In der Speisekammer lagerten Kartoffeln, Zwiebeln und Äpfel aus Papendieck‘ Garten, außerdem die Flasche Birnenschnaps, die der Vater zum Abschied seiner zweitältesten Tochter dann doch noch wortlos auf den Wagen gereicht hatte. Im hinteren Zimmer stand in einer Ecke ein kleiner Ofen, dessen Abwärme die Wand des dazwischenliegenden Zimmers wärmte. In frostigen Winternächten wuchsen im Kinderschlafzimmer trotzdem von innen Eisblumen an den Fenstern.
Vom ersten Moment hatte Gerda sich wohl in der neuen Wohnung gefühlt. Es war so schön gewesen, mit ein paar Gardinen und Kissen ein Heim zu schaffen und sich beim Wäscheaufhängen unten im Hof mit anderen Frauen zu unterhalten, die auch kleine Kinder am Rockzipfel hängen hatten. Familie Sienknecht war schnell beliebt gewesen, Hans hatte hilfsbereit zugepackt, wenn es irgendwo in der Nachbarschaft nottat. Gerda war darauf bedacht gewesen, dass ihre Kinder sauber und ordentlich gekleidet und höflich zu Erwachsenen waren. Stolz hatte sie oft mit Otto, Henriette und Karl am Tor gewartet, um Hans von der Arbeit abzuholen.
In diesen Jahren vor dem Krieg war Gerda mit ihrem Leben rundum zufrieden gewesen. Hans hatte gutes Geld verdient, sehr selten nur war er mit seinen Kollegen auf ein Bier in Knopf’s Wirtschaft in der Löwenstraße gegangen. Den größten Teil seines Lohnes hatte er jede Woche pünktlich nach Hause gebracht. Gerda hatte sich ein Bügeleisen gekauft und Bügelarbeiten für feine Leute angenommen. An den Wochenenden hatten sie Papendiecks besucht, die zu ihrer großen Trauer keine eigenen Kinder bekamen, und dort um den großen runden Tisch gesessen. Liebevoll hatten Onkel Albert und Tante Meta sich um Otto, Henriette und Karl gekümmert. Meta verwöhnte Neffen und Nichte mit Selbstgebackenem, während der Onkel ihnen hölzernes Spielzeug schenkte.
Auch Agnes, die jüngste Meier-Tochter, hatte den elterlichen Hof inzwischen verlassen. Bei ihrem allerersten Besuch in Hamburg hatte es zwischen ihr und einem Schaffner der Pferdebahn gefunkt. Willi Herder trug seine Uniform mit großem Stolz und Agnes fuhr nur noch einmal auf den elterlichen Hof, um ihre dürftigen Habseligkeiten und die kleine Aussteuer zusammenzupacken.
„Wat ihr alle midde S-tadt hebbt. Als ob de Peng dor op de Stroot leegen deiht…“12 Weder Vater noch Mutter hatten der jüngsten Tochter zum Abschied gewinkt und Agnes hatte Meta gebeten, das Pferd anzutreiben und schnell loszufahren. „Hier kumm ich nech wedder heer!13“
Albert Papendieck war auch seiner Schwägerin Agnes behilflich gewesen, eine Stellung als Dienstmädchen bei Bankier Habermann zu finden, der ein guter und regelmäßiger Kunde der Tischlerei war.
Viertel vor sieben – Gerda rollte an der Polizeiwache Hoheluft vorbei, jetzt war es nicht mehr weit zur Arbeit. An der nächsten Ecke ragte schon das große Gebäude der Zigarettenfabrik mit seinen großen Maschinensälen auf. Hunderte von Menschen, die hier ihren Arbeitsplatz hatten und mittags von der Werksküche versorgt wurden. Da heute Bratkartoffeln mit Rührei auf dem Speiseplan standen, würde Gerda bestimmt den ganzen Vormittag mit dem Schälen von Kartoffeln und Zwiebeln verbringen. Um halb zwölf kamen die Arbeiter in die Kantine, die bis um zwölf aßen. Danach hatten die Angestellten die Kantine bis viertel vor eins für sich.
Wenn alle ordentlich mit anpackten, konnte das Küchenpersonal am Sonnabend um halb zwei auch endlich Feierabend machen.
Erst drei Jahre zuvor, nämlich im Jahr 1925, hatten die ägyptischen Brüder Kyriazi eine moderne Zigarettenfabrik im Hamburger Stadtteil Hoheluft erbaut. Dort wurden Orientzigaretten aus ägyptischen Tabaksorten hergestellt, die in kleinen Blechschachteln verkauft wurden, in denen jeweils sechs Zigaretten lagen. Außerdem enthielten diese Schachteln kleine bunte Bildchen, die bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebte Sammelobjekte waren. Auch der sechsjährige Johann, Gerdas jüngster Sohn, bettelte immer um neue Bildchen, die er dann mit seinen Freunden tauschte.
Gerda kniff ihre Lippen zusammen, als sie an Johann dachte. Wäre er doch nie geboren worden!
Sie schluckte – hatte sie eine Wahl gehabt?
Nein, ganz bestimmt nicht. Energisch trat sie in die Pedalen.
Bei Kriegsausbruch hatten Gerda und Agnes Mann und Verlobten zum Bahnhof begleitet. Stolz war Gerda neben ihrem Hans hergelaufen, der auszog, für sein Vaterland zu kämpfen. Der vierjährige Otto hatte über die vielen Soldaten auf dem Bahnhof gestaunt, Henriette hatte ein Blumensträußchen in der Hand gehalten. Der einjährige Karl war auf Vatis Schultern geritten – „hüa, Per, hüa“ und hatte den Überblick von dort oben genossen.
Hans hatte Gerda zum Abschied ganz fest im Arm gehalten und sie lachend getröstet: „Wirst sehen, mien Seuten, dat duuert nich lang. Wiehnachten bin ük wedder to hus.14“
Agnes hatte sich bei ihrem Verlobten Willi eingehakt und ihm mit tränenfeuchten Augen nachgeblickt, als er mit Hans in den Zug stieg. Gerda hatte fröhlich ein Papierfähnchen geschwenkt und war neben dem Zug hergelaufen, bis er zu schnell geworden war. Auch mit gutem Zureden hatte Henriette ihr kleines Sträußchen dem Vati nicht mitgeben wollen und die welken Blütenköpfe abends ganz vorsichtig auf ihr Kopfkissen gelegt.
Je mehr Männer in den Krieg zogen, verwundet wurden oder überhaupt nicht mehr wiederkamen, umso mehr Arbeitsplätze in Werkhallen und an Maschinen mussten mit Frauen besetzt werden. Auch die Straßenbahnwaggons wurden schließlich gebraucht und jede Hand hatte geholfen. Für richtig schwere körperliche Arbeit war Gerda Sienknecht nicht geeignet, denn sie war nicht größer als ein zwölfjähriges Kind und hatte nur knapp an die Werkbänke herangereicht. Aber sie hatte gute Augen und geschickte Finger, außerdem war sie immer fleißig und ordentlich und wurde deshalb zu feinmechanischen Arbeiten herangezogen.
Wie ihre Nachbarinnen, deren Männer auch im Krieg waren und die ebenfalls kleine Kinder zu versorgen hatten, brachte Gerda nun Otto, Henriette und den kleinen Karl während der langen Arbeitsstunden zu „Mudder15 Böhm“, die ein paar Häuser weiter in einer größeren Wohnung lebte und sich für ein paar Pfennige um die Nachbarskinder kümmerte.
Gerda radelte weiter. Merkwürdig, ausgerechnet an einem so heißen Tag an die kalten Kriegswinter zu denken. Wie hungrig und abgemagert waren sie damals alle gewesen! Wie kalt war es in der Wohnung! Wie einsam hatte Gerda sich oft gefühlt. Wieviel Angst hatte sich von Kriegsjahr zu Kriegsjahr in ihr Herz geschlichen, sah man doch überall, mit welchen schweren Verwundungen die Männer heimkamen. Oder man traf schwarzgekleidete Nachbarinnen, die mit verweinten Augen und abgewendeten Gesichtern nur noch stumm nickten. Fragen mochte man damals gar nicht mehr.
Und dann diese schrecklichen Hamsterfahrten über Land, um überhaupt etwas Essbares aufzutreiben! Oft hatte Gerda Angst gehabt, am Bahnhof in diesem Gewühle und Gedrängel zerquetscht zu werden und drei kleine Kinder mutterseelenallein zurückzulassen. Und das Ganze für ein paar welke Kohlköpfe, ein Bund verschrumpelter Möhren oder ein paar Steckrüben. Kartoffeln, Eier und Milch waren meistens überhaupt nicht zu bekommen gewesen.
Am schlimmsten war Gerda ein Nachmittag im Winter 1917 in Erinnerung. Die Rationen, die es auf Marken zu kaufen gab, waren stetig kleiner geworden. So hatten Meta und sie schweren Herzens beschlossen, dem elterlichen Hof in Fahrenkroog doch noch einmal einen Besuch abzustatten. Den kleinen Karl hatten sie auf dem Wagen mitgenommen, während Schwager Albert auf Otto und Henriette aufgepasst hatte. Albert war als nicht kriegstauglich eingestuft worden, und sein Betrieb hatte weitergehen müssen. Das Heer hatte Munitionskisten gebraucht, außerdem war der Bedarf an Särgen stetig angewachsen. Neue Möbel hatte in diesen Kriegsjahren natürlich kaum noch jemand bestellt.
Meta hatte das Fuhrwerk vorsichtig über die teilweise vereiste Chaussee gelenkt und erzählt, dass einige Nächte zuvor Einbrecher das Pferd aus dem Stall zu stehlen versucht hatten.
„Bestimmt wollten sie den Gaul zu Wurst verarbeiten“. Ungläubig hatte Gerda ihren Kopf geschüttelt, während Meta das Tier angetrieben hatte. Was der Hunger aus den Menschen machte! „Diebe und Mörder.“
Gut dreißig Kilometer auf der windigen Chaussee hatten vor ihnen gelegen, immer wieder war Meta abgestiegen und hatte das Pferd im Schritttempo über eisige Stellen führen müssen.
Der Empfang durch Eltern, Bruder und Schwägerin war noch kälter als befürchtet ausgefallen. Mürrisch und unfreundlich wurde behauptet, dass man selbst nicht mehr genug zu essen hätte. Sogar als Gerda der Großmutter den kläglich weinenden Karl entgegengestreckt hatte und wenigstens um etwas Milch für den kleinen Jungen bat, hatte es nur die kurze Antwort gegeben, dass die Städter sich doch sonst auch immer für was Besseres hielten.
Wütend hatte die Schwägerin hervorgestoßen: „Un nu kümmst an un wullst Milch för dien Kinners hebben. Wi hebbt jo sölber nix. Pack dien Gör inn un aff vunn mien Hoff. Bi uns brukst nech wedder betteln kümm!“16.
Wohlgenährt waren Gerda und Meta die Gesichter vorgekommen, die ihnen finster durchs Fenster nachgesehen hatten. Auf jeden Fall wohlgenährter als Sienknechts und Papendiecks. Beide Schwestern hatten sich endgültig geschworen, nie wieder einen Fuß auf den elterlichen Hof zu setzen.
„Mien Hoff deit de Olsch seggen. Dat is ja woll de Hoff von unsern Bruder, nicht ehr Egendom, “17 hatte Gerda fassungslos hervorgestoßen.
„Nicht mal zum Begräbnis von Vater oder Mutter fahr ich da noch mal hin“, hatte Meta bekräftigt und ihrer Schwester aufmunternd in die Seite geknufft. „Wir treiben noch was Essbares auf, lot mi man moken.18“
Sie waren von der Chaussee abgebogen und auf einem ziemlich abseits gelegenen Gehöft hatte eine mitleidigere Bauersfrau als die garstige Schwägerin es war, das Sagen gehabt. Natürlich hatten auch deren Augen gierig geglitzert, als sie die feinen Tischdecken aus Gerdas Aussteuer und Metas silbernes Besteck gesehen hatte, aber immerhin konnten sie dafür einen viertel Liter Milch, einige Eier und zwei kleine Kohlköpfe eintauschen. Das Beste war aber ein kleines Stück Speck gewesen, das Meta und Gerda sich geteilt hatten. So war der lange Tag auf dem offenen Wagen bei eisigen Temperaturen und Schneegriesel wenigstens nicht ganz umsonst gewesen.
Im Frühling 1918 war Hans Sienknecht schwer verwundet aus dem Krieg zurückgekommen. Granatsplitter hatten sein Bein so zerfetzt, dass es unterhalb des rechten Knies amputiert werden musste. Körperlich hatte Hans sich trotz der schweren Verletzungen erstaunlich schnell erholt und lernte bald, geschickt mit seinen Krücken zu gehen.
Seinen plötzlich erwachten Jähzorn und die wachsende Ungeduld hatte Gerda zunächst auf die Schmerzen in dem Beinstumpf geschoben. Doch bald hatte sie einsehen müssen, dass es nicht die Schmerzen waren, die ihren Mann zur Verzweiflung brachten. Es waren die Schreie seiner sterbenden Kameraden, denen er nicht helfen konnte, die ihn jede Nacht bis in seine Träume verfolgten. Der Geruch nach Tod und Gas, den er ständig zu riechen meinte. Die Angst zu ersticken – all das sollte ihn den Rest seines Lebens nicht mehr loslassen.
Ihr ehemals hünenhafter Mann magerte ab, wurde unberechenbar und bösartig. Unkontrolliert zitterten seine Hände, stundenlang saß er dumpf brütend am Küchentisch. Wurde er angesprochen, schrak er auf und fing entweder an zu schreien oder begann wie ein kleines Kind zu weinen. Nachts wurde er von Weinkrämpfen geschüttelt, nässte ein wie ein Säugling. Otto, Henriette und Karl starrten den fremden Mann entsetzt an und liefen lieber nach draußen zum Spielen als sich lange mit ihm in einem Zimmer aufzuhalten.
Gerda konnte ihre Kinder tagsüber nicht mehr bei Mudder Böhm abgegeben, denn deren eigener Sohn war auch schwer krank aus dem Krieg heimgekommen. Fremde Kinder duldete er nicht mehr in der Wohnung. Ängstlich war Gerda Morgen für Morgen zur Arbeit gegangen und hatte ihre drei Kleinen in der Obhut des Vaters zurücklassen müssen. Es hatte Tage gegeben, da hatte er ganz friedlich mit den Kindern zusammen am Küchentisch gesessen und ihnen erklärt, welche Vögel draußen sangen oder dass die rotbraunen flinken Tierchen mit den buschigen Schwänzen Eichhörnchen hießen. An anderen Tagen jedoch hatte er sich mit starrem Blick stundenlang an den Kindern festgekrallt. Otto mühte sich verzweifelt, dem eisernen Griff zu entkommen, Henriette machte sich stocksteif und der kleine Karl brüllte aus Leibeskräften, bis die Nachbarn angelaufen kamen. Hans Sienknecht konnte oft nicht verstehen, was die Fremden in seiner Küche wollten und wer die drei Kinder waren, die mit verweinten Augen ängstlich hinter dem Küchensofa kauerten.
Verzweifelt hatte Gerda bald begreifen müssen, dass Hans nie mehr der Mann sein würde, den sie einmal geheiratet hatte und der voller Stolz auf sein Vaterland in den Krieg gezogen war.
Sicher würde es ihm helfen, tagsüber irgendeine Aufgabe zu haben. Doch wer sollte einem wie ihm Arbeit geben, auch wenn er seine Zornesausbrüche nie in Gegenwart von Fremden hatte? Würde sich das ändern, wenn er wieder regelmäßig unter Leute kam oder würde er auch dort über kurz oder lang zu streiten beginnen? Die Straßen waren doch voller Erwerbsloser und Kriegsversehrter, die alle um Arbeit bettelten. Welche Arbeit war ihm überhaupt noch zuzumuten?
Der Meister, mit dem er vor dem Krieg in den Straßenbahnwerkstätten zusammengearbeitet hatte, kannte Hans Sienknecht als tüchtigen Arbeiter. Erwin Hildebrandt hatte großes Mitleid mit der kleinen Gerda, auf deren schmalen Schultern nun die Verantwortung für eine fünfköpfige Familie lag. Deshalb half er Hans bei der Suche nach einem Arbeitsplatz und dank seiner Fürsprache konnte Gerdas Mann im Januar 1919 als Straßenbahnschaffner anfangen. Er fuhr auf der Linie zwei, die von der östlich gelegenen Stadt Wandsbeck durch die gesamte Hamburger Innenstadt bis hinaus nach Niendorf und Schnelsen fuhr. In friedlichen Momenten scherzte Hans manchmal, dass er „nun endlich wieder eine Uniform tragen dürfe“ und mit der großen Umhängetasche für das Wechselgeld „doch wenigstens ein paar Stunden lang ein reicher Mann“ sei. Gerda hatte gelächelt und gehofft, dass die Zeit die Wunden heilen würde.
Auch wenn die Kinder nun tagsüber sich selbst überlassen waren, war es die beste Lösung für die ganze Familie gewesen. Otto und Henriette gingen in die Schule und der dreijährige Karl musste dann eben bis mittags allein in der Wohnung bleiben, während Vater und Mutter arbeiteten.
In den ersten Monaten ging Hans voller Stolz, gestützt auf seine Krücken, jeden Morgen pünktlich zur Arbeit. Je mehr er sich jedoch wieder an Arbeit und Kollegen gewöhnte, umso stärker waren Unmut und Wut wieder gewachsen. Völlig ohne Grund begann er Kollegen und später auch Fahrgäste anzupöbeln. War ein Mann jung und gesund, wurde er von Hans Sienknecht als Drückeberger und Vaterlandsverräter beschimpft. Anfänglich versuchten seine älteren Kollegen, ihn abzulenken und beruhigend auf ihn einzureden, doch schnell wurde Hans zum unbeliebten Sonderling, der abseits stand und dessen gehässige Bemerkungen niemand mehr hören wollte.
Im November 1919 war es nach einer Pause an der Endhaltestelle Wandsbecker Marktplatz zu einer Rangelei mit einem Fahrgast gekommen. Völlig außer sich hatte Hans Sienknecht den angetrunkenen Mann am Einsteigen hindern wollen. Der Betrunkene wehrte Hans ab, beruhigend sprach ein Kollege auf Hans ein und wollte ihn fortziehen. Der feste Griff musste Hans so erschreckt haben, dass er sich mit einer heftigen Bewegung von ihm losreißen wollte. Dabei hatte er die Krücke verloren, war gestrauchelt und auf die Fahrbahn gestürzt. Vor den Augen seiner entsetzten Kollegen wurde er von einem vorbeifahrenden Pferdefuhrwerk überrollt.
Schwerverletzt war Hans Sienknecht ins Marienkrankenhaus nach Hamburg-Hohenfelde gebracht worden. Seine verzweifelte Frau hatte während der kurzen nachmittäglichen Besuchszeiten regungslos an seinem Bett gesessen, seinen bandagierten Kopf betrachtet und stumm gebetet, dass ihr Mann wieder aufwachen möge. Ohne jedoch noch einmal das Bewusstsein wieder zu erlangen, war Hans Sienknecht eine Woche später gestorben. Als er seine Augen für immer schloss, hatte Gerda auf einer Kiste an der Werkbank in der Fabrikhalle gestanden und Drahtrollen gelötet. Meister Hildebrandt hatte sie gerade noch auffangen können, als er ihr die Nachricht überbrachte.
Ohnmächtig war sie in seine Arme gesunken.
Gerda konnte sich später nicht mehr daran erinnern, wie sie die nächsten Wochen überstanden hatte. Meta hatte sich der Kinder angenommen und mit dem Meister gesprochen, damit sie bei der Arbeit frei bekam. Schwager Albert hatte einen Sarg getischlert und sich um die Beerdigung gekümmert. Irgendwann war er mit seinem Fuhrwerk gekommen, hatte den Sarg aufgeladen und war mit Gerda, Meta und Agnes zum Friedhof gefahren. Kollegen von der Straßenbahn hatten dort im Novembernebel gestanden, verlegen ihre Mützen in den Händen gedreht und ihr versichert, dass sie ihren Mann nie vergessen würden: „Warrn fien Kerl, dien Hans.19“
Wie vorher auch, war Gerda morgens aufgestanden, hatte die Kinder geweckt und versorgt und war danach zur Arbeit gegangen. Doch richtige Erinnerungen an diese Zeit hatte sie nicht.
So angenehm es gewesen war, nur über die Straße gehen zu müssen, um am Arbeitsplatz zu sein, so froh war Gerda heute, dass Gustav ihr die Arbeit als Küchenhilfe bei Kyriazi besorgt hatte. Die Arbeit war körperlich zwar nicht leichter, aber hier verdiente sie drei Pfennige mehr in der Stunde und durfte dann und wann übriggebliebene Lebensmittel für ihre Familie mit nach Hause nehmen. Es war wunderbar, einen Freund wie Gustav zu haben. Auch wenn er mit einer anderen Frau verheiratet war, hätte sie oft nicht gewusst, wie sie ohne ihn über die Runden gekommen wäre.
Gerda bog in den großen Fabrikhof ein, winkte ihrer Kollegin Ruth zu und stellte ihr Rad ab.
„Moin“, Ruth nickte ihr zu: „Is dat nich ne Affenhitze? Scheun, dat hüt Samstach is, nur n halben Dag arbeiten20.“
Gerda nickte – trotz der frühen Morgenstunde war es wirklich schon wieder sehr warm.
Die beiden Frauen beeilten sich mit dem Umziehen, in fünf Minuten war Arbeitsbeginn. Wer dann nicht an seinem Platz stand, bekam vom Lohn abgezogen – das konnte sich keine von ihnen leisten.
Ruth und Gerda waren noch nicht durch die schwere Küchentür getreten, da umfingen sie schon die wabernden warmen Essensdünste und ein scharfer Anpfiff von Mahler, dem Küchenchef:
„Kinners, mok de Dör dicht, dat treckt wie Hechtsubbe.21“ Gerda konnte ein durchweichtes Stück Zeitungspapier, in dem offensichtlich Fisch eingewickelt gewesen war und das auf den Boden wehen wollte, gerade noch auffangen, bevor es Mahler ins Gesicht flog.
Seufzend eilte Ruth an den großen Herd und Gerda nahm ihren Platz an den emaillierten Spülbecken ein. Eigentlich war Mahler sogar ganz nett, er brüllte nur gern herum und spielte den großen Mann. „Wenn du fertig mit Abwaschen bist,“ Mahler trat hinter Gerda, „dann schälst du Kartoffeln. Und beeile dich.“ Mit dem Kopf deutete er auf den großen Bottich und Gerda nickte, bevor sie den Wasserhahn aufdrehte und das Wasser in das Abwaschbecken plätschern ließ. Lächelnd prüfte sie die Temperatur und weichte die Tassen ein. Nur noch ein paar Stunden und sie und Gustav würden im Stadtpark mit seinen schattigen Bäumen und dem kühlen Wasser sitzen. Während sie zum Lappen griff, sah sie Gustav mit seinem schiefen Lächeln vor sich.
4 Ja und? Was soll ich dabei machen? Ich muss gleich los!
5 und war ganz schön betrunken
6 Kleine
7 Hättest du doch was gesagt, ich hätte dir geholfen
8 Und ich muss mich ja umziehen
9 Meine süße Gerda ist das schönste Mädchen
10 Das wird ja immer schöner! Jetzt sollen wir auch noch deine Kinder mit durchfüttern?
11 Und wenn ich auf Kohlensäcken schlafen muss – nichts wie weg von hier
12 Was ihr nur alle mit der Stadt habt. Als ob dort das Geld auf der Straße liegen würde!
13 Hier komme ich nicht wieder her!
14 Wirst du sehen, meine Süße, das dauert nicht lange. Weihnachten bin ich wieder zu Hause
15 Mutter
16 Und jetzt kommst du an und willst Milch für deine Kinder haben. Wir haben doch selber nichts! Pack deine Kinder ein und verschwinde von meinem Hof. Bei uns brauchst du nicht wieder betteln kommen.
17 Mein Hof, sagt die Alte. Dabei ist das wohl der Hof unseres Bruders, nicht ihr Eigentum.
18 Lass mich mal machen
19 Dein Hans war ein feiner Kerl
20 Schön, dass heute Samstag ist, nur einen halben Tag arbeiten
21 Kinder, macht die Tür zu, es zieht wie Hechtsuppe
07:30 Morgenstund‘ hat Gold im Mund
Nicht weit von Zigarettenfabrik und Falkenriedterrassen entfernt, im Hamburger Stadtteil Winterhude, öffnete Gerda Sienknechts ältere Schwester Meta Papendieck weit die Fenster ihres Schlafzimmers, das Gottlob nach Norden zeigte und dank der dahinterliegenden Gebäude der Großwäscherei im Schatten lag. Im Winter war das oft ein Nachteil, weil es dann lausig kalt darinnen wurde, jetzt, in diesem brütend heißen Sommer, empfand Meta es als Wohltat.
Abgesehen davon, dass der Nachtschlaf in den letzten Wochen durch die Hitze nicht ganz ungestört verlief, liebte Meta Papendieck jedoch Sommer und Wärme. Allerdings bedeutete das auch, dass sie nachher viele Eimer Wasser in den Garten schleppen musste, der hinter der Tischlerei lag. Sonst würde das mit der Gemüse- und Obsternte in diesem Jahr nichts Rechtes mehr werden.
So froh Meta damals auch gewesen war, dem elterlichen Hof den Rücken kehren zu können und ihrem Mann in die Stadt zu folgen, so sehr hatte sie anfangs die Garten- und Erntearbeit vermisst. Dieses Wühlen in der Erde, die Freude, wenn im Frühjahr die ersten zarten Triebe hervorkamen und Blüten und Knospen sich allmählich in Früchte verwandelten.
Albert war zuerst ziemlich skeptisch gewesen, ob es seiner Frau tatsächlich gelingen würde, das brachliegende Grundstück hinter dem Haus wirklich in einen Garten zu verwandeln. Doch mit unerschütterlicher Geduld und großem Geschick hatte Meta gegraben, geharkt, gesetzt und gesät, gejätet und dem Boden am Ende tatsächlich Früchte und Gemüse abgetrotzt.
Im Krieg war dann auch Albert dankbar gewesen, Selbstgezogenes und Selbstgeerntetes essen zu können. In diesem Jahr nun gab es eine regelrechte „Gurkenschwemme“, bevor sie bei den herrschenden Temperaturen verdarben, wollte Meta heute Schmorgurken zum Mittagessen vorbereiten und den Rest einkochen. Wahrlich kein Vergnügen in der heißen Küche im warmen Essigdunst stehen zu müssen, aber die Gurken waren überreif und mussten schnellstens verarbeitet werden.





























