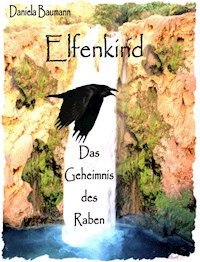
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein geheimnisvoller Rabe begleitet das Waisenmädchen Kristina schon seit ihrer Geburt vor etwa acht Jahren. In der Nähe des Waisenhauses, in dem sie lebt, lernt sie Gaagi kennen. Er ist der Häuptling einer kleinen Gruppe Diné, wie sich die Navajo selbst nennen. Sie sind auf der Flucht vor Soldaten und gelangen mit Hilfe von Kristina und dem Raben in eine geheimnisvolle Welt, in der sie allerlei Abenteuer erleben und einen schweren Kampf bestehen müssen, bis sie schließlich das Geheimnis des Raben lüften können. Auf ihrer Reise durch Kalima, diese andere Welt, in die sie gelangen, treffen sie auf Elfen, magische Wölfe, Elementare und viele verschiedene, fantastische Wesen. Außerdem auf einen Zauberer, der diese Welt seit Jahren unterdrückt, immer mit dem Ziel, noch mehr Macht zu erlangen. Letztendlich erkennen Gaagi und Yas, wie die Diné das Mädchen Kristina nennen, dass sie erst den Zauberer vernichten müssen, bevor sie ihre gefangenen Stammesmitglieder retten können. Werden die magischen Wesen, die sie dort treffen, ihnen helfen? Und können sie am Ende das Geheimnis des Raben tatsächlich lüften?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elfenkind - Das Geheimnis des Raben
Section 11. Ein seltsames Baby2. Unfall am Fluss3. Bei den Navajo4. Flucht in eine neue Welt5. Lagerleben6. Gaagis Rückzug7. Eine schicksalhafte Begegnung8. Der verschwundene Stamm9. Yáhzí10. Spuren im Schnee11. Adlerklaue12. Der Häuptling und der Grizzly13. Die Suche geht weiter14. Unerwartete Hilfe15. Der Spiegel aus Eis16. Neue Hoffnung17. Das unterdrückte Dorf18. Auf dem Weg zum Zauberschloss19. Ein Plan geht schief20. Die Elfenkönigin21. Ins Schloss hinein22. Der Zauberer Carimo23. Der Kampf gegen Carimos Anhänger24. Befreiung25. Zu den Diné26. Die Geschichte von Alemie und Tsé27. Die Befreiung der Diné28. Der Beginn eines neuen Lebens29. Bei den Kentauren30. ‘Ahé’éské – Hochzeit31. Verwandlung32. Ein neues Leben beginntWorterklärungen – ÜbersetzungenSection 1
Abschnitt 1
Daniela Baumann
Elfenkind
Elfenkind - Band 1
Daniela Baumann
Elfenkind
Das Geheimnis des Raben
Fantasy, Western
Eindruck
Texte: © 2019Copyright byDanielaBaumann
Umschlag:© 2021Copyright byDanielaBaumann
Verantwortlich
für den Inhalt: DanielaBaumann
Wiesenmühle 7
95632 Wunsiedel
Druck: epubli - ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Für meine Söhne, weil Ihr mir immer wieder neue Ideen geliefert und die Geschichte hart kritisiert habt!
Für meinen Mann, der mich in den beiden Jahren der Entstehung mehr als einmal mit den Charakteren dieser Geschichte teilen musste, aber dennoch an mich geglaubt hat!
Ich liebe Euch!
www.elfenkind.de.to
Facebook: Daniela Baumanns Ideenwelt
1. Ein seltsames Baby
Es war schon spät, als Mrs. Duncan, die Heimleiterin, ihren letzten Kontrollgang des Tages machte. Wie immer waren die Kinder in ihren Betten und schliefen tief und fest. Das Waisenhaus war stark überbelegt, fast doppelt so viele Kinder wie Betten hatte sie inzwischen hier, sodass sich immer öfter zwei Kinder ein Bett teilen mussten. Der Krieg war an den meisten Familien nicht spurlos vorübergegangen und daher hatten viele Kinder nun keine Eltern mehr und landeten bei ihr. Nicht wenige dieser Kinder hatten indianische Wurzeln, was es ihr sicher nicht leichter machen würde, diese zu vermitteln. Sie seufzte. Natürlich liebte sie die Kinder, aber am liebsten war es ihr, wenn sie sie vermitteln konnte und die Kleinen eine neue Familie bekamen. Dennoch, Kinder mit indianischen Wurzeln würden so schnell nicht genommen werden.
Die meisten Menschen in dieser Gegend waren den Indianern gegenüber sehr ablehnend. Wenn nicht sogar hasserfüllt. Obwohl in vielen Familien auch indianisches Blut war. Das war hier in Arizona nicht selten, aber es wurde abgestritten. Der Krieg zwischen den Siedlern und den Indianern war blutig gewesen, auf beiden Seiten, und nun waren die Indianer zurückgedrängt worden, als die Armee eingegriffen hatte. Sie wurden in Reservaten zusammengetrieben und ihre Freiheiten deutlich eingeschränkt. Noch gab es einzelne Widerstandskämpfer unter ihnen, aber sie hatten wohl kaum eine Chance. Mrs. Duncan seufzte wieder. Sie verstand nicht, was alle gegen die Indianer hatten, die Meisten waren freundlich und zuvorkommend, wenn man ihnen die Chance gab, sich zu öffnen. Natürlich gab es auch dort welche, die gegen Recht und Gesetz verstießen, aber wo gab es solche Menschen nicht?
Sie horchte auf. Was war das eben gewesen? Ihre Runde hatte sie gedankenverloren beendet und war zurück in ihre eigenen Räume gegangen. Die Kinder wussten, dass sie sie jederzeit wecken konnten, wenn etwas sein sollte. Das kam relativ häufig vor, da die meisten von ihnen die Schrecken des Krieges mit eigenen Augen erlebt hatten und nun unter Alpträumen litten. Doch das war keines der Kinder gewesen. Nein, es kam von unten. Mrs. Duncan stand auf und wollte nachsehen gehen. Sie war unruhig, hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Doch das Geräusch, das sie irritiert hatte, war inzwischen weg. Es war still. Zu still. Normalerweise konnte man in der Nacht hier viele verschiedene Geräusche hören, doch außer den einzelnen Schnarchern der Kinder konnte sie nichts hören. Absolut nichts.
Unruhig verließ sie ihr Zimmer und lief nach unten. Ein Instinkt sagte ihr, dass sie nach draußen sehen musste. Als sie die Tür öffnete, stockte ihr der Atem. Vor ihr auf der Treppe lag ein Baby. Eingewickelt in ein paar Tücher und auf eine Decke gebettet. Dabei war es kalt, eiskalt. Auch wenn sie in Arizona waren, der Winter konnte selbst hier tödlich enden, vor allem für ein Neugeborenes. Es war kurz vor Weihnachten und es sollte Schnee geben. Das Baby sah sie mit großen, dunklen Augen an. Die Haut war extrem hell, die wenigen Haare, die zu sehen waren, wirkten schwarz, aber in der Nacht konnte das täuschen.
Schnell sah sie sich um, doch sie konnte niemanden entdecken. Das Waisenhaus stand an einem Hügel, vor ihr fiel das Gelände ab, ein Weg führte in den Ort, doch kein Mensch war zu sehen. Wer hatte dieses Baby hier abgelegt? Die Stadt war klein, sie wusste nur von wenigen schwangeren Frauen in der Gegend, aber diese Babys dürften noch nicht so weit sein. Mrs. Duncan wandte sich wieder dem Baby zu. Das Kleine war ihr mit Blicken gefolgt und sah sie durchdringend an. Es wirkte unheimlich, so von einem Baby angesehen zu werden. Die Heimleiterin besann sich auf ihre Aufgabe und hob das Bündel vorsichtig hoch. In dem Moment, als sie das Baby im Arm hatte, schloss es seine Augen und schlief ein. Ein paar Meter weiter flatterte lautlos ein Rabe davon, der auf dem Treppengeländer gesessen und das Baby beobachtet hatte.
Mrs. Duncan eilte nach drinnen in den Waschraum. Darin war es immer so warm wie möglich, damit vor allem die Kleinsten nicht froren. Dort wickelte sie das Bündel auseinander. Schnell stellte sie fest, dass es sich um ein Mädchen handelte, das höchstens ein paar Stunden alt sein konnte. Die Nabelschnur war noch ganz frisch und es sah aus, als wäre der kleine Körper direkt nach der Geburt schnell in ein paar Tücher gewickelt und dann bei ihr abgelegt worden. Vorsichtig säuberte sie die Kleine und wickelte sie, bevor sie ihr ein paar saubere aber abgetragene Babysachen anzog. Das Mädchen wachte nicht auf. Daher legte sie sie in ein Gitterbett, das in der Ecke des Schlafraumes stand und zog es in ihr Zimmer. Da die Kleine immer noch tief und fest schlief, wandte sie sich den Tüchern zu, vielleicht konnten die ihr helfen, herauszufinden, wer das Baby war, und möglicherweise auch etwas über seine Eltern.
Die Tücher waren indianisch, das war eindeutig. Diese Webarbeiten stammten nicht von einem Stamm hier in der Nähe, das bunte Muster verriet selbst ihr so viel. Mrs. Duncan kannte sich nicht besonders gut aus mit den verschiedenen Stämmen, aber da einige der nahe wohnenden Indianerstämme immer wieder einen Markt im Ort abhielten, kannte sie deren Muster, und das hier war vollkommen anders. Die Tücher waren abgetragen und die Farben ein wenig ausgeblichen, als wären sie schon älter, aber sauber und gepflegt. Sie legte sie auseinander und ein Blatt Papier fiel heraus.
Das ist Kristina. Bitte kümmern Sie sich um sie. Ich kann es nicht tun.
Mehr stand nicht auf dem Papier. Einige Male drehte sie es hin und her, in der Hoffnung, mehr zu entdecken, aber da war einfach nichts. Seufzend ging Mrs. Duncan wieder in ihr Zimmer, noch immer grübelnd über diesen Fund. Als ihr Blick auf die Uhr fiel entschied sie, jetzt auch zu schlafen. Es war kurz nach drei Uhr morgens. Gedanken könnte sie sich später machen.
Am nächsten Morgen war Mrs. Duncan ziemlich unausgeschlafen. Das kleine Mädchen ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie hatte so zart und verletzlich gewirkt, als sie in der Nacht auf dem Tisch gelegen hatte. Ihr weniges Haar, noch feucht von der Geburt, war kohlrabenschwarz, was die Theorie unterstützte, dass sie ein Indianerkind war. Ihre Augen waren von einem dunklen blau, wenn man nicht genau hinsah, wirkten sie schwarz, allerdings hatten sie kleine, helle Sprenkel darin, was sie geheimnisvoll aussehen ließ. Aber ihre Haut war so hell, das hatte die Heimleiterin noch nie gesehen. Sie wirkte fast so weiß wie Porzellan, aber das Kind sah dennoch absolut gesund aus. Und sie konnte auf jeden Fall einschätzen, ob ein Kind einen Arzt brauchte oder nicht. Nicht dass ein Arzt da gewesen wäre, wenn sie denn einen brauchten. Der Ort war einfach zu klein und zu ärmlich, um für einen Arzt interessant zu sein. Supai hatte fast weniger Einwohner, als Kinder in dem Waisenhaus waren.
Die Indianer nicht mitgezählt hatte der Ort etwas über 300 Einwohner, vor dem Krieg waren es etwas über 400 gewesen. Carol Duncan kannte jeden Einzelnen. Rund um den Ort hatte es früher viele verschiedene Indianerdörfer gegeben, doch jetzt, nach diesem verheerenden Krieg gegen die Indianer, waren die Meisten in die Reservate zurückgedrängt worden. Einzelne Indianer wehrten sich noch dagegen und streunten wild umher, aber die Soldaten machten Jagd auf sie und wollten auch die letzten freien Rothäute in die Reservate drängen. Immer wieder kamen Soldaten durch den Ort und befragten die Menschen, ob sie wilde Indianer gesehen hätten, doch hier in der Nähe gab es ein Reservat, von dem aus viele indianische Frauen Waren auf dem örtlichen Markt verkauften. Gehörte das Mädchen zu ihnen? Doch der Name sprach gegen diese Theorie, er klang eher nordisch, vor allem die Schreibweise. Auch wenn das Aussehen zumindest zum Teil für die Indianer-Theorie sprach. Es war verwirrend.
Was sollte sie nun mit dem Baby machen? War es ein Indianerkind, so würde sich niemand groß kümmern, was mit ihr wurde. Doch ihre Haut sah so untypisch für diese Rasse aus, dass sich die Heimleiterin unsicher war.
In dem Moment öffnete das Mädchen die Augen und sah sie an. Die Augen waren dunkel, fast schwarz. Solche Augen hatte Carol Duncan noch nie bei einem Baby gesehen. Die Kleine musste langsam Hunger haben, aber sie weinte nicht. Schnell machte die Heimleiterin eine Flasche fertig. Sie musste unbedingt sehen, dass sie eine Leihmutter für das Baby fand, da sie selber mit ihren fünfzig Jahren schon aus dem Alter raus war, in dem sie Kinder gehabt hatte, sie konnte keine Milch geben. Ihre eigenen Kinder waren schon erwachsen, ihre Töchter beide verheiratet und weg gegangen in die Städte im Westen, ihr Sohn war in den Krieg gezogen und bisher nicht wiedergekommen. Sie befürchtete, dass er nicht mehr lebte, ihr Jüngster. Das Abbild seines Vaters und sein ganzer Stolz.
Als die Kleine ihre Flasche trank, drängte sie den Gedanken an ihren Sohn zurück. Sie brauchte nun ihre ganze Aufmerksamkeit für das Mädchen. In einer halben Stunde würden auch die anderen 45 Kinder aufstehen und dann war es vorbei mit der momentanen Ruhe. Bis dahin wollte sie die kleine Kristina versorgt haben, damit sie sich um die anderen Kinder kümmern konnte. Sie hatte zwar zwei Mädchen, die ihr halfen, aber Susannah und Deborah kamen immer nur für ein paar Stunden tagsüber. Sie waren von ihren Eltern geschickt worden, um zu lernen, wie man Kinder erzog. Sie müssten jeden Moment kommen, um das Frühstück mit ihr zusammen vorzubereiten. Die größeren Kinder hatten dabei ihre eigenen Aufgaben. Jeder musste mithelfen, sonst konnten sie nicht zurechtkommen. Die meisten Bewohner von Supai halfen ihr, wo sie konnten, spendeten Lebensmittel, Brennmaterial und Kleidung. Dennoch war sie zumeist auf verlorenem Posten. Vor vielen Jahren, als ihre Kinder anfingen, eigene Wege zu gehen, hatte sie dieses Waisenhaus gegründet, damals noch gemeinsam mit ihrem Mann, der kurz danach in den Krieg ziehen musste und nicht zurückkam. Sie hatten Kindern ohne Eltern eine Perspektive bieten wollen, doch im Moment fühlte sie sich ein wenig überfordert mit der Masse an Kindern. Ausgelegt war das Haus auf fünfzehn bis zwanzig Kinder, gerade hatte sie mehr als doppelt so viele. Es war schwer, sie gut zu versorgen, es gab selten wirklich genug zu essen und Kleidung hatte jedes Kind auch nur wenig. Und doch wies sie kein Kind ab, das Hilfe brauchte. Sie konnte es einfach nicht.
Kristina hatte inzwischen die Flasche leergetrunken und nun wurde sie unruhig. Wahrscheinlich war ihre Windel voll. Carol Duncan brachte sie in den Waschraum, wo die ältesten Kinder schon dabei waren, sich zu säubern. Erstaunt sahen sie zu dem Baby in den Armen ihrer Heimleiterin. „Das ist Kristina. Ich habe sie heute Nacht vor unserer Tür gefunden. Rebecca, Emma, ich werde eure Hilfe brauchen bei ihrer Versorgung.“, erklärte sie den beiden ältesten Mädchen.
Die beiden 13-jährigen Mädchen nickten ihr zu. Sie waren gezwungen, sehr erwachsen zu sein, konnten ihre Kindheit nicht genießen. Sie waren in ihrem Heim, seit sie sechs Jahre alt waren. Beide hatten ein ähnliches Schicksal hinter sich, waren aber nicht verwandt miteinander. Sie waren Kinder von einem weißen Vater und einem indianischen Mädchen. Diese Kinder wurden oft verstoßen und kaum einer wusste, wer der Vater war. Die meisten Männer vergnügten sich mit den roten Mädchen und ließen sie anschließend alleine. Wenn dann ein Baby geboren wurde, hatte es selten eine Chance. Das vermutete Carol Duncan auch bei Kristina, aber der Brief, den sie bei dem Mädchen gefunden hatte, deutete auf einen anderen Hintergrund hin. Die wenigsten Indianer konnten schreiben, vor allem nicht in Englisch. Die Frauen der Indianer noch weniger, die meisten von ihnen konnten noch nicht einmal Englisch sprechen. Auch der Name des Mädchens passte nicht dazu. Sie würde mit dem Sheriff reden. Sheriff Carlsen und vielleicht auch Mayor Grant würden sicher einen Weg wissen, um ihr zu helfen. Sobald sie diesen Entschluss gefasst hatte, war sie ruhiger.
Direkt nach dem Frühstück, das sie immer mit den Kindern zusammen einnahm, gab sie das Baby in die Obhut von Rebecca und Emma. Die beiden Mädchen machten das nicht zum ersten Mal, sie wussten, wie sie mit einem Baby umgehen mussten. Dann ging sie die kürzeste Strecke bis zum Rathaus, direkt am Fluss entlang. Es war ein Gebäude wie jedes andere in Supai, aber es war eines von zwei Häusern, an denen die amerikanische Flagge hing. Das andere war das Büro des Sheriffs. Mayor Grant hatte wie immer ein offenes Ohr für die Heimleiterin. Er konnte ihr nicht viel helfen, aber was er tun konnte, das tat er auch. Er rief sofort den Sheriff hinzu, der ein paar Minuten später kam. In einer Kleinstadt wie Supai gab es relativ wenig für ihn zu tun. Sie erzählte ihnen kurz die Geschichte, wie sie das Mädchen gefunden hatte, und zeigte Beiden den Brief.
„Ich stimme ihrer Theorie zu, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass eine Indianerin die Verfasserin dieses Briefes ist, aber vielleicht war die Mutter trotzdem eine. Sie kann ja immerhin Hilfe gehabt haben. Ich würde das Kind gerne einmal sehen.“, erklärte Mayor Grant, als er die wenigen Worte gelesen hatte.
„Auch ich denke, es könnte dennoch eine Indianerin gewesen sein. Aber ihre Erzählung hat mich ebenso neugierig gemacht. Wenn sie schon sagen, dass das Kind ungewöhnlich aussieht. Und sie haben es wirklich schon mit vielen Kindern zu tun gehabt.“, stimmte Sheriff Carlsen zu.
„Vielleicht haben sie beide gleich Zeit, mit mir zu kommen?“, fragte Mrs. Duncan. „Dann könnten wir vielleicht auch kurz darüber sprechen, dass ich Hilfe bräuchte, damit das Dach wieder dicht wird, der letzte Sturm hat Spuren hinterlassen.“
„Natürlich, Mrs. Duncan. Wir werden sehen, was wir da tun können. Ich werde mit den Männern im Ort reden, es findet sich sicherlich eine Lösung. Auch wenn die Kinder niemanden haben, wir müssen dennoch tun, was wir können. Die Kinder können schließlich nichts für ihre Eltern. Sie werden es nicht leicht haben in ihrem Leben, aber wir werden alles tun, um ihnen den Start dennoch zu erleichtern. Sie tun so viel für diese armen Kinder, da ist es auch an uns, sie zu unterstützen!“, versprach Mayor Grant.
Mrs. Duncan nickte ihm zu. Solche Versprechungen hatte sie schon viele von ihm bekommen. Doch ob sie dann die Hilfe auch bekam, war oft mehr als fraglich. Ihr war klar, dass es in einem so kleinen Ort nicht einfach war, als Bürgermeister zu bestehen, dennoch erhoffte sie sich mehr Hilfe, als sie bisher gehabt hatte, die Kinder hatten sich das wirklich verdient. Sie würden es nie einfach haben in ihrem Leben, dennoch hatten auch sie ein Recht auf eine unbeschwerte Kindheit. Doch alleine konnte sie das den Kindern nicht bieten. Es überstieg einfach ihre Möglichkeiten. Schnell gingen sie zu dritt den Weg auf den Hügel zurück zum Waisenhaus. Mrs. Duncan ließ sich die kleine Kristina von Rebecca geben und brachte sie in den Aufenthaltsraum, wo die Kinder normalerweise zum Essen saßen, oder bei schlechtem Wetter lernten und spielten. Dort blickten Mayor Grant und Sheriff Carlsen sie genau an.
„Wenn ihre schwarzen Haare nicht wären, würde ich ganz sicher sagen, dass sie kein Indianerkind ist. Aber die Haare sehen wirklich indianisch aus. Und auch die Augen sind dunkel wie bei den Indianern. Aber die Haut, sie sieht aus wie jemand aus dem nördlichsten Europa.“, überlegte Mayor Grant nach ein paar Minuten.
„Ja, die Hautfarbe irritiert auch mich, ich habe noch nie so helle Haut gesehen. Das ist ja fast wie ein Albino. Ich habe mal einen Mann gesehen, der war ein sogenannter Albino, aber er hatte rote Augen.“, wusste Sheriff Carlsen.
„Ich glaube nicht, dass sie ein Indianerkind ist, aber sicher bin ich mir nicht.“, erklärte der Bürgermeister schließlich.
Kristina hatte sie die ganze Zeit aus großen Augen angeblickt, als wüsste sie, dass hier etwas Wichtiges stattfand. Mrs. Duncan war fasziniert von diesem Baby, wie sie noch nie eines erlebt hatte. Sie würde Kristina auf jeden Fall hierbehalten. Der Sheriff entschied, dass er eine Vermisstenmeldung herausgeben und nach der Mutter suchen werde, war sich aber sicher, dass das wohl nichts bringen würde. Sie war schließlich bewusst vor dem Kinderheim ausgesetzt worden. Also war klar, dass dieses Mädchen das neue Kind von Mrs. Duncan wurde.
2. Unfall am Fluss
Kristina lachte. Sie hielt sich den Mund zu, damit die anderen Kinder ihr Lachen nicht hören konnten. Wo sie nun schon mitspielen durfte, da wollte sie sich nicht gleich verraten. Meist ließen die anderen Kinder sie links liegen. Doch heute hatten die beiden Anführer, der zehnjährige Lucas und der 14-jährige Steven, sie gefragt, ob sie mit ihnen Verstecken spielen wollte.
Die achtjährige Kristina hatte sich im Wald unter eine Tanne gehockt und die Zweige so natürlich wie möglich um sich herum drapiert, damit sie nicht entdeckt wurde. Schon seit einigen Minuten suchten nun mehrere der anderen Heimkinder nach ihr. Nur zwei andere fehlten noch, Jessica und Eric. Die beiden waren offenbar auch noch versteckt. Der Wald nahe dem Waisenhaus bot sich für derartige Spiele an. Der Hügel, an dem das Haus angelehnt war, wurde von ihnen bepflanzt, die Sonne schien hell darauf und Obst und Gemüse wuchsen dort gut. Manchmal, wenn es wenig regnete, mussten sie Wasser aus dem Fluss holen und ihre Felder gießen. Noch waren die Früchte nicht reif, aber die Blätter und die Nadeln der verschiedenen Bäume sehr dicht. Bienen und Hummeln summten von Blüte zu Blüte, die Vögel zwitscherten fröhlich. Die ersten Früchte wuchsen bereits und es schien ein ertragreiches Jahr zu werden. Noch hatten sie kaum Arbeit damit, daher hatten sie Zeit zum Spielen.
Das Haus selbst war zweistöckig, der Eingangsbereich etwas höher als der Boden auf dieser Seite, daher gab es eine Treppe mit zehn Stufen, damit es nach hinten hin noch über der Erde lag. In der unteren Etage gab es ein kleines Zimmer für Vorräte, eine Küche und den großen Speisesaal, dazu ein Zimmer, in dem die älteren Mädchen nähen und stricken konnten, damit sie alle genug zum Anziehen hatten. Die Jungen hatten im Keller einen Bereich, in dem sie Regale und andere Möbel zusammenbauten, meist unter Anleitung eines Mannes aus dem Ort. Im oberen Stockwerk waren die Schlafräume und das Bad untergebracht. Dort hielten sich die Kinder eigentlich nur nachts auf, denn die Schlafsäle waren sehr karg eingerichtet. Es gefiel niemandem so recht. Nur das Bad war warm, ansonsten war es relativ kühl im Haus, zumindest im Winter. Im Sommer war es so heiß, dass viele der Kinder nicht gut schlafen konnten.
Die meisten Kinder fanden Kristina seltsam, sie sprach fast nie, dazu ihre dunklen Augen und Haare und die helle Haut. Doch sie bekam nie Sonnenbrand, auch wenn sie eigentlich die ganze Freizeit, die sie hatte, im Freien verbrachte. Sie liebte Tiere, brachte immer wieder verletzte Vögel oder Eidechsen mit ins Heim. Ein Rabe schien ihr sogar fast auf Schritt und Tritt zu folgen. Anfangs hatte Mrs. Duncan es ihr immer wieder verboten, doch Kristina hatte sich stets über das Verbot hinweggesetzt. Sie konnte einfach nicht anders, musste den Tieren helfen. Es tat ihr beinahe körperlich weh, wenn sie den Schmerz der Tiere sah.
Da entdeckte Steven sie. Er schob die Zweige auseinander und klatschte Kristina ab. Lachend befreite sie sich aus ihrem Versteck. Ein wenig traurig war sie, dass sie gefunden worden war, hoffte aber, dass es noch weiter ging. Sie genoss die wenigen Tage, an denen sie mitmachen durfte und die Gemeinschaft sie aufnahm. Es war, als wäre sie ein Teil der Gemeinschaft.
„Gut gemacht, ich hab dich nur gefunden, weil die Zweige anders waren als sonst. Das hier ist mein Lieblingsbaum!“, erklärte Steven grinsend. Kristina war stolz auf das Lob. Sie war glücklich, dass sie einfach mittendrin sein durfte. Ein dankbares Lächeln traf Steven, der nicht anders konnte, als sie kurz in den Arm zu nehmen. Zusammen mit den anderen Kindern halfen sie nun, Jessica und Eric zu suchen. Kristina hatte eine Idee, dass sie sich in der kleinen verlassenen Höhle am Fluss versteckt haben könnten. Schnell lief sie mit Steven dorthin. Schon von weitem hörte sie ein Geräusch, das so nicht hierher passte. Sie blieb stehen und lauschte.
Als Steven etwas sagen wollte, hob sie abwehrend die Hand und schloss die Augen, um sich noch mehr auf ihr Gehör zu konzentrieren. Nach einem Moment winkte sie Steven und lief voran, auf den Bach zu. Zwischen den Bäumen war es dämmrig, die mächtigen Kronen und das dichte Laub schluckten die Sonnenstrahlen. Die Ruhe hier genoss sie normalerweise, doch heute hatte sie keinen Blick dafür, es ging um zwei Kinder, die Angst aussandten, die in der Ruhe deutlich spürbar für Kristina war. Nur ein gelegentlicher Ruf eines Vogels war zu hören, und die Schritte der beiden Kinder. Kristina lief wie immer barfuß, trug nur eine ausgeblichene, helle Leggins und darüber eine Tunika in einem dunklen Gelb, die ihre zierliche Figur umspielte. Ihre Haare waren offen und fielen ihr in schwarzen Locken weit über den Rücken hinab bis fast zur Hüfte. Sie bewegte sich anmutig und beinahe lautlos durch den Wald. Steven hingegen trug alte Lederschuhe und seine Schritte waren deutlich schwerer. Er war groß für sein Alter, schon über 5,6 Fuß, und trug wie fast immer ausgeblichene Jeans, die ihm zu kurz waren, und ein dunkelblaues T-Shirt. Seine kurzen braunen Haare standen wild vom Kopf ab, egal was er tat. Die braunen Augen sprühten vor Lebensfreude.
Auch er hatte fast sein gesamtes Leben im Waisenhaus verbracht, seine Eltern waren schon lange tot. Seine Mutter war im Kindbett am Fieber gestorben und sein Vater fiel den Kriegswirren zum Opfer. Mit knapp vier Jahren war er dann von dem Vorgänger des jetzigen Sheriffs zu Mrs. Duncan gebracht worden. Seitdem lebte er hier, da keine Verwandten gefunden worden waren. Er war einer der Wenigen, die Kristina akzeptierten. Der Vierzehnjährige wusste, dass sie ein unheimliches Gespür dafür hatte, wie es anderen ging. Daher kam es häufig vor, dass sie zu denen kam, denen es nicht gut ging, und versuchte, sie aufzumuntern. Doch einige der Kinder im Waisenhaus mochten das nicht. Sie kamen sich so durchschaut vor, oder sogar überwacht. Doch Kristina schien sich einfach nicht wohlzufühlen, wenn es negative Gefühle in ihrer Umgebung gab.
Jetzt hielt das Mädchen an und bedeutete Steven, ebenfalls zu lauschen. Auch er konnte nun etwas hören, das wie Hilfeschreie klang, und es kam eindeutig vom Fluss. Er nickte Kristina zu und sie rannten dann auf die Rufe zu. Nach und nach konnte er die Stimme von Jessica erkennen. Sie hörte sich panisch an. Obwohl sie sechs Jahre jünger war, rannte Kristina ihm fast davon. Sie wusste anscheinend genau, wohin sie musste, ließ sich von ihren Instinkten leiten. Steven musste sich anstrengen, um ihr zu folgen, obwohl sie keine Schuhe trug und somit mehr auf ihren Weg achten musste als er.
Zwei weitere Minuten später hatten sie den Fluss erreicht. Sie konnten Jessicas kinnlange rote Haare entdecken. Mitten im Fluss hing sie mit dem Bein unter einem Stein fest und nur ihr Kopf war noch über Wasser. Der Strudel um sie herum drohte, sie mit hinunterzuziehen, aber noch kämpfte sie. Eric konnten sie nirgendwo sehen, doch Kristina spürte, dass auch er hier sein musste. Steven stürzte sich sofort in das Wasser und lief vorsichtig auf Jessica zu. Beruhigend redete er auf sie ein, während er sich immer näher an sie herankämpfte. Die Kraft des Wassers war hier deutlich zu spüren, sie waren in der Nähe des Wasserfalles und konnten bereits den Sog fühlen. Als er etwa die halbe Strecke überwunden hatte, konnte er über den Stein sehen, unter dem Jessica feststeckte. Dort hing Eric, auch er schien sich nicht zu bewegen. Steven machte sich Sorgen, als einer der Älteren fühlte er sich verantwortlich für die jüngeren Kinder. Auch Mrs. Duncan erinnerte ihn regelmäßig daran, dass er Verantwortung übernehmen musste. Er wusste, sie machte das nicht gerne, aber es war nötig. Bald würde er sicherlich zum Militär gehen müssen, ihm blieben vielleicht noch zwei Jahre, maximal drei. Doch diese Gedanken schob er nun beiseite, er musste den beiden Verunglückten helfen.
„Jessica, was ist mit Eric?“, rief Steven dem Mädchen zu.
„Er wollte über den Fluss, ist aber auf dem Stein ausgerutscht. Beim Sturz ist er mit dem Kopf aufgekommen und hat sich nicht mehr bewegt. Ich wollte nach ihm sehen und bin auch weggerutscht und jetzt stecke ich fest. Sei vorsichtig, Steven!“, keuchte Jessica atemlos. Nach den Regenfällen in den letzten Tagen war das Wasser deutlich höher als sonst und die Strömung reißender. Obwohl es hier in Arizona heiß war, wirkte das Wasser immer eiskalt. Schritt für Schritt kämpfte sich Steven vorwärts, sich auf jeden Tritt konzentrierend. Er wollte verhindern, auch im Wasser zu landen, dann könnte er den beiden Unglücksraben nicht helfen. Das Wasser riss und zerrte an seinen Beinen, die Kälte machte seine Füße langsam aber sicher gefühllos. Dennoch ging er immer weiter, wenn auch langsamer. Er war eigensinnig, starrköpfig, aber dabei immer umsichtig. „Kristina!“, rief er nach hinten. „Bitte hole Hilfe aus dem Heim oder dem Ort.“ Doch Kristina antwortete nicht. Es war zu still, aber Steven konnte nicht nachsehen.
„Sie ist nicht mehr da, ist schon weggelaufen, als du ins Wasser bist.“, erklärte ihm Jessica. Das wiederum verwunderte Steven sehr, kannte er Kristina doch als eine stets überlegende Person. Wieso lief sie einfach davon? Oder war sie selber auf die Idee gekommen, Hilfe zu holen? Das würde zu ihr passen, aber warum hatte sie dann nichts gesagt? Um ihn nicht abzulenken? Plötzlich fiel ihm im Augenwinkel eine Bewegung am anderen Ufer auf. Er blickte auf, als er einen festen Stand hatte, und sah sich Auge in Auge mit Kristina. Wie kam sie an das andere Ufer? Sie schien trocken zu sein, also nicht durch das Wasser.
„Kristina, was tust du denn da? Wie kommst du da rüber? Lauf bitte und hole Hilfe!“, befahl Steven.
Kristina schüttelte energisch den Kopf. „Eric schafft es nicht bis dahin. Von hier aus kann ich an ihn herankommen.“, antwortete sie mit ihrer sanften, ruhigen Stimme. Ja, sie war näher an Eric, die Steine, auf denen sich Jessica und Eric befanden, waren deutlich näher am anderen Ufer, doch er wollte nicht, dass Kristina sich in diese Gefahr begab. Sie war gerade mal acht Jahre alt, und er fühlte sich für sie in besonderem Maße verantwortlich. Ihr durfte einfach nichts passieren. Von Anfang an hatte er einen enorm starken Beschützerinstinkt gegenüber diesem Mädchen entwickelt. Sie kletterte inzwischen über die Steine und kam dabei Eric immer näher. Bisher hatte sie noch nicht einen Fuß ins Wasser gesetzt, aber gleich musste sie ein Stück überqueren, in dem sie keine Steine zum Klettern hatte. Kristina schob ihre Hosenbeine nach oben und setzte ihren rechten Fuß ins Wasser.
„Sei vorsichtig!“, bat Steven, als er sah, dass er sie nicht aufhalten konnte. Er hatte Angst um das seltsame Mädchen. Sie reagierte nie so, wie man dachte, war immer für eine Überraschung gut. Das war es, was die anderen Kinder abschreckte, warum sie nicht mit ihr umgehen konnten. Sie war einfach unberechenbar, dabei aber immer sanft und ruhig. Er hatte noch nie ein lautes Wort von ihr gehört.
Dennoch wirkte sie gerade so sicher, als würde sie auf einer normalen Straße gehen. Sie setzte einen Fuß vor den anderen, ohne ihre Schritte erst lange abzuwägen. Mit einer unglaublichen Sicherheit fand sie die Stellen, auf denen sie sicher stehen konnte, und näherte sich dem bewusstlosen Eric, der glücklicherweise über Wasser lag, nur ab und zu von Spritzern getroffen wurde. Nach nur zwei Minuten war sie bei ihm angekommen, kniete sich auf den Stein neben seinem Kopf und begann, ihn mit den Händen vorsichtig abzutasten. Eric zuckte kurz zusammen und stöhnte, wachte aber nicht auf.
„Sch, ganz ruhig.“, murmelte Kristina Eric zu. Sie legte ihm die Hand auf den Kopf und schloss die Augen. Ein paar Momente passierte gar nichts, dann schlug Eric die Augen auf. Verwirrt sah er sich um. „Wo bin ich? Was ist passiert?“, fragte er.
„Ganz ruhig, bleib liegen, du hast dir den Kopf ganz schön heftig angestoßen. Aber nicht wieder einschlafen, hörst du?“, beruhigte ihn Kristina. Sie richtete sich auf. „Wir brauchen Hilfe, dass wir ihn in die Stadt bringen können. Er hat bestimmt eine Gehirnerschütterung, da kann er nicht laufen.“ Steven nickte zustimmend. Er war inzwischen bei Jessica angekommen und versuchte, ihr Bein zu befreien. Nach ein paar erfolglosen Versuchen ging er ein Stückchen um den Stein herum und probierte es an einer anderen Stelle nochmals. Diesmal schaffte er es unter Aufwendung aller seiner Kräfte, den großen Stein ein wenig zu bewegen, sodass Jessica ihr Bein hervorziehen konnte. Sie keuchte vor Schmerz auf, als das Blut wieder bis in den Fuß schoss. Steven half ihr hoch, doch sie konnte das rechte Bein, das eingeklemmt gewesen war, nicht belasten. Der Knöchel war verdreht, scheinbar gebrochen. Steven setzte sie erst einmal auf den Stein und überlegte, was sie nun machen sollten. Einer von ihnen musste Hilfe holen.
„Kristina, bitte lauf zurück in die Stadt und alarmiere Sheriff Carlsen. Er wird sicher kommen und uns helfen. Du bist schneller als ich und besser orientiert. Aber beeile dich, das Wasser ist kalt und die Beiden sind komplett durchnässt. Ich werde sehen, dass ich sie hier raus bekomme und ein wenig aufwärme. Wie bist du eigentlich dort rüber gekommen?“, sagte Steven.
„Über den Baumstamm dort hinten!“, erklärte Kristina und deutete nach rechts. „Der Rabe hat mir den Weg gezeigt.“
Etwa dreihundert Fuß flussaufwärts lag ein gefallener Baum quer über dem Fluss, auf dem ein Rabe saß und sie aus seinen dunklen Augen beobachtete. Kristina lief schon auf den Stamm zu und kletterte behände darüber. Als sie wieder am anderen Ufer war, winkte sie Steven kurz zu und rannte dann los, auf kürzestem Weg in die Stadt zurück. Nicht erst zum Waisenhaus, dort war im Moment wohl nur die Heimleiterin, die alleine konnte ihnen nicht helfen. Die beiden Frauen, die sonst halfen, waren mit zwei anderen Kindergruppen unterwegs auf einem Ausflug, sie wollten einige Hasen fangen, um sie im Waisenhaus zu halten, damit sie Fleisch bekamen. Nein, sie musste in die Stadt, dort gab es genügend Männer, die ihr helfen konnten. Sie wusste, dass die Stadt ein wenig weiter im Osten lag als das Waisenhaus und schlug die Richtung ein, die ihr richtig erschien. Es war nur ein Gefühl, aber sie ahnte, dass dies der kürzeste Weg war. Der Rabe flog über ihr und krächzte ab und zu, als wolle er ihr den Weg weisen.
Doch sie spürte nach kurzer Zeit, dass sie nicht alleine war, jemand außer dem Raben war in ihrer Nähe. Und wer auch immer mit ihr hier unterwegs war, derjenige wusste, dass auch sie hier war. Weglaufen hatte keinen Sinn, also wartete Kristina ruhig. Nach nur wenigen Momenten erkannte sie, dass links hinter ihr jemand war, aber derjenige hielt sich im Schatten der Bäume. Das Mädchen drehte sich in die Richtung und hielt die offenen Hände vor sich. „Ich will niemandem etwas tun, ich suche nach Hilfe für zwei Freunde.“, erklärte sie ruhig.
Hinter den Bäumen kam nun langsam ein Mann hervor. Er hatte dunkle Augen, schwarze Haare, sein Gesicht und die bloßen Arme waren bronzefarben. Seine langen Haare waren von einem roten Tuch zusammengehalten. Er trug ausgefranste, lederne Hosen und ein verblichenes, früher mal rotes, T-Shirt. Die Füße waren nackt, genau wie Kristinas. Sein Gesicht zeigte keine Regung, aber seine Augen blickten warm auf das Mädchen, das vor ihm stand. Er musterte Kristina. Das junge Mädchen verwirrte ihn. Ihre Augen. Sie wirkten so viel älter als ihr Körper. Er schätzte sie auf sechs oder sieben Jahre. Auf den ersten Blick wirkte sie indianisch, so wie er, aber wenn man genauer hinsah, dann erkannte man, dass dies nur wegen ihrer dunklen Haare und Augen war. Sie wirkte so andersartig, fremd. Und doch irgendwie vertraut. Die Art, wie sie ihn ansah. Es erinnerte ihn an… Er riss sich aus seinen Gedanken. „Was ist mit deinen Freunden?“, wollte er schließlich wissen.
„Jessica und Eric sind am Fluss, Jessicas Bein war eingeklemmt, aber Steven konnte es befreien. Eric ist mit dem Kopf auf einen Stein geschlagen und war bewusstlos. Beide sind komplett durchnässt.“, erzählte Kristina hektisch.
„Zeig es mir.“
Kristina sah ihn nur kurz durchdringend an und lief dann voran zum Fluss. Sie spürte instinktiv, dass sie ihm vertrauen konnte. „Ich bin übrigens Kristina.“, stellte sie sich noch vor.
„Gaagi. Oder Raven.“, war seine kurze Antwort.
Nur Minuten später waren sie bei den anderen Dreien angekommen. Gaagi ging sofort neben Jessica und Steven in die Hocke und sah sie intensiv mit seinen dunkelbraunen Augen an, tastete ihr Bein ab. Sie war unverletzt, bis auf ein paar Kratzer an ihrem Bein und dem Knöchel, aber total durchnässt und sie zitterte vor Kälte. Steven hatte es geschafft, sie ans Ufer zu bringen, und bemühte sich nun um Eric.
„Komm.“, sagte Gaagi und half Jessica beim Aufstehen. „Dein Knöchel ist nur gezerrt, das tut weh, aber du kannst damit auftreten. Ich werde dir helfen.“ Mit Gaagis Hilfe humpelte Jessica zu einem umgestürzten Baum. Dort setzte sie sich auf den Stamm. Gaagi ging zu einer nahen Tanne und zog ein Messer aus seinem Gürtel. Damit schnitt er ein paar dünne Äste ab, die dicht mit Nadeln besetzt waren, und brachte sie zu Jessica, die so sehr zitterte, dass ihre Zähne klapperten. Er wickelte sie darin ein und sofort spürte sie eine angenehme Wärme. Der Indianer reichte Kristina das Messer und deutete ihr an, noch mehr Zweige zu holen. Erschrocken beobachtete Jessica das Ganze, nie wäre sie auf die Idee gekommen, einer Achtjährigen ein derart großes und offensichtlich scharfes Messer in die Hand zu geben. Doch Kristina wirkte nicht unvorsichtig, das Mädchen war schon immer vorausschauend und umsichtig gewesen. Sie ging auf eine andere Tanne zu und schnitt dort weitere Äste ab, brachte sie nach und nach zu Gaagi, der noch ein paar um Jessica wickelte. Dann ging er zu Steven und half ihm, auch Eric ans Ufer zu bringen. Zusammen schafften sie es mit Leichtigkeit, den zitternden Eric von dem Stein zu heben und ans Ufer zu tragen. Dort wurde auch er in Tannenzweige eingewickelt, damit er nicht noch weiter auskühlen konnte.
„Sie müssen aus den nassen Sachen raus und sich aufwärmen.“, meinte Steven, der selber auch vor Kälte zitterte. „Können sie uns helfen, sie in die Stadt zu bringen?“, wandte er sich an Gaagi.
Der jedoch schüttelte nur den Kopf. „Zu weit. Kommt mit.“, antwortete er kurz angebunden. Er hatte in der Zwischenzeit Jessicas Knöchel geschient, sodass sie nun mit ein wenig Hilfe wieder humpelnd laufen konnte. Steven half ihr auf, als Gaagi sich Eric schnappte und ihn kurzerhand hochhob, da der Junge viel zu geschwächt war, um selber zu laufen. Er ging voran, weg aus der Richtung, in der die Stadt war, und auf die Wasserfälle zu. Nach nur wenigen Minuten waren sie an den Mooney-Falls angekommen. Die Wasserfälle wirkten noch imposanter als sonst, jetzt, wo der Fluss deutlich Hochwasser hatte. Doch Gaagi hielt keinen Moment inne, er trug Eric einfach weiter, bog vom Fluss ab und nur ein paar Minuten später erkannten sie einige Zelte auf einer kleinen Lichtung. Gaagi lief auf das Erste zu und rief etwas, das keines der Kinder verstehen konnte.
Die Antwort bestand in einer Frau mittleren Alters, einer Indianerin, die auf sie zukam und Steven half, Jessica zu unterstützen. Sie brachten sie in das Zelt und Gaagi sagte ihnen nur, sie sollten die nassen Sachen ausziehen und sich in die Decken einwickeln, er käme gleich wieder.
3. Bei den Navajo
Eine Stunde später war ihnen allen wieder warm, sie waren trocken, in warme Decken eingewickelt, und saßen um das Feuer, über dem ein Eintopf in einem Kessel blubberte. „So, nun esst erst einmal!“, lächelte die Indianerin, die Gaagi ihnen als Shadi vorgestellt hatte. Ihr Englisch war beinahe akzentfrei. Sie gab jedem der Kinder eine Schale mit Eintopf und einen geschnitzten Löffel in die Hand. Die ließen sich das nicht zweimal sagen. Shadi hatte sich auch Jessicas Knöchel angesehen und neu geschient, er war wirklich nicht gebrochen. Gaagi hatte versprochen, sie nach dem Essen ins Waisenhaus zurückzubringen.
Kristina war ihm neugierig hinterhergelaufen, als er aus dem Zelt gegangen war, um Feuermaterial zu holen. Sie war sich nicht sicher, was sie bei ihm spürte, er schien ihr einerseits gefühlskalt zu sein, aber dennoch fühlte sie, dass er eine Wärme ausstrahlte, die sie selten erlebt hatte. Außerdem schien er sie immer ein wenig seltsam von der Seite anzusehen, wenn sie nicht direkt hinsah. Kurz, sie war fasziniert von dem unnahbar wirkenden Indianer. Als sie ihm nachgegangen war, hatte er ihr einen abschätzenden Blick zugeworfen, bei dem sie nicht genau wusste, ob er jetzt erfreut oder entsetzt war, dass sie ihm folgte, aber sie hatte sich nicht abhalten lassen und so hatte Gaagi es akzeptiert.
Die Achtjährige hatte immer noch das Messer des Mannes, dessen Alter sie nicht schätzen konnte. Körperlich wirkte er jung, nur wenig älter als Steven, aber seine Augen waren so anders, das hatte Kristina noch nie gesehen. Diese Augen hatten schon viel erlebt, das war dem Mädchen plötzlich bewusst. Sie wollte auf einmal nur, dass diesem Mann vor ihr ein paar seiner Lasten abgenommen wurden und legte ihm die kleine, weiße Hand auf den dunklen, sonnengebräunten Arm. Kein Wort fiel zwischen den beiden, und obwohl Gaagi im ersten Moment geschockt wirkte, ließ er die Berührung zu. Er starrte in ihre Augen, und war gefangen. Bei beiläufiger Betrachtung wirkten sie schwarz, aber wenn man genauer hinsah, dann waren sie von einem dunklen Blau und schimmerten manchmal sogar dunkelgrün. Und wenn man noch genauer hinsah, konnte man goldene Sprenkel darin erkennen. Dieses Mädchen, was war es nur mit ihr? Er konnte seine Augen nicht mehr abwenden, sie hielt seinen Blick einfach nur fest. Und obwohl sein Geist ‚Gefahr‘ schrie, waren seine Instinkte ganz ruhig. Von dem Mädchen ging keine Gefahr aus, sie würde schützen, beschützen.
Dann knackte es im Unterholz hinter ihnen und seine Augen rissen sich von Kristinas los, um die Gefahr zu erkennen. Es war nur ein Hase, den sie aufgeschreckt hatten, aber Gaagis Herzschlag hatte sich fast verdoppelt. Bei jedem Geräusch reagierte er so, seit sie auf der Flucht vor den Soldaten waren. Sie mussten jederzeit bereit zur Flucht sein, das machte sich bemerkbar. Alle waren unruhig und schreckhaft geworden. Kristina lächelte ihm beruhigend zu, ihr Blick ging in weite Ferne. „Du bist nicht in Gefahr, ich bin da. Ich spüre, dass die Gefahr noch nicht so nahe ist. Aber wenn der Lauf der Sonne unterbrochen wird, dann solltest du die Deinen in Sicherheit bringen. Wenn die Mooney Falls golden sich färben, dann schreiten wir in eine andere Welt.“
Staunend hatte Gaagi die Worte des Mädchens gehört. Sie schien in einer Art Trance zu sein, in einem anderen Geisteszustand, sie wirkte wie ihr Medizinmann, wenn er mit den Geistern der Vorfahren sprach. Was war es mit dem Mädchen? Konnte sie Prophezeiungen sprechen? Es klang wie eine.
Erst nach einer ganzen Weile konnte sich Gaagi von dem Anblick dieses Mädchens losreißen und er machte sich wieder auf den Weg zu seinem Holzvorrat. Sie lief weiter hinter ihm her, aber auf einmal fühlte er eine seltsam beruhigende Präsenz und war ruhig, weil sie bei ihm war. Er verstand es nicht, diese Ruhe und Gelassenheit versuchte er seit Jahren zu erlangen, seit… Aber er unterbrach seine Gedanken genau hier, wollte nicht über seine Vergangenheit nachdenken. Doch dieses junge Mädchen, das ihn so sehr verwirrte, brachte ihm eine gewisse innere Ruhe. Er würde darüber mit Ma’ee sprechen müssen, einem der Ältesten seines Stammes. Vielleicht konnte der ihm helfen. Jetzt brauchten sie Holz, um ein Feuer zu entzünden, damit Shadi den Kindern etwas zu Essen machen konnte.
„Yas, komm her. Hilf mir tragen.“, wandte er sich an das Mädchen.
„Yas?“, kam es fragend.
„Dein Name ist schwer für meine Zunge, ich nenne dich Yas, Schnee, weil deine Haut weiß wie Schnee ist.“, erklärte er ruhig. Kristina akzeptierte es mit einem Nicken und öffnete die Arme, um einen Teil des Holzes zu tragen. Er achtete darauf, ihr nicht zu viel aufzuladen, dann gingen sie zügig zum Lager zurück. Gaagi konnte Kristinas fragenden Blick spüren. Er wusste, sie würde irgendwann Antworten fordern, und er würde sie ihr geben. Nicht gleich, aber auf Dauer könnte er sie ihr wohl nicht verweigern, zu sehr erinnerte sie ihn an SIE.
Nach dem Essen saßen sie rund um das Feuer, Shadi hatte sich zurückgezogen. Gaagi wusste, dass sie den Wagen bereit machte und die Ponys anspannte, damit er die Kinder zurückbringen konnte. Laufen konnten sie diesen weiten Weg nicht alleine, da zwei von ihnen verletzt waren. Auch wenn einige seiner Männer dagegen waren, die Kinder zurück zu bringen, bevor sie nicht selbst abreisen konnten, sie sahen es als zu gefährlich an, wenn die Kinder wussten, wo sie gerade lebten. Dennoch saß er nun mit ihnen am Feuer und erkannte den fragenden und neugierigen Blick des schwarzhaarigen Mädchens.
„Yas, du wolltest Wissen. Ich werde dir nicht alles verraten, aber du sollst so viel erfahren, wie ich dir sagen kann. Mein Volk, die Navajo, wurden von den weißen Männern vertrieben und in Reservate gesperrt. Einige sind hier mit mir gelandet, wir wollten unsere Freiheit behalten. Wir brauchen nicht viel, aber unsere Freiheit ist uns absolut heilig. Shadi ist meine ältere Schwester, genau das bedeutet auch der Name. Außer uns beiden sind nur wenige hier, zusammen sind wir etwa zwanzig von meinem Volk. Wir ziehen oft weiter, damit wir nicht erwischt und eingesperrt werden. Wir sind keine Krieger in dem Sinn, dass wir den weißen Mann bekämpfen wollen, dafür sind wir zu Wenige, selbst wenn sich mein ganzes Volk einigen könnte, aber es gibt unter uns schon zu viel Uneinigkeit. Meine Schwester ist eine von nur zwei Frauen, die mit uns gezogen sind. Warum wir hier sind, das kann ich dir nicht beantworten, es ist eine lange Geschichte, die ich niemandem erzählen werde, aber es ist etwas Persönliches. Wir werden niemandem schaden, wir wollen nur in Freiheit leben, im Einklang mit der Natur, mit Mutter Erde.“
Kristina sah ihn nachdenklich an. Schließlich nickte sie, spürend, dass er eigentlich keine ihrer vielen Fragen wirklich beantwortet hatte, aber sie wusste, dass er nicht mehr erzählen würde. Er war enttäuscht und verletzt worden und deshalb war er hier. Das sagte ihr Instinkt, doch wenn er nicht bereit war, darüber zu sprechen, dann war es nicht an ihr, das zu ändern. Auch wenn sie wusste, oder ahnte, dass sie helfen könnte. Aber woher dieses Wissen kam, das konnte sie sich nicht erklären.
„Entschuldigung, Mr. Gaagi“, unterbrach Steven in dem Moment.
Gaagi hob die Hand und stoppte ihn. „Nur Gaagi, einfach nur Gaagi. Oder Raven.“, bestimmte er freundlich.
„Okay, Raven. Also, was ich sagen wollte, wir müssen zurück zum Waisenhaus. Mrs. Duncan macht sich bestimmt schon Sorgen.“, bat Steven nun.
„Shadi macht den Wagen fertig, dann können wir die Verletzten besser transportieren.“, antwortete Gaagi. Kristina wollte ihm nun sein Messer zurückgeben, doch er lächelte nur. „Behalte es ruhig, Yas, es war nur mein Ersatz-Messer. Du kannst es vielleicht noch brauchen. Und wenn du magst, dann komm mich gerne einmal besuchen, aber ich weiß nicht, wie lange wir noch hier sind. Wir können nur so lange an einem Ort bleiben, bis jemand ahnt, dass wir dort sind.“
Kristina lächelte ihn dankbar an. „Ihr seid hier erst einmal sicher.“, prophezeite sie ihm, wieder mit diesem seltsam abwesenden Ausdruck in ihren Augen. Bevor er darauf reagieren konnte, kam Shadi und bedeutete ihm, dass der Wagen angespannt war. Die Jugendlichen zogen sich ihre inzwischen getrockneten Sachen wieder an und gaben die Decken zurück.
Steven und Gaagi brachten erst Jessica und dann Eric zum Wagen. Jessica wirkte recht fröhlich, sie hatte keine Schmerzen mehr, seit Shadi ihr einen Trank von einem Sáni gebracht hatte, und auch Eric war wacher. Er hatte bestimmte Beeren kauen müssen und danach auch einen Trank von Sáni bekommen. ‚Sáni‘ bedeutete ‚der Alte‘ und war eine respektvolle Anrede für den Ältesten in ihrer Gruppe. Er war gleichzeitig Berater und Medizinmann, da er das meiste Wissen hatte.
Steven und Kristina würden mit Gaagi neben dem Wagen laufen, da die zwei Ponys nicht so große Lasten ziehen konnten. Die Ponys waren klein, aber kräftig gebaut. Man sah es ihrem Fell an, dass sie es gewohnt waren, draußen zu sein, nie einen Stall von innen sahen. Es war struppig, aber wirkte warm. Ihre Farbe war unscheinbar, eine Mischung aus braun und beige, es fiel in der Steppe sicher nicht besonders auf. Aber die Augen blickten klug und lebendig. Die beiden schnaubten unruhig, als sie stehen sollten, und scharrten ungeduldig mit ihren Hufen. Als Gaagi sie kurz ansprach, fingen sie voller Freude an, den Wagen zu ziehen. Ein schwarzer Rabe flatterte aus einem Baum am Rande der Lichtung auf und flog lautlos hinter ihnen her. Schnell waren sie wieder am Wasserfall und wandten sich dann nicht in die Richtung, aus der sie gekommen waren, denn der Wagen würde sicher nicht so leicht durch den Wald kommen, sondern fuhren in Richtung der Händlerstraße, die immer noch Bestand hatte, auch wenn es nun neue Verbindungswege gab. Endlich auf der Straße angekommen, ging es zügig vorwärts und sie konnten bald das Waisenhaus erkennen. Als sie nur noch ein paar Minuten entfernt waren, hielt Gaagi den Wagen an. „Schafft ihr es von hier alleine? Es ist gefährlich für euch, wenn ihr mit mir gesehen werdet.“, wollte er wissen.
Steven sah ihn kurz verwirrt an, schien aber zu verstehen. Sie wussten, wo der Lagerplatz dieser sogenannten Rebellen war. Auf diese Informationen waren die Soldaten aus und sie würden jede Möglichkeit nutzen, sie auszufragen, egal wie alt sie waren. Gaagi wollte sie davor bewahren. Daher nickte er dem Indianer zu. „Danke für alles, Raven. Wir werden schweigen!“
Kristina ging noch einmal zu dem Mann und umarmte ihn kurz. Sie sagte nichts, doch er spürte ihren Dank in Form von Gelassenheit, die ihn einhüllte. Er lächelte ihr kurz zu. Seltsam, er hatte seit Jahren nicht mehr so gefühlt, erst Recht nicht mehr gelächelt. Mit diesem Mädchen fiel es ihm auf einmal leicht. Sie erinnerte ihn an… Halt, er wollte nicht darüber nachdenken. Das tat zu weh. Von weit oben hörte er das Krächzen eines Raben. Es klang zufrieden und beinahe ... zustimmend.
Steven hatte in der Zwischenzeit Eric aus dem Wagen geholfen, der nun mit Hilfe von Kristina aufrecht stand und die ersten zaghaften Schritte in Richtung Waisenhaus machte. Jessica stützte sich schwer auf Steven und sie gingen den anderen beiden hinterher. Als Steven sich noch einmal umdrehte, war Gaagi schon verschwunden. Der Jugendliche schüttelte den Kopf, wie hatte der Indianer das geschafft, vor allem mit dem Wagen und den Ponys? Kein Wunder, dass sie sich bereits so lange versteckt hatten, ohne gefunden zu werden. Er hoffte, dass sie es weiterhin schafften, auch wenn ihm klar war, dass es schwer würde. Die Soldaten suchten überall nach freien Indianern, denn sie sollten alle in die Reservate. Steven verstand es nicht, warum sollten die Indianer gefangen gehalten werden? Sie waren doch nicht böse, oder? Im Gegenteil, die Erfahrungen, die er an diesem Nachmittag gesammelt hatte, zeigten ihm, dass sie sehr friedlich waren und nicht mehr als ein wenig Ruhe wollten. Nur das, was sie zum Leben brauchten, mehr wollten sie nicht. Immer wieder kamen Soldaten in den Ort und auch zum Waisenhaus und fragten, ob irgendwo Indianer aufgetaucht waren, die nicht aus dem Reservat kamen. Die waren einfach zu erkennen, denn man hatte ihnen die Haare geschnitten. Die frei lebenden Indianer hingegen trugen ihre Haare fast immer mindestens schulterlang, oft sogar noch länger. Steven hatte es auch bei den Männern von Raven gesehen, die alle lange Haare hatten. Ein Zeichen ihrer Freiheit. Er hoffte wirklich, dass Raven und seine Leute weiterhin entkamen.
Die Vier gingen weiter, während er darüber nachdachte, und nur wenige Schritte später kamen mehrere Männer auf sie zu. Zusammen mit Mrs. Duncan. „Steven, wo wart ihr nur? Wir haben euch überall gesucht!“, rief sie schon von weitem. Dann sah sie, dass zwei nicht alleine laufen konnten. „Was ist passiert?“, wollte sie wissen.
„Eric ist auf einem Stein im Fluss ausgerutscht und mit dem Kopf aufgeschlagen, Jessica ist mit dem Fuß unter einem Stein eingeklemmt worden, als sie ihm helfen wollte. Wir haben sie gefunden und dort rausgeholt, sie am Feuer wieder getrocknet und dann hierher gebracht.“, erklärte Kristina.
Steven war überrascht, die Kleine hatte offenbar genau verstanden, dass sie nichts verraten durften. Aber sie war schon immer vorausschauend gewesen, etwas Anderes hätte ihn jetzt eher überrascht. Und die Erklärung war plausibel und auch nicht wirklich gelogen, nur ein paar entscheidende Details hatte sie ausgelassen, wobei er hoffte, dass niemand wegen dem Feuer nachfragte. Andererseits war es etwas, was sie öfter machen mussten, daher erwartete er keine Fragen. Anerkennend nickte er ihr zu, als die Männer ihnen die Verletzten abnahmen und Mrs. Duncan davon abgelenkt war. Jetzt konnte er nur hoffen, dass auch Jessica und Eric schweigen würden. Er musste wohl noch einmal mit ihnen reden, wenn sie unbeobachtet waren.
4. Flucht in eine neue Welt
Seit dem Unfall am Fluss waren inzwischen schon zwei Monate vergangen. Weder Jessica noch Eric hatten ein Wort über ihren Retter verloren, daher atmeten Steven und Kristina langsam auf. Sie hatten Gaagi gern und wollten nicht, dass er eingesperrt würde. Jessica war seit dem Unfall deutlich freundlicher als früher zu Kristina, immer mal wieder verbrachten die beiden so unterschiedlichen Mädchen Zeit miteinander. Die Rothaarige brachte Kristina das Lesen bei, während Kristina ihr zeigte, wie man mit verletzten Tieren umging. Gemeinsam versorgten sie einen Hasen, den sie mit einem gebrochenen Bein in der Nähe des Flusses gefunden hatten. Er war noch sehr jung und es gelang ihnen, das Tier zu zähmen, sodass sie ihn in einem Gehege halten konnten, das von Steven gebaut wurde. Sie setzten ihn zu den anderen Hasen, die seit etwa acht Wochen bei ihnen lebten, so konnten sie züchten und immer wieder Fleisch bekommen. Hühner hatten sie bereits in einem eingezäunten Bereich im Garten, die lieferten Eier und ab und zu auch Fleisch. Nach und nach bemerkte die Heimleiterin, dass Kristina sich wohler fühlte als noch einige Wochen zuvor. Offensichtlich hatte sie eine Freundin wie Jessica gebraucht. Mrs. Duncan sorgte daher dafür, dass sie in nebeneinander stehenden Betten schliefen und freute sich darüber, dass Kristina nun mehr Zeit im Haus mit den anderen Kindern verbrachte, nicht mehr so oft im Garten oder gar im Wald schlief. Vielleicht lag es auch daran, dass einige der älteren Kinder nun weg waren und so wieder jedes Kind ein eigenes Bett hatte.
Kristina allerdings schlich sich immer wieder davon und verbrachte Zeit mit dem geheimnisvollen Indianer, der ihr Legenden seines Volkes erzählte. Dabei folgte ihr der schwarze Rabe stets. Steven hatte es ein paar Mal mitbekommen, dass sie dort war und ihr nur gesagt, sie solle Raven einen schönen Gruß ausrichten. Noch immer hatte sie das Messer, hatte es geschickt versteckt, damit niemand es sah. Oft verbrachte sie ganze Tage bei den Diné, wie die Navajo sich selbst nannten, was bei anderen Kindern zu Fragen geführt hätte, aber da Kristina häufiger ganze Tage mit irgendwelchen Tieren im Wald spielte, fiel es niemandem auf. Beim ersten Mal waren die Indianer erschrocken, hatten sich erst wieder beruhigt, als Stunden später noch immer niemand gekommen war. Sie hatten ihr Essen und Wasser gegeben, mit ihr gesprochen, zumindest einige von ihnen. Nicht alle konnten Englisch, daher hielt sich Kristina an Gaagi, Sáni, Ma’ee und Shadi. Sie erzählten ihr Geschichten aus ihrem Stamm.
Als sie jedoch, etwa drei Wochen, nachdem sie die Indianer zum ersten Mal getroffen hatte, eine erneute Vision hatte und sie in eine andere Richtung schicken wollte, protestierten einige der Männer, allen voran ein Mann Mitte 30 namens K’ai. Shadi übersetzte für Kristina, als er sich dem Häuptling widersetzte. „Wir Diné haben noch nie Frauen oder gar Mädchen mit auf die Jagd genommen.“, schimpfte er. „Warum sollen wir jetzt damit anfangen? Es bringt Unglück.“ Scheinbar stimmten zwei weitere Krieger ihm zu, jedenfalls standen sie an seiner Seite.
Ma‘ee mischte sich ein. „Lasst uns sehen, ob es stimmt.“, schlug er vor. „K’ai, du gehst mit Manaba und Gad zu unserem alten Jagdgebiet und siehst nach, ob Yas Recht hat. Gaagi führt die anderen Jäger dorthin, wo uns das Mädchen schickt und wir sehen, was passiert.“
„Gaagi, dort werdet ihr auf Soldaten treffen, aber wenn ihr in Richtung der Mooney-Falls geht, werdet ihr Jagdglück haben.“, hatte sie einige Minuten zuvor prophezeit.
Ungläubig starrten die Männer sie an, bis auch Sáni entschied, das Risiko einzugehen, es könnte sicher nicht schaden. Der Häuptling stimmte den beiden Ältesten zu. Gaagi schickte zwei erfahrene Krieger mit K’ai zusammen in die ursprünglich geplante Richtung. Tatsächlich fanden sie dort Spuren von Soldaten und hörten sie sogar. Danach folgten sie ihren Ratschlägen etwas weniger skeptisch, vor allem, da die anderen Männer tatsächlich reiche Beute mitbrachten, zwei Rehe und mehrere Hasen. Kristina mochte die Männer und Frauen, auch wenn sie nicht alle verstand.
In den letzten Tagen war sie wieder da gewesen und hatte die Unruhe des Stammes gespürt. Die Männer hatten in ihrer Sprache diskutiert, aber niemand hatte ihr dieses Mal übersetzt. Alle waren immer wieder aufgesprungen, wo sie sonst ruhig und abwartend am Feuer saßen. Die Frauen hatten viel gearbeitet an den Häuten, neue Kleidung und Schuhe hergestellt, außerdem die Zelte ausgebessert und Decken gewebt. Die Männer hatten auf verschiedenen Wegen Wolle besorgt, von anderen Stämmen oder gar aus dem Reservat. Kaum jemand hatte auf sie geachtet. Was nur war los? Auch sie selber fühlte, dass eine Änderung bevorstand. Immer wieder hatte sie so seltsame Ahnungen, und meistens passierte hinterher etwas. Aber sie konnte es selten genauer bestimmen. Heute drängte sie alles dazu, zu Gaagi und seinen Freunden zu gehen. Dort würde heute etwas passieren und sie musste ihnen einfach helfen.
Leise schlich Kristina nach dem Frühstück nach draußen. Eigentlich sollte sie heute mit den anderen Mädchen im Garten helfen, das erste Obst und Gemüse zu ernten. Jetzt im Sommer war immer viel zu tun, das Waisenhaus versuchte, so weit wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen, unabhängig zu sein. Der Garten vor dem Haus war voll mit Tomatensträuchern, Bohnen, Erbsen, Mais, Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken und Karotten. Auf der anderen Seite des Hauses wuchsen verschiedene Obstbäume. Sogar einige Felder mit Getreide und weiterem Gemüse waren angelegt. Doch an diesem Tag würde Kristina nicht helfen. Ungesehen kam die Achtjährige aus dem Haus und verschwand im Wald. Wie immer trug sie keine Schuhe, nur eine Leggins und eine Tunika. Das Messer steckte in ihrem Gürtel, der nur aus einem Stoffstreifen bestand. Ihre langen Haare flatterten hinter ihr her, als sie zwischen den Bäumen hindurch in Richtung Wasserfall rannte.
Sie brauchte nicht lange, um die Zelte der Indianer zu erreichen. Gaagi, der Wache hielt, sah sie als Erster und freute sich über ihren Besuch. Sie hatte das Eis gebrochen, das er um sich herum aufgebaut hatte. Seit Jahren hatte er niemanden mehr an sich heran gelassen, dieses kleine Mädchen schaffte es spielend, die Mauern einzureißen, die ihn von den anderen Menschen getrennt hatten. Mit denen er sich selber von den anderen Menschen getrennt hatte.
Wie immer begrüßte sie ihn mit einer kurzen Umarmung. Bei den meisten Menschen konnte er so eine Berührung nicht ertragen, nur Shadi durfte ihm noch so nahe kommen. Die Kleine war besonders. Doch heute war sie unruhig, konnte nicht stillsitzen, hörte nicht einmal zu, als er erzählte, obwohl sie sonst nicht genug davon bekommen konnte. „Yas, was ist los?“, fragte er daher nach einer Weile.
„Gaagi, ich weiß es nicht. Etwas passiert heute. Ich kann es spüren, aber nicht mehr.“, antwortete das Mädchen leise.
„Wenn dein Gespür dir das sagt, dann wird es stimmen.“, wandte Sáni ein. Er kannte das Mädchen nun seit einigen Wochen und wusste, dass sie eine besondere Gabe hatte. Auch er selber hatte manchmal Ahnungen, die weit über das jahrelang angesammelte Wissen hinausgingen, aber so konkret wie bei diesem jungen Mädchen war es bei ihm nie.
„Was sagt dir dein Gefühl?“, fragte Ma’ee. Auch er kannte die Kleine nun schon eine Weile und wusste, dass man sich auf ihr Gespür verlassen konnte. Die beiden Männer, die Ältesten der letzten freien Navajo, saßen zusammen mit Gaagi und Yas am Feuer. Normalerweise wäre es undenkbar für sie, eine Frau oder gar ein Mädchen an ihrem Feuer sitzen zu lassen, aber bei Yas war es anders. Alle Männer, die mit ihnen unterwegs waren, wussten es, auch wenn es nicht alle zugaben und teilweise sogar Streit deshalb entstand. Doch da Gaagi, Sáni und Ma‘ee es so entschieden hatten, saß das Mädchen nun mit ihnen am Feuer. Kristina, oder Yas, wie sie von den Navajo genannt wurde, war anders und wichtig für sie.
„Ihr müsst gehen.“, antwortete Yas schlicht. „Ich zeige euch den Weg, damit sie euch nicht mehr finden.“ Wieder sprach sie so abwesend, wie sie es oft tat, wenn sie ihre ‚Prophezeiungen‘ sprach. Meist betrafen diese das Wetter oder die Jagd, aber immer war es richtig, was sie sagte. Die drei Männer am Feuer tauschten einen kurzen Blick, dann standen sie auf. Innerhalb von nur wenigen Minuten hatten sie ihre Leute zusammengerufen und begannen, den Platz zu räumen. Die Zelte wurden abgebaut und auf den Wagen gelegt, die Feuer gelöscht und die Stellen getarnt, indem die zuvor ausgehobene Erde wieder vorsichtig an die alten Plätze gelegt wurde. Eine halbe Stunde später zeugte nur das niedergetretene Gras noch davon, dass hier eine Gruppe Menschen über zwei Monate gelebt hatte. Nur K’ai protestierte erneut, doch die Gefahr war auch für die Männer spürbar, daher packte er, genau wie alle anderen, mit an.
Kristina hatte sich so gut es ging an den Arbeiten beteiligt, schien schnell zu erkennen, was zu tun war und was sie schaffte oder nicht. Sie hielt sich dabei immer in der Nähe von Gaagi auf, diese beiden verband eine seltsame Freundschaft. Beide waren immer ein wenig abseits von Anderen, hielten ihre Mitmenschen mehr oder weniger bewusst auf Abstand. Und doch zog es sie immer wieder zueinander hin. Als würde etwas sie verbinden, von dem sie keine Ahnung hatten. Gaagi war nicht immer so gewesen. Früher war er offen und fast immer fröhlich auf seine Mitmenschen zugegangen, doch dann hatte das Schicksal ihn hart getroffen und er hatte sich zurückgezogen. Kristina hingegen war schon immer eine Einzelgängerin, auch wenn sie es lieber anders gehabt hätte. Doch die anderen Kinder im Waisenhaus schnitten sie, bei gemeinsamen Spielen war sie meist ausgeschlossen oder nur dabei, wenn die Erwachsenen die anderen Kinder dazu zwangen, sie mitmachen zu lassen.
Shadi beobachtete die beiden, so oft sie die Gelegenheit dazu hatte. Yas erinnerte sie ein wenig an SIE. Da Shadi fast sechzehn Sommer älter als ihr Bruder war – sie hatte noch zwei weitere Brüder gehabt, die in den Krieg gegen die Soldaten gezogen und nie wieder zurückgekommen waren – hatte sie ihn mehr oder weniger aufgezogen, denn ihre Mutter hatte damals die schwere Geburt nur mit viel Können ihres Medizinmannes überlebt, war aber dann ein Jahr später doch gestorben. Shadi hatte es übernommen, ihren Bruder großzuziehen. Die beiden anderen Brüder waren zu der Zeit schon fast Männer gewesen, um die hatte sie sich nicht kümmern müssen. Und jetzt gab es nur noch sie beide. Eine Zeitlang war es anders gewesen, Gaagi hatte jemanden an seiner Seite gehabt, doch das Schicksal hatte es anders gewollt. Vielleicht hatte das Schicksal nun ein Einsehen mit ihrem Bruder und schenkte ihm Yas. Nicht als Partnerin, aber vielleicht als Familienmitglied.
„Gehen wir.“, entschied in diesem Moment Sáni, der als Ältester das Sagen hatte. Sie wollten in Richtung Norden ziehen, da es dort die meisten Versteckmöglichkeiten gab. Außerdem war es nahe ihrer alten Heimat, dort kannten sie sich relativ gut aus, auch wenn sie nicht nahe genug an ihr Heimatdorf herankonnten, da dort immer noch die Soldaten waren. Eigentlich wollten sie ihren Weg am liebsten frei kämpfen, aber dafür waren sie zu wenige, die Soldaten in der Überzahl. Nicht einmal wenn es jemand schaffen könnte, die Indianer alle zu einen, wären sie den weißen Soldaten gewachsen, die waren einfach zu viele.
„Bitte, nicht dahin!“, widersprach Yas. „Folgt mir, dort werden eure Feinde nicht suchen!“
„Yas, der Weg, den du gehen willst, führt genau in den Ort!“, warnte Sáni, als sie losging. Auch wenn er ihr vertraute, diese Entscheidung war schwerwiegender als eine Jagd. „Dort werden uns die Soldaten am schnellsten finden.“
„Gehen wir nach Norden, wie zuerst geplant!“, appellierte K’ai. Die Männer schienen gespalten, blickten abwechselnd auf Gaagi, der nachdenklich wirkte, und auf K’ai, dem man den Widerwillen richtiggehend ansah.
„Ich will nicht in den Ort. Mein Gefühl sagt mir, wir müssen ein Stück in diese Richtung. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, aber ich spüre, dass wir dorthin müssen. Der Rabe zeigt mir den Weg.“, erwiderte Kristina und deutete auf den schwarzen Raben, der weit oben am Himmel flatterte.
In diesem Moment verfinsterte sich der Tag. Obwohl der Himmel wolkenlos war, lag ein Schatten auf der Sonne. Gaagi wurde blass. „Wenn der Lauf der Sonne unterbrochen wird, dann solltest du die Deinen in Sicherheit bringen. Wenn die Mooney Falls golden sich färben, dann schreiten wir in eine andere Welt.“, zitierte er leise die Aussage von Yas, die sie bei ihrem ersten Treffen gemacht hatte. Er straffte sich und traf eine Entscheidung. „Gehen wir zu den Wasserfällen. Wenn sie sich golden färben, dann folgen wir Yas.“ Da Gaagi der Sohn des früheren Häuptlings war, ordneten sich die Anderen seiner Anweisung nun unter, wenn auch einige von ihnen nur widerwillig. Obwohl er noch sehr jung war, erst neunundzwanzig Sommer, so hatte er sie doch bisher sehr gut und wohlüberlegt geführt. Ma’ee und Sáni ordneten sich ihm unter, daher folgte ihm dann auch der Rest der Männer, wenn auch mehr als skeptisch. Shadi würde ihm immer folgen, auch ihr Mann war unter den Kriegstoten gewesen und Kinder hatten sie keine gehabt. Gaagi war ihre einzige noch lebende Familie, nie würde sie ihn im Stich lassen.
Es dauerte nicht lange, den hohen, rauschenden Wasserfall zu erreichen, der tatsächlich und zum Erstaunen aller golden schimmerte. Die Sonne war inzwischen nur noch eine kleine Sichel, verdunkelte sich immer weiter. Der Rabe flog tiefer und tiefer, bis er durch den Wasserfall glitt. Kristina ging ohne zu zögern auf den Wasserfall zu und durchschritt ihn, dicht gefolgt von Gaagi, der sie mittendrin aufhielt. „Yas, sei vorsichtig!“, warnte er.
„Wir müssen uns beeilen, die Soldaten haben das Lager gefunden und folgen den Wagenspuren!“, wisperte Kristina. „Hinter diesem Wasserfall ist es sicher!“ Sie hatte offenbar Recht, durchfuhr es Gaagi, als er auf ihren Weg zurückblickte und die ersten Soldaten am Waldrand auftauchten. Mit ihren schnellen Pferden waren sie noch ein oder zwei Minuten entfernt, bis sie in Schussweite herankamen, aber es würde sehr knapp.
„Eilt euch, folgt Yas durch den Wasserfall!“, ordnete er an, dem jungen Mädchen aus irgendeinem Grund vollkommen vertrauend. Er konnte es sich selbst kaum erklären, spürte aber, dass es so sein sollte. Alleine der Wasserfall, der sie nicht durchnässte, wie es eigentlich sein sollte, überzeugte ihn. Etwas war anders, es knisterte richtiggehend in der Luft. Yas schien diese Schwingungen deuten zu können, wenn auch nur instinktiv. Auch sein eigener Befehl war mehr auf Intuition gegründet als auf Tatsachen. Verwundert blickten seine Männer ihn an, sie konnten nicht glauben, dass er so einen seltsamen Befehl gab. Warum sollten sie unter dem Wasserfall hindurchgehen? Dahinter war eine Höhle, das wussten sie, aber darin konnte man sich nicht verstecken, vor allem, wenn die Soldaten sie bereits sehen konnten. Dennoch folgten sie seinem Befehl, aber auch nur, weil er sie noch nie falsch geführt hatte und es keine andere Möglichkeit gab, wie K’ai wütend feststellte. Kannte Gaagi einen Ausweg aus der Höhle? Aber weshalb nahm er den Wagen mit? Die Höhle war viel zu klein, nicht einmal alle zwanzig Menschen würden darin Platz haben, wie sollten der Wagen und die beiden Ponys darin unterkommen?
Doch als sie durch das Wasser schritten, das von oben auf sie herabfiel, wunderten sie sich darüber, dass sie nicht nass wurden. Nicht einmal das Wasser von unten durchnässte sie. Es war wie ein kühler Hauch, der sie berührte, aber ganz anders als das Wasser, das sonst auf sie herab prasselte, wenn sie in diese Höhle geflüchtet waren. Sie war schon mehrmals Zufluchtsort gewesen, wenn einer von ihnen sich vor den Soldaten verstecken musste, daher kannten sie sie alle. Nun allerdings wussten auch die Soldaten davon.





























