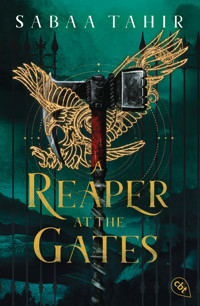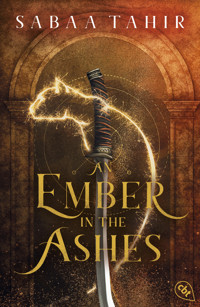9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Elias & Laia
- Sprache: Deutsch
Die Welt versinkt im Chaos - der Imperator ist tot, die machthungrige Keris Veturia hat sich zur neuen Herrscherin ernannt, und die so lange versklavten Dschinn sinnen auf Rache. Laia betrauert immer noch den Verlust von Elias, doch ihr Wunsch nach Gerechtigkeit ist ungebrochen. Deshalb schließt sie sich mit Helena dem Kampf gegen das Regime an. Währenddessen wird Elias von den Toten immer mehr auf ihre Seite gezogen. Doch um die Lebenden zu schützen, muss er das Zwischenreich noch einmal verlassen. Vor ihm liegt eine Mission mit ungewissem Ausgang: Es droht die Zerstörung der Welt. Aber es gibt auch noch die Hoffnung auf Rettung. Und wenn diese gelingt, hat sogar seine Liebe zu Laia eine Zukunft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungTEIL I: ERWACHENI: DER NACHTBRINGERII: LAIAIII: DER SEELENFÄNGERIV: LAIAV: DER SEELENFÄNGERVI: DER BLUTGREIFVII: LAIAVIII: DER SEELENFÄNGERIX: DER BLUTGREIFX: LAIAXI: DER SEELENFÄNGERXII: DER BLUTGREIFXIII: LAIATEIL II: DIE ERNTEXIV: DER NACHTBRINGERXV: DER SEELENFÄNGERXVI: DER BLUTGREIFXVII: LAIAXVIII: DER SEELENFÄNGERXIX: DER BLUTGREIFXX: LAIAXXI: DER SEELENFÄNGERXXII: DER BLUTGREIFXXIII: LAIAXXIV: DER SEELENFÄNGERXXV: DER BLUTGREIFXXVI: LAIAXXVII: DER SEELENFÄNGERXXVIII: DER BLUTGREIFXXIX: DER NACHTBRINGERXXX: LAIAXXXI: DER SEELENFÄNGERXXXII: DER BLUTGREIFXXXIII: LAIAXXXIV: DER BLUTGREIFTEIL III: DIE DSCHINNKÖNIGINXXXV: DER NACHTBRINGERXXXVI: LAIAXXXVII: DER SEELENFÄNGERXXXVIII: DER BLUTGREIFXXXIX: LAIAXL: DER SEELENFÄNGERXLI: DER BLUTGREIFXLII: LAIAXLIII: DER SEELENFÄNGERXLIV: DER BLUTGREIFXLV: LAIAXLVI: DER SEELENFÄNGERXLVII: DER BLUTGREIFXLVIII: LAIAXLIX: DER SEELENFÄNGERL: DER BLUTGREIFTEIL IV: DIE SHER DSCHINNAATLI: DER NACHTBRINGERLII: LAIALIII: DER SEELENFÄNGERLIV: DER BLUTGREIFLV: LAIALVI: DER SEELENFÄNGERLVII: DER BLUTGREIFLVIII: LAIALIX: DER SEELENFÄNGERLX: DER BLUTGREIFLXI: LAIALXII: DER NACHTBRINGERTEIL V: DIE MÜTTERLXIII: DER SEELENFÄNGERLXIV: LAIALXV: DER SEELENFÄNGERLXVI: KERIS VETURIALXVII: LAIALXVIII: DER SEELENFÄNGERLXIX: DER BLUTGREIFTEIL VI: DIE GESCHICHTELXX: ELIASLXXI: HELENALXXII: LAIADANKSAGUNGÜBER DIESES BUCH
Die Welt versinkt im Chaos – der Imperator ist tot, die machthungrige Keris Veturia hat sich zur neuen Herrscherin ernannt, und die so lange versklavten Dschinn sinnen auf Rache. Laia betrauert immer noch den Verlust von Elias, doch ihr Wunsch nach Gerechtigkeit ist ungebrochen. Deshalb schließt sie sich mit Helena dem Kampf gegen das Regime an. Währenddessen wird Elias von den Toten immer mehr auf ihre Seite gezogen. Doch um die Lebenden zu schützen, muss er das Zwischenreich noch einmal verlassen. Vor ihm liegt eine Mission mit ungewissem Ausgang: Es droht die Zerstörung der Welt. Aber es gibt auch noch die Hoffnung auf Rettung. Und wenn diese gelingt, hat sogar seine Liebe zu Laia eine Zukunft …
ÜBER DIE AUTORIN
Sabaa Tahir war Redakteurin bei der Washington Post. Berichte über den Nahen Osten beschäftigten sie und führten schließlich dazu, dass sie ihren ersten Roman schrieb. Sie wollte eine Geschichte erzählen, die die Gewalt in unserer Welt abbildet. Sie wollte aber auch Figuren erschaffen, die in dieser Welt Hoffnung finden. Die nach Freiheit suchen und sich für die Liebe entscheiden, egal gegen welche Widerstände. Aus diesem Impuls heraus entstand ihr erster Roman, Elias & Laia. Die Herrschaft der Masken.
SABAA TAHIR
ELIAS
&
LAIA
DAS LEUCHTEN HINTER DEM STURM
BAND 4
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Barbara Imgrund
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der englischsprachigen Originalausgabe:
»A Sky Beyond the Storm«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by Sabaa Tahir
All rights reserved.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
unter Verwendung von Motiven © Susan Fox/shutterstock; Krakenimages.com/shutterstock; Huzarska/shutterstock; Elzbieta Sekowska/shutterstock; Anton Petrus/shutterstock; Evgeniya Lystsova/shutterstock; tomertu/shutterstock; kaisorn/shutterstock
Lektorat: Julia Przeplaska, Regensburg
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0963-7
one-verlag.de
luebbe.de
lesejury.de
Für jedes Kind des Krieges,dessen Geschichte unerzählt bleiben wird.Für meine eigenen Kinder,meinen Falken und mein Schwert.Von all meinen Weltenist eure die schönste.
TEIL I
ERWACHEN
I: DER NACHTBRINGER
Ich erwachte im Schein einer jungen Welt, als der Mensch vom Jagen wusste, aber nicht vom Ackerbau, vom Stein, aber nicht vom Stahl. Es roch nach Regen und Erde und Leben. Es roch nach Hoffnung.
Erhebe dich, Geliebter.
Die Stimme, die sprach, war beladen mit Jahrtausenden jenseits meines Wissens. Die Stimme eines Vaters, einer Mutter. Eines Schöpfers und eines Zerstörers. Die Stimme Mauths, der der Tod selbst ist.
Erhebe dich, Kind der Flamme. Erhebe dich, denn meine Heimstatt erwartet dich.
Ich wünschte, dass ich nicht gelernt hätte, sie zu lieben, meine Heimstatt. Ich wünschte, dass ich nie Magie entfesselt, nie eine Gemahlin geliebt, nie kindliche Flammen entfacht, nie Geister umsorgt hätte. Ich wünschte, dass Mauth mir nie einen Namen gegeben hätte.
***
»Meherya.«
Mein Name zerrt mich aus der Vergangenheit auf einen regengepeitschten Hügel im Hinterland der Marinen. Meine alte Heimat ist die Zwischenstatt – den Menschen als Dämmerwald bekannt. Ich werde meine neue Heimat aus den Knochen meiner Feinde errichten.
»Meherya.« Umbras sonnenhelle Augen sind vom leuchtenden Rot uralten Zorns. »Wir erwarten Eure Befehle.« In der Linken hält sie ihre Waffe, eine Gleve, deren Klinge weiß glüht.
»Haben die Ghuls schon Bericht erstattet?«
Umbras Lippen verziehen sich. »Sie haben Delphinium durchstreift. Antium. Sogar die Zwischenstatt«, antwortet sie. »Aber sie konnten das Mädchen nicht finden. Seit Wochen hat man weder sie noch den Blutgreif gesehen.«
»Haben die Ghuls Darin von Serra in Marinn aufgespürt?«, frage ich weiter. »Er schmiedet Waffen in der Hafenstadt Adisa. Früher oder später werden sie wieder zusammentreffen.«
Umbra neigt den Kopf, und wir fassen die Ortschaft unter uns in den Blick: zusammengewürfelte Steinhäuser, die einem Brand standhalten können, gedeckt mit Holzschindeln, denen das nicht gelingen wird. Obwohl sie fast identisch mit anderen kleinen Orten ist, die wir zerstört haben, gibt es einen Unterschied: Es ist die letzte Siedlung in unserem Feldzug. Unser Abschiedsgruß, bevor ich die Martialen nach Süden schicke, wo sie zum Rest von Keris Veturias Armee stoßen werden.
»Die Menschen sind bereit zum Angriff, Meherya.« Umbras glühender Blick wird noch röter, und ihr Ekel vor unseren Martialenverbündeten ist fast mit Händen zu greifen.
»Gib den Befehl«, sage ich, und hinter mir verwandelt sich ein Schatten nach dem anderen in eine Flamme. Sie strahlen in den kalten Himmel hinauf.
Im Ort läutet eine Alarmglocke. Der Wächter hat uns gesehen und beginnt, panisch zu brüllen. Das Tor – nach unseren Überfällen auf benachbarte Gemeinden hastig errichtet – schließt sich, während Lampen aufleuchten und Rufe die Nachtluft zerreißen.
»Versiegelt die Ausgänge«, weise ich Umbra an. »Lasst die Kinder am Leben, damit sie die Kunde verbreiten. Maro.« Ich wende mich einem zaundürren Dschinn zu, dessen schmale Schultern die Kraft, die in ihm steckt, Lügen strafen. »Bist du stark genug für das, was du tun musst?«
Maro nickt. Er und die anderen lodern an mir vorbei, fünf Ströme aus Feuer wie jene, die von jungen Bergen im Süden ausgespien wurden. Die Dschinns schießen durchs Tor, das sie rauchend hinterlassen.
Eine halbe Martialenlegion folgt, und als der Ort in Flammen steht und sich meinesgleichen zurückzieht, beginnen die Soldaten mit dem Gemetzel. Die Schreie der Lebenden verklingen rasch. Die der Toten hallen länger nach.
Als die Ortschaft nur noch Asche ist, gesellt sich Umbra zu mir. Wie die anderen Dschinns ist sie nun kaum mehr als ein Flackern.
»Der Wind steht günstig«, sage ich zu ihr. »Ihr werdet rasch zu Hause sein.«
»Wir möchten bei Euch bleiben, Meherya«, erwidert sie. »Wir sind stark.«
Tausend Jahre lang habe ich geglaubt, dass Rache und Zorn mein Los wären. Dass ich niemals mitansehen würde, mit welcher Schönheit sich meinesgleichen durch die Welt bewegt. Dass ich niemals die Wärme ihrer Flammen spüren würde.
Doch Zeit und Beharrlichkeit erlaubten es mir, den Stern wieder zusammenzufügen – jene Waffe, mit deren Hilfe die Auguren mein Volk gefangen gesetzt haben. Nun sammeln sich die Stärksten meiner Art. Und obwohl es schon Monate her ist, seitdem ich die Bäume vernichtet habe, die sie gefangen hielten, prickelt meine Haut noch immer, wenn sie in meiner Nähe sind.
»Geht«, befehle ich ihnen sanft. »Denn ich werde euch in den kommenden Tagen brauchen.«
Als sie fort sind, streife ich durch die gepflasterten Straßen des Ortes und suche nach Gerüchen von Leben. Umbra hat ihre Kinder, ihre Eltern und ihren Liebsten in unserem längst vergangenen Krieg mit den Menschen verloren. Dank ihres Zorns geht sie gründlich zu Werke.
Ein Windstoß trägt mich zur südlichen Mauer. Die Luft erzählt von der Gewalt, mit der hier gewütet wurde. Aber da ist noch ein anderer Geruch.
Ein Zischen entfährt mir. Der Geruch ist menschlich, wenn auch von einem feeischen Hauch überlagert. Das Gesicht des Mädchens ersteht vor meinem geistigen Auge. Laia von Serra. Ihr Wesen fühlt sich so an wie das hier.
Aber warum sollte sie in einem Marinendorf auf der Lauer liegen?
Ich denke darüber nach, meine Menschenhaut überzustreifen, entscheide mich aber dagegen. Es ist ein beschwerliches Unterfangen und ohne guten Grund nicht leicht durchzuführen. Stattdessen ziehe ich meinen Umhang zum Schutz vor dem Regen fester um mich und folge dem Geruch bis zu einer Hütte, die sich an eine baufällige Mauer duckt.
Die Ghuls zu meinen Füßen quieken aufgeregt. Sie ernähren sich von Schmerz, und der ganze Ort strotzt davon. Ich schubse sie weg und betrete die Hütte allein.
Deren Inneres wird von einer Stammeslaterne und einem prasselnden Feuer erhellt, über dem eine Pfanne mit einem verkohlten Laib Brot qualmt. Rosafarbene Schneerosen stehen auf einer Kommode, und eine Tasse Brunnenwasser schwitzt auf dem Tisch.
Wer auch immer hier war, hat die Hütte erst vor Kurzem verlassen.
Oder möchte es zumindest so aussehen lassen.
Ich wappne mich, denn die Liebe eines Dschinns ist nicht wankelmütig. Laia von Serra hat Haken in mein Herz getrieben. Der Stapel Decken am Fuß des Betts zerfällt bei meiner Berührung zu Asche. Darunter versteckt und vor Entsetzen zitternd liegt ein kleiner Junge, der allzu offensichtlich nicht Laia von Serra ist.
Und doch fühlt sich das Kind an wie sie.
Nicht seinem Gesichtsausdruck nach, denn wo sich bei Laia von Serra Kummer abzeichnet, wird dieser Junge von Angst geschüttelt. Wo Laias Seele durch Leiden abgehärtet ist, ist dieses Kind weich und seine Freude ungetrübt. Bis jetzt. Er ist ein Marinenkind, nicht älter als zwölf Jahre.
Aber was tief in ihm ist, erinnert mich an Laia. Eine unwissbare Dunkelheit in seinem Geist. Seine schwarzen Augen begegnen meinen, und er hebt die Hände.
»H-hinfort!« Vielleicht war es als Schrei gemeint. Doch er krächzt, während sich seine Nägel ins Holz graben. Als ich ihm das Genick brechen will, hält er die Hände erneut hoch, und eine unsichtbare Kraft stößt mich zurück.
Seine Macht ist wild und beunruhigend vertraut. Ich überlege, ob das Dschinnmagie ist, aber obwohl Dschinn-Menschen-Paarungen schon vorgekommen sind, können ihnen keine Kinder entspringen.
»Hinfort, unflätige Kreatur!« Ermutigt durch meinen Rückzug wirft der Junge etwas nach mir. Es brennt wie Rosenblätter. Salz.
Meine Neugier schwindet. Das, was in dem Kind lebt, fühlt sich feeisch an, daher greife ich nach der Sense, die ich auf dem Rücken trage. Bevor er begreift, was vor sich geht, ziehe ich die Waffe über seine Kehle und wende mich ab, denn mein Geist eilt schon weiter.
Der Junge spricht, und ich bleibe sofort stehen. Seine Stimme donnert von der Entschiedenheit eines Dschinns, der eine Prophezeiung verkündet. Doch die Worte sind abgeschliffen, eine Geschichte, die durch Wasser und Fels hindurch erzählt wurde.
»Die Saat, die schläft, erwacht, die Frucht ihres Blühens gesegnet im Körper des Menschen. Und so wird dein Verderben geboren, Geliebter, und mit ihm das Zerbrechen – das Zerbrechen –«
Ein Dschinn hätte die Prophezeiung vollendet, doch der Junge ist nur ein Mensch und sein Körper ein zerbrechliches Gefäß. Blut spritzt aus der Wunde an seinem Hals, und er sackt tot zusammen.
»Was in allen Himmeln bist du?«, will ich von der Dunkelheit in dem Kind wissen, doch sie ist schon fort und hat die Antwort auf meine Frage mitgenommen.
II: LAIA
Die Geschichtenerzählerin in der Ucaya-Herbergeversteht es, den vollen Schankraum zu fesseln. Der Winterwind ächzt durch die Straßen von Adisa, rüttelt an den Dachtraufen draußen, und mit derselben Heftigkeit zittert die Stammes-Kehanni. Sie singt von einer Frau, die dafür kämpft, ihre wahre Liebe vor einem rachsüchtigen Dschinn zu retten. Selbst die bierseligsten Stammgäste sind ganz andächtig.
Während ich die Kehanni von einem Tisch in der Ecke aus beobachte, frage ich mich, wie es wohl ist, sie zu sein. All jenen, die man trifft, eine Geschichte schenken zu können, anstatt in ihnen Feinde zu vermuten, die nur darauf aus sind, einen zu töten.
Bei diesem Gedanken lasse ich den Blick erneut durch den Raum schweifen und taste nach meinem Dolch.
»Wenn du diese Kapuze noch tiefer ziehst, dann werden die Leute denken, dass du ein Dschinn bist«, flüstert Musa von Adisa. Der Kundige fläzt auf einem Stuhl zu meiner Rechten. Mein Bruder Darin sitzt wiederum zur Rechten Musas. Unser Tisch steht an einem der halbblinden Fenster, wo die Wärme des Feuers nicht hinreicht.
Ich lasse meine Waffe nicht los. Meine Haut kribbelt, denn mein Instinkt sagt mir, dass ein feindseliger Blick auf mir ruht. Aber alle haben nur Augen für die Kehanni.
»Hör auf, mit deiner Klinge herumzufuchteln, aapan.« Musa redet mich gern mit der marinen Ehrenbezeichnung für »kleine Schwester« an und spricht mit demselben genervten Ton, den ich manchmal von Darin zu hören bekomme. Der Bienenzüchter, wie man Musa auch nennt, ist achtundzwanzig Jahre alt – älter als Darin und ich. Vielleicht ist das der Grund, warum es ihm Freude macht, uns herumzukommandieren.
»Die Wirtin ist eine Freundin«, sagt er. »Hier gibt es keine Feinde. Entspann dich. Wir können sowieso nichts tun, bis der Blutgreif zurückkehrt.«
Wir sind von Marinen, Kundigen und nur ein paar Stammesleuten umgeben. Und doch brandet Beifall auf, als die Kehanni ihre Geschichte beendet hat – so plötzlich, dass ich meinen Dolch schon halb aus der Scheide ziehe.
Musa löst sanft meine Hand vom Heft. »Du befreist Elias Veturius aus Schwarzkliff, brennst Kauf nieder, treibst den Imperator der Martialen mitten in einen Krieg, trittst dem Nachtbringer öfter gegenüber, als ich zählen kann – und dann zuckst du bei ein bisschen Getöse zusammen? Ich habe dich für unerschrocken gehalten, aapan.«
»Lass es gut sein, Musa«, beschwichtigt Darin. »Besser schreckhaft als tot. Der Blutgreif würde das auch so sehen.«
»Sie ist eine Maske«, gibt Musa zurück. »Sie werden mit diesem Wahn geboren.« Der Kundige beobachtet die Tür, und seine Heiterkeit schwindet. »Sie sollte inzwischen zurück sein.«
Es ist seltsam, sich Sorgen um den Greif zu machen. Bis vor einigen Monaten dachte ich, dass ich meinen Hass auf sie mit ins Grab nehmen würde. Aber dann belagerten Grímarr und seine Horde karkaunischer Barbaren Antium, und Keris Veturia verriet die Stadt. Tausende Martiale und Kundige flohen nach Delphinium, auch ich, der Greif und ihr neugeborener Neffe, der Imperator. Die Schwester des Greifs, Imperatorregentin Livia, ließ die Kundigen frei, die noch immer in den Ketten der Sklaverei lebten.
Und irgendwie wurden wir zwischen damals und heute Verbündete.
Die Wirtin, eine junge Kundige etwa in Musas Alter, taucht mit einem Tablett voller Speisen aus der Küche auf. Sie rauscht auf uns zu, und die Wohlgerüche von Kürbissuppe und Knoblauchbrot wehen ihr voraus.
»Musa, mein Herz.« Die Wirtin stellt das Essen ab, und plötzlich merke ich, dass ich am Verhungern bin. »Ihr wollt nicht noch eine Nacht bleiben?«
»Tut mir leid, Haina.« Er wirft ihr eine Goldmark zu, die sie geschickt auffängt. »Das sollte für die Zimmer genügen.«
»Mehr als das.« Haina steckt die Münze weg. »Nikla hat schon wieder die Kundigensteuern erhöht. Nylas Bäckerei wurde letzte Woche dichtgemacht, weil sie nicht bezahlen konnte.«
»Wir haben unseren größten Verbündeten verloren.« Musa spricht von dem alten König Irmand, der seit Wochen krank ist. »Und es wird noch schlimmer werden.«
»Du hast die Prinzessin geheiratet«, sagt Haina. »Könntest du nicht mit ihr sprechen?«
Der Kundige bedenkt sie mit einem schiefen Lächeln. »Nicht, wenn du deine Steuern nicht noch weiter in die Höhe treiben willst.«
Haina geht, und Musa greift nach der Suppe. Darin zieht einen Teller mit gebratenen Okraschoten heran, die noch im Öl knistern.
»Du hast erst vor einer Stunde vier Maiskolben auf der Straße gegessen«, zische ich ihm zu und angle nach dem Brotkorb.
Als ich ihn zu fassen bekommen habe, fliegt die Tür auf. Schnee wirbelt in den Schankraum, zusammen mit einer großen, schlanken Frau. Ihre silberblonde Haarkrone liegt zumeist unter einer Kapuze verborgen. Der schreiende Vogel auf ihrem Brustharnisch blitzt einen Augenblick lang auf, bevor sie ihren Umhang darüber zieht und mit großen Schritten auf unseren Tisch zugeht.
»Das riecht unglaublich.« Der Blutgreif des Martialenimperiums lässt sich Musa gegenüber auf einen Stuhl fallen und nimmt ihm den Teller weg.
Angesichts seiner verdrießlichen Miene zuckt sie die Achseln. »Damen zuerst. Das gilt auch für dich, Schmied.« Sie schiebt mir Darins Teller zu, und ich beginne, das Essen herunterzuschlingen.
»Und?«, fragt Musa. »Hat dir dieser glänzende Vogel auf deiner Brust die Türen zum König geöffnet?«
Die blassen Augen des Blutgreifs blitzen auf. »Deine Frau«, sagt sie, »ist eine ganz gewaltig –«
»Verirrte Frau«, unterbricht sie Musa. Eine Erinnerung daran, dass sie einander früher vergöttert haben. Jetzt nicht mehr. Ein bitteres Ende für eine Liebe, die, wie sie gehofft hatten, ein ganzes Leben hätte halten sollen.
Dieses Gefühl kenne ich nur zu gut.
Elias Veturius schleicht sich in meine Gedanken, obwohl ich versucht habe, ihn auszusperren. Er zeigt sich, wie ich ihn zuletzt gesehen habe, mit scharfem Blick und unnahbar außerhalb der Zwischenstatt. Wir alle sind nur Besucher im Leben des anderen, hat er gesagt. Du wirst meinen Besuch bald genug vergessen.
»Was hat die Prinzessin gesagt?«, will Darin vom Greif wissen, und ich verstoße Elias aus meinem Kopf.
»Sie hat nicht mit mir gesprochen. Ihre Haushofmeisterin meinte, die Prinzessin werde meine Bitte anhören, wenn sich König Irmands Gesundheitszustand gebessert habe.«
Die Martiale funkelt Musa an, als wäre er derjenige, der ihr die Audienz abgeschlagen hat. »Die verfluchte Keris Veturia sitzt in Serra und enthauptet jeden einzelnen Botschafter, den Nikla schickt. Die Marinen haben keine anderen Verbündeten im Imperium. Warum weigert sie sich, mich zu treffen?«
»Das würde ich auch gern wissen«, entgegnet Mura, und ein schillerndes Flackern neben seinem Gesicht verrät mir, dass seine Wichte – winzige Geschöpfe, die ihm als Spione dienen – in der Nähe sind. »Aber obwohl ich Augen an vielen Orten habe, Blutgreif, gehört das Innere von Niklas Kopf nicht dazu.«
»Ich sollte schon wieder in Delphinium sein.« Der Greif starrt in den tobenden Schneesturm hinaus. »Meine Familie braucht mich.«
Sorge legt ihre Stirn in Falten, was bei einer so einstudierten Miene ungewöhnlich ist. In den fünf Monaten, seit wir aus Antium entkommen sind, hat der Blutgreif ein Dutzend Mordversuche an dem kleinen Imperator Zacharias vereitelt. Das Kind hat Feinde unter den Karkaunen wie auch unter Keris’ Verbündeten im Süden. Und sie kennen kein Erbarmen.
»Wir haben das erwartet«, sagt Darin. »Sind wir also entschlossen?«
Der Blutgreif und ich nicken, doch Musa räuspert sich.
»Ich weiß, dass der Blutgreif mit der Prinzessin sprechen muss«, erklärt er, »aber ich würde gern zu Protokoll geben, dass ich diesen Plan viel zu riskant finde.«
Darin lacht auf. »Daher wissen wir, dass es ein Laia-Plan ist – vollkommen wahnsinnig und höchstwahrscheinlich mit dem Tod endend.«
»Was ist mit deinem Schatten, Martiale?« Musa sieht sich nach Avitas Harper um, als könnte die Maske wie aus dem Nichts auftauchen. »Welche jämmerliche Aufgabe hast du dem armen Mann diesmal wieder aufgehalst?«
»Harper ist beschäftigt.« Der Körper des Blutgreifs versteift sich einen Moment lang, bevor sie weiter Essen in sich hineinstopft. »Mach dir keine Sorgen um ihn.«
»Ich muss in der Schmiede eine letzte Lieferung annehmen.« Darin steht auf. »Ich treffe dich gleich am Tor, Laia. Viel Glück euch allen.«
Während ich zuschaue, wie er die Schenke verlässt, überkommt mich Beklommenheit. Als ich im Imperium war, ist mein Bruder auf meine Bitte hier in Marinn geblieben. Wir haben uns vor einer Woche wiedergesehen, als der Greif, Avitas und ich in Adisa angekommen sind. Jetzt trennen wir uns schon wieder. Nur ein paar Stunden, Laia. Es wird ihm nichts geschehen.
Musa schiebt meinen Teller näher zu mir. »Iss, aapan«, sagt er nicht unfreundlich. »Alles ist besser, wenn du nicht hungrig bist. Ich werde dafür sorgen, dass die Wichte ein Auge auf Darin haben, und treffe euch alle am nordöstlichen Tor. Siebte Glocke.« Er zögert und runzelt die Stirn. »Seid vorsichtig.«
Als er hinausgeht, schnaubt der Blutgreif. »Marinenwachen können einer Maske nicht das Wasser reichen.«
Da kann ich nicht widersprechen. Ich habe erlebt, wie der Greif im Alleingang eine Armee aus Karkaunen in Schach gehalten hat, sodass Tausende Martiale und Kundige aus Antium fliehen konnten. Wenige Marine könnten es mit einer Maske aufnehmen. Kein einziger wäre dem Blutgreif ebenbürtig.
Der Blutgreif geht auf sein Zimmer, um sich umzuziehen, und zum ersten Mal seit Ewigkeiten bin ich allein. In der Stadt läutet eine Glocke zur fünften Stunde. Der Winter bringt früh die Nacht, und das Dach stöhnt unter der Kraft des Sturms. Ich denke an Musas Worte, während ich die lärmenden Gäste in der Schenke beobachte und das Gefühl, selbst ebenfalls unter Beobachtung zu stehen, abzuschütteln versuche. Ich habe dich für unerschrocken gehalten.
Ich hätte fast gelacht. Angst ist nur dann dein Feind, wenn du es zulässt. Das hat der Waffenschmied Spiro Teluman vor langer Zeit zu mir gesagt. An manchen Tagen lebe ich so leicht nach diesen Worten. An anderen sind sie eine Last auf meinen Schultern, die ich nicht tragen kann.
Natürlich habe ich all das getan, wovon Musa gesprochen hat. Aber ich habe Darin auch einer Maske überlassen. Meine Freundin Izzi ist um meinetwillen gestorben. Ich bin dem Nachtbringer entwischt, habe ihm jedoch unwissentlich dabei geholfen, seine Sippschaft zu befreien. Ich habe den Imperator zur Strecke gebracht, dabei allerdings hingenommen, dass meine Mutter sich selbst opferte, damit der Blutgreif und ich leben konnten.
Noch jetzt, Monate später, sehe ich Mutter in meinen Träumen. Weißhaarig und narbengesichtig, mit flammendem Blick, während sie ihre Pfeile auf eine Flut von karkaunischen Angreifern abfeuert. Sie hatte keine Angst.
Aber ich bin nicht meine Mutter. Und ich bin nicht allein mit meiner Angst. Darin spricht nicht über den Horror, dem er im Gefängnis von Kauf ausgesetzt war. Ebenso wenig spricht der Blutgreif über den Tag, an dem Imperator Marcus seine Eltern und Schwester ermordet hat. Oder wie es sich angefühlt hat, in dem Wissen aus Antium zu fliehen, was die Karkaunen den Menschen dort antun würden.
Unerschrocken. Nein, keiner von uns ist unerschrocken. »Unglückselig« trifft es besser.
Ich stehe auf, als der Blutgreif die Treppe herunterkommt. Sie trägt das schiefergraue, mit einer Kordel gegürtete Kleid einer Palastmagd und einen passenden Umhang. Ich erkenne sie kaum wieder.
»Hör auf zu glotzen.« Der Blutgreif steckt eine Locke unter dem grauen Kopftuch fest, das ihre geflochtene Haarkrone verbirgt, und schiebt mich zur Tür. »Sonst bemerkt noch jemand die Uniform. Komm. Wir sind schon spät dran.«
»Wie viele Schwerter hast du unter diesem Rock versteckt?«
»Fünf – nein, warte –« Sie tritt von einem Fuß auf den anderen. »Sieben.«
Wir treten aus dem Ucaya hinaus auf die Straße, die voller Schnee und Menschen ist. Der Wind ist schneidend, und ich taste mit tauben Fingerspitzen nach meinen Handschuhen.
»Sieben Schwerter.« Ich lächle sie an. »Und du hast nicht daran gedacht, Handschuhe mitzunehmen?«
»In Antium ist es kälter.« Der Blick des Greifs fällt auf den Dolch an meiner Hüfte. »Und ich verwende keine vergifteten Waffen.«
»Vielleicht bräuchtest du nicht so viele, wenn du es tätest.«
Sie grinst. »Viel Glück, Laia.«
»Bring niemanden um, Greif.«
Sie verschmilzt mit der abendlichen Menge wie ein Gespenst; vierzehn Jahre Ausbildung machen sie fast ebenso wenig wahrnehmbar, wie ich es gleich sein werde. Ich bücke mich, als wollte ich mir die Schnürsenkel zubinden, und werfe mir zwischen dem einen Augenblick und dem nächsten meine Unsichtbarkeit über.
Adisa mit seinen verschiedenen terrassenförmigen Ebenen und bunt bemalten Gebäuden ist tagsüber bezaubernd. Aber nachts überwältigt es mich geradezu. Stammeslaternen hängen an fast jedem Haus, und ihr vielfarbiges Licht funkelt selbst im Sturm. Lampenlicht dringt auch von drinnen durch die Schmuckgitter vor den Fenstern und wirft golden gebrochene Muster in den Schnee.
Das Ucaya thront auf einer erhabenen Terrasse und blickt sowohl auf die Faribucht am nordwestlichen Ende Adisas als auch auf die Aftabbucht im Nordosten. Im Wasser tauchen zwischen treibenden Eisbergen Wale auf und ab. In der Mitte der Stadt bohrt sich die verkohlte Nadel der Großen Bibliothek in den Himmel. Sie steht noch immer, trotz eines Feuers, das sie fast zerstört hätte, als ich das letzte Mal hier war.
Aber es sind die Menschen, von denen ich meinen Blick nicht abwenden kann. Selbst bei einem Unwetter, das von Norden her tobt, ziehen die Marinen ihre besten Gewänder an. Rote und blaue und purpurne Wolle, die mit Süßwasserperlen und Spiegeln bestickt ist. Weite Umhänge, mit Pelz verbrämt und schwer von Goldfäden.
Vielleicht kann ich mich hier eines Tages niederlassen. Die meisten Marinen teilen Niklas Vorurteile nicht. Vielleicht könnte auch ich schöne Kleider tragen und in einem lavendelblauen Haus mit grün gedecktem Dach wohnen. Mit Freunden lachen, eine Heilerin werden. Einen gutaussehenden Marinen treffen und Darin und Musa jedes Mal einen Klaps versetzen, wenn sie mich gnadenlos mit ihm aufziehen.
Ich versuche, dieses Bild festzuhalten. Aber ich will Marinn nicht. Ich will Sand und Geschichten und einen klaren Nachthimmel. Ich will in die blassgrauen Augen voller Liebe und einem Hauch von Verruchtheit schauen, nach denen ich mich sehne. Ich will wissen, was er vor anderthalb Jahren auf Sadhesisch zu mir gesagt hat, als wir auf dem Mondfest in Serra getanzt haben.
Ich will Elias Veturius zurück.
Hör auf, Laia. Die Kundigen und Martialen in Delphinium zählen auf mich. Musa hatte bereits den Verdacht, dass Nikla die Bitte des Blutgreifs nicht anhören werde – daher haben wir uns etwas einfallen lassen, damit uns die Kronprinzessin zuhören muss. Aber es wird nur funktionieren, wenn ich durch diese Straßen in den Palast gehe.
Während ich mir den Weg ins Zentrum von Adisa bahne, treiben Gesprächsfetzen an mir vorüber. Die Adisaner sprechen von Überfällen auf entlegene Ortschaften. Von Ungeheuern, die im Land umherstreifen.
»Hunderte Tote, habe ich erfahren.«
»Das Regiment meines Neffen ist vor Wochen ausgerückt, und wir haben seither nichts mehr von ihnen gehört.«
»Nur ein Gerücht –«
Nur dass es kein Gerücht ist. Musas Wichte haben heute Morgen Bericht erstattet. Mir dreht sich der Magen um, wenn ich an die Grenzdörfer denke, die bis auf die Grundmauern niedergebrannt und deren Bewohner abgeschlachtet wurden.
Die Straßen, die ich einschlage, werden enger und Straßenlaternen spärlicher. Hinter mir höre ich das Klingeln von Münzen, aber als ich herumfahre, ist da niemand. Ich gehe schneller und erhasche einen Blick auf das Palasttor. Es ist mit Intarsien aus Onyx und Perlmutt geschmückt und wirkt mondhell unter dem rosafarbenen Schneehimmel. Halte dich von diesem verfluchten Tor fern, hat Musa mich ermahnt. Es wird von Jadunas bewacht, und sie werden deine Unsichtbarkeit mühelos durchschauen.
Die magiebegabten Jadunas stammen aus den unbekannten Gegenden jenseits der Großen Einöde, Tausende von Meilen im Westen. Einige wenige dienen der königlichen Familie von Marinn. Einer Jaduna über den Weg zu laufen, würde Gefängnis bedeuten – oder den Tod.
Dankenswerterweise gibt es Seiteneingänge für die Mägde und Boten und Bediensteten, die den Palast am Laufen halten. Die Wachen dort sind keine Jadunas, daher ist es leicht genug, an ihnen vorbeizuschlüpfen.
Aber sobald ich drinnen bin, höre ich dieses Geräusch wieder – eine Münze, die gegen eine andere stößt.
Der Palast ist ein riesenhafter Gebäudekomplex, der in U-Form um die gepflegten Gartenanlagen herum angelegt ist. Die Gänge sind so breit wie Straßen und so hoch, dass die Fresken auf dem bleichen Stein weit oben kaum zu erkennen sind.
Überall befinden sich Spiegel. Als ich um eine Ecke biege, blicke ich geradewegs in einen und sehe goldene Münzen und ein strahlend blaues Gewand aufblitzen. Mein Herz schlägt schneller. Eine Jaduna? Die Gestalt ist zu rasch fort, um es sicher sagen zu können.
Ich gehe bis dorthin zurück, wo sie verschwunden ist. Aber alles, was ich finde, ist ein Gang, in dem Wachen paarweise Streife gehen. Wer – oder was – auch immer mich verfolgt, ich werde mich damit beschäftigen müssen, wenn er oder es sich zeigt. Im Augenblick muss ich in den Thronsaal.
Bei der sechsten Glocke, hat Musa gesagt, verlässt die Prinzessin den Thronsaal, um sich in den Speisesaal zu begeben. Geh durch den südlichen Vorraum hinein. Leg dein Schwert auf den Thron und mach, dass du wegkommst. Sobald ihre Wachen es entdecken, wird man Nikla in ihre Gemächer bringen.
Niemand nimmt Schaden, und wir haben Nikla da, wo wir sie haben wollen. Der Blutgreif wird sie erwarten und sein Anliegen vorbringen.
Der Vorraum ist klein und riecht unangenehm nach einer Mischung aus Schweiß und Parfum, aber wie Musa vorausgesagt hat, ist er leer. Ich durchquere ihn lautlos und betrete den Thronsaal.
Wo ich Stimmen höre.
Zuerst die einer Frau, schrill und zornig. Ich habe Prinzessin Nikla seit Monaten nicht mehr sprechen hören und brauche einen Augenblick, um ihren Tonfall zu erkennen.
Bei der zweiten Stimme erstarre ich, denn sie klingt gewalttätig und so leise, dass mir kalt wird. Es ist eine Stimme, die in Adisa nichts zu suchen hat. Eine Stimme, die ich überall erkennen würde. Sie nennt sich selbst Imperator Invictus – Unbezwingbarer Kriegsherr – des Imperiums.
Aber für mich wird sie immer die Kommandantin bleiben.
III: DER SEELENFÄNGER
Der Eintopf schmeckt nach Erinnerungen. Ich traue ihm nicht.
Die Karotten und Kartoffeln sind zart, das Moorhuhn fällt vom Knochen. Aber den ersten Bissen will ich sofort wieder ausspucken. In Schwaden steigt Dampf in der kühlen Luft meiner Hütte auf und beschwört Gesichter. Eine Kriegerin mit blonder Haarkrone, die in einem Urwald neben mir steht und fragt, ob es mir gut geht. Eine kleine tätowierte Frau mit einer Peitsche, von der Blut tropft, und einem grausamen Blick.
Ein goldäugiges Mädchen, das mich, die Hände auf meinem Gesicht, anfleht, sie nicht anzulügen.
Ich blinzele, und die Schüssel fliegt durch den Raum gegen das steinerne Kaminsims an der gegenüberliegenden Wand. Staub rieselt von den meisterlich gearbeiteten Schims herunter, die ich vor Monaten dort aufgehängt habe.
Die Gesichter sind fort. Ich stehe, und die Splitter des roh gezimmerten Tischs, den ich eben erst vollendet habe, bohren sich in meine Hände.
Ich kann mich nicht erinnern, die Schüssel geworfen zu haben oder aufgestanden zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, den Tisch so fest gepackt zu haben, dass meine Hände nun bluten.
Diese Menschen – wer sind sie? Sie sind im Duft der Winterfrüchte und in der Weichheit einer Decke. Im Knauf eines Schwerts und im Fegen des Nordwindes.
Und sie sind in meinen nächtlichen Visionen von Krieg und Tod. Die Träume beginnen immer mit einem großen Heer, das sich gegen eine Woge aus Feuer wirft. Der Himmel brüllt, und ein Strudel mahlt, fühlend und hungrig, und verschlingt alles, was ihm im Weg steht. Auch die Kriegerin. Die kalte Frau und das goldäugige Mädchen verschwinden. In der Ferne sinken die weichen rosa Blüten der Talabäume auf die Erde herab.
Die Träume verursachen mir Unbehagen. Nicht um meinetwillen, sondern um dieser Leute willen.
Sie spielen keine Rolle, Banu al-Mauth. Die Stimme, die in meinem Kopf widerhallt, ist tief und alt. Es ist Mauth, die Magie im Herzen der Zwischenstatt. Mauths Macht schirmt mich vor Bedrohungen ab und gewährt mir einen Einblick in die Gefühle der Lebenden und der Toten. Die Magie hilft mir, Leben zu verlängern oder zu beenden. All das, um die Zwischenstatt zu schützen und den Geistern, die sich hier aufhalten, Trost zu spenden.
Viel von meiner Vergangenheit ist verblasst, doch Mauth hat mir einige Erinnerungen gelassen. Eine darüber, was geschehen ist, als ich Seelenfänger wurde. Meine Gefühle hinderten mich daran, Mauths Magie anzuzapfen. Ich konnte die Geister nicht rasch genug durchschleusen, und sie entkamen aus der Zwischenstatt. Einmal draußen in der Welt, töteten sie Tausende.
Gefühle sind der Feind, rufe ich mir in Erinnerung. Liebe, Hass, Freude, Angst. Alle sind verboten.
Wie lautete der Schwur, den du mir geleistet hast?, fragt Mauth.
»Ich wollte den Geistern auf die andere Seite helfen«, antworte ich. »Ich wollte den Schwachen, den Müden, den Gefallenen und Vergessenen in der Dunkelheit, die auf den Tod folgt, auf dem Weg leuchten.«
Ja. Denn du bist mein Seelenfänger. Banu al-Mauth. Der Erwählte des Todes.
Aber früher war ich jemand anders. Wer? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich wünschte –
Draußen vor der Hütte heult der Wind. Vielleicht sind es aber auch die Geister. Als Mauth erneut spricht, folgt seinen Worten eine Welle der Magie, die meiner Neugier den Stachel nimmt.
Wünsche verursachen nur Schmerz, Seelenfänger. Dein altes Leben ist vorbei. Widme dich dem neuen. Eindringlinge sind unterwegs.
Ich atme durch den Mund, während ich die Suppe aufwische. Als ich meinen Umhang überziehe, denke ich an das Feuer. Im letzten Frühling haben Ifrits die Hütte, die an dieser Stelle stand, niedergebrannt. Sie gehörte Shaeva, der Dschinn, die Seelenfängerin war, bis der Nachtfänger sie tötete. Die Hütte wiederaufzubauen dauerte Monate. Der helle Holzboden, mein Bett, die Regale für Teller und Gewürze – alles ist so neu, dass noch immer Baumsaft austritt. Die Hütte und die Lichtung, auf der sie steht, bieten Schutz vor den Geistern und Feeischen, genau wie damals, als all das noch Shaeva gehörte.
Dieser Ort ist mein Heiligtum. Ich will ihn nicht noch einmal brennen sehen.
Aber die Kälte draußen ist grimmig. Ich schaufle Kohlen ins Feuer und achte darauf, dass tief in der Asche einige Glutnester weiterglimmen. Dann ziehe ich meine Stiefel an und greife mir den Armreif aus Holz; ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich an ihm schnitze – auch wenn ich mich nicht entsinne, woher er kommt. An der Tür werfe ich einen Blick zurück auf meine Schwerter. Es war schwierig, sie aufzugeben. Sie waren ein Geschenk von jemandem. Von jemandem, aus dem ich mir früher etwas gemacht habe.
Weshalb sie jetzt nicht mehr von Bedeutung sind. Ich lasse sie zurück und trete in den Sturm hinaus und hoffe, dass, da ich ein ganzes Reich zu schützen habe und mich um zahllose Geister kümmern muss, die Gesichter, die durch meinen Kopf spuken, am Ende verblassen werden.
***
Die Eindringlinge befinden sich so weit im Süden, dass der Sturm, der um meine Hütte tobte, nur noch ein Raunen ist, als ich mit dem Windwandeln aufhöre. Die Daskische See bestäubt meine Haut mit Salz, und ich höre die Eindringlinge durch die Brandung hindurch. Zwei Männer und eine Frau mit einem Kind auf dem Arm erklimmen durchnässt die glitzernden Klippen Richtung Zwischenstatt.
Sie alle haben die gleiche goldbraune Haut und ungezähmte Lockenpracht – vielleicht eine Familie. Die Überreste einer Schiffsflotte im Flachwasser hinter ihnen, versuchen sie stolpernd einer Horde Ifrits zu entkommen, die Trümmerteile auf sie werfen.
Obwohl ich mich verstecke, sehen die Ifrits zum Wald, als sie meine Anwesenheit spüren, und beschweren sich enttäuscht. Während sie sich zurückziehen, halten die Menschen weiter auf die Bäume zu.
Shaeva hat Knochen und Leiber gebrochen und an den Grenzen zurückgelassen, damit sie dort gefunden werden. Ich konnte mich nicht dazu überwinden – und das habe ich nun davon. Für Menschen ist die Zwischenstatt einfach der Dämmerwald. Sie haben vergessen, was hier lebt.
Die wenigen Geister, die ich noch nicht durchgeschleust habe, sammeln sich hinter mir und schreien angesichts der Anwesenheit dieser Menschen auf, weil sie sie quält. Die Männer wechseln Blicke. Aber die Frau mit dem Kind beißt die Zähne zusammen und geht weiter auf den Wald zu.
Als sie unter das Blätterdach tritt, umzingeln sie die Geister. Sie kann sie nicht sehen. Aber sie wird bleich bei ihrem unwilligen Knurren. Das Kind bewegt sich ruckartig.
»Ihr seid hier nicht willkommen, Reisende.« Ich tauche zwischen den Bäumen auf, und die Männer bleiben stehen.
»Ich muss sie füttern.« Die Wut der Frau, mit Verzweiflung gepaart, umwabert sie. »Ich brauche ein Feuer, um sie zu wärmen.«
Die Geister zischen, als eine Welle durch den Wald läuft. Die Bäume spiegeln Mauths Gestimmtheit wider. Er mag die Eindringlinge nicht mehr, als es die Geister tun.
Das letzte Mal, dass ich mit Mauths Hilfe jemandem das Leben genommen habe, liegt Monate zurück. Ich habe, fast ohne zu überlegen, eine Gruppe karkaunischer Kriegsherren getötet. Jetzt wende ich diese Macht wieder an, suche den Lebensfaden der Frau und ziehe daran. Zuerst packt sie ihr Kind nur noch fester. Dann schnappt sie nach Luft und greift sich an den Hals.
»Fozya!«, ruft einer der beiden Männer. »Zurück –«
»Nein!«, stößt Fozya hervor, selbst als ich ihr die Luft aus den Lungen drücke. »Seine Leute sind Mörder. Wie viele hat er schon umgebracht, während er hier wie eine Spinne auf der Lauer lag? Wie –«
Fozyas Worte bleiben bei mir hängen. Wie viele hat er schon umgebracht –
Wie viele –
In meinem Kopf werden Schreie laut: die Schreie Tausender Männer, Frauen und Kinder, die gestorben sind, nachdem ich letzten Sommer zugelassen habe, dass die Mauer der Zwischenstatt fiel. Die Menschen, die ich als Soldat getötet habe, Freunde, die ich mit meinen eigenen Händen umgebracht habe – sie alle marschieren vor meinem geistigen Auge vorbei und fällen mit toten Augen ihr Urteil über mich. Es ist zu viel. Ich kann es nicht ertragen –
So plötzlich, wie mich dieses Gefühl überfallen hat, klingt es wieder ab. Magie flutet durch mich hindurch: Mauth, der meinen Geist beruhigt und mir Frieden bringt. Distanz.
Fozya und ihresgleichen müssen wieder gehen. Ich presse der Frau fast das Leben aus dem Leib. Beinahe lässt sie das Kind fallen. Bei jedem Schritt, den ich auf sie zumache, taumelt sie zurück und bricht endlich am Strand zusammen.
»Schon gut, wir gehen wieder«, keucht sie. »Tut mir leid –«
Ich lasse sie los, und sie flieht Richtung Norden, während ihre Gefährten ihr nacheilen. Sie halten sich an der Küstenlinie und werfen immer wieder verängstigte Blicke zu den Bäumen, bis sie außer Sichtweite sind.
»Sei gegrüßt, Seelenfänger.« Der Geruch von Salz ist übermächtig, während die schäumenden Wellen zu meinen Füßen die Gestalt eines Mannes annehmen. »Deine Macht ist gewachsen.«
»Warum so weit im Landesinneren, Ifrit?«, frage ich die Kreatur. »Ist es wirklich so verlockend, Menschen zu quälen?«
»Der Nachtbringer hat die Zerstörung angeordnet«, erwidert der Ifrit. »Wir können … es kaum erwarten, ihm zu Gefallen zu sein.«
»Du meinst, ihr fürchtet euch davor, sein Missfallen zu erregen.«
»Er hat viele von meinesgleichen getötet«, sagt der Ifrit. »Ich möchte niemanden von ihnen mehr leiden sehen.«
»Lasst sie in Ruhe.« Ich nicke dorthin, wo die Menschen verschwunden sind. »Sie befinden sich nicht länger in eurem Hoheitsgebiet, und sie haben euch nichts getan.«
»Warum scherst du dich darum, was ihnen zustößt? Du bist nicht mehr einer der Ihren.«
Ich entgegne: »Je weniger Geister ich durchschleusen muss, desto besser.«
Der Ifrit erhebt sich gegen mich, schlingt sich um meine Beine und zerrt an mir, als wollte er mich unter Wasser ziehen. Aber Mauths Macht schirmt mich ab. Als der Ifrit loslässt, habe ich das bestimmte Gefühl, dass er mich nur auf die Probe stellen wollte.
»Eine Zeit wird kommen, da du dir wünschen wirst, diese Worte nie gesprochen zu haben«, sagt er. »Dann, wenn Mauth die Schreie in deinem Kopf nicht länger wegzaubern kann. An diesem Tag suche Siladh auf, den Herrn der Meeresifrits.«
»Bist du das?«
Die Kreatur antwortet nicht, stattdessen lässt sie sich in den Sand zurückfallen, und ich bin bis zu den Knien durchnässt.
Sobald ich wieder im Wald bin, schleuse ich ein Dutzend Geister durch. Um das tun zu können, muss ich ihren Schmerz und Zorn verstehen und auflösen, sodass sie diese Gefühle loslassen und in die nächste Dimension weiterreisen können. Mauths Magie erfüllt mich und gestattet mir einen raschen, tiefen Einblick in das Leiden dieser Seelen.
Die meisten brauchen nur wenige Augenblicke, um weiterzuziehen. Als ich fertig bin, untersuche ich die Grenzmauer, die für menschliche Augen unsichtbar ist, auf Schwachstellen. Die undurchdringliche Wand aus Bäumen öffnet sich für mich, während ich weiterlaufe. Der Weg unter meinen Füßen ist so eben wie eine Straße im Imperium.
So ist es, seit ich mich Mauth ausgeliefert habe. Als ich die Hütte baute, tauchte in regelmäßigen Abständen Holz auf, behauen und abgeschmirgelt wie von einem Zimmermann. Ich wurde nie gebissen, noch war ich krank, noch hatte ich Mühe, Wild zu finden. Dieser Wald ist eine physische Manifestation Mauths. Obwohl er auf Außenstehende wie jeder andere Wald wirkt, verändert er ihn nach meinen Bedürfnissen.
Nur, solange du für Mauth nützlich bist.
Schreie und Gesichter erheben sich wieder in meinem Kopf, und diesmal verschwinden sie nicht. Ich windwandle im Sturm zurück ins Herz der Zwischenstatt: zum Dschinnhain oder vielmehr zu seinen Überresten.
Bevor ich gemeinsame Sache mit Mauth machte, mied ich den Hain geflissentlich. Aber jetzt ist er ein Ort, an dem ich meine Probleme vergessen kann. Es handelt sich dabei um eine weite Ebene auf einer steilen Klippe über der Stadt der Dschinns. Jenseits dieser dunklen, gespenstisch stillen Ansiedlung schlängelt sich glitzernd der Dämmerfluss dahin.
Ich überfliege die geschwärzten Hüllen der wenigen Bäume, die noch vom Hain übrig sind und wie Wächter dastehen, einsam im strömenden Regen. In den fünf Monaten, seitdem der Nachtbringer die Dschinns befreit hat, habe ich nicht die geringste Spur auch nur eines einzigen von ihnen gefunden. Nicht einmal hier, an diesem Ort, der früher ihr Gefängnis war.
»Du gibst mir Geleit zum Gefängnis von Kauf. Und du hilfst mir, meinen Bruder von dort zu befreien.«
Die Worte erwecken die Erinnerung an ein goldäugiges Mädchen zum Leben. Zähneknirschend halte ich auf den größten der Bäume zu, eine tote Eibe mit vom Feuer geschwärzten Ästen. Ihr Stamm ist auf allen Seiten angesengt. Daneben liegt eine Eisenkette, die ich aus einem Martialendorf habe mitgehen lassen und deren einzelne Glieder halb so groß wie mein Handteller sind.
Ich hebe die Kette hoch und schlage sie auf der einen Seite gegen den Baum, dann auf der anderen, sodass die Brandmarken tiefer und tiefer werden. Schon nach wenigen Minuten beginnen meine Arme zu schmerzen.
Wenn dein Geist dir nicht zuhört, übe deinen Körper. Dein Geist wird folgen. Der Himmel weiß, wer das zu mir gesagt hat, aber ich habe mich in den letzten Monaten daran festgeklammert, und ich kehre immer und immer wieder in den Dschinnhain zurück, wenn meine Gedanken rastlos werden.
Nach einer halben Stunde bin ich schweißgebadet. Ich ziehe mein Hemd aus, während mein Körper schon stöhnt, aber ich habe ja gerade erst begonnen. Denn indem ich Steine stemme und den Baum peitsche und den Steilhang hinauf- und hinunterlaufe, schwinden die Gesichter und Geräusche, die mich heimsuchen.
Mein Körper ist das Einzige, was an mir noch menschlich ist. Er ist zuverlässig und real. Er leidet Hunger und Erschöpfung, wie er es schon immer getan hat. Wenn ich ihn geißle, bedeutet das, dass ich auf eine bestimmte Art atmen, auf eine bestimmte Art das Gleichgewicht halten muss. Das erfordert all meine Konzentration, sodass nichts für die Dämonen übrig bleibt.
Sobald ich die Möglichkeiten des Dschinnhains ausgeschöpft habe, schleppe ich mich zu seinem östlichen Rand, der zum Dämmerfluss hin abfällt, welcher nach dem Sturm schnell und tückisch ist. Ich springe hinein und schnappe angesichts des eisigen Wassers nach Luft, bevor ich den knappen halben Kilometer hinüberschwimme, wobei ich alles bis auf die Kälte und die Strömung aus meinem Geist verbanne.
Dann kehre ich nass und ausgelaugt, aber mit klarem Kopf ans Ufer zurück. Ich bin bereit, mich den Geistern zu stellen, die mich in den Bäumen erwarten. Denn selbst beim Schwimmen habe ich ein großes Nehmen von Leben weit im Norden wahrgenommen. Ich werde heute Nacht viel zu tun haben.
Ich wende mich der alten Eibe zu, um meine Kleider zu holen. Doch neben dem Baum steht jemand.
Mauth hat meinem Geist ein Bewusstsein für die Zwischenstatt eingepflanzt, das einer Landkarte gleicht. Ich taste nun nach diesem Bewusstsein und suche nach dem pulsierenden Glühen, das sonst die Anwesenheit eines Eindringlings anzeigt.
Die Karte ist leer.
Ich blinzele durch den Regen – vielleicht ein Dschinn? Aber nein, selbst die Feeischen hinterlassen eine Spur, denn ihre Magie folgt ihnen wie ein Kometenschweif.
»Du hast die Zwischenstatt betreten«, rufe ich. »Dieser Ort ist den Lebenden verboten.«
Ich höre nichts außer dem Regen und dem Wind. Die Gestalt steht still, doch die Luft knistert. Magie.
Dieses Gesicht blitzt in meinem Gedächtnis auf. Schwarzes Haar. Goldene Augen. Zauberei bis in die Knochen. Aber wie hieß sie? Wer war sie?
»Ich werde dir nicht wehtun.« Ich spreche, wie ich mit den Geistern sprechen würde – behutsam.
»Wirklich, Elias Veturius?«, fragt die Gestalt. »Nicht einmal jetzt? Nicht nach allem, was war?«
Elias Veturius. Der Name beschwört viele Bilder herauf. Eine Schule aus nacktem grauem Fels und mit dröhnenden Trommeln. Die winzige Frau mit den Eisaugen. In mir schreit eine Stimme: Ja, Elias Veturius. Das bin ich.
»Das ist nicht mein Name«, sage ich zu der Gestalt.
»Doch, und du musst ihn dir gut merken.« Die Stimme der Gestalt ist so leise, dass ich nicht sagen kann, ob es ein Mann oder eine Frau ist, Erwachsener oder Kind.
Sie ist es! Mein Herz schlägt zu schnell. Gedanken, die ich nicht haben sollte, drängen sich in meinen Kopf. Wird sie mir ihren Namen verraten? Wird sie mir verzeihen, dass ich ihn vergessen habe?
Dann tauchen in der Dunkelheit zwei welke Hände auf und schieben die Kapuze zurück. Die Haut des Mannes ist blass wie gebleichtes Leinen und das Weiß seiner Augen strahlend und blutgeädert. Obwohl ich das Meiste von mir selbst vergessen habe, ist dieses Gesicht in mein Gedächtnis eingebrannt.
»Ihr«, flüstere ich.
»In der Tat, Elias Veturius«, erwidert Cain, der Augur. »Gekommen, dich zu quälen. Ein letztes Mal.«
IV: LAIA
Keris Veturia ist in Marinn und nur wenige Meter von mir entfernt. Wie kann das sein? Ich würde am liebsten schreien. Vor wenigen Tagen erst berichteten Musas Wichte, dass sie sich in Serra aufhalte.
Aber welche Rolle spielt das, wenn Keris den Nachtbringer rufen kann? Er muss mit dem Wind geflogen sein, um sie nach Adisa zu bringen.
Mein Herzschlag dröhnt in meinen Ohren, aber ich zwinge mich weiterzuatmen. Die Anwesenheit der Kommandantin erschwert alles. Aber trotzdem muss ich Nikla aus dem Thronsaal und in ihre Gemächer schaffen. Die Kundigen und Martialen in Delphinium haben wenige Waffen, wenig Essen und keine Verbündeten. Wenn Nikla sich nicht anhört, was der Blutgreif zu sagen hat, ist jede Hoffnung auf Hilfe dahin.
Lautlos schleiche ich näher, bis Nikla und Keris in Sicht kommen. Die Marinenprinzessin sitzt kerzengerade auf dem gewaltigen Treibholzthron ihres Vaters, ihr Gesicht liegt im Schatten. Ihr burgunderrotes Kleid ist an der Hüfte eng mit einer Kordel gegürtet und schleppt auf dem Boden, als wäre es eine Pfütze aus Blut. Zwei Wachen stehen hinter dem Thron, vier weitere links und rechts.
Die Kommandantin steht in ihrer Zeremonialrüstung vor Nikla. Sie trägt keine Waffen, keine Krone. Das ist nicht nötig. Keris schöpfte ihre Macht schon immer aus ihrer Durchtriebenheit und ihrer Gewalttätigkeit.
Ihre Haut schimmert silbern in ihrem Nacken, denn sie hat das Hemd aus lebendem Metall angelegt, das sie dem Blutgreif gestohlen hat. Ich staune über ihre Körpergröße – sie ist gut und gern fünfzehn Zentimeter kleiner als ich. Trotz all des Elends, das sie verursacht hat, könnte man sie von fern für ein junges, harmloses Mädchen halten.
Während ich näher und näher rücke, geraten die Schatten auf Niklas Gesicht wimmelnd in Bewegung: Ghuls, die sich am Schmerz der Kronprinzessin weiden und sie als gottloser Heiligenschein umschwirren, welchen sie nicht sehen kann.
»– könnt keine Entscheidung treffen«, sagt Keris gerade. »Vielleicht sollte ich mit Eurem Vater sprechen.«
»Ich werde meinen Vater nicht aufregen, solange er krank ist«, entgegnet Nikla.
»Dann ergebt Euch, Prinzessin.« Die Kommandantin hält ihre Handflächen nach oben, als würde jemand anders diese abscheulichen Worte sprechen. »Die Angriffe auf Euer Volk werden aufhören. Die Dschinns werden sich zurückziehen. Die Kundigen liegen Euch auf der Tasche. Ihr wisst das.«
»Weshalb ich sie dazu angehalten habe, Adisa zu verlassen«, sagt Nikla. »Jedenfalls ist das, worum Ihr bittet –« Die Prinzessin schüttelt den Kopf.
»Ich biete Euch an, Euch das Gesindel abzunehmen, das nur Probleme bereitet.«
»Um sie zu versklaven.«
Keris lächelt. »Um ihnen einen neuen Sinn im Leben zu geben.«
Vor Wut beginnen meine Hände zu zittern. Meine Mutter, Mirra von Serra, konnte mir nichts, dir nichts Mauern erklimmen. Ich wünschte, ich besäße die gleiche geheimnisvolle Fähigkeit. Ich würde sie dazu benutzen, mich auf Keris zu stürzen, jetzt, da sie es am wenigsten erwartet.
Ich greife nach meinem Dolch – nicht nach dem, den ich auf Niklas Thron legen wollte, sondern nach einer älteren Waffe. Elias hat ihn mir vor langer Zeit geschenkt. Er ist verflucht scharf und von der Parierstange bis zur Spitze mit Gift beschichtet. Ich fahre mit dem behandschuhten Finger über die Klinge und arbeite mich näher an den Thron heran.
»Was ist mit den Tausenden Kundigen, die Ihr umgebracht habt?« Nikla schüttelt leicht den Kopf, womit sie unwissentlich die verärgert zwitschernden Ghuls vertreibt. »Wo war deren Sinn im Leben? Ihr habt Völkermord begangen, Imperatrix. Woher soll ich wissen, dass Ihr das nicht wieder tun werdet?«
»Die Anzahl der angeblich getöteten Kundigen war maßlos übertrieben«, entgegnet Keris. »Die, die ich tatsächlich hingerichtet habe, waren Verbrecher. Rebellen und politische Abweichler. Ihr habt Euch von Eurem eigenen Gemahl losgesagt, weil er sich gegen die Monarchie ausgesprochen hat. Meine Methoden waren nur endgültiger.«
Die Haushofmeisterin tritt hinter dem Thron hervor. Ihr Gesicht ist ernst, als sie sich vorbeugt, um Nikla etwas ins Ohr zu flüstern.
»Vergebt mir, Imperatrix«, sagt die Prinzessin anschließend. »Ich komme zu spät zu meiner nächsten Verpflichtung. Wir werden morgen früh weiterreden. Meine Wache kann Euch zu Eurer Unterkunft geleiten.«
»Wenn es Euch nichts ausmacht«, erwidert die Kommandantin, »möchte ich mir noch einen Augenblick Zeit lassen, um Euren Thronsaal zu bewundern. Seine Schönheit ist weithin berühmt – selbst im Imperium.«
Nikla erstarrt, und ihre Hände schließen sich noch fester um die aufwändig geschnitzten Armlehnen des Throns.
»Natürlich«, antwortet sie endlich. »Die Wachen werden auf dem Korridor warten.«
Die Prinzessin rauscht hinaus, ihre Soldaten im Schlepptau. Ich weiß, dass ich ihr folgen sollte. Einen anderen Weg finden, um eine Bedrohung zu fingieren, damit man sie in ihre Gemächer bringt.
Aber ich ertappe mich dabei, wie ich die Kommandantin anstarre. Sie ist eine Mörderin. Aber nein – das ist zu simpel. Sie ist ein Monstrum im Gewand einer Mörderin. Eine Ausgeburt der Hölle, die sich als Mensch verkleidet hat.
Sie betrachtet die Glasmalereien der Kuppel über ihr, wo Schiffe mit geblähten Segeln durch das türkisfarbene Meer von Marinn gleiten. Ich mache vorsichtig einen Schritt auf sie zu. Wie viel Leid hätte sich vermeiden lassen, wenn ich vor Monaten den Mut gehabt hätte, sie zu töten? Damals vor den Toren von Serra, wo sie bewusstlos zu meinen Füßen lag!
Jetzt könnte ich wieder mit einem Streich ihrem Leben ein Ende setzen. Sie kann mich nicht sehen. Ich hefte meinen Blick auf ihren Hals, auf die lebhafte blaue Tätowierung, die ihren Nacken hinaufkriecht.
Ihre Brust hebt und senkt sich, und es erinnert daran, dass sie immer noch ein Mensch ist, gleichgültig, was sie getan hat. Und sie kann sterben wie wir anderen auch.
»In die Kehle oder nirgendwohin, Laia von Serra.« Die Stimme der Kommandantin ist leise. »Es sei denn, du durchbohrst meinen Kampfanzug, um die Beinarterie zu treffen. Aber ich bin schneller als du, also wirst du damit wahrscheinlich kein Glück haben.«
Ich mache einen Satz nach vorn, aber sie wendet sich zu dem fast unhörbaren Rascheln meines Umhangs um, als ich auf sie zufliege. Bei unserem Zusammenprall fällt meine Unsichtbarkeit von mir ab. Bevor ich auch nur einen weiteren Atemzug tue, wirft mich die Kommandantin rücklings zu Boden und klemmt meine Schenkel zwischen ihren Knien ein. Mit einer Hand fixiert sie meine Arme, während mir die andere Elias’ Waffe an die Kehle hält. Ich habe es nicht mal gespürt, dass sie sie mir weggenommen hat.
Ich winde mich, aber der hohe Kragen meines Hemdes schützt mich vor dem Gift auf der Klinge. Die silberne Haut ihrer Brust blitzt auf. Sie neigt den Kopf, und ihr reptilienartiger Blick bohrt sich in mich.
»Wie wirst du sterben?«, fragt sie. »In der Schlacht wie deine Mutter? Oder im Schrecken wie meine?« Ihre Hand umklammert das Heft des Dolchs. Reden. Mach, dass sie weiterredet.
»Wagt –« Ich keuche, als sie die Waffe gegen meine Luftröhre drückt. »Wagt es nicht, so über meine Mutter zu sprechen, Hex–«
»Ich weiß nicht, warum du dich aufregst, Mädchen«, stößt sie hervor. »Ich weiß i-immer –«
Der Druck des Messers an meiner Kehle lässt nach. Keris’ Augen werden groß, und sie hustet. Ich arbeite mich unter ihr hervor und rolle mich zur Seite. Sie stürzt sich auf mich, und als sie mich verfehlt und stolpert, erlaube ich mir ein Lächeln. Sie verliert gerade das Gefühl in den Händen. In den Beinen. Ich weiß es, weil ich das Gift am eigenen Leib erlebt habe.
Zu spät bemerkt Keris meine Handschuhe. Zu spät lässt sie Elias’ Dolch fallen, ohne den Blick von dessen Knauf abzuwenden, während ihr aufgeht, wie das Gift auf sie übergegangen ist. Wenn sie es eingenommen hätte, hätte es sie getötet. Aber auf der Haut ist es nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Eine, die übel genug ist, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Die Kommandantin taumelt rückwärts, während ich einen Langdolch aus meinem Stiefel reiße.
Aber Keris Veturia ist schon fast ihr ganzes Leben im Krieg. Ihr Instinkt übernimmt, und als ich nach ihrer Kehle stoße, antwortet sie mit einem Schlag knapp unter mein Brustbein, sodass ich mich vornüber krümme. Mir fällt die Waffe aus den Händen, und ich greife nach meinem letzten Messer. Mit einem Hieb gegen mein Handgelenk sorgt Keris dafür, dass es klirrend über den Boden davonschlittert.
Draußen ertönen Stimmen. Die Wachen.
Ich taumle gegen Keris, während sie sich davon ablenken lässt, doch sie schüttelt mich mit solcher Kraft ab, dass ich gegen den Thron pralle und benommen zu Boden sacke. Sie öffnet den Mund, um die Wachen auf sich aufmerksam zu machen – wahrscheinlich ist es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie um Hilfe ruft. Aber das Gift hat ihr auch die Stimme geraubt, und sie hat Mühe zu stehen und bricht endlich mit ungelenk erschlafften Gliedmaßen zusammen.
Jetzt oder nie, Laia. Wo in aller Welt sind meine Dolche? Ich würde sie erwürgen, aber sie könnte mittendrin aufwachen. Sie wird höchstens eine Minute lang ohnmächtig sein. Ich brauche eine Waffe.
Das Heft von Elias’ Dolch lugt unter dem Thron hervor. Gerade als ich ihn, noch immer um Luft ringend, zu fassen bekomme, werde ich wie eine Puppe zurückgeschleudert.
Ich krache gegen eine Säule aus Quarz. Der Thronsaal verschwimmt vor meinen Augen und wird wieder scharf, als eine Gestalt, die nicht die Kommandantin ist und ganz gewiss eben noch nicht da war, auf mich zukommt.
Blasse Haut. Ein dunkler Umhang. Warme braune Augen. Sommersprossen, die über ein herzzerreißend schönes Gesicht tanzen. Und ein Rotschopf, der nichts im Vergleich zu dem Feuer ist, das in diesem Wesen brennt.
Ich weiß, was er ist. Ich kenne ihn. Aber als ich ihn sehe, denke ich nicht: Nachtbringer! Dschinn! Feind!
Ich denke: Kinan. Freund. Geliebter.
Verräter.
Lauf, Laia! Mein Körper verweigert den Gehorsam. Blut strömt salzig und heiß aus einer klaffenden Wunde an der Seite meines Schädels. Meine Muskeln schreien, die Beine schmerzen wie sonst immer nach dem Auspeitschen. Der Schmerz ist ein Seil, das um mich geschlungen ist und sich fester und fester zieht.
»D-du«, bekomme ich endlich heraus. Warum sollte er diese Gestalt annehmen? Warum, wenn er es bis jetzt vermieden hat?
Weil er will, dass du panisch und unvorsichtig wirst, dumme Kuh!
Sein Geruch nach Zitrone und Holzrauch erfüllt meine Sinne. Er ist so vertraut, auch wenn ich versucht habe, ihn zu vergessen.
»Laia von Serra. Es ist schön, dich wiederzusehen, meine Liebste.« Kinans Stimme ist leise und warm. Aber er ist nicht Kinan, rufe ich mir in Erinnerung. Er ist der Nachtbringer. Nachdem ich mich in ihn verliebt hatte, nachdem ich ihm den Armreif meiner Mutter als Unterpfand dieser Liebe geschenkt hatte, offenbarte er sein wahres Wesen. Der Armreif war das Bruchstück des Sterns – eines Talismans, den er brauchte, um seine gefangenen Brüder zu befreien. Als er den Armreif besaß, hatte er keine Verwendung mehr für mich.
Er legt mir eine Hand auf den Arm, um mir aufzuhelfen, aber ich schüttle ihn ab und komme aus eigener Kraft auf die Beine.
Es ist über ein Jahr her, dass ich den Nachtbringer zum letzten Mal in seiner menschlichen Gestalt gesehen habe. Ich wusste bis jetzt nicht, welch ein Geschenk das war. So viel Sorge in diesen dunklen Augen. So viel Zuwendung. Und nur, um eine niederträchtige Kreatur zu verbergen, die sich nichts sehnlicher wünscht, als mich auszulöschen.
Die Kommandantin wird bald wieder zu sich kommen. Und während der Nachtbringer mich nicht töten kann – und auch keinen anderen, der den Stern je berührt hat –, kann es Keris Veturia sehr wohl.
»Verdammt seist du.« Ich sehe an dem Nachtbringer vorbei zu Keris. Wenn ich nur zu ihr könnte –
»Ich kann nicht zulassen, dass du ihr etwas antust, Laia.« Der Nachtbringer klingt fast bedauernd. »Sie dient einem Ziel.«
»Verflucht sei dein Ziel in alle Ewigkeit!«
Der Nachtbringer sieht zum Portal.
»Es ist sinnlos zu schreien. Die Wachen werden im Augenblick dringend anderswo gebraucht.« Er geht neben Keris in die Hocke und fühlt ihren Puls mit einer Zartheit, die mich verblüfft.
»Du willst sie umbringen, Laia von Serra.« Er erhebt sich und kommt näher. »Denn Keris ist der Ursprung all deiner Leiden. Sie hat deine Familie zerstört und deine Mutter zu einer Mörderin und Kindsmörderin gemacht. Sie hat dein Volk verfolgt und quält es noch immer. Du würdest alles tun, um ihr Einhalt zu gebieten, richtig? Was unterscheidet dich dann noch von mir?«
»Ich bin kein bisschen wie du –«
»Auch meine Familie wurde umgebracht. Meine Frau auf einem Schlachtfeld erschlagen. Meine Kinder mit Salz und Stahl und Sommerregen ermordet. Meinesgleichen niedergemetzelt und eingekerkert.«
»Von Menschen, die seit tausend Jahren tot sind!«, schreie ich. Aber warum rede ich überhaupt mit ihm? Er schindet Zeit, bis die Kommandantin aufwacht. Er glaubt, dass ich zu dumm bin, es zu bemerken.
Wut kocht in meinen Adern, betäubt meinen Schmerz und lässt mich die Kommandantin vergessen. Sie färbt alles rot, und eine Dunkelheit regt sich brüllend in mir. Dieselbe Wildheit, die sich vor Monaten in mir erhob, als ich ihm meinen Armreif schenkte. Das Tier, das im Dämmerwald angriff, als ich schon dachte, er werde Elias töten.
Der Nachtbringer funkelt mich an, und sein Mund verzieht sich zu einer unmenschlichen Grimasse. »Was bist du?«, fragt er, und es ist das Echo einer Frage, die er schon einmal gestellt hat.
»Du wirst nicht gewinnen.« Meine Stimme ist ein unkenntliches Knurren, das aus einem uralten, ursprünglichen Teil meiner Seele kommt. »Du hast zu vielen mit deiner Rache geschadet.« Ich bin nur noch wenige Zentimeter von ihm entfernt, starre in diese vertrauten Augen, während mein eigener Blick Hass verströmt. »Es schert mich nicht, was dafür notwendig ist oder wie lange es dauern wird. Ich werde dich bezwingen, Nachtbringer.«
Schweigen tritt zwischen uns ein. Der Moment ist unnatürlich lang und so still wie der Tod.
Dann höre ich einen ohrenbetäubenden, unheimlichen Schrei. Er hört und hört nicht auf. Die Glasfenster über uns bekommen Risse, der Thron splittert. Ich schlage mir die Hände über die Ohren. Woher kommt das?
Das bin ich, geht mir auf. Ich schreie. Nur dass nicht ich es bin, oder? Es ist etwas in mir. Sobald ich das begreife, ist es, als würde meine Brust aufreißen. Das dunkle Licht, das aus meinem Körper fließt, brüllt, als wäre es nach langer Gefangenschaft endlich befreit. Ich versuche, es aufzuhalten, es in mir zu behalten.
Aber es ist zu machtvoll. Ich höre rasche Schritte, sehe kajalumrandete Augen. Münzen klirren – ein Geräusch, an das ich mich jetzt erinnere. Der Kopfputz der Jadunas.
Ich muss weglaufen – ihnen entkommen.
Stattdessen falle ich auf die Knie, und die Welt wird weiß.
V: DER SEELENFÄNGER
Beim Anblick des Augurs überfällt mich ein unnatürlich anmutendes Gefühl. Wie ein Tier zerfetzt es mir mit seinen Krallen die Eingeweide.