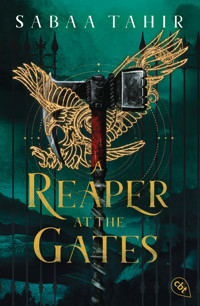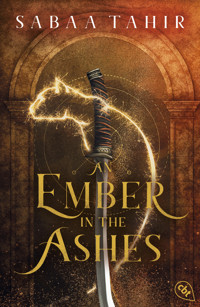15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Heir-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Waise. Eine Ausgestoßene. Ein Prinz. Und ein Killer, der ein ganzes Imperium in die Knie zwingt.
Aiz hat als Kind im Waisenhaus eine Tragödie erlebt und dürstet seitdem nach Rache. Sirsha, die wegen eines unverzeihlichen Verbrechens aus ihrem Stamm verbannt wurde, kann mit Erde, Luft und Wasser sprechen. Für Geld erklärt sie sich bereit, einen gewissenlosen Mörder zu jagen. Doch dabei kommt ihr die Liebe in die Quere. Quil ist der Kronprinz des Imperiums, will aber als Sohn des meistgehassten Imperators seines Volks keine Macht übernehmen. Als jedoch ein bösartiger Feind das Imperium bedroht, muss Quil sich fragen, ob er sein Erbe nicht doch antreten will.
Die drei jungen Helden begeben sich auf eine düstere und atemlose Reise, die sie das Leben kosten könnte – und ihre Herzen.
In ihrer großen neuen Fantasy-Dilogie kehrt New-York-Times-Bestsellerautorin Sabaa Tahir zurück in die Welt von »An Ember in the Ashes«. Dort kämpfen eine Waise, eine Ausgestoßene und ein Prinz mit der Bürde der Macht, den verheerenden Folgen hemmungsloser Gier und den Fallstricken der Liebe.
Enthaltene Tropes: Fated (Soul-)Mates, Forced Proximity, Broken Hero/Heroine
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 772
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabaa Tahir
Heir
Aus dem amerikanischen Englisch von Christel Kröning, Hanna Christine Fliedner und Christopher Bischoff
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 der deutschsprachigen Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
[email protected] (Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2024 Sabaa Tahir
Entwurf der Karte: Sabaa Tahir / Illustration der Karte © 2024 Francesca Bearald
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »Heir« bei G. P. Putnam’s Sons, einem Imprint der Verlagsgruppe Penguin Random House LLC, New York
Übersetzung: Christel Kröning, Hanna Christine Fliedner und Christopher Bischoff
Lektorat: Tamara Reisinger
Umschlagkonzeption: Geviert GbR, Grafik und Typografie, nach einer Vorlage von Kristen Boyle
Coverillustration, Innenillustration: © 2024 Micaela Alcaino
kk · Herstellung: ang
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-32581-7V002
www.cbj-verlag.de
Karte
Für Cathy Yardley, die zehn Jahre lang mit mir durch den Morast meiner Ideen gewatet ist. Deine Geduld und Liebe sind ein Geschenk. Du erinnerst mich daran, dass ich Wertvolles zu sagen habe. Danke!
Und für Sami, mein ureigenes flauschiges Licht von Earendil.
Teil I Der Fall
1 Aiz
Kegar, Südlicher Kontinent
Aiz wünschte, sie würde ihre Feinde nicht so glühend hassen, denn das gab ihnen Macht über sie. Doch sie war ein Kind der Gosse, und die Gosse in Kegar brachte zähe und raue Kreaturen hervor, bereit, Ränke zu schmieden, zuzustechen oder sich in den Schatten zu verkriechen, je nachdem, was die Situation erforderte.
Was die Gosse nicht bot, war Glück. Glück konnte einem in Kegar nur durch ein göttliches Wesen zuteilwerden.
Daher schlich Aiz gerade kurz vor Tagesanbruch durch die stillen Gänge mit den hohen Deckenbalken auf den gepflasterten Innenhof des Klosters. Den dreißig Zentimetern Neuschnee, die in der Nacht gefallen waren, hatte Aiz in ihren dünnen Schuhen und dem zerschlissenen Rock wenig entgegenzusetzen. Dennoch schob sie sich mit grimmiger Miene voran, durch den beißenden Wind, der von den Gipfeln herabfegte und ihr den Atem nahm. Vielleicht würde er ihr ja auch die Wut nehmen. Mehr als je zuvor brauchte sie heute einen klaren Kopf.
Denn heute würde Aiz bet-Dafra ihren ersten Mord begehen.
Die Klosterwaisen und die Ordensmitglieder schliefen noch. Der Unterricht begann erst nach Sonnenaufgang. Auch der Rest von Kegar – dieser mit ihrer Viertelmillion an Einwohnern übervollen Stadt – lag hinter den Klostermauern ruhig da. Aiz war allein, die Wut ihre einzige Begleiterin. Sie betrachtete die verkohlten Balken an der einen Seite des Innenhofs: der alte Waisenflügel, noch immer eine Ruine, nachdem er vor zehn Jahren fast bis auf die Grundmauern niedergebrannt war.
Der Anblick schnürte Aiz die Kehle zu, und wieder hörte sie die Schreie der anderen Kinder, die es nicht wie sie aus den Flammen herausgeschafft hatten. Sie grub die Fingernägel in ihren Oberschenkel, in die Narben unter ihrem Flickenrock. Die meiste Zeit verschwendete Aiz keinen Gedanken an sie. Doch an manchen Tagen brannten sie nach wie vor.
Deine Wut bringt dich noch ins Grab, hatte ihr ältester Freund Cero vor Jahren zu ihr gesagt. Zu oft hatte er miterlebt, wie sie die Beherrschung verlor, kein Wunder also, dass er so dachte. Du musst sie im Zaum halten. Nimm dir, was du brauchst. Vergiss alles andere.
Was Aiz brauchte, war Rache. Gerechtigkeit. Dass ihr Plan funktionierte.
Vor der Statue in der Mitte des Innenhofs blieb sie stehen: eine Frau in einem Gewand mit Glockenärmeln, die den Blick auf die Berge gerichtet hatte. Ausgeprägte Wangenknochen im steinernen Gesicht, schmale Lippen und eine markante Brauenpartie, die Haare aus der hohen Stirn gekämmt, darauf ein Kopfschmuck mit einer strahlend aufgehenden Sonne. Aiz stellte sich gern vor, dass sie und das Vorbild der Statue die gleichen braunen Haare und hellen Augen hatten.
Die Frau hatte viele Namen. Kelch der Quelle. Erste Königin der Überfahrt. Aber hier im Armenviertel Dafra, wo so viele durch Militärdienst, Krankheit und Hunger zu Waisen geworden waren, nannte man sie Mutter Div.
Die Gedenktafel an der Statue war durch die Witterung nahezu unleserlich geworden, doch Aiz konnte die Inschrift seit Kindertagen auswendig: Gesegnet sei Div, Retterin von Kegar, die unser Volk nach der großen Katastrophe im Mutterland jenseits des Meeres hier zwischen den Gipfeln in Sicherheit brachte.
»Mutter Div, hör mich an.« Aiz faltete die Hände zum Gebet. »Lass mich nicht versagen. Ich kann nicht länger warten. Werde ich gefangen genommen oder gefoltert, so sei es. Werde ich getötet, so ist es dein Wille. Aber zuvor muss ich Erfolg haben.«
Seltsam, die Schutzpatronin des Lichts und der Güte darum zu bitten, ihren Segen für einen Mord zu geben, so viel war Aiz klar. Doch in Mutter Divs Herzen hatten Waisen einen besonderen Platz. Auch sie würde Rache für diejenigen wollen, die im Feuer umgekommen waren. Ganz sicher.
Ein Segler glitt über sie hinweg und warf einen Schatten wie ein gigantischer Vogel, ehe er nach Norden abdrehte. Tiral bet-Hiwa, der hochgeborene Kommandant der Fliegerstaffel, schickte regelmäßig Patrouillen über die Armenviertel. Eine Erinnerung daran, dass die Schnepfen, die hier lebten, unter Beobachtung standen. Und ein Versprechen, dass sie mit genügend Glück eines Tages selbst zu den Beobachtern gehören würden. Aiz ließ das fliegende Gefährt eine ganze Weile nicht aus den Augen und fuhr zusammen, als sie Schritte hinter sich hörte.
Schwester Noa lief durch den knirschenden Schnee, der Saum ihres fadenscheinigen wollenen Rocks schleifte hinter ihr her. »Licht der Gipfel, mein Kind«, grüßte die alte Frau.
»Lang möge es uns leiten«, antwortete Aiz.
Schwester Noa legte die braune runzlige Hand an die steinerne Stirn der Statue und wickelte dann ihr Halstuch um Aiz’ Hals. Ihren Protest tat sie ab. »Du wirst auf dem Flugfeld arbeiten, während ich bloß hier herumbummele.«
»Ja, ja, und Tee mit Keksen zu Euch nehmt«, stieg Aiz darauf ein, wohl wissend, dass das Kloster für beides zu arm war, »und Eure Bediensteten umherscheucht.«
So viel Unfug brachte Noa zum Lächeln, und ihre braunen Augen funkelten in all dieser Schnee- und Wolkenblässe. Als Priesterin des größten Klosters im Armenviertel Dafra würde sie den ganzen Tag auf den Beinen sein, selbst einer Bediensteten gleich. Sie würde Unterricht beaufsichtigen, für reibungslose Abläufe in der Küche sorgen und sicherstellen, dass sich um alle gekümmert wurde, die sich Hilfe suchend ans Kloster wandten. Und bei alldem würde sie zweifellos vor Kälte zittern.
Noa strich Aiz mit der gleichen resoluten Zärtlichkeit übers Haar, mit der sie ihr früher fürs Berberitzenstehlen einen Klaps versetzt oder sie im Arm gehalten hatte, als sie den Tod ihrer Mutter beweinte. Schon damals war Noa ihr alt vorgekommen. Jetzt war sie so verhutzelt und knorrig wie eine Dornkiefer.
Die Priesterin musterte Aiz. »Du hast Sorgen, mein Liebes. Sag, wovon träumst du?«
Bei dieser vertrauten Aufforderung musste Aiz lächeln. »Ich träume vom Frühling in Kegar. Und von einer ordentlichen Portion Silzfisch-Curry.«
»Möge Mutter Div es dir vergönnen«, gab Schwester Noa zurück. »Die Sonne geht auf. Rasch zum Flugfeld. Wenn Cero dich mitnimmt, kommst du zeitig genug an, dass die Staffelmeister dir keinen Satz heiße Ohren verpassen.« Noa wies zu den Klostertoren. Dahinter stampfte ein Pferd in der Kälte mit den Hufen. Und daneben lief ebenso ungeduldig eine Gestalt auf und ab. Cero.
Die Gelassenheit, mit der Noas Berührung sie erfüllt hatte, verpuffte, und an ihre Stelle trat eine Erinnerung: eine Nacht vor sechs Monaten, kurz bevor ein neuer Schwung Piloten verkündet werden sollte. Aiz hatte zusammen mit Cero in seiner Kammer gewartet und gebangt, ob man sie beide für die Elite-Seglerstaffel auswählen würde. Unfähig, still zu sitzen, war Aiz unablässig zwischen Pritsche und Fenster hin und her getigert, bis Cero ihre Hand genommen hatte. Seine Berührung hatte einen Funken entzündet und zu einem Kuss geführt, gefolgt von Verwirrung und dann Lachen und Glück und Hoffnung.
Und am Morgen danach wurde Cero Pilot. Und Aiz wurde gar nichts.
»Ich verstehe einfach nicht, warum er hier wohnen muss«, sagte Aiz nun. »Ein Bett besetzen. Unsere Vorräte verbrauchen. Er könnte mit den anderen Piloten zusammenleben.«
»Das Kloster ist sein Zuhause«, entgegnete Schwester Noa. »Du bist sein Zuhause. Bestraf ihn nicht, weil Mutter Div es für richtig hielt, ihn zum Piloten zu machen. Und jetzt husch, husch, Liebes.«
Aiz nahm den Schal und legte ihn wieder um Schwester Noas kurze weiße Locken. Die Priesterin brauchte ihn dringender. »Geht nach drinnen, Schwester. Wärmt Eure Knochen noch ein klein wenig länger.«
Als Schwester Noa davongetrippelt war, blickte Aiz zu Cero, der weiterhin vor den Toren wartete. Noch hatte er sie nicht entdeckt.
Abrupt wandte sie sich ab und schlich sich durch einen Hintereingang nach draußen.
Als Aiz auf dem Flugfeld ankam, wimmelte es dort bereits von Pilotinnen, Staffelmeistern, Ingenieurinnen und Lotsen. Mitten durch dieses Getümmel wuselten Hilfskräfte wie Aiz – ebenso wie sie mittellose Schnepfen – und schleppten Eimer, Stangen und vereiste Fliegerrüstungen aus Leder hin und her.
Hinter dem Flugfeld ging es im Hof der Segler-Werft zwischen Gerüsten, Spulen mit Segelgarn, Packen von Segeltuch und Bündeln getrockneter Schilfrohre nicht minder betriebsam zu. Daneben ragte der Horst auf und warf einen langen, bläulichen Schatten. Wie viele Gebäude in Kegar war er aus Holz und Steinen erbaut, hatte ein Schrägdach und war geformt wie die Spitze einer Schreibfeder. Hunderte Piloten und Hilfskräfte waren darin untergebracht.
»Schnepfe!« Ein Staffelmeister packte Aiz am Ellbogen und zerrte sie zu den Ställen. Er war ein Habicht, ein Hochgeborener, wie die meisten, die im Horst etwas zu sagen hatten. »Miste die Ställe aus, dann melde dich in Hangar eins. Ein Dutzend neue Segler muss kalfatert werden.«
Aiz seufzte und griff nach einer Mistgabel. Die Stallarbeit war übel riechend, aber wenigstens hielten die robusten Steinwände den Wind ab, während die breiten Torbögen trotzdem den Blick aufs Flugfeld freigaben.
Draußen auf der Startbahn warteten Hunderte Segler auf ihre Piloten. Von hier hatte man den Eindruck, die Flotte wäre nichts weiter als ein Haufen Stöcke und im Wind flatterndes Segeltuch, doch Aiz wusste es besser.
Jedes kegarische Kind wurde im Alter von vierzehn Jahren auf die Gabe des Windlenkens geprüft. Als Aiz ein Talent dafür gezeigt hatte, hatten die Staffelmeister sie in einen Segler verfrachtet und sie mit zum Horst genommen, um sie auszubilden.
Nie würde Aiz vergessen, wie überwältigend es sich angefühlt hatte, einen Einsitzer zu fliegen: die kühle Schale mit dem Metall Loha, das sich bei ihrer Berührung verflüssigte und eins mit ihrer Hand wurde, ehe es durch den hohlen Rahmen des Segels emporschoss; den Anblick der gebogenen, dreieckigen Segelschwingen, die sich wie die Flügel einer Küstenmöwe hoben; wie Aiz’ Blut bei der Liebkosung des Windes zu prickeln begonnen hatte – bevor sie unausweichlich zu Boden getrudelt war, nicht in der Lage, ihre Magie zu kontrollieren.
Aiz hatte Jahre mit dem Versuch verbracht, sie zu beherrschen. Und war gescheitert.
Nun sah sie mit vor Neid heißem Kopf zu, wie Segler um Segler zum Leben erwachte, sich Schwingen strafften, während sich die Gestänge mit lebendigem Metall füllten. Die Segler-Piloten würden nach Norden über die Berge fliegen, um Bomben auf weit entfernte fremde Siedlungen abzuwerfen. Woraufhin die parat stehende kegarische Armee Getreidevorräte und Waren plündern würde, die sie in die Heimat brachten. Und so würde Kegar ein paar weitere Monate überleben.
Aiz’ Volk konnte seit etwa einem Jahrhundert nicht mehr genug Nahrung produzieren, um sich selbst zu ernähren. Seitdem waren diese Raubzüge fester Bestandteil des Lebens in Kegar. Und ebenso wichtig wie die Piloten, die sie anführten.
Ganz gleich also, ob Schnepfe von niedrigem, Sperling von mittlerem oder Habicht von hohem Stand – Pilot zu werden, verhieß Nahrung, Wohnung, Kleidung und Ausbildung. Es verhieß Leben. Eine Zukunft.
Das leise Klirren von Zügeln ließ Aiz herumfahren. Cero führte gerade seine Stute Tregan in den Stall. Ceros dunkle Haare waren zu einem straffen, hohen Knoten zusammengebunden. Die lila schimmernden Ringe unter seinen Augen ließen die grünen Iriden fast schwarz wirken. In seiner blau-geschuppten Lederrüstung sah er zugleich schön und würdevoll aus, selbst als er Aiz jetzt vorwurfsvoll anfunkelte.
»Ich habe auf dich gewartet.«
Aiz zuckte mit den Schultern und schippte schwungvoll einen besonders großen Haufen Mist zur Seite, der Cero nur knapp verfehlte. »Ist ja nicht mein Problem.«
»Bei den Gipfeln, Aiz, du machst es einem aber auch wirklich nicht leicht.« Cero, normalerweise stoisch wie die Berge, klang beinahe verärgert.
»Und du hast schlechte Laune.« Sie bedachte ihn mit einem Seitenblick. »Wofür ich beim besten Willen keinen Grund sehe.«
»Ah, richtig, weil ich ja Pilot bin.« Cero führte Tregan zu ihrer Box und sie schnappte nach ihm. Aiz konnte sich ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Die Stute hatte Aiz schon immer lieber gemocht.
»Heißt, ich kann meine Grundbedürfnisse erfüllen«, fuhr Cero fort, »und im Gegenzug muss ich mich bloß dem Triumvirat unterwerfen und mein Leben für einen von allen Gipfeln verlassenen Größenwahnsinnigen aufs Spiel setzen, der nicht mal eine Hundestaffel anführen sollte, ganz zu schweigen von einer Armee.«
»Pst, halt den Schnabel!« Panisch blickte Aiz sich um. Die Ställe waren augenscheinlich leer, aber das hieß noch lange nicht, dass sie niemand belauschte. Heerführer Tiral bet-Hiwa kommandierte die Fliegerstaffeln. Und er war außerdem der Erbe eines der Mitglieder des Triumvirats, das Kegar regierte. Seine Familie hatte überall Spitzel.
»Und wenn er mich hört? Was soll er schon tun?« Cero lehnte sich an die dicke Stallmauer. »Mich in den Tohr sperren? Die Segler heben morgen ab. Für Tiral bin ich nützlich, wenn ich Bomben auf unschuldige Dorfbewohner abwerfe. Nicht, wenn ich im Gefängnis verrotte.«
Cero klang nicht stolz, sondern verbittert. Seine Gabe, den Wind zu lenken, die Luftströme seinem Willen zu unterwerfen, war ungewöhnlich stark. Weshalb man ihn ja auch zum Seglerpiloten auserkoren hatte.
Offenbar hatte er nicht damit gerechnet, dass Aiz zurückbleiben würde. Doch während Cero den Wind zähmte, machte Aiz den Wind wütend. Während Cero einen Segler in einer perfekten Spirale emporsteigen ließ, zerfetzte Aiz die Segeltuchschwingen. Sie konnte üble Gerüche vertreiben oder eine sanfte Brise herbeirufen, doch sobald sie mehr wollte, trotzte ihr der Wind.
Aber es hatte keinen Zweck, zu betrauern, was hätte sein können. Aiz hatte eine andere Aufgabe gefunden.
»Tiral verdient unseren Respekt.« Aiz verschluckte sich fast an ihrer eigenen Lüge. In Wahrheit verdiente Tiral, dass jemand ihm ein Messer in die Halsschlagader rammte – exakt das, was Aiz in ein paar Stunden vorhatte. Aber falls Cero ihren Plan erriet, würde er versuchen, sie aufzuhalten, ihr erzählen, es sei zu gefährlich. »Tiral ist der Anführer unserer Flotte.« Aiz dachte an das Messer unter ihrem Rock, geschärft in den dunklen, vergessenen Tunneln unter dem Kloster. »Ohne ihn würden wir alle verhungern.«
»Er interessiert sich kein bisschen für uns.« Cero musterte Aiz aufmerksam und sie konnte nur schwer wegsehen. »Nimm dich vor ihm in Acht.«
Aiz erstarrte. Cero sagte nie etwas einfach so daher. Er musste sie beim Betreten von Tirals Gemächern beobachtet haben. Oder beim Verlassen. Ihr kam wieder in den Sinn, was Tiral vor Monaten gesagt hatte, als Aiz ihn zum ersten Mal denken ließ, sie sei seinem Charme erlegen. Behalte unser Geheimnis für dich, kleine Schnepfe. Wir wollen doch nicht, dass dir etwas zustößt.
Ceros Miene war ernst genug, dass Aiz sich fragte, ob auch zwischen ihm und Tiral Gefühle im Spiel waren. Sie war schon öfter von seinen romantischen Verstrickungen überrascht worden. Sein Verhältnis zu einer Schneiderin hatte er so geheim gehalten, dass Aiz erst davon erfahren hatte, als die Frau beim Kloster aufgetaucht war und nach ihm verlangt hatte.
»Es ist mir egal, mit wem du dich vergnügst, Aiz.« Ceros Gleichgültigkeit versetzte Aiz einen Stich. »Aber lass dich nicht von Tiral täuschen. Die einzige Person, für die er sich interessiert, ist er selbst.« Beim Sprechen drehte er beständig einen Ring am Finger.
Aiz hatte einst ebenso einen besessen. Es war ein Aaj, eine von Ceros vielen Erfindungen. Durch die Ringe hatten sie lautlos miteinander kommunizieren können. Aiz hatte ihren Cero zurückgegeben, nachdem er Pilot geworden war.
»Vortrag beendet?«, fragte sie eisig und fing wieder an, Heu zu schaufeln. »Ich habe zu arbeiten.«
Ceros Miene versteinerte und er verließ den Stall. Aiz hatte ihn verletzt. Das erfüllte sie mit Genugtuung, zugleich jedoch auch mit Wehmut. Aber sie konnte nicht weiter über Cero nachdenken. Heute hatte sie nur für einen Mann Zeit.
Die Warterei war eine einzige Folter. Die Minuten krochen nur so dahin, während sie ausmistete, Segler kalfaterte und den Schlägen der Staffelmeister auswich. Schließlich zogen die leuchtend rosa Wolken stockend nach Süden und das Brüllen des Windes ebbte zu einem Flüstern ab. Es dämmerte. Aiz half gerade, die Lampen des Flugfelds zu entzünden, als einer der Lotsen rief: »Landeanflug!«
Er deutete auf die schneebedeckten Gipfel, die die Hauptstadt säumten und wie triumphierend gereckte Fäuste in den Himmel ragten. Der Mond beleuchtete die herannahenden Segler und Aiz’ Puls beschleunigte sich.
»Bringt diese Lampen zum Leuchten, ihr gipfelverdammten Ratten!«, brüllte die Staffelmeisterin, die Aiz am nächsten stand, und schwang die Peitsche. Innerhalb von Sekunden strömten Dutzende Lotsen auf das Feld und hielten blaues Feuer in die Höhe.
Die Segler landeten mit geübter Präzision. Alle außer einem, dem größten: Der Segler von Heerführer Tiral drehte sich nicht nur einmal, sondern zweimal um eine Flügelspitze, während er die Staffel überwachte. Erst als der Rest des Geschwaders gelandet war, schraubte auch sein Gefährt sich nach unten.
Aiz flitzte auf den Landebahnen hin und her, sammelte Fliegerbrillen und -mützen und leere Loha-Schalen ein. Die ganze Zeit über beobachtete sie Tiral aus den Augenwinkeln, suchte nach Anzeichen von Schwäche, Müdigkeit oder einer Verletzung. Irgendetwas, das es ihr erleichtern würde, ihm ein Messer in den Körper zu rammen.
Das einzig Auffällige an ihm war ihr schon bekannt: Seine Hand wanderte immer wieder zu dem schmalen Buch, das stets in seinem Gürtel steckte. Als ihr das vor Monaten zum ersten Mal aufgefallen war, hatte sie angenommen, es wären die Neun Heiligen Sagen, die Geschichten, die Mutter Div ihrem Volk erzählt hatte, um es anzuleiten. Oder vielleicht ein Notiz- oder Logbuch. Aber wie es schien, war es bloß ein Band mit Kindergeschichten und nützte ihr rein gar nichts, es sei denn, sie wollte ihn damit totprügeln.
Leider war es dafür nicht schwer genug.
Während Tiral um seinen Segler herummarschierte und den Staffelmeistern zeigte, wo das Fluggerät Schaden genommen hatte, tigerte Aiz in den Schatten auf und ab und wurde schier überwältigt von Hass.
Nie würde sie verstehen, warum Mutter Div Tiral die Gabe des Windlenkens geschenkt hatte, wo er doch auf all das spuckte, wofür sie stand. Wo er Kinder zu Waisen machte, indem er ihre Eltern für die Armee zwangsverpflichtete, und über die Ordensmitglieder spottete, die in Mutter Divs Namen Gutes taten.
Als hätte Tiral Aiz’ Wut gespürt, sah er auf. Er war zwanzig Jahre alt, mittelgroß, hatte breite Schultern, blonde Haare und eine etwas schiefe Nase, die sein Gesicht interessant machte, statt es zu entstellen. Mit seinem echsenhaften Blick fixierte er Aiz nun. Es kostete sie größte Mühe, ihre Mimik unter Kontrolle zu halten. Er nickte einmal knapp.
Sie wusste, was er wollte. Und zur Abwechslung tat sie ihm den Gefallen gern.
Aiz machte sich auf zum Horst, schritt vorbei an den Essen, wo Metallurgen das für die Segler benötigte Loha vorbereiteten. Bei dem Geruch rümpfte sie die Nase. Es wurde gemunkelt, dass Kegars Loha-Vorrat – der seit einem Jahrtausend stets sparsam eingesetzt wurde – zur Neige ging.
Ohne Loha keine Segler. Ohne Segler keine erfolgreichen Plünderungen. Ganz gleich ob Habichte oder Schnepfen, sie würden alle verhungern.
Durch eine Seitentür schlüpfte Aiz in den Horst und lief in Richtung der Bäder. Im letzten halben Jahr hatte sie gelernt, sich mit Leichtigkeit in dem Labyrinth aus Dienstbotengängen zurechtzufinden. Auf dem Weg zu Tirals Gemach begegneten ihr Schicksalsgenossinnen und -genossen. Leicht bekleidete Schnepfen mit leerem Blick, die taten, was sie tun mussten, um zu überleben. Sie grüßten einander nicht.
Aiz schlängelte sich durch die Gänge des Wohnturms bis zu der Geheimtür, die zu Tirals Gemach führte. Das Gemäuer war alt, und sie zog einen Stein heraus, um ihr Messer dahinter zu verstecken. Dann klopfte sie dreimal an die Tür.
Tiral ließ sie warten. Wenig überraschend. Sicher gefiel ihm die Vorstellung, dass Aiz draußen im Gang zitterte und sich fragen musste, ob er sie einlassen würde. Aiz hatte hart an ihrer Rolle als liebestrunkene Schnepfe gearbeitet. In den Nächten, in denen ihr der Zutritt verwehrt worden war, hatte sie bittere Tränen geweint und um Einlass gebettelt.
Schwein. Er hielt sich für übermächtig. Aber heute Nacht würde sie ihn eines Besseren belehren.
Ein Geräusch. Die Tür öffnete sich und schwaches blaues Licht fiel in den Gang. Tirals blasse Haut leuchtete, als wäre er ein Geist.
»Aiz«, säuselte er und fasste sie am Arm.
»Mein Gebieter«, wisperte sie. Sag es, sag es ein letztes Mal. »Danke, dass Ihr mich einlasst.«
»Ich bin ein großzügiger Mann, Schnepfe.«
Heerführer Tiral zog sie durch seine Wohnkammer. Die pelzbezogenen Bänke waren mit Stiefeln und den ledernen Teilen einer frischen Fliegerrüstung übersät. Im Spiegel erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf sich selbst – klein und zierlich, helle Haut und lange braune Haare. Ihre blauen Augen schimmerten. Tiral schob sie aufs Bett. Ihr Kopf sank auf das Daunenkissen, das auf dem Markt einen Wochenvorrat Getreide einbringen würde.
Wenigstens war es schnell vorbei. Wie viele von Aiz’ Bettpartnern fiel Tiral kurz nach dem Akt in einen unbekümmerten Schlaf. Aiz betrachtete ihn. Ihre Mundwinkel hoben sich.
Ihr Volk sah in Tiral einen tapferen Heerführer. Aber Aiz sah den mordlustigen Jungen, der vor Jahren mitten in der Nacht ins Kloster geschlichen war, um die Schlafsäle der Waisen in Brand zu stecken. Er hatte ihren Schreien gelauscht, während sie verbrannten, und alles nur, weil er sich bei einem offiziellen Besuch mit seinem Vater von ihnen gedemütigt gefühlt hatte.
Die Priester des Klosters, darunter auch Schwester Noa, waren vor das Triumvirat getreten. Hatten diese drei korrupten Ungeheuer um Gerechtigkeit angefleht. Selbst Dovan, Hohepriesterin von Kegar und Oberhaupt über die vielen Klöster, hatte eine leidenschaftliche Bitte vorgetragen.
Das Triumvirat hatte rein gar nichts unternommen. Und mit der Zeit vergaßen die Menschen die toten Waisenkinder – selbst Cero, der in dieser Nacht beinahe ebenfalls gestorben wäre.
Doch Aiz hatte sie nicht vergessen.
Sie stand auf, warf sich Rock und Bluse über und hastete zur Geheimtür, um ihr Messer zu holen. Sie hatte sie fast erreicht, als Tiral sich rührte. Pfeilschnell wandte Aiz sich dem Schreibtisch zu und tat, als würde sie sich für seine Sachen interessieren. Sollte er aufwachen, würde er sie nur beim Herumstöbern erwischen. Inmitten der Schriftrollen, Federkiele und Militärdepeschen fiel ihr ein Buch ins Auge. Das Buch.
Sie fuhr mit dem Finger über den Einband. Das Leder war so glatt wie die Haut eines Wesens, das seit Urzeiten unter Wasser lebte. Den Einband zierte eine dreieckige Prägung, die Aiz an die wild wuchernden Wälder auf den Gipfeln denken ließ. Ohne dass sie hätte sagen können, warum, sträubten sich ihr die Nackenhaare. Sie schlug das Buch auf.
Der Falke und der Dieb
Im beständigen Zwielicht der nördlichen Gefilde machte sich ein einsamer Falke nach einem langen und …
Pah. Nur ein Märchen. Aiz klappte das Buch zu und horchte auf Tirals Schnarchen, ehe sie die Tür öffnete und ihr Messer aus dem Gang holte.
Als sie zurück ins Bett kroch, senkte sich die Matratze, und Tiral murmelte im Schlaf.
Aiz schloss die Hand fest um das Heft des Messers. Nimm dir, was du brauchst. Vergiss alles andere. Je eher, desto besser. Direkt in den Hals. Vor einer Ewigkeit hatte Cero ihr beigebracht, wo man zustechen musste, um einen Menschen zu töten. Niemand kann uns dauerhaft schützen, hatte er gesagt. Nicht mal die Priester.
»Im Namen von Mutter Div«, flüsterte Aiz, »übe ich Rache.«
Sie stach zu.
Und schnappte nach Luft, als Tirals Hand nach vorn schoss und er blitzschnell ihr Handgelenk packte.
Er öffnete die Augen und grinste. »Ach, Aiz. Du arme, dumme Närrin.«
2 Quil
Martialenimperium, Nördlicher Kontinent
Zacharias Marcus Livius Aquillus Farrar, Erbe des Throns der Martialen und Prinz der Gens Aquilla, brauchte keine vier bis an die Zähne bewaffneten Masken, die ihm überallhin folgten.
Denn Quil – wie er selbst am liebsten genannt wurde – hatte bereits im Alter von dreizehn Jahren für seine Tante, die Imperatrix Helena Aquilla, in den südlichen Grenzlanden gekämpft. Seit seinem fünfzehnten Geburtstag besiegte er vergleichsweise mühelos mindestens zwei Auftragsmörder pro Jahr. Er hatte Hunderte Male die Dünen der Stammeswüste und die Wälder von Marinn durchquert, nur in Begleitung von seinem besten Freund Sufiyan. Warum sollte er dann ausgerechnet die belebten Märkte der größten Hafenstadt des Imperiums fürchten?
Zumal er schon vor geraumer Zeit bemerkt hatte, dass ihm noch jemand folgte, im Gegensatz zu den Masken. Sie waren nach ihren silbernen Gesichtsbedeckungen benannt und galten als die besten – und gefürchtetsten – Soldaten im gesamten Imperium. Aber unfehlbar waren sie nicht.
»Quil, hör auf, die armen Wachen so finster anzustarren«, kommentierte Sufiyan seine düstere Miene. »Du machst ihnen noch Angst.«
»Das sind Masken. Die dürfen keine Angst haben.«
Obwohl sie vielleicht welche haben sollten, wenn man bedachte, wie viele von ihnen in den letzten Monaten einen hässlichen unnatürlichen Tod gestorben waren. Normalerweise waren es die Masken, die die Klingen führten. Doch laut dem gestrigen Bericht eines Hauptmanns der westlichen Wache hatte man zwei weitere von ihnen aufgeschlitzt.
Das ging Quil nicht aus dem Kopf. Aber er konnte darüber auch nicht mit Sufiyan sprechen, da Tante Helena ihm Stillschweigen über den Tod der Masken auferlegt hatte.
Der Prinz fühlte sich wie ein Matrose auf dem ersten Landgang nach monatelanger Seefahrt. Flau. Beklommen. Und jetzt folgte ihm auch noch irgendein vermummter Missetäter.
Doch nichts davon war Sufiyans Problem, weshalb Quil versuchte, seine düstere Grübelei auf ein Minimum zu beschränken, während er mit seinem Freund durch den geschäftigen Nachtmarkt von Navium schlenderte.
Eigentlich mochte Quil Städte nicht besonders, aber Naviums fröhliche Bewohner, das azurblaue Meer und die Köstlichkeiten, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen, gaben wenig Anlass zu Kritik. Es war fast Zeit fürs Abendessen, und bei all den fantastischen Gerüchen knurrte Quil der Magen – Shrimps mit Zitrone und Chili, gegrilltes Hühnerhack auf Bergen von schneeweißem Reis und eine typische Spezialität Naviums: dreieckige Teigtaschen, gefüllt mit geräuchertem Wintergemüse.
In einer Ecke des Marktplatzes leuchteten bunte Stammeslaternen. Eine Kehanni – die Geschichtenerzählerin eines Stammes – trug dort etwas vor. Es war eine von Quils Lieblingsgeschichten, über die Helden Laia von Serra und Elias Veturius und wie sie zusammen mit Imperatrix Helena die Welt vor einem Dschinn gerettet hatten, der durch Schmerz und Verrat in den Wahnsinn getrieben worden war. Das Publikum jubelte, als die drei am Ende siegten.
Sufiyan lächelte. Quil ließ unterdessen den Blick prüfend über die Menge, die dicht gedrängten Stände und die Wagen hinter der Kehanni schweifen.
Da oben – eine blitzschnelle Bewegung. Sein neuer Schatten hatte sich auf die Dächer geschwungen.
Die Wachen hatten noch immer nichts bemerkt. Ihre volle Aufmerksamkeit galt dem Markt, der schier barst vor Reisenden aus dem gesamten Imperium und sogar von außerhalb der Grenzen. Stammesleute aus dem Osten in reich verzierten Lederrüstungen verkauften Waffen und Seide, Kundige, die vor den Martialen über dieses Land geherrscht hatten, diskutierten über Politik und Philosophie. Und natürlich waren auch die verschiedenen Stände der Martialen vertreten: Mercatoren, die Waren anpriesen; wohlhabende Illustrier, die mit ihnen feilschten. Und Plebejer, von denen viele die Farben der illustrischen Familien trugen, für die sie arbeiteten.
Sie alle waren auf gewisse Art Quils Volk, auch wenn es sich nicht immer so angefühlt hatte. Sein Vater war Plebejer gewesen und doch kannte Quil die Sorgen und Nöte der Plebejer nicht aus eigener Erfahrung. Seine Mutter war Illustrierin gewesen, doch diese hochgeborenen Familien blickten auf seine plebejischen Wurzeln herab. Aus Sicherheitsgründen war er von Stammesleuten aufgezogen worden, bei Sufiyans Familie, dem Stamm Saif. Doch letzten Endes blieb er auch dort ein Martialer, eine beständige Erinnerung an das Imperium, das einst mit eiserner Hand über die Stämme geherrscht hatte.
Ich gehöre nirgendwohin, hatte Quil als kleiner Junge zu Tante Hel gesagt, als er ihr noch ohne Angst vor ihrem Urteil sämtliche Sorgen anvertraut hatte.
Du gehörst zu deinem Volk, hatte sie geantwortet. Dem Volk des Imperiums.
Sufiyan blieb stehen, um kegelförmiges Gebäck zu kaufen und der Konditorin mit den hellen Augen Komplimente zu machen. Ein Banner über ihrem Stand zeigte einen Laib Brot, den eine Weizenähre kreuzte. Sie musste aus einer der größeren Mercatorenfamilien stammen – Gens Scriba vielleicht oder Gens Vesta. Ihr Blick streifte Quil, dann bemerkte sie die Wachen. Ihre Augen wurden groß und sie sank in einen Knicks.
»Eure Hoheit«, sagte sie, und ihre Wangen färbten sich rosa. Innerlich fluchte Quil, weil sich nun Leute zu ihnen umdrehten. »Hoch lebe die Imperatrix. Ich danke Euch, dass Ihr meinen Stand beehrt.«
Sufiyan verdrehte die Augen, immerhin war er derjenige gewesen, der etwas gekauft hatte, doch Quil lächelte, setzte dann seine Kapuze auf und ging zügig weiter. Er versuchte, sein mulmiges Gefühl abzuschütteln. Er vermisste die Anonymität.
»Bleibt zurück«, befahl er dem Hauptmann seiner Wache ohne weitere Erklärung in dem sachlichen Tonfall, auf den seine Tante bestand. Als Junge hatte er »bitte« hinzugefügt, doch das war den Masken unangenehm gewesen.
Der Hauptmann zögerte, als würde er den möglichen künftigen Zorn der Imperatrix gegen den sicheren sofortigen Ärger des Kronprinzen abwägen. Einen Moment später verschwanden er und seine Männer in der Menge. Quil entspannte sich merklich.
Sufiyan bot Quil etwas von dem Gebäck an. »So, deine Zügel sind gelockert und du hast etwas zu essen. Konzentrieren wir uns jetzt darauf, was wir hier eigentlich wollen.«
»Die unstillbare Gier eines Tunichtguts stillen, den ich seit achtzehn Jahren an der Backe habe«, sagte Quil, während sein Schatten wieder untertauchte, indem er von einem Dach in die Gasse darunter sprang.
Sufiyan schüttelte den Kopf. »Du willst dem Menschen, der für dich einem Bruder am nächsten kommt, zum feierlichen Anlass seines achtzehnten Wiegenfests ein großzügiges Zeichen der Anerkennung erstehen, du ungehobelter Flegel.«
»Du vergisst Tas. Den kenne ich seit meiner Geburt.«
»Ich meinte buchstäblich am nächsten. Immerhin stehe ich keinen Meter von dir entfernt, während allein die Himmel wissen, wo Tas sich rumtreibt.«
Zacharias.
Sein Name war nur ein Flüstern, das ihm der Wind zutrug. Überrascht blickte Quil auf. Niemand außer Tante Helena nutzte seinen ersten Vornamen, höchstens Suf, wenn er ihn ärgern wollte. Der Prinz wandte sich Sufiyan zu, doch der war damit beschäftigt, ehrfürchtig einen mit Rubinen besetzten Dolch zu betasten, der wahrscheinlich so viel wert war wie der monatliche Sold für die gesamte Fünfte Legion.
»Das hier wäre ein schönes Geschenk.« Sufiyan ließ den Dolch flink von einer Hand in die andere wandern. Seine liebste Waffe war der Bogen, aber wie Quil war auch er darauf trainiert, alles Mögliche zu seiner Verteidigung einzusetzen. Als ein illustrischer Trottel sich einmal über Sufiyans Herkunft lustig gemacht hatte, hatte Sufiyan ihn mit beißendem Spott und einer Tonflöte mattgesetzt.
»Mein Prinz.« Der Dolchhändler nickte Quil zu. »Ich möchte Euch danken. Ich komme aus einer Familie von Plebejern …« Stolz flackerte über sein wettergegerbtes Gesicht, während er seine Waren musterte. »Ich habe eine Prinzengabe erhalten, um mein Geschäft zum Laufen zu bringen.«
Quil horchte auf. Er hatte diese Art der Förderung letztes Jahr ins Leben gerufen, nachdem ihm aufgefallen war, wie wenige plebejische Händler es auf den Märkten gab.
Der Verkäufer bot ihm den Dolch an. »Nehmt ihn, als Zeichen der Dankbarkeit.«
Quil schüttelte jedoch den Kopf und senkte die Stimme. »Ein Stück hinter mir steht eine Frau – Mater Candela. Reicher als die Imperatrix. Sie sammelt hübsche Sachen. Wie wär’s, wenn Ihr ihr den doppelten Preis abknöpft? Ihr seht mir aus, als könntet Ihr das.«
Der Händler grinste und gab Quil einen Klaps auf die Schulter. »Im Herzen seid Ihr ein gewiefter Pleb, mein Prinz. Wusste ich’s doch, dass Ihr mir sympathisch seid.«
Quil wurde ganz warm ums Herz. Manchmal machte er sich Gedanken, wie sein Volk ihn wohl sah. Als den stillen Sohn eines brutalen Ungeheuers vielleicht. Oder den undeutlichen Schemen neben einer strahlenden Imperatrix. Gewiefter Pleb. Das war Quil deutlich lieber als die beiden Alternativen.
Am nächsten Stand glänzte ein silberner Spiegel, und Quil blickte lang genug hinein, um sicherzugehen, dass er den Schatten auf seinen Fersen noch im Blick hatte, ehe er ihn Sufiyan hinhielt. »Der hier passt besser zu dir, oder? Wo du doch so besessen von deinem eigenen Gesicht bist.«
»Du hast den Adelstitel abbekommen, ich das gute Aussehen. Das ist nur gerecht.« Sufiyan betrachtete sich im Spiegel. »Apropos Adel … Hast du schon mit deiner Tante gesprochen?«
Der Prinz schüttelte den Kopf. Einst hatte er der Imperatrix alles erzählt. Inzwischen wusste er nicht mal mehr, wie er überhaupt ein Gespräch mit ihr anfangen sollte. Sie hatten einfach zu unterschiedliche Ansichten – vor allem, was Quils Zukunft betraf.
Quil entfernte sich ein Stück vom Stand des Kleinodhändlers und Sufiyan folgte ihm. »Das letzte Mal, als ich das Wort abdanken in den Mund genommen habe, hat sie eine Woche lang nicht mehr mit mir geredet.«
»Du bist zwanzig, Quil«, meinte Sufiyan. »Wenn du noch länger rumtrödelst, hast du bald ’ne Krone auf dem Kopf, eine sterbenslangweilige Gemahlin samt zig heulender Hosenscheißer am Hals und selbst absolut kein Verlangen mehr danach, das Wort abdanken zu hören.«
Eine Gemahlin … Jäh blitzte ein Gesicht in Quils Gedanken auf: kurze braune Haare, ein Blick voller Misstrauen und ein seltenes Lächeln. Ilars ruhige, selbstsichere Art hatte ihn vom ersten Augenblick an fasziniert. Sie hatte ihn nie gelangweilt. Und sie wäre eine großartige Imperatrix geworden.
Aber sie war gestorben. Über ein Jahr war das nun her. Tiefe Trauer regte sich in ihm, doch das kannte er schon. Er schob sie weit nach unten zu all den anderen Geheimnissen.
Von einem der vielen in der Stadt verteilten Trommeltürme dröhnte eine Serie von Schlägen. Quil übersetzte sie mit Leichtigkeit: Zweite Kohorte der Vierten Legion melde sich in den Kasernen des südlichen Kothons.
Der Prinz runzelte die Stirn. »Sollte die Vierte Legion nicht in Antium sein?«
»Vielleicht hatten die da oben genug davon, sich den Allerwertesten abzufrieren, und wollen jetzt hier ein bisschen Sonne tanken?«
Zacharias. Runter vom Marktplatz.
Quil zuckte zusammen, als er die Stimme hörte – so durchdringend, als hätte ihm jemand direkt ins Ohr geschrien.
Sufiyan plapperte völlig ahnungslos weiter: »Himmel, ich hätte jedenfalls keine Lust, in dieser Eishölle Wache zu schieben …«
Quil umklammerte das Heft seines Schims, jener langen schmalen Klinge, die so sehr Teil von ihm war wie einer seiner Arme. Schon vor langer Zeit hatte man ihm beigebracht, dass er lieber aufpasste, wenn er Stimmen im Kopf hörte.
Und diese Stimme klang vertraut. Ungeduldig, fast gereizt.
»Suf …« Quil steuerte auf den Rand des Platzes zu. »Wir sollten …«
Ein Schrei am Rande der Menge. Dann noch einer.
Zacharias, du törichter Bengel. Lauf!
»Bleib hier«, befahl Quil Sufiyan, ehe er sich rasch einen Weg durch die Menge bahnte, auf die Schreienden zu. Die letzten Stände lagen schon hinter ihm, da sah er endlich den Grund für den kleinen Menschenauflauf.
Ein Junge. Vielleicht dreizehn, in zu großen Kleidern und abgewetzten Stiefeln. Nicht weiter auffällig, bis auf das Loch in seiner Brust und die rauchenden Überreste seines Herzens darin.
Quil wich zurück, und zwei weitere Tote von vor etwas über einem Jahr kamen ihm in den Sinn. Dann der Bericht am Morgen über die Masken …
Sie waren auf dieselbe Weise getötet worden: Man hatte ihre Herzen wie mit einem glühenden Schürhaken verbrannt.
Und der Mörder war hier. Hier in der Menge.
Wenn du dich schon nicht selbst retten willst, dann rette wenigstens Sufiyan!
Die Stimme riss Quil aus seinen Gedanken. Er fand Sufiyan hinter sich und schob ihn in Richtung seiner Wachen, die auf der Suche nach ihrem Prinzen die Menge teilten.
»Was zu allen Höllen ist da los?« Sufiyan versuchte, über Quils Schulter zu schauen. »Was ist passiert?«
»Es gibt einen Verletzten!«, rief ein Marktbesucher. »Ein Junge. Er war doch bloß ein Junge.«
Sufiyans braune Haut wurde aschfahl. »Ein … ein Junge? Wie alt? Quil, was …«
Es hatte eine Zeit gegeben, da hätte Sufiyan einer solchen Situation unerschütterlich wie eine Eiche gegenübergestanden und wahrscheinlich einen zynischen Spruch auf den Lippen gehabt. Doch wie Quil hatte sich auch Sufiyan im letzten Jahr verändert. Er versteckte seinen Kummer hinter Witzen und Lächeln. Gab sich Mühe, seine innere Zerrissenheit in den Armen von Liebschaften oder beim Schimtraining zu vergessen. Quil kannte Sufiyan Veturius jedoch von Geburt an. Etwas war vor einem Jahr in ihm zerbrochen. Und Quil hasste es, dass er es nicht reparieren konnte.
Aber er konnte dafür sorgen, dass nicht noch mehr zerbrach.
»Mein Prinz.« Der Hauptmann hatte Quil erreicht. »Es ist hier nicht sicher für Euch.«
»Bringt Sufiyan zum Palast.« Quil senkte die Stimme und sah der Wache direkt in die Augen. »Das ist keine Bitte.«
Der Hauptmann seufzte und gab den anderen Masken ein Zeichen. Einen Augenblick später waren sie mit Suf verschwunden.
Quil kehrte zu dem Toten zurück, wo eine Plebejerin sich die Tränen abwischte, während sie auf den toten Jungen hinabschaute.
»Entschuldigt«, sprach Quil sie vorsichtig an, »kanntet Ihr ihn?«
Sie schüttelte den Kopf. »Er war einer von den Straßenjungen hier. Hat sich um ein paar der jüngeren Kinder gekümmert.« Erst jetzt sah die Frau Quil an und verzog den Mund, als sie ihn erkannte. »Ihr illustrischen Bastarde«, flüsterte sie. »Wir sind Euch doch keine zwei Pfefferkörner wert. Er ist nicht der Erste, der so sterben musste.«
Quil ignorierte die Beleidigung und konzentrierte sich auf den zweiten Satz. Zwar waren die Masken auch mit versengten Herzen gestorben, aber diese Tatsache wurde streng geheim gehalten. »Woher …«
Doch die Frau verschwand bereits in der Menge. Ehe Quil ihr folgen konnte, fuhr die Stimme erneut durch seine Gedanken: Es reicht! Ich muss mit dir sprechen. An der Südostecke des Marktplatzes ist eine Apotheke. Triff mich dort. Und beeil dich, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
Quil erwog, der Stimme eine gesalzene Abfuhr zu erteilen, schlussendlich siegte aber seine Neugier. Als er wenige Minuten später mit gezücktem Schim die düstere Apotheke betrat, löste sich eine vermummte Gestalt aus den Schatten hinter der Ladentheke.
»Steck das große Messer weg, Junge.«
Quil erkannte die Frau sofort. »Bani al-Mauth.« Der Prinz schob seinen Schim zurück in die Scheide und verneigte sich. Die Erwählte des Todes. Einst war sie Geflüchtete, Rebellin, Sklavin und Mörderin gewesen. Nun hatte sie eine heilige Funktion und führte ruhelose Geister von diesem Leben ins nächste. Sie nahm den Schmerz, der die Geister an die menschlichen Gefilde fesselte, und verbannte ihn in eine andere Dimension – das Meer des Leidens –, damit die Geister in Frieden weiterziehen konnten. Durch diese Aufgabe war sie größtenteils an den Dämmerwald nahe der östlichen Grenze des Imperiums gebunden. Man nannte ihn auch die Zwischenstatt, weil in ihm jene Seelen verweilten, die sich dort zwischen Leben und Tod am Diesseits festklammerten.
Früher hatte Quil die Bani al-Mauth oft getroffen. Zum Beispiel, wenn sie Tante Helena besucht hatte. Aber meist dann, wenn sie in die Stammeswüste gekommen war, um ihre Familie zu sehen – darunter Sufiyan, ihren Enkel, und dessen Eltern Laia von Serra und Elias Veturius.
Und natürlich waren Quil und sie sich auch später noch einmal begegnet. Aber kaum hatte er das gedacht, knurrte die Frau: »Verbann diese Gedanken aus deinem Kopf, Junge.« Sie musste seinen Gesichtsausdruck richtig gedeutet haben. »Du weißt es besser. Du kennst den Preis.«
Und ob er ihn kannte. Doch trotzdem fluteten Bilder seine Gedanken – Eindrücke aus jener Nacht vor über zwölf Monaten. Die Berge. Eine Höhle. Der metallische Geruch von Blut. So scharf, als hätte er ein Schlachthaus betreten.
Was in gewisser Weise gar nicht so falsch war.
»Ihr wart das.« Er rang die Eindrücke nieder – darin war er besser geworden, seit er die Bani al-Mauth das letzte Mal gesehen hatte. »Ihr seid mir gefolgt.«
»Hätte gedacht, du merkst es schneller. Ich war dir seit dem Palast auf den Fersen.«
Tja, das war peinlich. »Soll ich Sufiyan holen?« Quil stieg Hitze in die Wangen. »Er wird …«
»Mein Enkel und seine Familie wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich bin hier, weil ich deine Hilfe brauche.«
»Meine Hilfe?« Quil schüttelte den Kopf. »Ihr wusstet doch von dem toten Jungen, oder? Woher überhaupt?«
»Ich habe gespürt, dass etwas passieren würde. Erzähl mir, was du über diejenigen weißt, die auf dieselbe Weise gestorben sind.«
Quil erwiderte den Blick aus ihren tiefblauen Augen. Die Imperatrix hatte ihn ermahnt, kein Sterbenswort über die toten Masken zu verlieren. Vor allem nicht gegenüber Sufiyan oder seiner Familie! Das hatte sie Quil nicht zweimal sagen müssen. Sufiyans Schwestern waren erst fünfzehn und dreizehn. Und Elias und Laia hatten genug durchgemacht.
Die Bani al-Mauth hingegen war zwar auch Teil der Familie, aber das war etwas anderes. Als Quil noch klein gewesen war, war sie eines Tages in Antium aufgetaucht und hatte darauf bestanden, mit der Imperatrix zu sprechen. Quil, der aus den Stammeslanden zu Besuch war, hatte damit gerechnet, dass seine Tante eine solch brüske Forderung zurückweisen würde. Stattdessen hatte sie all ihre anderen Termine verschoben.
»Vielleicht sollten wir zusammen zu Tante Helena gehen«, schlug Quil vor, doch die Bani al-Mauth winkte nur ungeduldig ab.
»Deine Tante tut, als wäre alles in bester Ordnung. Sie unternimmt nichts gegen die Morde.«
Quils Nackenhaare sträubten sich. Im Moment war er zwar selbst nicht besonders gut auf Tante Hel zu sprechen, aber wehe, irgendwer anders verlor ein schlechtes Wort über sie. »Diese Masken waren junge Illustrier und sie wurden in den Stammeslanden ermordet. Tante Helena hält das unter Verschluss, weil sie weiß, dass es aussehen könnte, als wären die Stämme verantwortlich. Sie will vermeiden, dass die illustrischen Familien nach ihrem Blut dürsten.«
»Ich rede nicht von den Masken«, entgegnete die Bani al-Mauth. »Ich rede von den Kindern. Ruh war das erste …« Ihre Stimme brach, doch sie räusperte sich rasch. »Dann dein Mädchen … Ilar.«
Quil spürte ein Ziehen in der Brust. Der Klang ihrer Namen beschwor ihre Gesichter herauf, ihren Geruch, ihre Stimmen. Halt. Denk nicht an sie. Begrab die Erinnerungen.
»Am Tag darauf wurden zwei Leichen in Nur gefunden«, fuhr die Bani al-Mauth fort. »Straßenkinder ohne Familien. Etwa ein Dutzend weitere, überall in den Stammeslanden und im südlichen Imperium. Danach war es monatelang ruhig. Bis jetzt.«
Vierzehn Kinder. Tot. Und Quil hatte von keinem von ihnen gehört. Die Luft im bereits düsteren und klammen Laden wurde noch kälter.
Die Bani al-Mauth sprach weiter: »Drei sind vor ein paar Wochen in Serra gestorben. Zwei in Navium. Vier sogar oben in Silas. Alle unter zwanzig, alle mit derselben klaffenden Wunde, ihre Herzen zu Asche verbrannt. Das sind die Fälle, die mir bekannt sind.«
»Dazu kommen sechs Masken.« Quils Magen zog sich zusammen, als er an den morgendlichen Bericht dachte. »Zwei wurden gestern in den Grenzlanden gefunden. Aber Ihr sprecht doch mit Geistern. Wisst Ihr denn nichts über sie?«
Die Bani al-Mauth musterte ihn. »Nicht alle Geister kommen durch die Zwischenstatt.«
»Das war keine Antwort.«
»Du erinnerst mich an deine Tante. Absolute Nervensäge. Verstand so scharf wie ein Schim, muss man ihr lassen. Weiß mehr, als sie preisgibt. Genau wie du, möchte ich wetten.«
»Ich wusste nichts von den Kindern. Darüber hat sie nichts gesagt.«
»Tu mir einen Gefallen«, gab die Bani al-Mauth zurück, »wenn du sie das nächste Mal siehst, frag sie, warum sie es dir verschwiegen hat. Eins noch, Junge …« Ihr Ton verlor jegliche Schärfe. »Wie geht es dir?«
Eine einfache Frage. Eine, die einen ganzen Wasserfall an Gedanken zur Folge hatte.
Quil erlaubte sich nicht oft, an Ilar und Ruh zu denken. Aber jetzt tat er es: Da waren Ruhs Hände, wenn er Geschichten von düsteren Ghulen und bösen Erzählerinnen vortrug. Ilars Lachen, so zaghaft, als wäre sie aus der Übung. Wie sie hinter seine zurückhaltende Fassade blickte und ihn mit Fragen aus der Reserve lockte, als könnte nichts, was er sagte, sie langweilen. Erzähl mir vom Palast in Antium. Wie war das noch mal, als du dich im Hafen von Navium verlaufen hast? Gibt es wirklich ganze Gassen voller Drachenbauer in Serra?
»Ich habe Euren Rat befolgt«, antwortete Quil. »Ich versuche, nicht darüber nachzudenken.«
»Was ist mit deiner Magie? Werden die Jadunas dich unterweisen?«
Bei der Erwähnung der Jadunas versteifte Quil sich. »Ihr habt mir aufgetragen, zu vergessen, was ich in dieser Nacht gesehen habe. Im Gegenzug möchte ich nicht über die Magie reden. Nie wieder.«
Die Bani al-Mauth zuckte mit den Schultern und klopfte sich den Staub vom Umhang. »Wie du willst … Ich muss zurück in die Zwischenstatt. Zu niemandem ein Wort hierüber. Und, Junge …« Sie legte den Kopf schräg. Die Schatten in der Apotheke schienen an ihren Umrissen zu nagen. »Nimm dich in Acht. Es liegt was in der Luft. Die Geister sind unruhig. Etwas kommt auf uns zu.«
Nein, dachte Quil, während sie mit der Dunkelheit verschmolz, etwas ist bereits hier.
3 Sirsha
Eigentlich hatte Sirsha ja gewusst, dass sie das Geiernest längst hätte verlassen sollen. Es war ein verfluchter Ort, der sich wie ein Geschwür an den Ausläufern der Serraberge ausbreitete, eine eitrige Wunde, aus der Betrüger, Diebinnen und Schlimmeres tropften.
Dann stünde sie jetzt nämlich nicht zu verregneter nachtschwarzer Stunde in dieser matschigen Gasse – umzingelt von einer Bande der ganz üblen Sorte. Sirsha war unbewaffnet und trug verdrießlicherweise nicht mal ihre Stiefel. Nur ihr Verstand konnte sie jetzt noch vor der Mittellosigkeit retten.
Oder vor dem Tod. Wobei ihr momentan hauptsächlich die Mittellosigkeit Sorgen machte.
Sieben Jahre des Fährtenlesens hatte sie jede noch so kleine Münze gespart, um das verfluchte Imperium für immer verlassen zu können. Sirsha wollte warmes Wetter, klares Wasser – sich ein hübsches kleines Gasthaus auf den Südlichen Inseln kaufen. Dass sie ihren Traum an diese Meute zerlumpter Simpel verlor, kam gar nicht infrage.
»Rück endlich das Geld raus, Schnüfflerin«, verlangte Migva, das Oberhaupt der Schlägerbande. Für einen so blassen Strich in der Landschaft hatte sie eine überraschend harte Rechte, die sie gerade ausschüttelte, weil sie sie an Sirsha schon ganz wund geschlagen hatte. »Ich bin müde und hungrig und habe keine Lust, dir hier noch ewig das Leben aus dem Leib zu prügeln.«
Sirsha linste hinter sich zu dem Häuschen, in dem sie die letzten paar Monate über gewohnt hatte. Eine klapprige Konstruktion, die wie der Großteil vom Geiernest durch nicht viel mehr als Schmutz und Bosheit zusammengehalten wurde. Der bullige Juwelenhändler, so Furcht einflößend, dass selbst ein Nestgeier ihn nicht zu verärgern wagte, hatte Sirsha das Zimmer vermietet. Sie hatten ein Abkommen: Sirsha spürte immer mal wieder Objekte oder Personen für ihn auf, er jagte alle davon, die sie ausrauben wollten. An einem gesetzlosen Ort wie dem Nest war das so bequem, wie es nur ging.
Und alles war auch wunderbar gelaufen, bis des Juweliers Herzblatt ihn mit der Schönheit vom Teeladen die Straße hoch erwischt hatte. Eine Stunde später war der Juwelier tot und sein Herzblatt mit den Edelsteinen auf und davon. Jetzt kreisten die Geier.
»Ich habe doch schon gesagt, dass ich kein – uff.« Migva zielte tief und Sirsha fiel japsend auf die Knie. Die triefnassen schwarzen Haare klatschten ihr in die Stirn und zwischen ihren Sockenzehen quoll der Matsch hindurch. Himmel, gab es ein ekligeres Gefühl als nasse Socken?
»Ihr habt mich doch schon zig Mal durchsucht«, gab Sirsha zurück. »Ich habe nichts.«
»Glaubst du, mir haben sie ins Hirn geschissen?«, fauchte Migva. »Du hast es irgendwo versteckt. Und wenn du uns den Ort nicht verrätst, verstreue ich deine Einzelteile überall im Geiernest. Für dich Fremdling wird niemand einen Finger rühren.«
Sirsha sah Migva aus ihrem nicht-zugeschwollenen Auge böse an. Ganz offenbar hatte Sirsha die dürre Hexe unterschätzt. Sie hatte die Nestlaus für eine gewöhnliche Diebin gehalten, die bloß die Krümel ehrgeizigerer Missetäter auflas. Doch Migva war schlauer als erwartet. Und gemeiner. Von Nahem war der hungrige Schimmer in Migvas Blick deutlich zu sehen. Sirsha kannte ihn gut. Der Glanz im Auge des Raubtiers, das vor langer Zeit aus Notwendigkeit das Töten gelernt und Freude daran gefunden hat.
Nicht zum ersten Mal wünschte Sirsha sich, dass ihre Magie zu mehr taugte, als Juwelendiebe aufzuspüren.
Neben Migva stand ein magerer Junge. Letzten Monat hatte er dem Juwelier falsche Rubine andrehen wollen. Nur dank Sirshas Überzeugungskunst hatte der Hüne dem kleinen Betrüger nicht den Hals umgedreht.
»Du, Junge«, sagte Sirsha. »Dir habe ich dein armseliges Leben gerettet, als du den Juwelier bescheißen wolltest, weißt du nicht mehr?«
Der Junge trat, ein Messer zwischen zitternden Händen, von einem Fuß auf den andern. »Migva, vielleicht sollten wir –«
Migva fuhr herum und zog dem Jungen den Dolch so rasch durch die Kehle, dass sein Blut schon im Matsch versickerte, bevor Sirsha so ganz begriff, was passiert war. Sie wog ihr Leben und ihre Ersparnisse gegeneinander ab. Würde es ihr gefallen, wieder ganz von vorn anzufangen und aufs Neue jahrelang Münzen zusammenzukratzen, um diesem elenden Ort zu entkommen? Nein. Aber wäre jenes Los immerhin besser, als von den Krähen zum Frühstück verspeist zu werden? Höchstwahrscheinlich.
»Im Schlafzimmer«, beeilte sie sich also zu sagen. »In einem Geheimfach hinter dem Porträt von dem hässlichen Hund. Wenn ich so drüber nachdenke: Er ähnelt dir irgendwie, Migva. Hast du je Modell ge–«
Sirsha kippte vornüber, als Migva ihr in den Bauch trat. Doch selbst mit dem Gesicht im Matsch und einer oder zwei gebrochenen Rippen musste Sirsha über das Gekicher aus Migvas Bande grinsen.
»Worauf wartest du?«, fuhr Migva einen Handlanger neben sich an. »Rein da!« Der Junge warf einen raschen Blick auf seinen toten Kameraden und huschte ins Gebäude. Dreißig Sekunden später kam er wieder heraus.
Mit leeren Händen.
Migva packte Sirsha an den Haaren, zerrte sie zum Häuschen und drückte sie neben einem Fass und einer rostigen Harke gegen die Wand. »Was spielst du für ein Spiel?«
»Gar keins!«, ächzte Sirsha. »Sein Herzblatt muss es sich unter den Nagel gerissen haben. Da hat es gelegen, ich schwöre!« Sirsha machte sich gar nicht erst die Mühe, die Angst aus ihrer Stimme herauszuhalten. Vielleicht hielt sie Migva ja davon ab, ihr den Kopf abzureißen.
Angeekelt ließ Migva Sirsha los. »Du bist also erbärmlich und dumm.« Sie winkte einem aus ihrer Bande. »Mach sie kalt.«
»Nein … nein, bitte …« Sirsha wand sich und flehte – ziemlich überzeugend, wie sie fand. Bis Migvas Scherge sie am Kragen packte.
Den Moment nämlich nutzte sie aus, um die Harke neben sich zu ergreifen und sie dem Mann in die Weichteile zu rammen. Kurz genoss sie das Wut- und Schmerzgeheul des Mistkerls, dann schickte sie ihn mit einem zweiten Harkenschlag schlafen, schubste den Zusammensackenden gegen Migva, schoss ins Haus und verriegelte die Tür hinter sich. Das würde die Bande nicht lang aufhalten. Aber vielleicht lang genug, dass Sirsha es verdammt noch mal hier weg schaffte.
Sie schnappte sich ihre Stiefel, ihre Waffen und ihr Bündel, dann spurtete sie ins Schlafzimmer. Das hässliche Hundeporträt lag auf dem Boden, das Geheimfach stand sperrangelweit auf. Und war leer. So viel dazu.
Sirsha stieg in den Kleiderschrank und hantierte, während zwei Zimmer weiter die Vordertür splitternd nachgab, an einem winzigen Riegel im Boden herum. Er gehorchte, und Sirsha schloss gerade rechtzeitig die Falltür über sich, bevor Migvas Schläger ins Zimmer strömten. Sie tappte durch einen schmalen Tunnel und eine verborgene Tür in eine Hintergasse, dann mit patschenden Schritten ein paar Häuser weiter bis zu einer Nische und spähte hinter sich. Keine Verfolger.
Die nassen Socken zog sie aus, die roten Lederstiefel an. Das würde Blasen geben, aber Haut wuchs nach. Die Stiefel passten wie angegossen und hatten Sirsha schon Hunderte Kilometer getragen. Sie hatte nicht vor, das Innenfutter dreckig zu machen.
Als Sirsha aus der Nische schlüpfte, erklang eine Stimme.
»Da ist sie!«
Sirsha schickte einen ihrer giftigen Wurfpfeile in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war, und rannte los. Ein verklingendes Stöhnen sagte ihr, dass sie die Späherin getroffen hatte.
Raus hier. Bloß raus aus der Stadt. Sirsha kannte das Geiernest gut, besser als die meisten. Das Problem war nur, dass Migva ihr da in nichts nachstand. Zahllose Geheimpfade führten hier hinaus – die meisten davon waren lebensgefährlich.
Einen kannte Sirsha, den würde kein vernünftiger Mensch je betreten. Und genau der war ihr Ziel, während sie, immer wieder hinter sich blickend, von Gasse zu Gasse flitzte. Sie meinte, eine Bewegung zu sehen, und duckte sich tief in die Schatten einer Taverne. Als sich jedoch niemand zeigte, hetzte sie weiter bis zum Ostrand der Stadt.
Das Nest lag eingezwängt zwischen zwei hoch aufragenden Felswänden. Von Weitem wirkten sie komplett senkrecht und somit völlig unbegehbar. Sirsha wusste es besser. Sie stahl sich an den äußersten Hütten und Zelten vom Geiernest vorbei zu einem Spalt im Felsen. Er war gerade breit genug, dass Sirsha hineinpasste. Sie zog sich Handschuhe an und machte sich an den gefährlichen Aufstieg.
Der Stein war durch den Regen umso tückischer und schon bald waren ihre Handschuhe durchgeschwitzt. Sirsha zog das Tempo an, doch da hörte sie es unter sich kratzen.
Ein Gesicht blickte ihr entgegen. Selbst aus der Entfernung erkannte Sirsha Migvas wölfisch gebleckte Zähne.
»Verdammt«, stieß Sirsha hervor. Sie gab sich der Wunschvorstellung hin, Migva würde einfach ausrutschen und sang- und klanglos von dieser Welt scheiden. Doch die Frau war die reinste Jibauter-Spuckschabe – gemein, stark und unmöglich zu töten. Sirsha sah zu dem schmalen Strich Himmel empor, zu den regenschweren, von einem Blitz erleuchteten Wolken. Alles tat ihr weh. Ihre Knochen fühlten sich an wie Glasscherben. Aber es war nicht mehr weit.
Also biss sie die Zähne zusammen und kletterte weiter. Nur stellte sie bei jedem Blick über die Schulter fest, dass die knochige Bandenchefin aufholte. Sie war keine sechs Meter mehr hinter ihr, als Sirsha, nach Luft ringend, aus dem Spalt kroch. Mit zusammengekniffenen Augen versuchte sie, in der Dunkelheit etwas zu erkennen.
Die Felsen vor ihr fielen zu den Nadeln hin ab, Gebirgsformationen, die aussahen, als wären der Erde Stacheln gewachsen. Hinter ihnen verlief die imposante Kette der Serraberge. Wer die Nadeln bei diesem Wetter passieren wollte, musste schon sehr verzweifelt sein.
Weswegen Sirsha jetzt auf sie zustolperte. Der Pfad hinunter war steil, aber wenn sie achtgab, würde sie eine der dünnen Felsbrücken erreichen, die sie in dieser Richtung wusste – und nicht in den schwindelnden Abgrund stürzen.
»Komm gefälligst zurück, du Irre, damit ich dich töten kann!«, schrie Migva durch den Trichter ihrer Handflächen, die von der Kletterpartie bestimmt aufgerissen waren.
»Hat dir auf so was schon jemals wer gehorcht, Hundefresse?« Und zack, da passierte es: Sirsha trat fehl, rutschte aus und den Hang hinunter auf den Abgrund zu. Erst ein Felskamm beendete jäh ihren Sturz und stauchte ihr jeden Knochen im Leib. Sirsha sah noch Sternchen, da zuckte ein Blitz über den Himmel und erleuchtete für einen Moment weiter vorn neben einem Geröllblock eine große, breite Gestalt.
Zwei Sekunden später war Sirsha sich nicht mehr sicher, was sie gesehen hatte, doch die Ablenkung kam sie teuer zu stehen. Als Migva sie rammte, trieb es ihr die Luft aus der Lunge.
Sirsha taumelte und Migvas Blick blieb an der schmalen Goldkette um Sirshas Hals hängen. Gier glänzte in ihren Augen auf, und als sie danach griff, brachte sie sowohl Sirsha als auch sich selbst zu Fall. Hilflos kugelten sie weiter den felsigen Hang hinunter. Viel zu schnell kam der Abgrund näher.
»Bist du lebensmüde?!«, schrie Sirsha, während Migva immer noch die Kette an sich zu reißen versuchte. »Du bringst uns beide um!«
Aber Migva war offenbar völlig von Sinnen, und Sirsha blieb nichts anderes übrig, als die Mistkröte mit der einen Hand abzuwehren, während sie mit der anderen verzweifelt nach Halt suchte. Hier gab es doch irgendwo Knubbel im Stein, Ranken, Felsvorsprünge. Wenn sie nur irgendetwas davon zu fassen bekäme, könnte sie den Fall noch abwenden.
Auf dem letzten Stückchen Hang vor dem garantierten Sturz ins Bodenlose ertastete sie etwas Raues. Eine vertrocknete Ranke, für die sie spontan eine innige Liebe empfand. Sirsha klammerte sich daran, und die Ranke zog sich gefährlich straff, als Schwer- und Schwungkraft Sirsha und Migva in den sicheren Tod zerren wollten – doch sie hielt. Sirsha bohrte Migva den Daumen ins Auge und trat mit aller Kraft nach ihr. Vom jähen Angriff überrascht, ließ die Nestlaus Sirsha los. Migva stürzte hinab in die Dunkelheit, und ihre panischen Schreie hallten vom Fels wider, bis sie mit einem Schlag verstummten.
»Ich habe dich gewarnt«, murmelte Sirsha. Sie wagte es kaum, sich zu bewegen. Praktisch senkrecht hing sie an der Ranke und rechnete jeden Moment damit, dass die Pflanze sich aus der Erde löste. Behutsam tastete sie mit den Füßen nach Halt.
Und fand keinen. Sondern fiel, stürzte dem Tod entgegen. Verfluchte Höllen. Das Grab mit diesem käsegesichtigen Miststück teilen. So endet es also.
Bis es auf einmal einen Ruck gab. Und sie nicht tot war. Ihre geliebte Ranke war gestrafft bis zum Äußersten, und Sirsha klammerte sich daran wie an das Leben selbst, während sie über dem aufgerissenen Maul der Nadeln hin und her schwang. Unerklärlicherweise bewegte die Ranke sich nach oben.
Ah, ging Sirsha auf. Jemand zog sie nach oben. Mit schnellen, gleichmäßigen Bewegungen. Nach wenigen Minuten baumelte Sirsha nicht länger über der Leere. Sie versuchte, einen Blick auf den oder die Rettende zu erhaschen. Doch da war nur der Schein einer Lampe und wieder diese hünenhafte Gestalt, bevor der Regen Sirsha die Sicht nahm. Sekunden später wurde sie auf eine flache Stelle eben jenes Felshangs gezogen, der sie fast umgebracht hatte.
»Ihr könnt mich loslassen. Von hier fallt Ihr nicht.« Die Stimme war ein tiefes Grollen. Sie kam Sirsha nicht bekannt vor. Der nächste Blitz erhellte kurz den Fremden. Er war größer als sie, hatte helle Augen, dunkles Haar. Sein Gesicht war grimmig – von Leid gezeichnet. Er war bestimmt doppelt so alt wie sie.
»Seid Ihr Sörsha Westering?«, fragte er. »Die Fährtenleserin?«
Bevor der Mann auch nur daran hätte denken können, einen Schim zu ziehen, lag ihm das Messer an der Kehle, das Sirsha für den Notfall immer im Ärmel trug. »Es heißt Sir-scha. Mit i. Und wer will das überhaupt wissen?«
Sie rechnete mit Wut von seiner Seite oder zumindest mit Verärgerung. Männer mochten es nicht, von solchen wie ihr übertölpelt zu werden. Doch er lächelte nur und wies mit dem Kinn nach unten. Wo er ihr seinerseits ein Messer an den Bauch hielt. So schnell, wie es aufgetaucht war, verschwand es auch wieder, und der Mann hob die Hände.
»Ganz ruhig, ich bin ein Kunde«, sagte er. »Ich habe einen Auftrag für Euch.«
4 Aiz
Ach, Aiz. Du arme, dumme Närrin.
Aiz war unfähig, sich zu rühren. Konnte die Klinge weder in Tirals Hals stoßen noch sie auch nur einen Zentimeter bewegen. Tiral grinste und verstärkte den Schraubgriff um Aiz’ Handgelenk sogar noch, bis sie aufschrie und die Waffe fallen ließ.
Er hob das Messer auf und fegte Aiz dann mit einer schallenden Ohrfeige vom Bett. Sie rappelte sich auf und ein einziger Gedanke wirbelte in ihrem Kopf umher: Nein. Nein. Nein.
»Hast du wirklich gedacht, du könntest mich umbringen?« Tiral klang fast, als würde ihm das hier Spaß machen. Scham durchflutete Aiz. Tiral trat ihr in den Bauch und sie fiel auf die Knie. Er lachte.
»So ist’s besser. Bettele um Vergebung, und ich werde dafür sorgen, dass du einen schnellen Tod bekommst und niemand aus dem Kloster durch deine Dummheit Schaden nimmt.«
Aiz scherte es nicht, ob ihr ein schneller Tod vergönnt war. Sie wollte nur, dass Tiral litt. Dass er lernte, was Kummer und Leid bedeuteten. Und doch registrierte sie, dass er ihr gerade einen Ausweg bot – wenn auch einen, der für sie selbst tödlich enden würde. Aber das Kloster, die Priester … Sie hatte nicht bedacht, was er ihnen antun würde, wenn sie versagte.
»Oder lass das Betteln bleiben.« Tiral lächelte. »Und ich sorge dafür, dass dich die Befrager im Tohr auseinandernehmen, alle Gliedmaßen einzeln, zusammen mit den Priestern, die dir so lieb und teuer sind.«
Aiz starrte auf ihre blassen Hände, verschrammt und gezeichnet von dem harten Leben in Dafra. Eine Strähne fiel ihr ins Gesicht, doch sie rührte sich nicht. Die ungezieferverseuchten Zellen im Tohr waren voll von gebrochenen Schnepfen, die dem Triumvirat getrotzt hatten. Deine Wut bringt dich noch ins Grab.
Ins Grab.