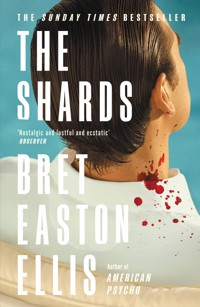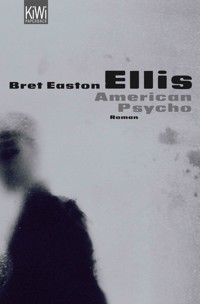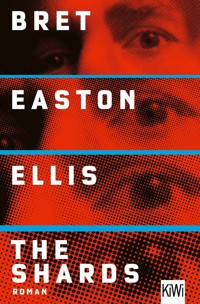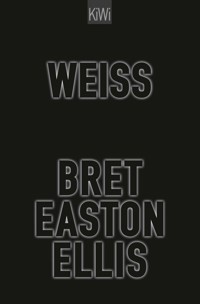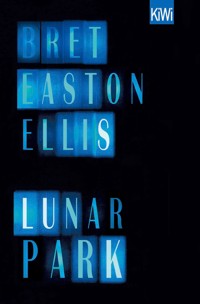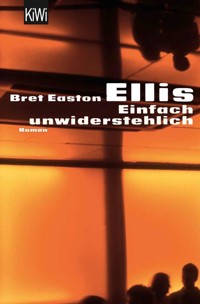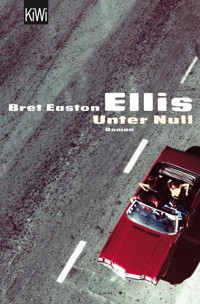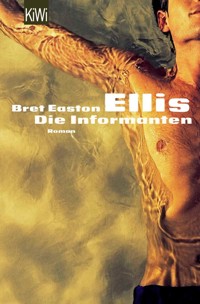
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In zwölf miteinander verwobenen Geschichten zeichnet der Autor von »American Psycho« das Bild einer sanften Apokalypse im Los Angeles der 1980er-Jahre Braun gebrannte Teenagerstudenten kreuzen mit ihren Porsches durch die Straßen zwischen Bel Air und Malibu Beach, immer auf der Suche nach dem ultimativen Kick, der ihrem kreditkartengesicherten Leben etwas Authentizität verleiht. Ob Drogendealer oder höhere Tochter, alle sind sie Konsumexperten: Man trifft sich zum Essen, zur Koksline, zum Sex, und man hat sich doch nichts zu sagen. Ihre Eltern stehen ihnen dabei in nichts nach, frustrierte Ehefrauen aus dem Filmbusiness halten sich Liebhaber im Alter ihrer Söhne, ein Vater nötigt seinen Sohn zum Wochenendtrip nach Hawaii, der sich als Fahrt ins blanke Nichts entpuppt. Ein Rockstar auf Welttournee schändet im Drogenrausch Zimmermädchen und Groupies, um dann von seinem Manager zu verlangen, was der Wunsch all dieser saturierten Upper-Class-Figuren zu sein scheint: »Bring mir meine Träume in Ordnung.« Auch im Nachfolgebuch zu seinem international erfolgreichen und umstrittenen Roman American Psycho bestätigt Ellis einmal mehr seine herausragende Stellung als literarischer Chronist der Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bret Easton Ellis
Ellis, Die Informanten
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bret Easton Ellis
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bret Easton Ellis
Bret Easton Ellis wurde am 7. März 1964 in Los Angeles geboren und wuchs im Stadtteil Sherman Oaks auf. Er besuchte die private Buckley School und begann 1986 ein Musikstudium am Bennington College in Vermont. Schon während seiner Highschool-Zeit bis in die Anfänge der 80er-Jahre spielte Ellis Keyboard in diversen New-Wave-Bands und wollte ursprünglich Musiker werden. Im Laufe des Studiums zog es ihn jedoch immer mehr zum Schreiben, trotz anhaltender Begeisterung für Musik. Mit 21 Jahren veröffentlichte Ellis das Debüt Unter Null und zog zwei Jahre später nach New York City. 1991 erschien American Psycho, der Roman machte ihn endgültig zum Kultautor. Seit 2006 lebt er wieder in Los Angeles, in der Nähe von Beverly Hills.
Clara Drechsler, geboren 1961, übersetzt meistens gemeinsam mit Harald Hellmann aus dem Englischen, u.a. Werke von Bret Easton Ellis, Helen Walsh und Irvine Welsh.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Auch im Nachfolgebuch zu seinem international erfolgreichen und umstrittenen Roman American Psycho bestätigt Ellis einmal mehr seine herausragende Stellung als literarischer Chronist der Gegenwart. In zwölf miteinander verwobenen Geschichten zeichnet der Autor das Bild einer sanften Apokalypse im Los Angeles der 80er-Jahre: Braun gebrannte Teenagerstudenten kreuzen mit ihren Porsches durch die Straßen zwischen Bel Air und Malibu Beach, immer auf der Suche nach dem ultimativen Kick, der ihrem kreditkartengesicherten Leben etwas Authentizität verleiht. Ob Drogendealer oder höhere Tochter, alle sind sie Konsumexperten: Man trifft sich zum Essen, zur Koksline, zum Sex, und man hat sich doch nichts zu sagen. Ihre Eltern stehen ihnen dabei in nichts nach, frustrierte Ehefrauen aus dem Filmbusiness halten sich Liebhaber im Alter ihrer Söhne, ein Vater nötigt seinen Sohn zum Wochenendtrip nach Hawaii, der sich als Fahrt ins blanke Nichts entpuppt. Ein Rockstar auf Welttournee schändet im Drogenrausch Zimmermädchen und Groupies, um dann von seinem Manager zu verlangen, was der Wunsch all dieser saturierten Upper-Class-Figuren zu sein scheint: »Bring mir meine Träume in Ordnung.«
»Eine scharf beobachtete, düster-witzige Anklage gegen eine von Geld und Drogen saturierte Kultur.« Times Literary Supplement
»Man kann und muss Ellis als schwarzhumorigen Satiriker lesen, ein paar Sekunden später aber wieder – und mit gleichem Recht – als Eins-zu-eins-Porträtisten.« Zürcher Zeitung
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Less Than Zero
© 1994 by Bret Easton Ellis
All rights reserved
Aus dem amerikanischen Englisch von Clara Drechsler
© 1995, 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Getty Images / Daly & Newton
ISBN978-3-462-31897-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
1 Bruce ruft vom Mulholland Drive an
2 Am Ruhepunkt
3 Es geht aufwärts
4 Auf den Inseln
5 Im Zug
6 Wasser von der Sonne
7 Japan entdecken
8 Briefe aus L.A.
9 Noch eine Grauzone
10 Die Geheimnisse des Sommers
11 Das fünfte Rad
12 Am Strand
13 Mit Bruce im Zoo
Motto
Eines Abends saß ich auf dem Bett in meinem Hotelzimmer in Bunker Hill, mitten im Herzen von Los Angeles. Es war ein bedeutsamer Abend in meinem Leben, weil ich mich wegen des Hotels entscheiden musste. Entweder ich zahlte oder ich verschwand: Das jedenfalls stand auf der Nachricht, die mir die Vermieterin unter der Tür durchgeschoben hatte. Ein großes Problem, das höchste Aufmerksamkeit verdiente. Ich löste es, indem ich die Lichter ausknipste und zu Bett ging.
John Fante Ich – Arturo Bandini
1Bruce ruft vom Mulholland Drive an
Bruce ruft, bekifft und sonnenverbrannt, aus Los Angeles an und sagt mir, wie leid es ihm tue. Er sagt, es tue ihm leid, dass er nicht bei mir sei, an der Uni. Er sagt, ich hätte recht gehabt, er hätte diesen Sommer den Workshop mitmachen sollen, und er sagt, es tue ihm leid, jetzt nicht in New Hampshire zu sein, und auch, dass er mich eine Woche nicht angerufen hat, und ich frage ihn, was er in Los Angeles treibt, und gehe darüber hinweg, dass es zwei Monate waren.
Bruce sagt, alles sei schiefgelaufen, seit Robert das Apartment, das sie sich Ecke Sechsundfünfzigste und Park teilten, verlassen habe, um mit seinem Stiefvater eine Wildwasserfahrt auf dem Colorado River zu unternehmen, sodass Roberts Freundin Lauren, die ebenfalls in dem Apartment Ecke Sechsundfünfzigste und Park wohnt, und Bruce vier Wochen zusammen allein blieben. Ich habe Lauren nie kennengelernt, aber ich weiß, welche Art Mädchen Robert attraktiv findet, und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie sie aussehen muss, und dann denke ich an die Mädchen, die Robert attraktiv finden, wunderschöne Mädchen, die so tun, als kümmere es sie nicht, dass Robert, mit zweiundzwanzig, an die dreihundert Millionen Dollar schwer ist, und ich stelle mir dieses Mädchen vor, Lauren, wie sie auf Roberts Futon liegt, den Kopf zurückgeworfen, wie Bruce sich langsam auf ihr bewegt, die Augen fest geschlossen.
Bruce sagt, die Affäre habe eine Woche nach Roberts Abreise begonnen. Bruce und Lauren waren ins Café Central gegangen, und nachdem sie das Essen zurückgehen lassen und nur etwas zu trinken beschlossen hatten, waren sie sich einig geworden, mehr als Sex sei nicht. Und dazu käme es nur, weil Robert westwärts gezogen war. Sie versicherten einander, abgesehen vom rein Körperlichen habe man nichts füreinander übrig, und dann gingen sie zurück in Roberts Wohnung und ins Bett. So lief das eine Woche lang, sagt Bruce, bis Lauren anfing, mit einem dreiundzwanzigjährigen Immobilientycoon auszugehen, der etwa zwei Milliarden schwer ist.
Bruce sagt, das habe ihn nicht gekratzt. Aber »leicht verstimmt« sei er an dem Wochenende gewesen, als Laurens Bruder Marshall, der gerade seinen Abschluss an der Rhode Island School for Design gemacht hatte, nach L.A. kam und in Roberts Wohnung Ecke Sechsundfünfzigste und Park abstieg. Bruce sagt, die Affäre zwischen ihm und Marshall habe einfach deshalb länger gedauert, weil Marshall länger geblieben sei. Marshall blieb anderthalb Wochen. Und dann kehrte Marshall nach SoHo ins Loft seines Ex-Freunds zurück, weil sein Ex-Freund, ein junger Kunsthändler, der etwa drei Millionen schwer ist, wollte, dass Marshall ihm drei funktionslose Träger in dem Loft in der Grand Street bemalt, in dem sie früher zusammen gewohnt hatten. Marshall ist etwa viertausend Dollar und ein paar Zerquetschte schwer.
Das war zu der Zeit, als Lauren ihr gesamtes Mobiliar (und einiges von Robert) in die Wohnung des dreiundzwanzigjährigen Immobilientycoons im Trump Tower schaffte. Zur gleichen Zeit hatten Roberts zwei teure ägyptische Eidechsen offenbar vergiftete Schaben gefressen und waren tot aufgefunden worden, die eine ohne Schwanz unter der Couch im Wohnzimmer, die andere auf Roberts Videorekorder – die große hatte fünftausend Dollar gekostet, die kleinere war ein Geschenk. Doch da Robert irgendwo im Grand Canyon unterwegs ist, besteht keine Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu treten. Bruce sagt, deshalb habe er das Apartment Ecke Sechsundfünfzigste und Park verlassen und sei in Reynolds Haus in Los Angeles oben am Mulholland Drive gezogen, solange Reynolds, der Bruce zufolge ein paar Falafeln bei PitaHut ohne Getränke schwer ist, in Las Cruces ist.
Bruce steckt sich einen Joint an und fragt, was ich so getrieben habe, was hier los gewesen sei, entschuldigt sich nochmals. Ich erzähle ihm von Lesungen, Empfängen, dass Sam mit einer Redakteurin des Paris Review geschlafen hat, die am Publishers’ Weekend von New York gekommen war, dass Madison sich eine Glatze schneiden lassen hat und Cloris glaubte, sie mache eine Chemotherapie durch, worauf sie Madisons sämtliche Storys an ihr bekannte Redakteure beim Esquire, New Yorker und bei Harper’s schickte, was alle ziemlich gaga fanden. Bruce sagt, ich soll Craig sagen, dass er seinen Gitarrenkoffer wiederhaben will. Er fragt, ob ich nach East Hampton fahre und meine Eltern besuche. Ich sage, da der Workshop so gut wie vorbei und es fast schon September sei, wüsste ich nicht, wieso.
Letzten Sommer war Bruce bei mir in Camden geblieben, wir belegten beide den Workshop, und das war der Sommer, in dem Bruce und ich nachts im Lake Parrin schwimmen gingen, der Sommer, in dem er den Text des Titelsongs von »Petticoat Junction« auf meine Tür kritzelte, weil ich immer lachen musste, wenn er den Song sang, nicht weil der Song so lustig war – es war nur, wie er ihn sang: mit todernstem, dabei völlig ausdruckslosem Gesicht. Das war der Sommer, in dem wir nach Saratoga fuhren, um uns die Cars anzusehen, und später im selben August Bryan Metro. Der Sommer war trunken und Nacht und warm und der See. Ein Bild, das ich niemals sah: wie meine kalten Hände über Bruce’ glatten, feuchten Rücken gleiten.
Bruce sagt, ich soll mich anfassen, gleich hier, in der Telefonzelle. In dem Wohnheim, wo ich bin, ist es ganz still. Ich verscheuche eine Stechmücke. »Ich kann mich nicht anfassen«, sage ich. Ich gleite langsam zu Boden, den Hörer noch in der Hand.
»Reich sein ist cool«, sagt Bruce.
»Bruce«, sage ich. »Bruce.«
Er fragt mich nach letztem Sommer. Er erwähnt Saratoga, den See, einen Abend in einer Bar in Pittsfield, an den ich mich nicht erinnere.
Ich sage nichts.
»Kannst du mich hören?«, fragt er.
»Ja«, flüstere ich.
»Kannst du, äh, gerade nicht reden?«, fragt er.
Ich starre auf eine Zeichnung: eine schaumüberladene Tasse Cappuccino und zwei in Schwarz daruntergekritzelte Worte: die Zukunft.
»Reg dich ab«, sagt Bruce schließlich.
Als wir aufgelegt haben, gehe ich zurück in mein Zimmer und ziehe mich um. Reynolds holt mich um sieben ab, und wir fahren in ein kleines chinesisches Restaurant am Rand von Camden, er stellt das Radio leiser, als ich sage, Bruce habe angerufen, und Reynolds fragt: »Hast du’s ihm gesagt?« Ich sage gar nichts. Heute habe ich beim Lunch erfahren, dass Reynolds im Moment was mit einem Mädchen aus der Stadt namens Brandy laufen hat. Ich kann an nichts als an Robert in einem Schlauchboot denken, immer noch irgendwo in Arizona, wie er ein kleines Foto von Lauren betrachtet, aber wahrscheinlich hat er gar keins. Reynolds dreht das Radio lauter, als ich den Kopf schüttele. Ich starre aus dem Fenster. Es ist das Ende des Sommers 1982.
2Am Ruhepunkt
»Ein Jahr ist es her«, sagt Raymond. »Auf den Tag.«
Ich habe gehofft, niemand würde darauf zu sprechen kommen, aber ich ahnte, als der Abend fortschritt, dass irgendwer etwas sagen würde. Ich hatte nur nicht gedacht, dass es Raymond tun würde. Wir vier sind bei Mario’s, einem kleinen italienischen Restaurant im Westwood Village, und es ist ein Donnerstag Ende August. Obwohl die Schule nicht vor Anfang Oktober anfängt, spürt jeder, dass der Sommer zu Ende geht, zu Ende ist. Es gibt wirklich nicht viel zu unternehmen. Eine Party in Bel Air, an der niemand größeres Interesse bekundet. Keine Konzerte. Keiner von uns hat ein Date. Ich glaube sogar, außer Raymond geht keiner von uns mit irgendwem. Also beschließen wir vier – Raymond, Graham, Dirk und ich –, zum Dinner auszugehen. Mir ist nicht einmal bewusst, dass es jetzt »auf den Tag« ein Jahr her ist, ehe ich auf dem Parkplatz neben dem Restaurant bin und fast einen Steppenläufer überfahre, den der Wind plötzlich vor meine Stoßstange kullert. Ich parke ein und sitze im Wagen, während mir aufgeht, welchen Tag wir haben, und ich gehe langsam, sehr bedächtig, zur Tür des Restaurants und lasse mir vor dem Reingehen einen Moment Zeit, um eine Speisekarte hinter Glas anzustarren. Ich komme als Letzter an. Die Runde ist nicht sehr gesprächig. Ich versuche, die spärliche Konversation auf andere Themen zu lenken: das neue Fixx-Video, Vanessa Williams, wie viel Ghostbusters einspielt, welche Kurse wir vielleicht belegen sollten, ob man nicht morgen mal surfen gehen könnte. Dirk verlegt sich aufs Erzählen schlechter Witze, die wir alle schon kennen und nicht komisch finden. Wir bestellen. Der Kellner geht. Raymond spricht.
»Ein Jahr ist es jetzt her. Auf den Tag«, sagt Raymond.
»Seit was?«, fragt Dirk interessiert.
Graham sieht zu mir, dann nach unten.
Lange sagt niemand was, nicht mal Raymond.
»Ihr wisst schon«, sagt er endlich.
»Nein«, sagt Dirk. »Ich nicht.«
»Doch, du weißt es«, sagen Graham und Raymond gleichzeitig.
»Nein, ehrlich nicht«, sagt Dirk.
»Na hör mal, Raymond«, sage ich.
»Nein, hör du mal«, sagt Raymond und sieht Dirk an, der keinen von uns ansieht. Er sitzt einfach da und stiert auf ein Glas Wasser, in dem sehr viel Eis ist.
»Mach dich nicht lächerlich«, sagt er leise.
Raymond lehnt sich mit einem Ausdruck bitterer Genugtuung zurück. Graham sieht wieder zu mir rüber. Ich schaue weg.
»Kommt einem gar nicht so lange vor«, murmelt Raymond. »Oder, Tim?«
»Na hör mal, Raymond«, sage ich noch mal.
»Seit was?«, sagt Dirk und sieht Raymond endlich an.
»Du weißt es«, sagt Raymond. »Du weißt es, Dirk.«
»Nein, weiß ich nicht«, sagt Dirk. »Warum sagst du’s uns nicht einfach? Sag’s einfach.«
»Das muss ich nicht«, murmelt Raymond.
»Ihr seid vielleicht Wichser«, sagt Graham und spielt mit einer Brotstange. Er bietet sie Dirk an, der abwinkt.
»Na los, Raymond«, sagt Dirk. »Du hast damit angefangen. Jetzt sag’s auch, Feigling.«
»Kannst du denen mal sagen, sie sollen die Klappe halten?«, sagt Graham zu mir.
»Du weißt schon«, sagt Raymond kläglich.
»Klappe«, seufze ich.
»Sag’s doch, Raymond«, stichelt Dirk.
»Seit Jamie …« Raymond versagt die Stimme. Er beißt auf die Zähne, dreht sich dann von uns weg.
»Seit Jamie was?«, fragt Dirk lauter und mit schrillerer Stimme. »Seit Jamie was, Raymond?«
»Ihr Typen seid die letzten Affen.« Graham lacht. »Wie wär’s, wenn ihr mal das Maul haltet.«
Raymond flüstert etwas, das für keinen von uns zu verstehen ist.
»Was?«, fragt Dirk. »Was hast du gesagt?«
»Seit Jamie gestorben ist«, gesteht Raymond endlich kleinlaut ein.
Aus irgendeinem Grund stopft das Dirk den Mund, und während der Kellner das Essen auf den Tisch stellt, lehnt er sich lächelnd zurück. Ich mag keine Kichererbsen in meinem Salat und hatte den Kellner darauf hingewiesen, als wir bestellten, empfinde es aber als unpassend, irgendwas zu sagen. Der Kellner stellt einen Teller Mozzarella marinara vor Raymond. Raymond stiert darauf. Der Kellner geht, kommt dann mit unseren Drinks zurück. Raymond starrt weiter auf seinen Mozzarella marinara. Der Kellner fragt, ob alles zu unserer Zufriedenheit sei. Graham nickt als Einziger von uns.
»Das hat er immer bestellt«, sagt Raymond.
»Du lieber Himmel, reg dich ab«, sagt Dirk. »Dann bestell was anderes. Bestell Abalone.«
»Die Abalone ist sehr gut«, sagt der Kellner, ehe er geht. »Die Trauben auch.«
»Ich fasse es nicht, wie du damit umgehst«, sagt Raymond.
»Wie denn? Weil ich anders damit umgehe als du?« Dirk nimmt seine Gabel in die Hand, legt sie dann zum dritten Mal wieder hin.
Raymond sagt: »Dass du so tust, als ob dir das am Arsch vorbeigeht.«
»Tut es ja vielleicht. Jamie war ein Wichser. Ein netter Typ, aber auch ein Wichser, klar?«, sagt Dirk. »Jedenfalls ist es aus und vorbei. Reit nicht darauf rum, ja?«
»Er war einer deiner besten Freunde«, sagt Raymond anklagend.
»Er war ein Arsch und keineswegs einer meiner besten Freunde«, sagt Dirk und lacht.
»Du warst sein bester Freund, Dirk«, sagt Raymond. »Tu jetzt nicht so, als wär’s anders gewesen.«
»Er hat mich auf seiner Jahrbuchseite erwähnt – na und?« Dirk zuckt die Achseln. »Mehr war da nicht.« Pause. »Er war ein Wichser.«
»Dir ist das scheißegal.«
»Dass er tot ist?«, fragt Dirk. »Er ist seit einem Jahr tot, Raymond.«
»Ich kann nicht glauben, dass dich das nicht betroffen macht.«
»Wenn Betroffenheit heißt, hier rumzusitzen und wie eine Schwuchtel zu flennen …«, Dirk seufzt, dann sagt er: »Hör mal, Raymond. Es ist lange her.«
»Gerade mal ein Jahr«, sagt Raymond.
Was ich von Jamie in Erinnerung habe: mit ihm kiffen auf einem Oingo-Boingo-Konzert in der elften Klasse. Besoffen am Strand von Malibu bei einer Party im Haus eines iranischen Klassenkameraden. Ein übler Streich, den er ein paar Verbindungstypen von der USC auf einer Party in Palm Springs gespielt hat und bei dem Ted Williams ziemlich böse verletzt wurde. An den Streich selbst erinnere ich mich nicht, aber daran, wie Raymond, Jamie und ich durch einen Flur im Hilton Riviera stolpern, alle drei stoned, an den Weihnachtsschmuck, wie jemand ein Auge verliert, einen zu spät eintreffenden Feuerwehrwagen, ein Schild über einer Tür mit der Aufschrift »Kein Eintritt«. Wie ich mit ihm am Abend des Abschlussballs auf einer Yacht gutes Koks nahm und er mir sagte, ich sei mit Abstand sein bester Freund. Während ich die nächste Line von einem schwarzen Lacktisch sniffte, hatte ich nach Dirk, nach Graham, Raymond, ein paar Filmstars gefragt. Jamie sagte, er fände Dirk und Graham nett und Raymond nicht so besonders. »Der Typ ist ein Schleimer«, waren seine exakten Worte. Nach noch einer Line sagte er, er würde mich verstehen oder irgendwas in der Art, und ich nahm noch eine Line und glaubte ihm, weil es so einfacher war.
Eines Abends Ende August versuchte Jamie auf der Fahrt nach Palm Springs einen Joint anzuzünden und verlor entweder die Kontrolle über den Wagen, weil er raste, oder ihm platzte ein Reifen, und der BMW flog vom Freeway, und er war auf der Stelle tot. Dirk war hinter ihm gewesen. Sie wollten das Wochenende auf den Labor Day im Haus von Jeffreys Eltern in Rancho Mirage verbringen und kamen von einer Party in Studio City, auf der wir alle gewesen waren, und Dirk hatte Jamies zerschmetterten, blutigen Körper aus dem Wagen gezogen und dann einen Typ angehalten, der nach Las Vegas unterwegs war, um dort einen Tennisplatz zu bauen, und der Typ fuhr zum nächsten Krankenhaus, und siebzig Minuten später kam ein Krankenwagen, und Dirk hatte in der Wüste gesessen und die Leiche angestarrt. Dirk hat nie viel darüber erzählt, nur nebensächliche Einzelheiten, die er uns in der Woche, nachdem es passiert war, verraten hat: wie der BMW sich überschlug, über Sand schlitterte, einen Kaktus platt walzte, wie Jamies Oberkörper die Windschutzscheibe durchschlug, wie Dirk ihn rauszog, hinlegte, in Jamies Taschen nach einem übrig gebliebenen Joint suchte. Ich war oft versucht, rauszufahren und mir die Stelle anzusehen, wo es passiert ist, aber ich fahre nicht mehr nach Palm Springs, weil ich jedes Mal, wenn ich dann da bin, völlig am Arsch bin und mich totlangweile.
»Ich fasse einfach nicht, wie egal euch das ist«, sagt Raymond gerade.
»Raymond«, sagen Dirk und ich unisono.
»Es ist halt so, dass wir es nicht ändern können«, führe ich den Satz zu Ende.
»Ja.« Dirk zuckt die Achseln. »Was können wir dran machen?«
»Sie haben recht, Raymond«, sagt Graham. »Es ist alles so verwischt.«
»Ich fühle mich schon selbst ganz zermatscht«, sagt Dirk.
Ich sehe rüber zu Raymond und dann wieder zu Dirk.
»Er ist tot und so weiter, aber das heißt nicht, dass er kein Wichser war«, sagt Dirk und schiebt seinen Teller weg.
»Er war kein Wichser, Dirk«, sage ich zu ihm und muss plötzlich lachen. »Er war ein Flitzer, kein Wichser.«
»Wie meinst du das, Tim?«, fragt Dirk und sieht mir gerade ins Gesicht. »Nach dem Scheiß, den er mit Carol Banks abgezogen hat?«
»O Jesus«, sagt Graham.
»Welchen Scheiß hat er mit Carol Banks abgezogen?«, frage ich nach kurzem Schweigen. Carol und ich waren während unserer letzten beiden Schuljahre ab und zu zusammen aus gewesen. Eine Woche, bevor Jamie starb, ging sie nach Camden. Ich habe seit einem Jahr nicht mehr mit ihr geredet. Ich glaube nicht, dass sie diesen Sommer überhaupt zurückgekommen ist.
»Er hat sie hinter deinem Rücken gefickt«, sagt Dirk, und es bereitet ihm Vergnügen, mir das zu erzählen.
»Er hat sie zehn-, zwölfmal gebumst, Dirk«, sagt Graham. »Jetzt mach nicht so was wie ’ne heiße Affäre draus.«
Ich hatte Carol Banks sowieso nie richtig gemocht. Ein Jahr, ehe wir dann richtig miteinander gingen, verlor ich meine Unschuld an sie. Süß, blond, Cheerleader, guter Notendurchschnitt, nichts Besonderes. Carol hatte immer gesagt, ich sei nonchalant, ein Wort, dessen Bedeutung mir nie klar wurde, ein Wort, das ich in mehreren Französischwörterbüchern nachschlug und nie finden konnte. Ich hatte immer den Verdacht gehabt, dass zwischen Jamie und Carol was gelaufen war, aber da ich Carol im Grunde nie besonders mochte (außer im Bett, und selbst da war ich nicht so sicher), sitze ich gelassen am Tisch, ungerührt von dem, was außer mir alle wussten.
»Ihr habt das also alle gewusst?«, frage ich.
»Du hast mir immer gesagt, du hättest dir nie viel aus Carol gemacht«, sagt Graham.
»Aber ihr wusstet alle Bescheid?«, frage ich noch mal. »Raymond – hast du es gewusst?«
Raymond kneift kurz die Augen zusammen, den Blick auf einen Punkt geheftet, den er nicht sehen kann, und er nickt, ohne etwas zu sagen.
»Na und, auch kein Beinbruch, oder?«, sagt Graham, und es klingt nicht wie eine Frage.
»Gehen wir jetzt ins Kino oder was?«, fragt Dirk genervt.
»Ich kann nicht glauben, wie egal euch das ist«, sagt Raymond laut und unerwartet.
»Willst du ins Kino?«, fragt mich Graham.
»Ich kann nicht glauben, wie egal euch das ist«, wiederholt Raymond leiser.
»Ich war dabei, Arschloch«, sagt Dirk und packt Raymond am Arm.
»Oh, Scheiße, ist das peinlich«, sagt Graham und drückt sich tiefer in seinen Stuhl. »Halt die Klappe, Dirk.«
»Ich war dabei«, sagt Dirk, ohne auf Graham zu achten, die Hand immer noch um Raymonds Arm. »Ich bin geblieben und habe ihn aus der Scheißkarre gezogen. Ich musste ihm da draußen beim Verbluten zusehen. Also komm mir bloß nicht damit, wie egal mir das ist. Stimmt, Raymond. Es ist mir egal.«
Raymond weint schon, er reißt sich von Dirk los, steht vom Tisch auf und steuert durch den hinteren Teil des Restaurants zur Herrentoilette. Die wenigen Leute, die noch in dem Restaurant sind, sehen jetzt zu unserem Tisch. Dirks coole Pose bröckelt ein wenig. Graham macht ein leicht gequältes Gesicht. Ich erwidere das Gaffen eines jungen Paars zwei Tische neben uns, bis sie wegschauen.
»Es sollte jemand mit ihm reden«, sage ich.
»Und was sagen?«, fragt Dirk. »Scheiße, was denn?«
»Na, eben einfach mit ihm reden?« Ich zucke kläglich die Achseln.
»Ich jedenfalls nicht.« Dirk verschränkt die Arme und schaut sonst wohin, nur nicht zu Graham und mir.
Ich stehe auf.
Dirk sagt: »Für Jamie war Raymond ein Arschloch. Verstehst du? Scheiße, er fand ihn widerlich. Er war nur mit ihm befreundet, weil wir es waren, Tim.«
Einen Moment später sagt Graham: »Er hat recht, Alter.«
»Ich dachte, Jamie sei auf der Stelle tot gewesen«, sage ich im Stehen.
»War er auch«, sagt Dirk achselzuckend. »Wieso? Warum?«
»Du hast Raymond gesagt, er sei – äh – verblutet.«
»Jesus – was macht das für einen Unterschied? Also, ehrlich«, sagt Dirk. »Jesus, seine Eltern haben die verdammte Totenwache im Spago steigen lassen, lieber Himmel. Also krieg dich wieder ein, Junge.«
»Nein, ehrlich, Dirk«, sage ich. »Warum hast du Raymond das erzählt?« Pause. »Ist das die Wahrheit?«
Dirk schaut auf. »Ich hoffe, jetzt geht es ihm schlechter.«
»Ach ja?«, frage ich und unterdrücke ein Grinsen.
Dirk starrt mich herausfordernd an, dann verliert er das Interesse und lässt es. »Du blickst nie irgendwas, Tim. Die Optik stimmt, aber sonst funktioniert nichts.«
Ich verlasse den Tisch und gehe zur Herrentoilette. Die Tür ist abgeschlossen, und über dem Spülgeräusch der Toilette, die mehrmals abgezogen wird, kann ich Raymonds Schluchzen hören. Ich klopfe. »Raymond – lass mich rein.«
Die Spülung hört auf zu laufen. Ich höre ihn schniefen und sich dann die Nase putzen.
»Bin gleich wieder in Ordnung«, ruft er.
»Lass mich rein.« Ich drehe am Knopf. »Komm schon. Mach die Tür auf.«
Die Tür öffnet sich. Es ist ein kleiner Waschraum, Raymond sitzt auf dem heruntergeklappten Toilettendeckel und fängt gerade wieder an zu weinen, Gesicht und Augen rot und feucht. Ich bin so verblüfft über Raymonds Gefühlsausbruch, dass ich mich an die Tür lehne und nur glotze und zusehe, wie er die Hände zu Fäusten ballt.
»Er war mein Freund«, sagt er schnaufend, ohne zu mir hochzusehen.
Ich betrachte sehr lange eine vergilbte Kachel an der Wand und frage mich, warum der Kellner, dem ich ganz sicher gesagt hatte, dass ich einen Salat ohne Kichererbsen wollte, sich nicht darum gekümmert hat. Wo war der Kellner geboren, warum war er bei Mario’s gelandet, hatte er sich den Salat nicht angesehen, verstand er nicht?
»Er mochte dich … auch«, sagte ich endlich.
»Er war mein bester Freund.« Raymond versucht mit dem Geschluchze aufzuhören, indem er gegen die Wand hämmert.
Ich beuge mich zu ihm runter, heuchle Mitgefühl und sage »scht-scht«.
»War er wirklich.« Raymond schluchzt weiter.
»Komm schon, steh auf«, sage ich. »Es wird schon wieder. Wir gehen ins Kino.«
Raymond schaut auf und fragt: »Ehrlich?«
»Jamie hat dich wirklich auch gemocht.« Ich nehme Raymond beim Arm. »Er hätte nicht gewollt, dass du dich so aufführst.«
»Er mochte mich wirklich«, bestätigt er sich, vielleicht ist es auch eine Frage.
»Ja, wirklich.« Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen, als ich das sage.
Raymond hustet und nimmt ein Stück Klopapier und putzt sich die Nase, dann wäscht er sich das Gesicht und sagt, dass er Pot braucht.
Wir gehen beide zurück an den Tisch und versuchen etwas zu essen, aber alles ist kalt, mein Salat schon abgeräumt.
Raymond bestellt eine gute Flasche Wein, und der Kellner bringt sie zusammen mit vier Gläsern, und Raymond schlägt einen Toast vor. Und nachdem die Gläser gefüllt sind, drängt er uns, damit anzustoßen, und Dirk sieht uns an, als wären wir irre, er weigert sich und kippt sein Glas runter, noch ehe Raymond so was sagen kann wie: »Auf dich, alter Junge, verdammt, du fehlst uns.« Ich hebe wie ein Idiot mein Glas, und Raymond sieht mich an, mit geschwollenem, aufgedunsenem Gesicht, grienend und bekifft, und während dieses Ruhepunkts, als Raymond sein Glas hebt und Graham aufsteht, um zu telefonieren, erinnere ich mich so abrupt und mit solcher Klarheit an Jamie, dass es mir vorkommt, als sei der Wagen in dieser Nacht in der Wüste gar nicht vom Highway geflogen. Es kommt mir fast so vor, als sei das Arschloch direkt hier, unter uns, und dass er, wenn ich mich umdrehe, dort sitzen wird, ebenfalls mit dem Glas in der Hand, spöttisch grinsend den Kopf schütteln und stumm »Idioten« mit den Lippen formen wird.
Ich trinke einen Schluck, zaghaft zuerst, weil ich fürchte, der Schluck besiegelt etwas.
»Tut mir leid«, sagt Dirk. »Ich … kann einfach nicht.«
3Es geht aufwärts
Ich stehe auf dem Balkon von Martins Apartment in Westwood, in einer Hand einen Drink und in der anderen eine Zigarette, und Martin kommt auf mich zu, geht auf mich los und stößt mich mit beiden Händen vom Balkon. Martins Apartment in Westwood liegt nur im ersten Stock, darum dauert der Sturz nicht lange. Im Fallen hoffe ich aufzuwachen, ehe ich am Boden aufschlage. Ich klatsche hart auf den Asphalt, und während ich so daliege, platt auf dem Bauch, den Kopf ganz verdreht, sehe ich hoch, und mein Blick bleibt an Martins hübschem Gesicht hängen, das milde lächelnd auf mich herabschaut. Es ist die heitere Gelassenheit dieses Lächelns – und weniger der Sturz oder die eingebildete Vorstellung meines zerschmetterten, blutenden Körpers –, die mich aufwachen lässt.
Ich sehe zur Decke, dann zum Digitalwecker auf dem Nachttisch neben dem Bett, der mir verrät, dass wir fast Mittag haben, und in der vergeblichen Hoffnung, ich hätte mich bei der Uhrzeit verlesen, kneife ich die Augen zu, aber als ich sie wieder aufschlage, zeigt die Uhr immer noch kurz vor Mittag. Ich hebe leicht den Kopf und schaue auf die kleinen, flimmernden roten Leuchtziffern des Videorekorders, und sie verkünden dasselbe wie die Zeiger des melonenfarbenen Weckers: fast Mittag. Ich versuche, wieder einzuschlafen, aber die Wirkung der Librium, die ich im Morgengrauen genommen habe, hat nachgelassen, und mein Mund ist pappig und trocken, und ich bin durstig. Träge stehe ich auf und gehe ins Badezimmer, und als ich den Wasserhahn aufdrehe, sehe ich lange in den Spiegel, bis ich gezwungen bin, die neuen Fältchen um meine Augen zur Kenntnis zu nehmen. Ich wende den Blick ab und konzentriere mich auf das Wasser, das aus dem Hahn schießt und meine zur Schale geformten Hände füllt.
Ich öffne den Spiegelschrank und hole ein Röhrchen heraus. Ich schraube den Deckel ab und zähle nur vier verbliebene Librium. Ich schüttele eine der grün-schwarzen Kapseln in meine Hand, starre darauf, lege sie dann behutsam auf den Waschbeckenrand und schließe das Röhrchen und stelle es in den Medizinschrank zurück und nehme ein anderes Röhrchen heraus und lege daraus zwei Valium auf die Ablage neben die grün-schwarze Kapsel. Ich stelle das Röhrchen zurück und nehme ein anderes heraus. Ich öffne es und riskiere einen vorsichtigen Blick. Ich stelle fest, dass nicht mehr viel Thorazin übrig ist, und notiere mir im Hinterkopf, die Valium und Librium nachfüllen zu lassen, und ich nehme eine Librium und eine der beiden Valium und drehe die Dusche auf.
Ich trete in die große schwarz-weiß geflieste Duschkabine und stehe da. Das Wasser, erst kalt, dann wärmer, prasselt mir ins Gesicht, und mir wird schwach, und während ich langsam in die Knie gehe und die schwarz-grüne Kapsel mir irgendwie in der Kehle festhängt, stelle ich mir einen Augenblick lang vor, das Wasser sei ein sattes, kühles Aquamarin, und ich öffne die Lippen, den Kopf in den Nacken gelegt, um etwas Wasser in die Kehle zu leiten und damit die Kapsel runterzuspülen. Als ich die Augen öffne, stöhne ich auf, als ich sehe, dass das auf mich herabströmende Wasser nicht blau ist, sondern durchsichtig und hell und warm, und die Haut auf meiner Brust und meinem Bauch rötet.
Nach dem Anziehen gehe ich nach unten, und mich quält der Gedanke, wie lange es dauert, sich für einen Tag frisch zu machen. Wie viele Minuten verstreichen, während ich lustlos durch einen großen begehbaren Schrank streife, wie lange ich brauche, um die gewünschten Schuhe zu finden, wie viel Mühe es kostet, mich aus der Dusche aufzuraffen. Man kann das vergessen, wenn man vorsichtig, methodisch, auf jeden Schritt konzentriert, nach unten geht. Ich erreiche den unteren Treppenabsatz, höre aus der Küche Stimmen und halte darauf zu. Von dort, wo ich stehe, kann ich meinen Sohn und einen anderen Jungen auf der Suche nach Essbarem in der Küche sehen, und das Hausmädchen, das an dem großen Massivholztisch sitzt und sich Fotos im Herald Examiner vom Vortag anschaut, die Sandalen abgestreift, blauer Nagellack auf den Zehennägeln. Im Fernsehzimmer läuft die Stereoanlage, und irgendwer, eine Frau, singt »I found a picture of you«. Ich gehe in die Küche. Graham schaut vom Kühlschrank auf und sagt ohne ein Lächeln: »So früh auf den Beinen?«
»Warum bist du nicht in der Schule?«, frage ich und versuche, so zu klingen, als läge mir was dran, während ich an ihm vorbei nach einem Tab im Kühlschrank greife.
»Wir haben montags früher frei.«
»Oh.« Ich glaube ihm, ohne zu wissen, warum. Ich öffne das Tab und nehme einen Schluck. Es kommt mir so vor, als stecke die Pille, die ich vorhin genommen habe, immer noch langsam zerfallend in meinem Hals. Ich trinke noch einen Schluck Tab.
Graham angelt sich eine Orange aus dem Kühlschrank. Der andere Junge, groß und blond wie Graham, steht am Waschbecken und starrt aus dem Fenster in den Pool. Graham und der andere Junge tragen ihre Schuluniformen und sehen sich sehr ähnlich: Graham beim Schälen einer Orange, der andere Junge mit unverwandtem Blick aufs Wasser. Ich finde die eine Pose so enervierend wie die andere, also wende ich mich ab, aber der Anblick des am Tisch sitzenden Hausmädchens mit den Sandalen vor ihren Füßen und der unverwechselbare Geruch nach Marihuana, der aus der Handtasche und dem Sweater des Mädchens dringt, ist irgendwie noch schlimmer, und ich trinke noch einen Schluck Tab und kippe dann den Rest in den Ausguss. Ich will aus der Küche gehen.
Graham wendet sich an den Jungen. »Möchtest du MTV sehen?«
»Ich … ich glaube nicht«, sagt der Junge und starrt in den Pool.
Ich nehme meine Handtasche, die in einer Nische neben dem Kühlschrank steht, und vergewissere mich, dass meine Brieftasche drin ist, denn bei meinem letzten Besuch bei Robinson’s war sie es nicht. Ich bin schon fast aus der Tür. Das Mädchen faltet die Zeitung zusammen. Graham zieht seinen weinroten Sweater mit Schulabzeichen aus. Der andere Junge will wissen, ob Graham Alien auf Video hat. Im Fernsehzimmer singt die Frau von »circumstances beyond our control«. Ich ertappe mich dabei, wie ich meinen Sohn anstarre, blond und groß und gebräunt, mit leeren grünen Augen, der den Kühlschrank öffnet und sich noch eine Orange herausnimmt. Er sieht sie prüfend an, hebt dann den Kopf, als er mich neben der Tür stehen sieht.
»Gehst du weg?«, fragt er.
»Ja.«
Er wartet einen Moment, und als ich nichts sage, dreht er sich um und zuckt die Achseln und beginnt die Orange zu schälen, und unterwegs zum Le Dôme, wo ich mich mit Martin zum Lunch treffe, wird mir klar, dass Graham nur ein Jahr jünger ist als Martin, und ich muss den Jaguar auf dem Sunset Boulevard an den Straßenrand lenken, das Radio leiser stellen, erst ein Fenster öffnen, dann das Sonnendach und die Hitze der heutigen Sonne das Wageninnere wärmen lassen, während ich mich auf einen Steppenläufer konzentriere, den der Wind langsam über einen leeren Boulevard weht.
Martin sitzt an der runden Bar im Le Dôme. Er trägt Anzug und Krawatte, und er wippt mit dem Fuß ungeduldig zu der Musik aus der Lautsprecheranlage des Restaurants. Er beobachtet mich, während ich auf ihn zugehe.
»Du bist spät dran«, sagt er und zeigt mir die Uhrzeit auf einer goldenen Rolex.
»Stimmt«, sage ich, und dann: »Setzen wir uns.«
Martin schaut auf seine Uhr und dann auf sein leeres Glas und dann wieder zu mir, und ich presse meine Handtasche fest an mich. Martin seufzt, nickt dann. Der Maître führt uns an den Tisch, und wir setzen uns, und Martin fängt an, von seinen Kursen an der UCLA zu reden, und dann davon, dass ihn seine Eltern nerven, dass sie unangemeldet in seinem Apartment in Westwood aufgetaucht seien, dass sein Stiefvater auf Martins Anwesenheit bei einer Dinnerparty bestanden habe, die er im Chasen’s gab, und dass Martin keinen Bock auf eine Dinnerparty gehabt habe, die sein Stiefvater im Chasen’s steigen ließ, und über das müde Wortgefecht deswegen.
Ich schaue aus einem Fenster zu einem spanischen Parkplatzwächter, der vor einem Rolls-Royce steht und murmelnd hineinstarrt. Als Martin über seinen BMW und die Höhe der Versicherung zu nörgeln anfängt, unterbreche ich ihn.
»Warum hast du mich zu Hause angerufen?«
»Ich wollte dich sprechen«, sagt er. »Ich wollte absagen.«
»Ruf nicht zu Hause an.«
»Warum nicht?«, fragt er. »Ist da irgendwer, den es stört?«
Ich zünde eine Zigarette an.
Er legt die Gabel neben den Teller und schaut dann weg. »Wir essen im Le Dôme«, sagt Martin. »Also ehrlich – Herrgott.«
»Abgemacht?«, frage ich.
»Ja. Okay.«
Ich bitte um die Rechnung und zahle und begleite Martin in seine Wohnung in Westwood, wo wir Sex haben und ich Martin einen Tropenhelm schenke.
Ich liege auf einer Chaiselongue am Pool. Die Vogue und das Los Angeles Magazine und der Tageskalender der Times stapeln sich neben meinem Liegeplatz, aber ich kann sie nicht lesen, weil die Farbe des Pools meinen Blick von den Worten ablenkt und ich sehnsüchtig in das blass aquamarinblaue Wasser starre. Ich würde gerne schwimmen gehen, aber die Sonne hat das Wasser zu sehr erwärmt, und Dr. Nova hat mich davor gewarnt, auf Librium Runden zu schwimmen.
Ein Poolboy reinigt den Pool. Der Poolboy ist sehr jung und braun gebrannt und hat blondes Haar, und er trägt kein Hemd und sehr enge weiße Jeans, und als er sich vorbeugt, um die Wassertemperatur zu prüfen, spielen seine Rückenmuskeln zart unter glatter, sauberer brauner Haut. Der Poolboy hat einen tragbaren Kassettenrekorder mitgebracht, der am Rand des Whirlpools steht, und irgendwer singt »Our love’s in jeopardy«, und ich hoffe, der warme Wind in den Palmwedeln wird die Musik in den Garten der Suttons tragen. Ich bin ganz davon gefangen genommen, wie hoch konzentriert der Poolboy wirkt, wie sanft sich das Wasser kräuselt, wenn er es mit einem Netz abschöpft, wie er das Netz leert, in dem sich Blätter und bunt schillernde Libellen verfangen, mit denen die gleißende Wasseroberfläche übersät zu sein scheint. Er öffnet einen Abfluss, und ganz leicht, nur einen Augenblick lang, spannen sich seine Armmuskeln. Gebannt sehe ich weiter zu, wie er in das runde Loch greift und mit dem Arm etwas aus dem Loch hochzieht, wie die Muskeln wieder kurz zucken, und sein Haar ist blond und vom Wind zerzaust, von der Sonne gesträhnt, und ich verlagere mein Gewicht auf der Sonnenliege, ohne den Blick abzuwenden.
Der Poolboy zieht langsam den Arm aus dem Abfluss, hebt zwei große, graue Fetzen hoch, lässt sie tropfend auf Beton klatschen und starrt sie an. Er starrt die Fetzen lange an. Und dann kommt er auf mich zu. Kurz überfällt mich Panik, ich rücke meine Sonnenbrille zurecht und greife nach dem Sonnenöl. Der Poolboy kommt langsam auf mich zu, und die Sonne knallt auf uns nieder, und ich habe die Beine gespreizt und reibe Öl auf die Innenseite meiner Schenkel und dann über meine Beine, Knie, Knöchel. Er steht direkt vor mir. Das Valium, das ich zuvor eingenommen habe, bringt alles durcheinander, lässt den Hintergrund in Zeitlupe vibrieren. Ein Schatten legt sich auf mein Gesicht, der es mir möglich macht, zu dem Poolboy aufzuschauen, und aus dem tragbaren Kassettenrekorder höre ich »Our love’s in jeopardy«, und der Poolboy öffnet den Mund, seine Lippen sind voll, seine Zähne weiß und sauber und ebenmäßig, und mich packt das rasende Verlangen, er möge mich auffordern, in den am Fuß der Einfahrt geparkten weißen Pick-up zu steigen und mit ihm raus in die Wüste zu fahren. Seine Hände, chlorduftend, würden Öl über meinen Rücken, Bauch und Hals reiben – und als er auf mich herabblickt, während aus dem Kassettendeck Rockmusik dröhnt und die Palmen sich im heißen Wüstenwind wiegen und die Sonne auf der blauen Wasserfläche des Pools gleißt, straffe ich jeden Muskel und warte darauf, ihn etwas sagen zu hören, irgendetwas, ein Seufzen, ein Stöhnen. Ich hole Luft, stiere durch meine Sonnenbrille in die Augen des Poolboys, zitternd.
»Sie haben zwei tote Ratten im Abfluss.«
Ich sage gar nichts.
»Ratten. Zwei tote Ratten. Haben sich im Abfluss verfangen oder sind vielleicht reingefallen, wer weiß.« Er sieht mich tumb an.
»Warum … sagst du mir das?«, frage ich.
Er steht da und wartet, dass ich noch irgendwas sage. Ich schiebe die Sonnenbrille ein Stück vor und betrachte die grauen Bündel neben dem Whirlpool.
»Schaff sie … weg?«, bringe ich mit gesenktem Blick hervor.
»Klar. Okay«, sagt der Poolboy, die Hände in den Taschen. »Ich weiß bloß nicht, wie sie da reingeraten sind.«
Die Feststellung, schon mehr eine Frage, erfolgt so schleppend, dass ich ihm, wiewohl sie keiner Antwort bedarf, sage: »Das muss dann wohl … ein Geheimnis bleiben?«
Ich sehe mir das Titelbild einer Ausgabe des Los Angeles Magazine an. Ein riesiger Wasserstrahl reckt sich in den Himmel, ein blau und weiß und grün aufschießender Springbrunnen.
»Ratten fürchten sich vor Wasser«, belehrt mich der Poolboy.
»Ja«, sage ich. »Hab ich gehört. Ich weiß.«
Der Poolboy geht zu den beiden ersoffenen Ratten zurück und hebt sie an ihren Schwänzen hoch, die rosa sein sollten, nun aber, wie ich selbst von dort, wo ich sitze, sehen kann, blassblau sind, und er steckt sie in etwas, das ich für seinen Werkzeugkasten gehalten hatte, und dann schlage ich das Los Angeles Magazine auf und suche nach dem Artikel über den Springbrunnen auf dem Titelbild, um nicht daran denken zu müssen, der Poolboy könne sich die Ratten aufheben.