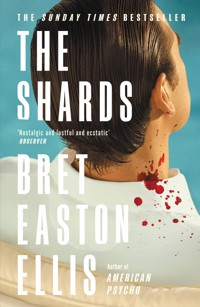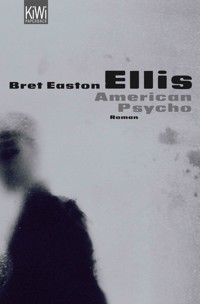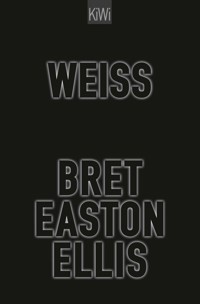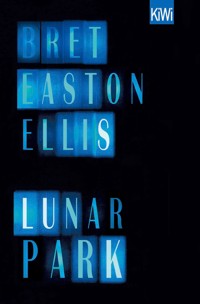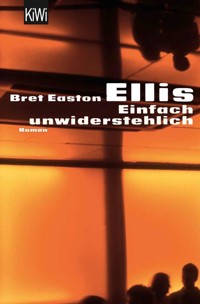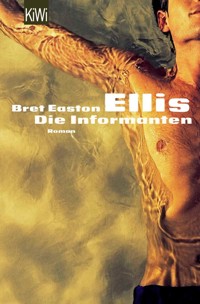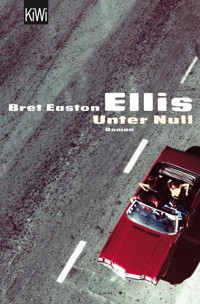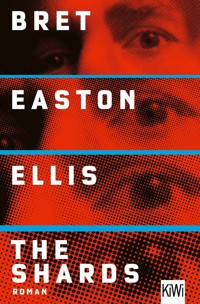
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bret Easton Ellis' meisterhafter neuer Roman erzählt eine traumatische Geschichte: Während seiner eigenen Schulzeit war ein Serienmörder in L.A. eine Bedrohung für die Jugendlichen. Der siebzehnjährige Bret ist in der Oberstufe der exklusiven Buckley Prep School, als ein neuer Schüler auftaucht. Robert Mallory ist intelligent, gutaussehend und charismatisch und zieht Bret magisch an. Bret ist sich sicher, dass Robert ein düsteres Geheimnis hat, und kann dennoch nicht verhindern, dass Robert Teil seiner Freundesgruppe wird. Als der Trawler, ein Serienmörder, der Jugendliche auf bestialische Weise umbringt, immer näher an ihn und seine Clique heranrückt, gerät Bret zunehmend in eine Spirale aus Paranoia und Isolation. Doch wie zuverlässig ist Bret als Erzähler? »The Shards« ist eine faszinierende Mischung aus Fakten und Fiktion, aus Realität und Fantasie, die auf brillante Weise das emotionale Gefüge von Brets Leben als Siebzehnjähriger auslotet – Sex und Eifersucht, Besessenheit und mörderische Wut. Fesselnd, raffiniert, spannend, eindringlich und oft düster-komisch – »The Shards« ist ein unnachahmliches Meisterwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1154
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bret Easton Ellis
The Shards
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bret Easton Ellis
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bret Easton Ellis
Bret Easton Ellis wurde 1964 in Los Angeles geboren. Er besuchte die private Buckley School und begann 1986 ein Musikstudium am Bennington College in Vermont. Schon während seiner Highschool-Zeit bis in die Anfänge der 80er-Jahre spielte Ellis Keyboard in diversen New-Wave-Bands und wollte ursprünglich Musiker werden. Im Laufe des Studiums zog es ihn jedoch immer mehr zum Schreiben. Mit 21 Jahren veröffentlichte Ellis das Debüt »Unter Null« und zog zwei Jahre später nach New York City. 1991 erschien »American Psycho«, der Roman machte ihn endgültig zum Kultautor. Seit 2006 lebt er wieder in Los Angeles, in der Nähe von Beverly Hills.
Stephan Kleiner, geboren 1975, lebt als literarischer Übersetzer in München. Er übertrug u. a. Geoff Dyer, Michel Houellebecq, Gabriel Talent und Hanya Yanagihara ins Deutsche.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Bret Easton Ellis’ meisterhafter neuer Roman erzählt eine traumatische Geschichte: Während seiner eigenen Schulzeit war ein Serienmörder in L.A. eine Bedrohung für die Jugendlichen.
Der siebzehnjährige Bret ist in der Oberstufe der exklusiven Buckley Prep School, als ein neuer Schüler auftaucht. Robert Mallory ist intelligent, gut aussehend und charismatisch und zieht Bret magisch an. Bret ist sich sicher, dass Robert ein düsteres Geheimnis hat, und kann dennoch nicht verhindern, dass Robert Teil seiner Freundesgruppe wird. Als der Trawler, ein Serienmörder, der Jugendliche auf bestialische Weise umbringt, immer näher an ihn und seine Clique heranrückt, gerät Bret zunehmend in eine Spirale aus Paranoia und Isolation. Doch wie zuverlässig ist Bret als Erzähler?
»The Shards« ist eine faszinierende Mischung aus Fakten und Fiktion, aus Realität und Fantasie, die auf brillante Weise das emotionale Gefüge von Brets Leben als Siebzehnjähriger auslotet – Sex und Eifersucht, Besessenheit und mörderische Wut. Fesselnd, raffiniert, spannend, eindringlich und oft düster-komisch – »The Shards« ist ein unnachahmliches Meisterwerk.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: The Shards
© 2023 by Bret Easton Ellis Corporation
All rights reserved
Grateful acknowledgment is made to Hal Leonard LLC for permission to reprint an excerpt from »Vienna«, words and music by Warren Cann, Christopher Allen, William Currie, and Midge Ure. Copyright © 1981 by Hot Food Music Ltd., Sing Sing Songs Ltd., Jump-Jet Music Ltd., and Mood Music Ltd.
Aus dem amerikanischen Englisch von Stephan Kleiner
© 2023, 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln, nach einer Idee von Chip Kidd, Penguin Random House
Covermotiv: © Steve Speller / Alamy Stock Foto
Lektorat: Kristof Kurz
ISBN978-3-462-31151-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Vorwort
Herbst 1981
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Zum Buch
Zum Werk
Für niemanden
Do you remember back in old L.A.
When everybody drove a Chevrolet?
Whatever happened to the boy next door
The suntanned, crew-cut, all-American male?
»Beach Baby« The First Class
Willst du ein Geheimnis bewahren, musst du es auch vor dir selbst verbergen.
1984George Orwell
Vor vielen Jahren wurde mir klar: Ein Buch, ein Roman ist ein Traum, der auf die gleiche Weise niedergeschrieben werden will, wie wir uns in jemanden verlieben – der Traum wird unwiderstehlich, du kannst nichts dagegen tun, irgendwann gibst du auf und beugst dich, selbst wenn dir dein Instinkt zur Flucht rät, weil es letztlich ein gefährliches Spiel sein könnte – jemand wird verletzt werden. Bei manchen von uns führen die ersten Ideen, Bilder, die anfänglichen Regungen dazu, dass der Autor automatisch in die Welt des Romans, in ihre Romantik und Fantasie, in ihre Geheimnisse eintaucht. Bei anderen kann es länger dauern, bis diese Verbindung deutlicher spürbar wird, unter Umständen vergeht eine Ewigkeit, bis du erkennst, wie dringend du den Roman schreiben oder diesen Menschen lieben, diesen Traum noch einmal durchleben musst, selbst nach Jahrzehnten noch. Über dieses Buch, diesen speziellen Traum und darüber, diese Version der Geschichte zu erzählen – diejenige, die Sie in diesem Augenblick lesen, die Sie gerade begonnen haben –, dachte ich zuletzt vor fast zwanzig Jahren nach; damals dachte ich, ich hätte das Zeug zu enthüllen, was mir und einigen Freunden zu Beginn unseres Abschlussjahrs 1981 auf der Buckley School widerfahren war. Wir waren Teenager, nur dem Anschein nach mondäne Kinder, die in Wahrheit nichts darüber wussten, wie die Welt wirklich funktionierte – über die Erfahrung verfügten wir wohl, nur ihre Bedeutung kannten wir nicht. Jedenfalls nicht, bis etwas geschah, was uns in einen Zustand erhabener Erkenntnis versetzte.
Als ich mich ein Jahr nach den Geschehnissen erstmals hinsetzte, um diesen Roman zu schreiben, stellte sich heraus, dass ich es nicht ertrug, mich noch einmal mit dieser Zeit zu befassen, mit den Menschen, die ich gekannt hatte, und mit den schrecklichen Dingen, die über uns hereingebrochen waren, insbesondere mit dem, was mir selbst widerfahren war. Tatsächlich verwarf ich die Idee zu dem Projekt fast augenblicklich, noch bevor ich auch nur ein Wort geschrieben hatte – ich war neunzehn. Selbst ohne einen Stift in die Hand zu nehmen oder mich an die Schreibmaschine zu setzen, erwies sich in jenem Moment schon die zarteste Erinnerung an das Geschehene als zu zermürbend, und ich befand mich an einem Punkt meines Lebens, an dem ich die zusätzliche Belastung nicht gebrauchen konnte, also zwang ich mich, diesen Zeitabschnitt zumindest eine Weile zu vergessen, und in jenem Augenblick fiel es mir nicht schwer, die Vergangenheit auszulöschen. Doch der Drang, das Buch zu schreiben, regte sich erneut, als ich New York verließ, wo ich mehr als zwanzig Jahre lang gelebt hatte – ich war fast unmittelbar nach meinem Abschluss vor dem Trauma meines letzten Highschooljahrs an die Ostküste geflohen –, und wieder nach Los Angeles zurückkehrte, wo die Ereignisse des Jahres 1981 stattgefunden hatten und wo ich mich stärker fühlte, mit einer größeren Entschlossenheit auf die Vergangenheit zurückblickte und glaubte, dem Schmerz des Erlebten standhalten und in den Traum eintreten zu können. Doch das erwies sich abermals als Irrtum, und nachdem ich ein paar Seiten mit Notizen zu den Ereignissen im Herbst 1981 zusammengetippt hatte und mich mit einer halben Flasche Ocho ausreichend betäubt zu haben glaubte, um weiterarbeiten zu können, die zitternden Hände vom Tequila beruhigt, befiel mich eine so heftige Panikattacke, dass ich mitten in der Nacht in der Notaufnahme des Cedars-Sinai landete. Um die Metapher der romantischen Liebe für den Schreibvorgang zu bemühen, hatte ich diesen Roman lieben wollen, und endlich schien er sich mir hinzugeben, und die Versuchung war so groß, doch als es zum Vollzug kommen sollte, war ich nicht in der Lage, mich in den Traum fallen zu lassen.
Um genauer zu sein, geschah das, als ich über den Trawler schrieb – einen Serienmörder, der das San Fernando Valley im Spätfrühling des Jahres 1980 heimzusuchen begann und im Sommer 1981 richtig in Erscheinung trat und der beängstigenderweise irgendwie mit uns in Verbindung stand – und in der Nacht, in der ich mit den Notizen begann, brach eine Woge so heftiger innerer Anspannung über mich herein, dass mich die Angst vor den Erinnerungen buchstäblich aufstöhnen ließ und ich zusammenbrach und den hinuntergestürzten Tequila auswürgte. Das im Nachttisch aufbewahrte Xanax war keine Hilfe – ich schluckte drei Tabletten, und mir war klar, dass die Wirkung nicht schnell genug einsetzen würde. Ich war mir in jenem Augenblick sicher: Ich würde sterben. Ich wählte den Notruf und sagte, ich hätte einen Herzinfarkt, dann verlor ich das Bewusstsein. Man konnte mich über meinen Festnetzanschluss – das war 2006, ich war zweiundvierzig und lebte allein – ausfindig machen, und ein erschrockener Portier des Hochhauses, in dem ich wohnte, brachte die Sanitäter in den zehnten Stock hinauf. Er öffnete ihnen die Wohnungstür, und sie fanden mich auf dem Boden des Schlafzimmers. Ich kam in einem Krankenwagen zu mir, der über den San Vicente Boulevard zum unweit von meiner Wohnung im Doheny Plaza gelegenen Cedars-Sinai raste, und nachdem man mich auf einer Liege in die Notaufnahme geschoben hatte und ich mich wieder erinnerte, was passiert war, schämte ich mich – die Wirkung des Xanax hatte eingesetzt, und ich war ruhig, und ich wusste, dass mir körperlich nichts fehlte. Ich wusste auch, dass die Panikattacke unmittelbar mit meinen Erinnerungen an den Trawler und insbesondere an Robert Mallory zusammenhing.
Ein Arzt untersuchte mich – mir schien nichts zu fehlen, aber man wollte mich über Nacht dabehalten, um eine Reihe von Tests inklusive eines MRT-Scans durchzuführen, und mein Hausarzt unterstützte den Vorschlag und erinnerte mich am Telefon daran, dass meine Krankenversicherung nahezu den gesamten Aufenthalt abdeckte. Aber ich musste nach Hause und verweigerte mich allen Tests, denn ich war mir sicher, dem Wahnsinn zu verfallen, wenn ich in jener Nacht im Cedars bliebe, weil ich wusste, was mir passiert war, hatte mit meinem Körper oder irgendeiner Krankheit, an der ich womöglich litt, nicht das Geringste zu tun. Es war nichts anderes als eine Reaktion auf die Erinnerungen, auf meine Vergangenheit und die Heraufbeschwörung jenes Schreckensjahres – auf Robert Mallory, auf den Trawler, auf Matt Kellner, Susan Reynolds, Thom Wright und Deborah Schaffer sowie den düsteren Tunnel, den ich als Siebzehnjähriger durchquerte.
Nach jener Nacht gab ich das Projekt auf und schrieb in den folgenden dreizehn Jahren stattdessen zwei andere Bücher, und erst 2020 fühlte ich mich wieder in der Lage, mit The Shards zu beginnen, oder The Shards hatte beschlossen, dass Bret so weit war, denn das Buch trat auf mich zu – nicht umgekehrt. Ich hatte mich dem Buch nicht genähert, weil ich so viele Jahre lang versucht hatte, mich von dem Traum, von Robert Mallory, von jenem Abschlussjahr auf der Buckley fernzuhalten; so viele Jahrzehnte hatte ich damit verbracht, mich vom Trawler und von Susan, Thom, Deborah und Ryan fernzuhalten und von dem, was Matt Kellner widerfahren war; ich hatte diese Geschichte in die finsterste Schrankecke verbannt, und diese Verdrängung hatte viele Jahre lang gut funktioniert – ich schenkte dem Buch weniger Aufmerksamkeit, und es hörte auf, nach mir zu rufen. Doch irgendwann im Jahr 2019 begann es wieder in mir aufzusteigen, von einem Eigenleben erfüllt, wollte sich mit mir vereinigen, sich so nachdrücklich in meinem Bewusstsein ausbreiten, dass ich es nicht mehr ignorieren konnte – der Versuch, es zu ignorieren, lenkte mich von allem anderen ab. Zur selben Zeit hatte ich aufgehört, Drehbücher zu schreiben, hatte an einem bestimmten Punkt beschlossen, dieses Spiel, bei dem ich zehn Jahre lang großzügige Abfindungen für TV-Piloten und Filmdrehbücher erhalten hatte, die zum größten Teil nie produziert worden waren, nicht mehr weiterzutreiben, und ich fragte mich kurz, ob es zwischen dem Umstand, dass das Buch mich lockte, und diesem neuen Desinteresse am Schreiben für Hollywood einen Zusammenhang gab. Es spielte keine Rolle: Ich musste das Buch schreiben, weil ich mit dem Geschehen abschließen musste – es war endlich an der Zeit.
Mein neu erwachtes Interesse an dem Roman entsprang einem kurzen Augenblick, Jahre nachdem mich jene Panikattacke ins Cedars befördert hatte. Ich sah eine Frau – ich wollte zuerst »ein Mädchen« schreiben, aber das war sie nicht mehr; sie war eine Frau in ihren Fünfzigern, in meinem Alter – an der Ecke Holloway Drive und La Cienega Boulevard in West Hollywood. Sie stand auf dem Bürgersteig vor dem Palihouse Hotel, eine Sonnenbrille auf der Nase, ein Handy ans Ohr gedrückt, und wartete auf ihren Wagen, und obwohl es sich um eine deutlich ältere Version des Mädchens handelte, das ich auf der Highschool gekannt hatte, war sie es ohne jeden Zweifel. Ich war mir sicher, obwohl ich sie seit fast vierzig Jahren nicht gesehen hatte: Sie war noch immer auf eine völlig unangestrengte Weise schön. Ich war gerade nach links in den Holloway Drive eingebogen und hatte im dichten Verkehr anhalten müssen, als ich die Gestalt unter dem Schirm des Parkdiensts bemerkte – sie stand vielleicht sechs Meter von mir entfernt. Statt freudige Überraschung beim Anblick einer alten Freundin zu empfinden, umhüllte mich augenblicklich ein Laken aus Furcht – mir wurde eiskalt, und ich erstarrte. Als ich diese Frau in Fleisch und Blut vor mir sah, kehrte die Angst zurück, und sie verschlang alles – so wie im Jahr 1981. Die Frau rief mir in Erinnerung, dass alles real gewesen war, dass sich der Traum wirklich ereignet hatte, dass wir, auch wenn unsere letzte Begegnung vier Jahrzehnte zurücklag, noch immer durch die Ereignisse in jenem Herbst des Jahres 1981 miteinander verbunden waren.
Ich hielt nicht unvermittelt am Rand des Holloway Drive nahe der Einfahrt zum Parkhaus der CVS-Filiale gegenüber dem Palihouse, um die Frau auf mich aufmerksam zu machen, weder tat ich lautstark meine Überraschung kund, noch stieg ich aus dem Auto, um sie zu umarmen und staunend zu rufen, wie schön sie noch immer sei – ich hatte jeglichen Kontakt mit den Mitschülern aus meiner Abschlussklasse in den sozialen Medien erfolgreich vermieden, und nur wenige hatten sich mit mir in Verbindung gesetzt, meist in den Wochen nach der Veröffentlichung eines Buches. Stattdessen starrte ich nur durch die Windschutzscheibe meines BMW, während sie auf dem menschenleeren Bürgersteig stand, das Telefon ans Ohr gedrückt, und ihrem Gesprächspartner wortlos zuhörte, und auch wenn sie eine Sonnenbrille trug, hatte ihre Haltung etwas Ruheloses an sich, oder vielleicht bildete ich mir das auch nur ein – vielleicht ging es ihr gut, vielleicht war sie mit allem im Reinen, hatte verarbeitet, was ihr im Herbst 1981 geschehen war, die schreckliche Verletzung, die sie erlitten, die fürchterliche Entdeckung, die sie gemacht, die Verluste, die sie erfahren hatte. Ich war mit Todd, den ich im Jahr 2010 kennengelernt hatte und der seit neun Jahren mit mir zusammenlebte, auf dem Weg nach Palm Springs, wo wir eine Woche mit einem Freund verbringen wollten, der mit dem Flugzeug aus New York kam und ein Haus am Rand der Movie Colony in Palm Springs gemietet hatte, um anschließend nach San Diego weiterzureisen und dort an einer Reihe von Konferenzen teilzunehmen. Ich hatte mich mit Todd unterhalten, als ich die Frau vor dem Palihouse stehen sah, und verstummte mitten im Satz. Hinter mir hupte plötzlich ein Auto, und als ich in den Rückspiegel schaute, wurde mir bewusst, dass die Ampel auf Grün geschaltet hatte und ich nicht weiterfuhr. »Was ist denn?«, fragte Todd, als ich zu abrupt anfuhr und über den Holloway Drive in Richtung Santa Monica Boulevard schlingerte. Ich schluckte und versuchte völlig neutral zu klingen, als ich wie betäubt sagte: »Ich kannte das Mädchen dort …«
Natürlich war sie kein Mädchen mehr – wie gesagt, sie war fast fünfundfünfzig, genau wie ich –, aber so hatte ich sie gekannt: als Mädchen. Es spielte keine Rolle. Todd fragte nur: »Welches Mädchen?«, und ich machte eine flüchtige, fahrige Handbewegung – »Ach, da vor dem Palihouse.« Todd reckte den Hals, sah aber niemanden – sie war schon fort. Er zuckte mit den Schultern und schaute wieder auf sein Telefon. Mir wurde bewusst, dass das Satellitenradio auf den Sender Totally 80s eingestellt war und gerade der Refrain von »Vienna« von Ultravox lief – It means nothing to me, schrie der Sänger heraus, this means nothing to me –, während die Angst weiter voranwirbelte, eine Variante jener Angst aus dem Herbst 1981, als wir diesen Song gegen Ende jeder Party aufgelegt und ihm auf jedem selbst zusammengestellten Mixtape einen prominenten Platz zugeteilt hatten. Während ich mich an jenem Dezembertag von dem Lied in die Vergangenheit zurückversetzen ließ, glaubte ich, ich hätte mir das Rüstzeug angeeignet, um mit dem fertigzuwerden, was sich in meinem achtzehnten Lebensjahr ereignet hatte, ja ich war sogar so naiv und töricht zu glauben, ich hätte meine traumatischen Erfahrungen mithilfe der viele Jahre später, in meinen Zwanzigern und Dreißigern und bis in meine Vierziger hinein veröffentlichten Bücher bewältigt, doch dieses ganz bestimmte Trauma brach nun wieder über mich herein und führte mir vor Augen, dass es offensichtlich ein Irrtum war zu glauben, ich hätte irgendetwas aus eigener Kraft bewältigt, ohne es in einem Roman beichten zu müssen.
Während der Woche in der Wüste konnte ich nicht schlafen – selbst bei regelmäßiger Einnahme von Benzodiazepinen brachte ich es pro Nacht vielleicht auf zwei Stunden. Selbst wenn ich mich mit dem Xanax, von dem ich die Überdosis genommen hatte, außer Gefecht setzen konnte, verhinderten die schwarzen Träume, dass ich mehr als eine oder zwei Stunden schlief, und dann lag ich erschöpft im Schlafzimmer des Hauses am Azure Court und kämpfte gegen die wachsende Panik an, die mit dem Anblick des Mädchens zusammenhing. Die Midlife-Crisis, die nach jener Nacht im Jahr 2006 eingesetzt hatte, als ich über unsere Erlebnisse während des Abschlussjahrs auf der Buckley zu schreiben versuchte, kam nach knapp sieben Jahren – sieben Jahren in einem Fiebertraum, in dem die frei flottierende Angst all meine Bekannten verprellte und ich durch die damit verbundene Belastung zwanzig Kilo abnahm – zum Ende, nach und nach überwunden mithilfe eines Therapeuten, einer Art Life-Coach, den ich ein Jahr lang pflichtschuldig einmal pro Woche in einer Praxis am nur einen Block vom Freeway 405 entfernten Sawtelle Boulevard aufgesucht hatte und der es von dem halben Dutzend Psychiater, bei denen ich gewesen war, als Einziger nicht mit der Angst zu tun bekam, wenn ich zu erzählen anfing. Die vorherigen fünf Therapeuten hatten mir erklärt, ich müsse den Schrecken, der mir, der uns widerfahren war, abmildern und die Erzählung so abwandeln, dass sie leichter verdaulich wurde, um einen ungestörten Verlauf der Sitzung zu ermöglichen.
Ich hatte endlich eine längerfristige Beziehung, und die unbedeutenden Probleme, die nie wirklich lebensbedrohlich gewesen waren – Abhängigkeit, Depression –, stahlen sich davon. Diejenigen, die in den letzten sieben Jahren, in denen ich derart ausgezehrt und wütend gewesen war, einen Bogen um mich gemacht hatten, erschienen verwirrt, wenn sie dem neuen Bret in einem Restaurant oder bei einer Filmvorführung über den Weg liefen und sahen, dass ich nicht mehr so panisch und durchgedreht war wie zuvor. Und das Image des Fürsten der Finsternis, das ich in den Augen der Leser als Schriftsteller stets verkörpert hatte, verflüchtigte sich jetzt, und an seine Stelle trat ein sonnigeres Gemüt – der Mann, der American Psycho geschrieben hatte, war zur Überraschung so mancher nur ein netter, womöglich sogar liebenswerter, leicht abgewrackter Typ und nicht einmal annähernd der verantwortungslose Nihilist, für den mich so viele gehalten hatten, ein Ruf, zu dem ich vielleicht selbst beigetragen hatte. Aber es war nie eine bewusst eingenommene Pose gewesen.
Sie stand gegenüber einer CVS-Drogerie, die vor Jahrzehnten einmal eine New-Wave-Rollschuhdisco namens Flipper’s gewesen war, an der Straße, und während wir stadtauswärts in Richtung Palm Springs fuhren, ließ mich der Anblick der Frau an meinen letzten Besuch im Flipper’s im Frühjahr 1981 zurückdenken, bevor Robert Mallory im darauffolgenden September aufgetaucht und alles anders geworden war. Ich war mit Thom Wright und zwei anderen aus unserer Klasse, Jeff Taylor und Kyle Colson, dort gewesen – vier siebzehnjährige Highschool-Schüler im Rolls-Royce-Cabrio eines etwas anrüchigen, aber harmlosen schwulen Trickbetrügers Anfang vierzig namens Ron Levin, mit dem Jeff Taylor uns bekannt gemacht hatte, alle ein bisschen aufgedreht von dem Kokain, das wir zuvor in Rons Wohnung in Beverly Hills genommen hatten. Es war ein Abend unter der Woche, mitten im elften Schuljahr, und was das über unsere Jugend aussagt, ist wohl Ansichtssache. Es könnte ebenfalls einen gewissen Aufschluss über unsere Welt geben, dass Jeff, ein gut aussehender Surfer und nach Thom Wright der Zweit- oder Dritthübscheste in unserer Klasse, Ron Levin gegen Geld kleinere sexuelle Gefälligkeiten erwies, obwohl Jeff nicht schwul war; das Geld floss größtenteils in ein neues Surfbrett, Komponenten für die Stereoanlage und die Tasche eines Grasdealers aus Zuma.
Es könnte weiterhin Aufschluss über unsere Welt geben, dass Ron Levin ein paar Jahre später von zwei Mitgliedern des sogenannten Billionaire Boys Club ermordet wurde, einem Investmentkollektiv und Gesellschaftsverein, dem viele angehörten, die wir flüchtig aus der Privatschulszene von Los Angeles kannten, Typen, die auf die Harvard School for Boys gingen, neben der Buckley School eine der renommiertesten Privatschulen in Los Angeles, und in der mehr oder weniger exklusiven Welt der Prep-Schools kannten sich die Schüler beider Einrichtungen oft untereinander. Später, auf dem Bennington College, lernte ich den Gründer des Billionaire Boys Club, einen Typen in meinem Alter namens Joe Hunt, während der vorlesungsfreien Zeit im Winter bei einem informellen Dinner mit ein paar Freunden im La Scala Boutique in Beverly Hills kennen, nur Wochen bevor er Ron Levin vom Sicherheitschef des BBC ermorden ließ, und nichts an dem großen, gut aussehenden Joe Hunt deutete im Entferntesten darauf hin, dass er zu den Verbrechen fähig war, für die er später ins Gefängnis kam.
Ich schweife ab, denn was uns in jenem Herbst 1981 widerfuhr, hatte nichts mit dem Billionaire Boys Club, mit Joe Levin oder Joe Hunt zu tun. Dieser Abschnitt sollte nur verdeutlichen, in welche Richtung sich unsere Welt während jener Hochphase des Empire bewegte, und als »das mit dem Billionaire Boys Club« 1983 passierte, war »das mit uns« längst vorbei, und vielleicht öffnete die zwanglos hedonistische Welt der Erwachsenen, der wir so eifrig entgegenstrebten, eine Tür, die Robert Mallory und dem Trawler und den Geschehnissen in jenem Herbst Eintritt gewährte – mir zumindest erschien es später wie eine Einladung, die wir gedankenlos aussprachen, ohne in irgendeiner Weise zu ahnen, welchen Preis wir schließlich dafür bezahlen würden.
An jenem Frühlingsabend rückte das Flipper’s immer näher, während wir in Ron Levins Rolls-Royce-Cabrio von Beverly Hills kommend auf dem La Cienega Boulevard in Richtung West Hollywood fuhren und Donna Summers »Dim All the Lights« vom Achtspurband des Bad-Girls-Albums aus den Autolautsprechern drang. Ron saß am Steuer, Jeff auf dem Beifahrersitz und ich mit Kyle und Thom hinten, aber zwischen den beiden eingequetscht konnte ich sehen, dass Rons Hand auf Jeffs Oberschenkel lag und wie Jeff Rons Hand dann sanft wegschob, ohne ihn anzusehen. Thom hatte sich zur Seite gebeugt und sah es auch, nachdem ich ihn angestupst hatte, und er warf mir einen Blick zu, verdrehte die Augen und zuckte mit den Schultern: Was soll’s. Hieß das Schulterzucken, dass das alles keine große Sache war?, fragte ich mich hoffnungsvoll, während ich Thom Wrights Blick erwiderte. Aber es war uns wirklich egal: Wir waren high und jung, und es war ein warmer Frühlingsabend, und wir waren auf dem Weg in die Welt der Erwachsenen – alles andere spielte keine Rolle. Dieser Abend des Jahres 1981 ging einem friedlichen und schönen Sommer in L.A. voraus – dem Sommer, bevor der Schrecken begann, auch wenn wir feststellen sollten, dass er eigentlich vor jenem Sommer begonnen hatte, bereits in uns nicht bewusster Art und Weise Form angenommen hatte – und im Rückblick erscheint mir jener Abend, von dem mir nur wenige Einzelheiten in Erinnerung geblieben sind, als einer der letzten unschuldigen Abende meines Lebens, obwohl wir dort eigentlich gar nichts zu suchen hatten, minderjährig und ein bisschen high vom Kokain und mit einem deutlich älteren Schwulen, der drei Jahre später von einem Privatschüler wie wir ermordet werden sollte.
Ans Rollschuhfahren erinnere ich mich nicht, aber ich erinnere mich, in einer Sitznische Champagner getrunken zu haben, während der Xanadu-Soundtrack aus den Boxen schallte, und ich erinnere mich, dass wir zu Rons Wohnung in Beverly Hills zurückfuhren und dass Ron beiläufig mit Jeff im Schlafzimmer verschwand – er wolle Jeff die neue Rolex zeigen, die er sich gerade gekauft habe. Kyle fuhr zurück ins Haus seiner Eltern in Brentwood, und Thom und ich zogen noch ein bisschen Koks und legten Musik auf (und an die Platten des Abends erinnere ich mich: Duran Duran, Billy Idol, Squeeze), ehe ich ging und Thom auf Jeff wartete, und als Ron eingeschlafen war, brachen die beiden zum Haus von Jeffs Vater in Malibu auf, wo sie die Nacht durchmachten und das halbe Gramm vernichteten, das Jeff von Ron bekommen hatte, und bei Dämmerung gingen sie in ihren Neopren-Anzügen zum Strand, um auf den Wellen zu surfen, die sich im Morgennebel am Ufer brachen, ehe sie ihre Schuluniformen anzogen und sich auf die lange Fahrt zur Buckley machten, den Sunset Boulevard entlang bis zum Beverly Glen Boulevard und dann über den Hügel nach Sherman Oaks. Ich war schon vor Stunden durch die Canyons zum Haus meiner Eltern am Mulholland Drive gefahren, wo ich eine Valium nahm, die ich in einer Gucci-Pillendose fand – die Dose hatte ich mit fünfzehn von Susan Reynolds zu Weihnachten bekommen, vielleicht ein weiterer Hinweis darauf, wie es um uns stand –, und in einen ruhigen, traumlosen Schlaf fiel.
Wir waren mit sechzehn so eigenständig, aber es fühlte sich nie an, als würde uns das in unserer Entwicklung als Jugendliche beeinträchtigen, da man mit der Woche, in der man in L.A. den Führerschein machte, zum Erwachsenen wurde. Ich weiß noch, dass Jeff Taylor als Erster ein Auto hatte und wie er an einem Abend unter der Woche Thom Wright in Beverly Hills abholte und dann am Mulholland Drive vorbeikam, um mich aufzulesen, und wie wir dann nach Hollywood fuhren, während Billy Joels »You May Be Right« vom Achtspurband des Albums Glass Houses aus den Lautsprechern dröhnte, und uns im verwaisten Cinerama Dome eine Spätvorstellung von Saturn-City ansahen – das war im Februar 1980. An den Film – einen nicht jugendfreien Science-Fiction-Streifen mit Farrah Fawcett – erinnere ich mich nicht, nur an die Freiheit, allein unterwegs zu sein, außerhalb der Reichweite irgendwelcher Erziehungsberechtigter. Es war das erste Mal, dass wir allein losgefahren waren, um uns eine Zehn-Uhr-Vorstellung anzusehen, und ich weiß noch, wie wir auf dem weitläufigen Parkplatz des Cinerama Dome mitten im menschenleeren Hollywood herumhingen, während es auf Mitternacht zuging, und uns einen Joint teilten, die ganze Zukunft vor uns ausgebreitet.
Als ich den Führerschein hatte, kam es zum Beispiel vor, dass ich nach einem kurzen Blick auf meine Hausaufgaben an einem Mittwochabend um sieben beschloss, vom Mulholland Drive nach West Hollywood zu fahren, um mir den ersten Auftritt der Psychedelic Furs im Whisky anzusehen, und da ich mittwochabends häufiger ausging, verzichtete ich darauf, meine Mutter um Erlaubnis zu fragen (meine Eltern lebten 1980 schon getrennt). Ich sagte nur Bescheid, dass ich gegen Mitternacht zurück sein würde, huschte aus dem Haus, fuhr zur Musik der Missing Persons oder der Doors durch die verwaisten Canyons, stellte das Auto auf einem Parkplatz direkt am Sunset Boulevard ab und drückte dem Parkplatzwächter in der North Clark Street fünf Dollar in die Hand. Mit einem gefälschten Ausweis kam ich problemlos ins Whisky (an manchen Abenden wurde ich nicht einmal kontrolliert), und in der Disco fragte ich den Rastafari an der Bar, ob er wisse, wo ich etwas Koks bekommen könne, und der Rastafari zeigte für gewöhnlich auf einen jungen Typen mit platinblondem Haar im hinteren Teil des Raums; ich ging hin, gab ihm ein Zeichen und steckte ihm ein Bündel gefalteter Geldscheine zu, um mir anschließend einen Whiskey Sour zu bestellen, meinen bevorzugten Drink zu Highschool-Zeiten, und auf ihn zu warten, während er im Geschäftsführerbüro verschwand und mir dann ein kleines Tütchen brachte. Hinterher fuhr ich die Canyons hinauf und rollte dann den Mulholland Drive entlang – alles war verlassen, ich war high und rauchte eine Nelkenzigarette – und den Laurel Canyon hinunter und an den Wohnvierteln vorbei, die sich von oben an den Ventura Boulevard schmiegten: Ich begann in Studio City und glitt dann in der Dunkelheit langsam auf dem Valley Vista Boulevard durch Sherman Oaks bis nach Encino und dann weiter nach Tarzana, fuhr einfach nur träge an den dunklen Häusern vorbei, die die Vorortsiedlungen säumten, und hörte die Kinks, bis es Zeit war, mich wieder auf den Weg hinauf zum Mulholland Drive zu machen. Ich nahm entweder den Ventura Boulevard oder den Freeway 101, bog dann am Van Nuys Boulevard ab und fuhr den Beverly Glen Boulevard hoch, und manchmal sah ich auf dem Weg nach Hause die Augen der Kojoten im Scheinwerferlicht grün aufblitzen, die zum Mercedes herüberblickten, während sie – manchmal im Rudel – über den Mulholland Drive trotteten, und dann musste ich anhalten und sie über die Straße lassen. Und egal wie spät es wurde, am nächsten Morgen bog ich immer auf den Buckley-Parkplatz ein, in tadelloser Uniform, mehrere Minuten vor der ersten Unterrichtsstunde, nie verkatert oder müde, immer nur angenehm beduselt.
Waren Frühling und Sommer 1981 ein Traum gewesen, etwas Paradiesisches, dann stellte der September mit der Ankunft Robert Mallorys das Ende dieses Traums dar – es fühlte sich nun an, als würde sich etwas anderes ankündigen, dunkle Muster kamen allmählich zum Vorschein, und wir nahmen gewisse Dinge zum ersten Mal wahr: Ein Rufsignal, das wir noch nie vernommen hatten, schallte zu uns herüber. Ich will das Erscheinen von Robert Mallory im September 1981 nach diesem paradiesischen Sommer nicht unmittelbar mit bestimmten Ereignissen in Verbindung bringen, aber es fiel tatsächlich mit einer Art Wahnsinn zusammen, der sich langsam über die Stadt senkte. Es war, als würde sich eine andere Welt einstellen und die, die wir alle für so selbstverständlich gehalten hatten, in eine dunklere Farbe tauchen.
Beispielsweise wurden zu dieser Zeit Häuser in bestimmten Vierteln plötzlich von Anhängern einer Sekte beschattet, deren Absichten schwer festzustellen waren; der bleiche Hippie am Fuß der Einfahrt ging murmelnd auf und ab, seine Schritte immer wieder unterbrochen von einem kurzen schlurfenden Tanz, und im Dezember dann hatte die Sekte, der die Hippies angehörten, an verschiedenen Orten überall in der Stadt Plastiksprengstoff deponiert. Am Abend vor Thanksgiving erschien plötzlich ein Scharfschütze auf dem Dach eines Kaufhauses in Beverly Hills, und das Restaurant Chasen’s wurde an Heiligabend aufgrund einer Bombendrohung geräumt. Plötzlich wussten wir von einem Teenager aus Pacific Palisades, der sich eingeredet hatte, von einem »satanischen Dämon« besessen zu sein, und von dem aufwendigen Exorzismus, durch den zwei Priester den Jungen von dem Dämon befreien wollten, was diesen beinahe umbrachte – der Junge blutete aus den Augen und wurde auf einem Ohr taub, bekam eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, und ihm wurden bei dem Ritual vier Rippen gebrochen. Plötzlich war da der UCLA-Student, der bei einer, wie es ein Zeuge vorsichtig formulierte, »irgendwie aus dem Ruder gelaufenen« Verbindungs-Party von fünf mit PCP zugedröhnten Kommilitonen aus Spaß lebendig begraben worden war und um ein Haar nicht überlebt hätte und der nun in einem verdunkelten Raum in einem der Gebäude am Medical Plaza im Koma lag. Da war plötzlich der überall in der Stadt auftretende Spinnenbefall. Die abstruseste Geschichte in jenem Herbst handelte von einer Mutation, einem Monster, einem Fisch von der Größe eines Kleinwagens, den man an der Küste von Malibu aus dem Meer gezogen hatte – seine Haut war grauweiß und mit großen Flecken silbrig-oranger Schuppen überzogen, und auch wenn das Ding die Kiefer eines Hais hatte, war es eindeutig keiner, und als es von Fischern aus dem Ort ausgenommen wurde, fanden sie die im Ganzen verschlungenen Körper zweier vermisster Hunde.
Und dann war natürlich noch der Trawler auf der Bildfläche erschienen.
Seit ungefähr einem Jahr hatte es immer wieder Einbrüche mit tätlichen Angriffen gegeben, dann war es zu Entführungen gekommen, und 1981 – nachdem man bereits 1980 ein totes Mädchen im Teenageralter gefunden hatte – wurde dann die Leiche eines zweiten vermissten Mädchens entdeckt und schließlich mit den Hauseinbrüchen in Verbindung gebracht. All das wäre vielleicht auch ohne Robert Mallorys Anwesenheit geschehen, aber dass sein Auftauchen mit der seltsamen Dunkelheit zusammenfiel, die sich sanft in unser Leben zu winden begann, konnte ich nicht ignorieren, auch wenn andere es auf eigene Gefahr taten. Ob es Unglück war oder nur unglückliches Timing, diese Ereignisse hingen schlicht miteinander zusammen, und auch wenn Robert Mallory nicht der Scharfschütze auf dem Dach der Neiman-Marcus-Filiale oder der Anrufer war, wegen dem das Chasen’s geräumt wurde, und auch wenn er nicht mit dem gewaltsamen Exorzismus in Pacific Palisades in Verbindung stand und nicht einmal in der Nähe des Verbindungshauses in Westwood gewesen war, wo sie den Anwärter in ein offenes Grab geworfen hatten, hing seine Anwesenheit für mich mit all diesen Dingen zusammen; jede Horrorgeschichte, die wir in jenem Herbst hörten, alles, was unsere Blase auf zuvor nie bemerkte Arten verfinsterte, führte zu ihm.
Vor einer Woche habe ich auf einer Website namens Classmates.com für neunundneunzig Dollar ein Faksimile des Buckley-Jahrbuchs von 1982 bestellt, und vier Tage später wurde es per FedEx in die Wohnung am Doheny Drive geliefert, und als es ankam, fiel mir wieder ein, warum ich kein Exemplar besaß: Ich hatte nicht daran erinnert werden wollen, was mir und den Freunden, die wir verloren hatten, zugestoßen war. Unser Jahrbuch trug den Titel Images, und diese Ausgabe war unter der Leitung einer Mitschülerin zusammengestellt worden, die später eine bekannte Hollywood-Produzentin geworden war, und sie hatte das Jahr 1982 unter das Motto »Film« gestellt: Im ganzen Buch waren Standbilder aus Filmen verteilt, die von Vom Winde verweht bis zu Eine ganz normale Familie reichten, was im Nachhinein angesichts der Geschehnisse beinahe grausam leichtfertig und sorglos erschien, so als wollte man einer Totenmaske mit Lippenstift ein Lächeln aufdrücken. Während ich langsam durch den Abschnitt der Abschlussklasse blätterte, in dem jeder von uns auf einer eigenen Seite in Erinnerungen schwelgen, sich bei seinen Eltern bedanken und Fotos von Freunden oder Zitate hinzufügen konnte, um die Seite so zu gestalten, dass sie das widerspiegelte, wofür wir uns mit achtzehn hielten, eine Idealversion von uns, wurde mir quälend bewusst, dass von den sechzig Schülern dieses Abschlussjahrgangs 1982 fünf fehlten – die fünf, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht geschafft hatten –, und diese Tatsache war schlicht unausweichlich: Ich konnte sie nicht wegträumen oder die Wahrheit verleugnen. Wir waren alphabetisch aufgelistet, und nach einem Schluck Gin aus dem Tumblerglas schlug ich das Buch zaghaft an den jeweiligen Stellen auf, an denen sie sich innerhalb dieser sechzig Seiten hätten befinden müssen, und stellte fest, dass sie schlicht nicht da waren – in jener ersten Septemberwoche hatten sie alle existiert, doch nun waren sie ausgelöscht. Drei von ihnen waren stattdessen in dem mit »In Memoriam« überschriebenen Abschnitt am Schluss des Buches aufgeführt.
Herbst 1981
1
Ich weiß noch, dass es der Sonntagnachmittag vor dem Labor Day 1981 war und unser letztes Schuljahr am Morgen des darauffolgenden Dienstag, dem 8. September, beginnen sollte – und ich weiß noch, dass sich die Windover-Stallungen an einem Steilufer über Malibu befanden, wo Deborah Schaffer ihr neues Pferd Spirit in einer der zwanzig Einzelboxen eingestellt hatte, und ich weiß noch, dass ich auf dem Pacific Coast Highway allein hinter Susan Reynolds und Thom Wright herfuhr, die in Thoms Corvette saßen, während neben uns der Ozean schwach in der feuchten Luft schimmerte, bis wir an die Ausfahrt zu den Stallungen kamen, und ich weiß noch, dass ich die Cars hörte, der Song war »Dangerous Type« – auf dem Mixtape waren auch noch Blondie, die Babys und Duran Duran –, als ich Thoms Wagen die kurvenreiche Straße hinauf zum Eingang der Stallungen folgte, wo wir neben Deborahs funkelndem, brandneuem BMW hielten, an jenem Sonntag der einzige Wagen auf dem Parkplatz, und uns dann am Empfang meldeten und anschließend einen baumgesäumten Pfad entlanggingen, bis wir Debbie fanden, die Spirit am Zügel um eine mit einem Tor versehene leere Reitbahn herumführte – sie war schon geritten, aber der Sattel lag noch auf, und sie trug ihre Reiterkluft. Der Anblick des Pferdes erschreckte mich – und ich weiß noch, dass mich seine Gegenwart in der spätnachmittäglichen Hitze erzittern ließ. Spirit war der Ersatz für ein Pferd, das Debbie im Juni in den Ruhestand geschickt hatte.
»Hey«, sagte Debbie in ihrem ausdruckslosen, gleichförmigen Tonfall. Ich weiß noch, wie dumpf es in der uns umgebenden Leere klang – ein gedämpftes Echo. Hinter den gepflegten, weiß und kieferngrün gestrichenen Ställen lag ein Wald, der den Blick auf den Pazifik versperrte – man konnte kleine Flecken von glasigem Blau sehen, aber alles wirkte versteckt und reglos, nichts rührte sich, so als wären wir unter einer Art Plastikkuppel eingeschlossen. Ich weiß noch, dass es an jenem Tag sehr heiß war, und es kam mir vor, als wäre ich irgendwie zu diesem Stallbesuch gezwungen worden, einfach nur weil Debbie seit jenem Sommer meine Freundin war und es von mir verlangt wurde, statt dass ich es aus freien Stücken getan hätte. Aber ich hatte mich gefügt: Ich wäre vielleicht gern zu Hause geblieben, um an dem Roman zu arbeiten, den ich schrieb, aber mit siebzehn wollte ich auch einen gewissen Schein wahren.
Ich weiß noch, dass Thom »Wow« sagte, als er auf das Pferd zuging, und wie immer bei Thom hätte es aufrichtig klingen können, wäre es nicht wie Debbies Tonfall ausdruckslos gewesen, so als hätte er keine richtige Meinung: Alles war cool, alles war locker, alles war ein verhaltenes Wow. Susan murmelte zustimmend und nahm die Wayfarer-Sonnenbrille ab.
»Na, mein Hübscher«, sagte Debbie und drückte mir einen Kuss auf die Wange.
Ich weiß noch, dass ich das Tier bewundernd anzustarren versuchte, aber eigentlich wollte ich mich davon nicht beeindrucken lassen – und doch war es so groß und lebendig, dass es mich erschütterte. Aus der Nähe betrachtet, wirkte es schon ziemlich prächtig, und es beeindruckte mich auf jeden Fall – es wirkte einfach so gewaltig und schien nur aus Muskeln zu bestehen, eine Bedrohung – Es könnte dich verletzen, dachte ich –, aber tatsächlich war es ruhig und hatte in diesem Augenblick nichts dagegen, dass wir ihm die Flanken streichelten. Ich weiß noch, wie mir bewusst wurde, dass Spirit nur ein weiteres Beispiel für Debbies Reichtum und ihre damit verflochtene Achtlosigkeit war: Die Versorgung und Unterbringung des Tieres würde astronomische Summen verschlingen, obwohl niemand wusste, wie groß ihr Interesse mit siebzehn wirklich war und ob dieses Interesse anhalten würde. Doch das war ein weiterer Aspekt von Debbie, den ich nicht gekannt hatte, auch wenn wir seit der fünften Klasse gemeinsam zur Schule gingen – ich hatte vorher nicht darauf geachtet: Ich fand heraus, dass sie sich immer schon für Pferde interessiert hatte, obwohl ich bis zum Sommer vor unserem Abschlussjahr, als wir zusammenkamen und ich die mit Preisschleifen, Pokalen und Fotos von Debbie bei verschiedenen Reitturnieren vollgestellten Regale sah, keine Ahnung davon gehabt hatte. Ich hatte mich stets eher für ihren Vater Terry Schaffer als für Debbie selbst interessiert. Im Jahr 1981 war Terry Schaffer neununddreißig und schon äußerst wohlhabend; den Großteil seines Vermögens hatte er mit einer Handvoll Filme verdient, die – in zwei Fällen unerklärlicherweise – Kassenschlager geworden waren, und er war einer der meistgeschätzten und gefragtesten Produzenten der Stadt. Er hatte Geschmack oder zumindest das, was man in Hollywood für Geschmack hielt – er war zweimal für den Oscar nominiert worden –, und ihm wurde ständig die Leitung irgendwelcher Studios angeboten, woran er aber keinerlei Interesse hatte. Terry war außerdem schwul – nicht offen, aber insgeheim –, und er war mit Liz Schaffer verheiratet, die in so vielen Privilegien und so viel Schmerz versunken war, dass ich mich fragte, ob sie überhaupt mitbekam, dass Terry schwul war. Deborah war ihr einziges Kind. Terry starb 1992.
Thom stellte Debbie allgemeine Fragen zu dem Pferd, und Susan schaute zu mir herüber und lächelte – ich verdrehte die Augen, nicht wegen Thom, sondern wegen der Belanglosigkeit des Ganzen. Susan sah mich an und verdrehte auch die Augen: Zwischen uns entstand eine Verbindung, die unsere jeweiligen Partner nicht mit einschloss. Nachdem wir das Pferd gestreichelt und bewundert hatten, schien es keinen Grund mehr zu geben, dort herumzustehen, und ich weiß noch, wie ich dachte: Dafür bin ich bis Malibu gefahren? Um Debbies blödes neues Pferd zu betrachten und zu streicheln? Und ich weiß noch, dass ich dastand und mir ein bisschen albern vorkam, was Thom und Susan sicherlich nicht so ging: Sie regten sich fast nie über etwas auf, nichts konnte Thom und Susan aus der Ruhe bringen, sie kamen mit allem klar, und dass Susan die Augen verdrehte, schien nur meiner Beschwichtigung zu dienen, aber ich war ihr dankbar. Debbie küsste mich sanft auf die Lippen.
»Kommst du nachher?«, fragte sie.
Ich war kurz durch das Geflüster zwischen Thom und Susan abgelenkt, bevor ich meine Aufmerksamkeit Debbie zuwandte. Mir fiel ein, dass Debbie für den Abend ein paar Leute zu sich nach Bel Air eingeladen hatte, und ich lächelte unbefangen, um sie zu beruhigen.
»Ja, logisch.«
Und dann gingen Thom und Susan und ich wie aufs Stichwort, als wäre das Ganze einstudiert, zu unseren Autos, während Debbie Spirit in seinen Stall führte, begleitet von einem Windover-Mitarbeiter in einer aus weißen Jeans und Windjacke bestehenden Uniform. Ich fuhr hinter Thom und Susan den Pacific Coast Highway entlang, und als sie nach links in den Sunset Boulevard einbogen, der uns vom Strand zum Eingang von East Gate Bel Air bringen würde, lief auf dem Mixtape ein Song, den ich mochte, was ich aber nie zugegeben hätte: REO Speedwagons »Time for Me to Fly«, eine rührselige Ballade über einen Verlierer, der seinen ganzen Mut zusammennimmt, um mit seiner Freundin Schluss zu machen, aber für mich als Siebzehnjährigen ging es in dem Lied um eine Metamorphose, und die Zeile I know it hurts to say goodbye, but it’s time to fly … bedeutete in jenem Frühling und Sommer 1981, als mir der Song ans Herz wuchs, etwas anderes. Sie handelte davon, eine Welt zu verlassen und in eine andere überzuwechseln, so wie ich es getan hatte. Und wenn ich mich an den Besuch im Stall erinnere, dann nicht, weil dort irgendetwas Besonderes passiert wäre, sondern weil es der Nachmittag war, auf den der Abend folgte, an dem wir erstmals den Namen eines neuen Schülers hörten, der in jenem Herbst auf die Buckley und in unsere Abschlussklasse wechseln würde: Robert Mallory.
Thom Wright und Susan Reynolds waren seit der zehnten Klasse ein Paar, und nach dem Abschluss von Katie Choi und Brad Foreman im Juni waren sie nicht nur die beliebtesten Schüler unseres Jahrgangs, sondern der Buckley überhaupt, und die Gründe lagen auf der Hand: Thom und Susan waren auf eine beiläufige Art schön, durch und durch amerikanisch, dunkelblondes Haare, grüne Augen, immerwährende Bräune, und es folgte einer gewissen Logik, dass sie sich so unaufhaltsam zueinander hingezogen gefühlt hatten und überall als unzertrennliche Einheit auftraten – sie waren so gut wie immer zusammen. Beide entstammten wohlhabenden Familien aus Los Angeles, aber Thoms Eltern waren geschieden, und sein Vater war nach New York gezogen, und nur wenn Thom seinen Vater in Manhattan besuchte, war er nicht in Susans unmittelbarer Nähe. Sie waren ungefähr zwei Jahre lang ineinander verliebt, bis zum Herbst 1981, als einer von beiden nicht mehr verliebt war, was eine Reihe schrecklicher Ereignisse in Gang setzte. Ich war in beide vernarrt, gestand aber keinem von beiden, dass es in Wahrheit Liebe war.
Seit der siebten Klasse auf der Buckley war ich Susans engster männlicher Freund, und fünf Jahre später schien es mir, als wüsste ich alles über sie: wann sie ihre Tage bekam, die Probleme mit ihrer Mutter, jede vermeintliche Kränkung und Zurücksetzung, die sie zu erleiden glaubte, Schwärmereien für Mitschüler in der Zeit vor Thom. Sie ahnte, dass ich sie insgeheim liebte, aber auch wenn wir uns immer nahestanden, sagte sie nie etwas, neckte mich nur in bestimmten Momenten ein wenig, wenn ich ihr zu viel oder auch zu wenig Aufmerksamkeit schenkte. Ich fühlte mich geschmeichelt, wenn man uns für ein Paar hielt, und ich unternahm wenig gegen diesbezügliche Gerüchte, bis Thom auf der Bildfläche erschien. Susan Reynolds war das Idealbild des coolen SoCal-Girls, selbst mit dreizehn schon, Jahre bevor sie ein BMW-Cabrio fuhr und immer leicht bedröhnt war von Marihuana oder Valium oder einer halben Quaalude (aber immer im Rahmen – sie war eine Einser-Schülerin, ohne sich besonders anstrengen zu müssen) und frech ihre Wayfarer-Sonnenbrille trug, wenn sie durch die weiß verputzten Arkaden zum Unterricht ging, bis ihr irgendein Lehrer sagte, sie solle sie abnehmen – alle Buckley-Schüler schienen Designer-Sonnenbrillen zu besitzen, aber mit Ausnahme von Parkplatz und Sportplatz durften sie sie auf dem Campus nicht tragen. In der Mittelstufe – während der 1970er »Junior High« genannt – schien Susan mir alles anzuvertrauen, und auch wenn ich ihr nicht ganz mit der gleichen Offenheit begegnete, hatte ich doch so viel preisgegeben, dass sie Dinge über mich wusste, die sonst niemand wusste, aber nur innerhalb gewisser Grenzen. Manche Dinge hätte ich ihr niemals gesagt.
Susan Reynolds stieg Klasse für Klasse zur unbestrittenen Königin unseres Jahrgangs auf: Sie war schön, mondän, faszinierend unprätentiös, und noch bevor sie mit Thom zusammenkam, strahlte sie eine zwanglose Sexualität aus, nicht weil sie leicht zu haben gewesen wäre – sie hatte ihre Jungfräulichkeit an Thom verloren und seitdem auch mit niemand anderem geschlafen –, sondern weil Susans Schönheit stets unsere Vorstellung von ihrer Sexualität beflügelte. Thom verstärkte diesen Effekt noch, und Susans sexuelle Aura, die immer da gewesen war, wurde ausgeprägter, als sie zusammenkamen und alle wussten, dass sie miteinander vögelten; und selbst wenn sie am Anfang ihrer Beziehung, in den ersten Herbstwochen des Jahres 1979, noch nicht miteinander vögelten, sobald sie ein Paar wurden, lautete die Frage: Wie war es möglich, dass zwei derart gut aussehende Teenager nicht miteinander vögelten? Im September 1981 standen Susan und ich uns noch immer nah, und ich glaube, in gewisser Hinsicht fühlte sie sich mir näher als Thom – natürlich hatten wir eine andere Art von Beziehung –, aber es schien jetzt eine leichte Zurückhaltung zwischen uns zu herrschen, die nicht mit irgendetwas Bestimmtem zu tun hatte, es war eher ein allgemeines Unbehagen. Sie war seit zwei Jahren mit Thom zusammen, und ein vager, aber wahrnehmbarer Ennui hatte von ihr Besitz ergriffen. Die Eifersucht, die die beiden in mir geweckt hatten und an der ich fast zugrunde gegangen wäre, schien zu diesem Zeitpunkt, so dachte ich, allmählich zu verfliegen.
Thom Wright war wie Susan Reynolds in der siebten Klasse auf die Buckley gekommen; er war vorher auf der Horace Mann gewesen. Seine Eltern hatten sich scheiden lassen, als er in der Neunten war, und er wohnte bei seiner Mutter in Beverly Hills, während sein Vater nach New York gezogen war. Obgleich Thom immer hübsch gewesen war –, eindeutig der Hübscheste unseres Jahrgangs, geradezu bezaubernd – passierte im Sommer 1979, nachdem er den Juli und August bei seinem Vater verbracht hatte, irgendetwas mit ihm, was ihn auf irgendeine unerklärliche Weise zum Mann machte; in jenem Sommer hatte sich eine Art Metamorphose vollzogen, das Hübsche und Bezaubernde war verblasst, und wir sahen Thom mit anderen Augen – als wir ihn im September unseres Abschlussjahrs in der Schule wiedersahen, war er mit einem Mal ganz offiziell ein sexuelles Wesen. Ich hatte Thom immer auf diese Weise betrachtet, aber jetzt erkannten auch alle anderen, dass er gut gebaut war, seine Kieferpartie wirkte ausgeprägter, sein Haar war kürzer – das traf auf die meisten Jungen auf der Buckley zu (was vor allem an den Schulvorschriften lag), aber Thoms Haarschnitt war jetzt irgendwie stilvoll, ein Moment, ein Ausdruck seiner Männlichkeit –, und als ich in jener ersten Woche nach den Sommerferien im Umkleideraum, wo wir uns für den Sportunterricht umzogen (unsere Spinde befanden sich während der gesamten Schulzeit nebeneinander) einen Blick auf ihn warf, hielt ich kurz die Luft an, als ich sah, dass er offensichtlich Krafttraining betrieben hatte und seine Brust, seine Arme und sein Torso auf eine Weise definiert waren, wie es Ende Juni, als ich ihn auf einer Poolparty bei Anthony Matthews zuletzt in Badehose gesehen hatte, noch nicht der Fall gewesen war. Außerdem schockierte mich, wie sich die Blässe seiner nun muskulösen Schenkel- und Gesäßpartie – wo die Badehose während der in den Hamptons verbrachten Wochenenden die Haut vor der Sonne geschützt hatte – sich gegen den übrigen gebräunten Körper abzeichnete. Thom war zum Idealbild des gut aussehenden Teenagerjungen geworden, und was ihn so anziehend machte, war, dass es ihm gleichgültig zu sein schien, dass er es gar nicht zu bemerken schien, so als wäre es nur eine Gabe der Natur – er hatte kein Ego. Ich hatte mir mehrfach jede Hoffnung aus dem Kopf geschlagen, meine Gefühle für Thom Wright könnten je erwidert werden, weil er im Gegensatz zu mir auf eine sehr entschlossene Weise heterosexuell war.
Diese unausgereifte Schwärmerei für Thom war vielleicht in jenen ersten Wochen nach seiner Rückkehr aus New York wieder aufgelebt, aber dann war er plötzlich mit Susan zusammen, und als wir im Frühling darauf alle Autos hatten, wurden wir wie von selbst zu einer Art Dreigespann, trafen uns an den Wochenenden, fuhren zusammen nach Westwood ins Kino, lagen am Jonathan Beach Club in Santa Monica im Sand und lungerten in der Century City Mall herum, und meine Schwärmerei sowohl für Thom als auch für Susan war nun bedeutungslos. Nicht dass Thom es je bemerkt hätte; Susan dagegen war sich gewiss über meine Gefühle im Klaren und wusste, dass ich sie begehrte: Thom war in vielen Bereichen zugegebenermaßen eher unbedarft und hatte eine faszinierende Ausdruckslosigkeit an sich, die anziehend und tröstlich wirkte, es kam nie zu Spannungen, er war der Inbegriff der Gelassenheit, und dabei kiffte er nicht einmal. Am Ende der elften Klasse war Kokain die einzige Droge, die Thom mochte, aber immer nur ein, zwei Lines, mit ein paar Nasen schaffte er es durch jede Party, und er trank auch nicht, abgesehen von einem Corona hier und da. Er war so unkompliziert im Umgang und so offen für alles, dass ich mir, wenn ich davon träumte, mich an ihn heranzumachen, oft vorstellte, er ließe es geschehen, zumindest eine Zeit lang, ehe er meine Annäherungsversuche sanft zurückwies, aber nicht ohne einen Kuss und eine Hand, die vielversprechend meinen Oberschenkel drückte, um mir sinnlose Hoffnungen zu machen. In etwas ausgefeilteren Fantasien wies Thom meine sexuellen Avancen nicht zurück, und am Ende waren wir schweißgebadet, und in meinen Träumen war der Sex übertrieben intensiv, und hinterher, so stellte ich mir vor, küsste er mich innig, keuchend, leise lachend, erstaunt darüber, dass ich ihm Genuss bereitet hatte, wie Susan Reynolds es niemals gekonnt hätte.
Ich hatte nicht unbedingt vorgehabt, an jenem Nachmittag vor Thoms und Susans Augen von Debbie Schaffer geküsst zu werden, aber es hatte mir auch nichts ausgemacht. In gewisser Weise war sie ein Experiment – ich hatte es nicht darauf angelegt, in meinem Abschlussjahr auf der Buckley eine Freundin zu haben – von Susan Reynolds einmal abgesehen –, und doch war Debbie am Sommeranfang auf irgendeine unerklärliche Art genau das geworden. Wir waren auf einer anderen Party bei Anthony Matthews gewesen, und sie hatte einfach auf einer Liege am beleuchteten Pool mit mir zu knutschen begonnen. Ich war von einer Quaalode bedröhnt, sie war auf Koks, es war Mitternacht, aus dem Haus schallte »I Got You« von Split Enz herüber (… I don’t know why I sometimes get frightened …), und zu dieser Zeit hatte ich noch versucht, auf Mädchen zu stehen – das war noch nicht vorbei –, und sie schien alle Voraussetzungen zu erfüllen. Sie warf sich mir einfach an den Hals, und zu meiner eigenen Überraschung ließ ich mich darauf ein. Der äußere Schein bedeutete mir nichts – auch wenn ich mich definitiv nicht als bisexuell geoutet hatte und nicht vorhatte, irgendein Mädchen oder einen Jungen auf die falsche Fährte zu locken –, aber ich war auch ziemlich passiv, und was Debbie Schaffer anging, die ich seit der fünften Klasse kannte, machte ich in diesem Sommer alles mit, was sie wollte, und ich glaubte, sie könnte das aus Susan, Thom und mir bestehende Grüppchen abrunden, das Ganze weniger schmerzhaft für mich machen und hoffentlich einen der beiden zur Eifersucht anstacheln, was natürlich nicht passierte. Außerdem wollte ich mich über Debbie ihrem berühmten Vater Terry Schaffer nähern, zu dem es mich immer hingezogen und den ich doch in all den Jahren nie so richtig kennengelernt hatte, dabei kannte ich Debbie seit einer gefühlten Ewigkeit.
Bis zum Beginn der achten Klasse vollzog Debbie eine Verwandlung von einem etwas sonderbar aussehenden Mädchen – obwohl sie immer unwahrscheinlich selbstbewusst oder vielleicht auch nur anmaßend wirkte, war sie pummelig und trug eine Zahnspange und Zöpfe – in eine Art leicht nuttige Jungsfantasie. Ihre Brüste waren voll und aufrecht, und sie nutzte jede Gelegenheit, um ihr Dekolleté zur Schau zu stellen. Das gehörte sich nicht für ein Buckley-Mädchen, die weiße Bluse war so hochgeschlossen zu tragen, dass man nicht das Geringste sah, aber in der neunten und zehnten Stufe setzten sich viele der Mädchen über diese Regel hinweg, und je nachdem, welchem Erwachsenen das auffiel, wurde es mitunter geduldet – die Vorschriften waren Auslegungssache. Ihre Beine waren umwerfend, lang, gebräunt und glatt, und die Sattelschuhe, die sie zu knöchelhohen weißen Söckchen trug, verliehen ihr einen gewissen Fetischcharakter; der Saum ihres grauen Uniformrocks saß exakt so hoch wie erlaubt, sodass man etwas mehr als den Oberschenkel sehen konnte, und wenn sie sich setzte, erhaschte man ebenso mühelos einen Blick auf die hellrosa Schlüpfer, die sie so gern trug. Im Abschlussjahr war ihr Haar einen Hauch dunkler als platinblond, inspiriert von Blondie, und obgleich den jüngeren Mädchen Make-up untersagt war (Lipgloss wurde akzeptiert), durfte man ab der zehnten oder elften Stufe ein Minimum an Schminke auflegen, und die Mädchen trugen oft unauffälligen Lippenstift, aber Debbie trug ihn auf trotzige Weise, leuchtend pink und blutrot, auch wenn sie oft von Lehrern oder unserem Direktor Dr. Croft gebeten wurde, ihn abzuwischen. Susan trug kaum Make-up, weil Thom es nicht mochte.
Auch wenn mir Thom und Susan als Paar in dem minimalistischen Augenblick, den wir 1981 durchlebten und der von New Wave und Punk inspiriert war – Gefühllosigkeit und Verdrossenheit, eine kategorische Ablehnung von Siebzigerjahre-Kitsch, alles war nun sauber und spitzwinklig –, schärfer als alles andere vor Augen zu stehen schienen, erinnerten sie, so up to date und unangestrengt modern sie nach außen hin auch wirkten, doch an eine vergangene Ära – oft benahmen sie sich wie der König und die Königin des Abschlussballs aus einem Film von Anfang der Sechzigerjahre: glücklich, sorglos, unbeschwert. Aber von einem bestimmten Zeitpunkt an – dem Spätfrühling 1981, fast zwei Jahre, nachdem sie zusammengekommen waren – wusste ich, dass Thom glücklicher war als Susan. Sie hatte sich mir eines Tages kurz vor Ende des elften Schuljahrs anvertraut, als wir nach dem Unterricht in unseren Buckley-Uniformen durch Westwood liefen, während Thom beim Baseball-Training war. »Thom ist ja nicht dumm oder so …«, hatte sie aus heiterem Himmel gesagt, und ich hatte nicht gewusst, was ich darauf erwidern sollte – ich sah nur zu ihr hinüber. Es stimmte: Er hatte gute Noten, er tat viel dafür – das musste er auch, wegen all der Sportarten, die er betrieb und in denen er glänzte: Football, Basketball, Fußball, Baseball, Leichtathletik –, und er las und bewunderte Bücher (in der Zehnten hatte uns unsere Liebe zu Der große Gatsby und Fiesta zusammengeschweißt), und inzwischen war er ein fast so großer Filmliebhaber wie ich und begleitete mich oft in Programmkinos wie beispielsweise das Nuart, wo ich ihm dann erklärte, wodurch sich ein guter Robert-Altman-Film von einem schlechten unterschied und warum Brian De Palma ein wichtiger Regisseur war. »Aber manchmal ist Thom …«, setzte Susan an und verstummte. Ich weiß noch, dass sie die folgenden Worte sorgfältig abwägte, während wir vor dem Postermat standen, unschlüssig, ob wir hineingehen sollten. Ich weiß noch, nebenan im Bruin lief Outland – Planet der Verdammten, der auf einem der Jupitermonde spielt. »… nicht gerade beschränkt«, sagte sie und schwieg kurz. »Aber uninteressiert.«
Nun ja, Thom brauche aber auch nichts weiter zu sein, erwiderte ich halb im Scherz. Er sei sexy, seine Familie habe Geld, Thom werde sich nie Sorgen machen müssen, ob er nun dumm sei oder nicht. Worauf wolle sie hinaus?
Susan warf mir einen seltsamen Blick zu, nachdem ich das gesagt hatte; es schien sie zu stören, dass ich einer so unverfänglichen und vagen Aussage so vehement widersprach. »Du bist auch nicht gerade unsexy, Bret«, sagte Susan, während wir langsam den Bürgersteig entlangschlenderten.
Ich schwenkte eine gelbe Tower-Records-Tüte (Squeeze, East Side Story, die Kim-Carnes-LP mit »Bette Davis Eyes« darauf) und versuchte völlig gleichgültig zu wirken, als ich sagte: »Aber ich bin nicht Thom.«
Das ärgerte sie. »Gott, du klingst ja, als wärst du scharf auf ein Date mit ihm.«
»Ein Date?«, sagte ich grinsend. »Besteht denn da eine Chance?« Es war nicht ernst gemeint, aber ich wollte sie auf die Probe stellen.
Susan sah mich an, zuerst lächelnd und neckisch, die Wayfarer auf der Nase, einen Hauch Bubblegum-Gloss auf den Lippen, und sagte dann ernst: »Nein, eher nicht. Nein, keine Chance.«
Dass sie mit einer so beiläufigen Entschiedenheit darauf antwortete, ärgerte mich. »Mein Gott, Susan, das war ein Scherz«, sagte ich, auch wenn es natürlich keiner gewesen war.
Susan schwieg, als wir die Broxton Avenue überquerten, sie sah mich nur wieder an, auch wenn ich wegen der Wayfarer ihre Augen nicht sehen konnte – sie versuchte, sich über etwas klar zu werden.
Ich fragte: »Woher willst du eigentlich wissen, dass Thom da so abgeneigt wäre?«
Schließlich seufzte sie und sagte: »Ach, Bret, ich hoffe, du bist glücklich. Das hoffe ich wirklich. Dein Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben.«
Ich lachte und sagte: »Meine Geheimnisse kennst du gar nicht.«
Aber wir fanden ja tatsächlich ständig fehlende Puzzlestücke und Geheimnisse, und ich hatte mehr als nur ein paar, und in diesem Augenblick fragte ich mich, welche davon Susan kannte, welche sie aufgedeckt hatte und welche verborgen geblieben waren.
Alles beschleunigte sich, wenn man mit sechzehn sein Auto bekam: Man war auf eine völlig neue Art unabhängig, man stand auf eigenen Füßen oder glaubte es zumindest – das war die Illusion –, und nun da wir älter waren und vor allem, wenn wir keine Geschwister hatten – und wir hatten seltsamerweise alle keine, weder Thom noch Susan oder Deborah, noch Matt Kellner oder ich –, nahmen unsere Eltern das zum Anlass, entweder mehr zu arbeiten oder ungehinderter zu reisen, viele an abgelegene Filmschauplätze in fremden Ländern, oder sie unternahmen einfach nur ausgiebigere Urlaubsreisen, und im elften Schuljahr nutzten wir es aus, dass sie leere Häuser in Bel Air und Beverly Hills und Benedict Canyon und entlang der Klippen am Mulholland Drive bis nach Malibu hinterließen. Und aufgrund dieser neuen Unabhängigkeit und Mobilität fuhren wir zu Freunden, wann immer wir wollten, oder hingen nach Lust und Laune im Strandclub herum, und einige der Jungs kauften nun unverhohlen Pornohefte an den Zeitungskiosken in Sherman Oaks und Studio City oder fuhren manchmal nach West L.A. oder Hollywood, um mit einem gefälschten Ausweis Zeitschriften und Videokassetten zu kaufen.
Wir waren auch immer öfter im Odyssey, einer Disco am Beverly Boulevard unweit der Kreuzung zum La Cienega Boulevard, zu der auch Jugendliche Zutritt hatten und in der kein Alkohol ausgeschenkt wurde, aber wenn man sich ein bisschen auskannte, konnte man Quaaludes und Gras und kleine Tütchen mit Kokain kaufen, und zumindest für mich hatte das Odyssey den zusätzlichen Reiz, dass dort Schwule verkehrten, obwohl es vordergründig eine Hetero-Disco war; und auch wenn die Schwulen für meinen Geschmack vielleicht etwas alt waren, war es das erste Mal, dass ich ihnen nahekam, und es war immer ein wenig aufregend, auch wenn ich in dieser Richtung nichts unternahm, sondern nur mit Thom und Susan und Jeff tanzte und manchmal mit Debbie und Anthony und allen, die sonst noch da waren, am Wochenende bis zwei, drei Uhr morgens, und da unsere Eltern in jenem Frühling größtenteils abwesend waren, konnten wir nach Hause fahren, wann wir wollten, ausschlafen und wieder von vorn anfangen – all das machten die Autos möglich.
Wir waren auch nicht darauf angewiesen, von unseren Eltern ins Westwood Village gefahren zu werden, wo wir uns trafen, um zwei, drei oder (wenn wir besonders ehrgeizig waren) sogar vier Filme zu schauen, denn so verbrachten wir unsere Samstage: Wir sahen uns die Filme an, die freitags angelaufen waren – die Zusammensetzung der Gruppe änderte sich je nachdem, welche Filme liefen und wer was sehen wollte, meist waren Thom, Jeff, Anthony und ich dabei, manchmal auch Kyle oder Dominic. Samstagmorgens verständigten wir uns mithilfe des Veranstaltungskalenders der Los Angeles Times (