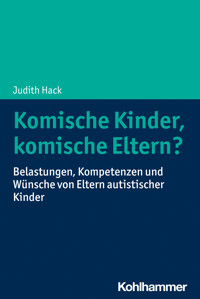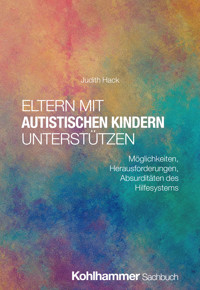
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Das Familienleben mit autistischen Kindern birgt im Alltag zahlreiche (unsichtbare) Herausforderungen, welche nicht selten an die Grenze emotionaler und praktischer Belastbarkeit führen. Auf der Suche nach passgenauen Hilfen stoßen Eltern mitunter auf Widerstände und gravierende Systemmängel, die ihren autistischen Kindern schlimmstenfalls die begehrte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmöglich und angebotene Maßnahmen für alle zu einer zusätzlichen Herausforderung werden lassen. Neben den "Schattenseiten" des Hilfesystems bietet das Buch einen umfangreichen Hilfekompass, um Eltern im undurchsichtigen Dschungel der Angebote Orientierung zu Bgeben und den Zugang zu Hilfen zu erleichtern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Einleitung
1 Die Ausgangssituation von Familien mit autistischen Kindern
1.1 Auf dem Weg zur Diagnose
1.1.1 Mögliche Stolpersteine
1.1.2 Handlungsempfehlungen
1.2 Besonderheiten in der Erziehung autistischer Kinder
1.3 Über Auswirkungen auf die familiäre Situation und die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Hilfen
2 Darstellung des (öffentlichen) Hilfesystems
2.1 Leistungen der Pflegeversicherung
2.1.1 Pflegegrad und Pflegegeld
2.1.2 Verhinderungs- und Kurzzeitpflege
2.1.3 Entlastungsbeitrag
2.1.4 Familienentlastende und Familienunterstützende Dienste
2.2 Schwerbehindertenausweis
2.3 Leistungen der Eingliederungshilfe
2.3.1 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
2.3.2 Leistungen zur sozialen Teilhabe
2.3.3 Das Persönliche Budget
2.3.4 Unterstützung durch einen Verfahrenslotsen
2.4 Hilfe zur Erziehung
2.4.1 Erziehungsberatung
2.4.2 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
2.4.3 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
2.4.4 (Sozialpädagogische) Tagesgruppen
2.5 Weitere Maßnahmen, Anlaufstellen und Hilfsangebote
2.5.1 Unabhängige Beratungsstellen
2.5.2 Nachteilsausgleich in der Schule
2.5.3 Ambulante Therapieangebote
2.5.4 Mutter-/Vater-(Kind)-Kur oder Familienkur
2.5.5 Bundesverband und Regionalverbände
2.5.6 Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen
3 Die Tücken des Hilfesystems – Wenn Hilfe zur Herausforderung wird
3.1 Auf der Suche nach einem System, das wirklich funktioniert
3.1.1 Ist das System für das Kind da oder das Kind für das System?
3.1.2 Vertrauen aufbauen, Hilfe annehmen können
3.1.3 Defizitorientierung und Wortwahl
3.1.4 Hohe Personalfluktuation
3.1.5 Erfolglose Therapien
3.2 Strategien der Kostenträger
3.2.1 Strukturen der Behörden
3.2.2 Beratungspflicht
3.2.3 Bedarfsermittlung im Hilfeplanverfahren
3.2.4 Überformalisierung und Verschleierung der Hilfeprozesse
3.2.5 Die Mühlen der Justiz
3.3 Autismus-Spektrum ist keine befristete Teilzeit-Behinderung
3.4 Die Macht des Schweigens
3.5 Kooperationen und Abhängigkeiten
3.5.1 Zur Personalsituation von Leistungserbringern
3.5.2 Zu viele Köche verderben den Brei
3.6 Expertengerangel und mangelndes Fachwissen
3.6.1 Eltern als Therapeuten?
3.6.2 Die Schuldfrage
3.7 Unterstützungssystem Familie und andere Bezugspersonen
3.8 Wenn Hilfe eine Neiddebatte auslöst
4 Lösungsansätze – Wie Hilfe gelingen kann
4.1 Wirkungsvolle Hilfen von Anfang an
4.2 Eine (adäquate) Definition von Erfolgen
4.3 Wünsche von Eltern autistischer Kinder
4.3.1 Verständnis und Aufklärung
4.3.2 Respekt, Wertschätzung und Anerkennung
4.3.3 Toleranz und Akzeptanz
4.3.4 Offenheit, Transparenz und Kooperation auf Augenhöhe
4.3.5 Fachlich kompetente Unterstützung
Schlussbemerkung
Dankesworte
Nachwort der Autorin
Literaturverzeichnis
Fachliteratur/Fachartikel
Internetquellen
Broschüren
Weitere nützliche Internet-Links
Judith Hack
Eltern mit autistischen Kindern unterstützen
Möglichkeiten, Herausforderungen, Absurditäten des Hilfesystems
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-045056-1
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-045057-8epub:ISBN 978-3-17-045058-5
Einleitung
Das Familienleben mit autistischen Kindern stellt alle Beteiligten immer wieder vor besondere Herausforderungen, die sie im Alltag nicht selten an die Grenzen ihrer emotionalen und praktischen Belastbarkeit führen. Wenn das Verhalten ihrer Kinder im öffentlichen Raum wiederholt auf Unverständnis stößt und sich Eltern den Vorwürfen über fehlgeschlagene Erziehung, mangelnde Erziehungskompetenzen oder auch fehlende Kooperationsbereitschaft ausgesetzt sehen, kommen sie oftmals (ungewollt) in Erklärungs- und Rechtfertigungsnöte gegenüber den Kritiker/innen und Fachleuten, die sie im Alltag enorme Kräfte und Ressourcen kosten und sie zusätzlich in die Enge treiben.
Nach Erhalt der Diagnose setzen sich Eltern häufig intensiv mit der Autismus-Thematik auseinander und werden – nicht zuletzt auch aufgrund ihrer zahlreichen Erfahrungen im Familienalltag – auf lange Sicht zu Expert/innen ihres autistischen Kindes. Sie verstehen infolgedessen im besten Fall dessen Besonderheiten, vermögen auch die Motive und Bedürfnisse dahinter zu erkennen und die daraus resultierenden Bedarfe und Notwendigkeiten zu identifizieren. Auf der anschließenden Suche nach passgenauen Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen stoßen Familien mit autistischen Kindern jedoch nicht selten auf Systemgrenzen, sei es unter anderem im Kampf um deren (dauerhafte) Finanzierung oder auch bei der Installation und praktischen Umsetzung derselben. In diesem Kontext machen sie und ihre autistischen Kinder unter Umständen die groteskesten Erfahrungen, die sie nicht selten sukzessive und dauerhaft an den Rand der Verzweiflung bringen und/oder ihren Glauben und ihre Hoffnung auf ein »funktionierendes« Unterstützungssystem verlieren lassen. Neben der häufig in der Öffentlichkeit geführten (Neid)Debatte um die Gewährung zwingend erforderlicher Hilfen treffen Familien zudem wiederholt auf rigide, (scheinbar) veränderungsresistente Hilfesysteme, welche für viele von ihnen bei genauerer Betrachtung am Ende zu einer zusätzlichen Herausforderung werden und damit das Wort »Hilfe« im Namen schlichtweg nicht verdienen.
Überdies geht in Zeiten schrumpfender Wirtschaft und leerer Staatskassen der zunehmende Kostendruck und der daraus resultierende Sparzwang auch an vielen Kostenträgern nicht spurlos vorbei. Statt in die Inklusion und die individuelle Versorgung autistischer Menschen nachhaltig zu investieren, scheint sich in den letzten Jahren eine Art »Parallelsystem« entwickelt zu haben, welches am Ende mehr Geld in die Verwaltung, Infragestellung und/oder Verhinderung von Hilfen als tatsächlich in deren Gewährung und Umsetzung und damit in die Anspruchsberechtigten selbst fließen lässt.
Gerade im Bereich Autismus-Spektrum, wo die damit einhergehenden individuellen Beeinträchtigungen der Menschen nicht selten auf den ersten Blick unsichtbar erscheinen, fällt es Kostenträgern häufig offenbar leicht(er), den Umfang bewilligter und installierter Hilfen frühzeitig wieder zu reduzieren oder diese auch komplett aus dem System zu entfernen, da sich der Mensch vermeintlich »so gut entwickelt hat«. Ferner führen mangelhaftes Wissen bzw. eine nicht vorhandene Autismus-Kompetenz bei Entscheidungsträgern sowie die fehlende gesellschaftliche Lobby autistischer Menschen in vielen Fällen dazu, dass dringend erforderliche Hilfen nicht bzw. nicht ausreichend bewilligt werden und sie infolgedessen früher oder später innerhalb der Gesellschaft zu scheitern drohen.
So vermag jeder frühzeitig und langfristig investierte Euro in diesem Bereich, sowohl für die erbringenden Leistungsträger als auch für die bedarfsdeckende Ausgestaltung und Umsetzung der Hilfen für die Betroffenen, immense Folgekosten im sozialen Bereich verhindern. Gerade hier sollte im Zuge von nachhaltigen Einsparpotenzialen der öffentlichen Hand auch immer langfristig gedacht werden. Eine umfassende Schulung von Fachkräften und fallzuständigen Sachbearbeitenden erscheint in diesem Kontext unumgänglich, damit die vorhandenen Unterstützungsmaßnahmen adäquat und bedarfsgerecht eingesetzt und gesetzlich verankerte Leistungsansprüche innerhalb der Kostenträger korrekt und fristgerecht umgesetzt werden können.
Dieses Buch hat deshalb zum Ziel, die individuellen Herausforderungen und Belastungen von Familien mit autistischen Kindern aufzuzeigen, Verständnis für diese zu entwickeln und daraus resultierende Bedarfe zu identifizieren. Da betroffene Familien aus verschiedensten Gründen über diese Aspekte oftmals nicht offen oder auch umfassend kommunizieren, bleiben diese Problematiken meist innerfamiliär im Verborgenen und erscheinen damit für Außenstehende unsichtbar. Externe Personen sehen im Gegenzug wiederum häufig nur die sichtbaren Resultate aus den mitunter langanhaltenden, kräftezehrenden Kämpfen der Eltern um die gesellschaftliche Teilhabe und Akzeptanz ihrer autistischen Kinder, die gewährten Hilfsmittel und Unterstützungsmaßnahmen sowie ihre damit verbundene »Sonderrolle«. Dies kann dann schlimmstenfalls noch in eine gesellschaftliche Neiddebatte münden, die am Ende jedoch niemandem hilft. Denn Tatsache ist, dass das Thema Autismus-Spektrum von vielen Menschen nach wie vor nicht richtig verstanden wird und die zahlreichen Auswirkungen auf das Familiensystem demzufolge auch häufig völlig unterschätzt oder gar bagatellisiert werden, so dass in diesem Bereich noch viel Aufklärung notwendig ist.
Neben dem Aufklärungsaspekt dient das Buch der Informationsvermittlung und als »Hilfekompass«, indem es eine Vielzahl vorhandener (öffentlicher) Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten dieser Zielgruppe aufzeigt, die vielen Familien (und Fachkräften) – zumindest zum Zeitpunkt der Diagnose – nicht zwingend bekannt sind und infolgedessen von ihnen aufwändig recherchiert werden müssen.
Darüber hinaus soll das Buch auch zum Nachdenken anregen, indem es offensichtliche Missstände und Widersprüche innerhalb der vorhandenen Systeme aufdeckt und explizit für Stolpersteine und Barrieren bei der Inanspruchnahme von Hilfen sensibilisiert. Familien mit autistischen Kindern berichten selten in der Öffentlichkeit über ihre (negativen) Erfahrungen, aus Scham, Macht- oder auch Hilflosigkeit bzw. aus Angst und Sorge, dass eine offene Systemkritik auch weitgehende Konsequenzen für ihre Kinder – gerade im Hinblick auf die Gewährung zukünftiger Hilfen – mitbringen und ihren eigenen Standpunkt damit »verschlechtern« kann.
Durch das Aufzeigen potenzieller Lösungsansätze erhofft sich die Autorin langfristig ein generelles Umdenken innerhalb des Hilfesystems, insbesondere bezogen auf die konkrete Umsetzung und Prozessgestaltung, so dass die individuell erforderliche Unterstützung auch tatsächlich ankommt bzw. angenommen werden kann und alle Beteiligten nachhaltig davon profitieren können. Zudem möchte sie durch ihren fachlichen und persönlichen Hintergrund eine Brücke zwischen Eltern, autistischen Menschen und der Fachwelt schlagen, um damit eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche, vertrauens- und verständnisvolle Zusammenarbeit schaffen.
Somit richtet sich das vorliegende Werk insbesondere an Autist/innen sowie Familien mit autistischen Kindern, deren Verwandte, Bekannte und Freunde, die auf der Suche nach geeigneten Hilfs- und Entlastungsmöglichkeiten sind oder selbst wirkungsvolle Unterstützung leisten wollen. Weiterhin ist es unter anderem an Psycholog/innen, Therapeut/innen, Berater/innen, Schulbegleiter/innen, Behördenmitarbeiter/innen, sonstige (pädagogische) Fachkräfte, Laienhelfer/innen und andere am Thema Interessierte adressiert, die sich manchmal darüber wundern, aktiv hinterfragen bzw. nach möglichen Erklärungsmodellen suchen, weshalb (mitunter umfangreich) installierte Hilfen scheinbar dauerhaft keinen (sichtbaren) Erfolg bzw. keine nachhaltige Veränderung erzielen und im Gegenzug für alle Beteiligten schlimmstenfalls noch zu einer weiteren Herausforderung werden.
Ein wichtiger Aspekt sollte am Ende dieses Buches deutlich werden: Familien mit autistischen Kindern wird (im Regelfall) nichts geschenkt bzw. werden ihnen erforderliche Hilfen prinzipiell nicht »auf dem Silbertablett« bereitgestellt/präsentiert. Ganz im Gegenteil, Eltern kämpfen häufig vielmehr ein Leben lang für die Anerkennung der (unsichtbaren) Hilfebedarfe und für die Rechte ihrer autistischen Kinder. Denn nur ein besseres Verständnis der Thematik und ein offenes, wertschätzendes Miteinander vermag das Leben vieler Familien mit autistischen Kindern erheblich zu vereinfachen, für Entlastung zu sorgen, nachhaltige Veränderungen bewirken und ihnen letztlich eine wahrhafte Teilhabe am Leben innerhalb der Gesellschaft zuteilwerden lassen.
In diesem Kontext beschäftigt sich Kapitel 1 (▸ Kap. 1) einleitend mit der Ausgangssituation von Familien mit autistischen Kindern, indem es zunächst auf den Weg zur Diagnose (▸ Kap. 1.1), mögliche Stolpersteine (▸ Kap. 1.1.1) und Handlungsempfehlungen (▸ Kap. 1.1.2) und anschließend auf Besonderheiten in der Erziehung (▸ Kap. 1.2), mögliche Auswirkungen und die daraus resultierende Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Hilfen (▸ Kap. 1.3) näher eingeht.
Kapitel 2 (▸ Kap. 2) beschäftigt sich dann ausführlich mit der Darstellung des (öffentlichen) Hilfesystems. Neben Leistungen der Pflegeversicherung (▸ Kap. 2.1), dem Schwerbehindertenausweis (▸ Kap. 2.2), Leistungen der Eingliederungshilfe (▸ Kap. 2.3) und Hilfen zur Erziehung (▸ Kap. 2.4) werden auch weitere Maßnahmen, Anlaufstellen und Hilfsangebote (▸ Kap. 2.5) dargestellt und erläutert.
Kapitel 3 (▸ Kap. 3) rückt anschließend die Tücken des Hilfesystems in den Mittelpunkt, die potenzielle Hilfen für viele Familien am Ende mitunter zu einer Herausforderung werden lassen. Dabei werden zunächst verschiedene Aspekte bei der Suche nach einem funktionierenden System (▸ Kap. 3.1) sowie diverse Strategien der Kostenträger (▸ Kap. 3.2) betrachtet und sich nachfolgend unter anderem mit der Macht des Schweigens (▸ 3.4), Kooperationen und Abhängigkeiten (▸ Kap. 3.5) sowie mit dem Unterstützungssystem Familie und anderer Bezugspersonen (▸ Kap. 3.7) näher befasst.
Kapitel 4 (▸ Kap. 4) stellt schließlich Lösungsansätze dar, die zu einem Gelingen der Hilfe beitragen können, indem es sich mit wirkungsvollen Hilfen von Anfang an (▸ Kap. 4.1) und einer (adäquaten) Definition von Erfolgen (▸ Kap. 4.2) auseinandersetzt. Abschließend wird dann noch auf Wünsche von Eltern autistischer Kinder (▸ Kap. 4.3) eingegangen und die Gesamtthematik damit abgerundet.
1 Die Ausgangssituation von Familien mit autistischen Kindern
Das Leben mit autistischen Kindern stellt alle Familienmitglieder im Alltag immer wieder vor zahlreiche Herausforderungen, die sie nicht selten auf die Dauer an die Grenze ihrer emotionalen und praktischen Belastbarkeit führen und dabei für Außenstehende häufig unsichtbar erscheinen.
Wenn das Verhalten ihrer autistischen Kinder in der Öffentlichkeit auf Unverständnis und Ablehnung stößt und sich Eltern den Vorwürfen über fehlgeschlagene Erziehung, mangelnde Erziehungskompetenzen und/oder auch fehlende Kooperationsbereitschaft ausgesetzt sehen, kommen sie oftmals gegenüber Kritiker/innen und potenziellen Unterstützer/innen (ungewollt) in Erklärungs- und Rechtfertigungsnöte, obwohl sie im Hinblick auf ihr autistisches Kind am Ende selbst eine Expert/innenrolle innehaben.
Um ihren Kindern eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, wird die Alltagsorganisation aller Familienmitglieder meist vom Verhalten, den Bedürfnissen, den Ressourcen und dem Stressniveau des autistischen Kindes bestimmt. Das Aushalten eigener Macht- und Hilflosigkeit verbunden mit ambivalenten Gefühlen gegenüber ihren Kindern in Konflikt- und Spannungssituationen lassen Eltern phasenweise an sich selbst verzweifeln und ihre eigenen Erziehungskompetenzen dauerhaft in Frage stellen. Dies wird durch die anhaltende Kritik Außenstehender häufig noch verstärkt.
Dabei verstehen Eltern im Laufe der Zeit im besten Fall zunehmend die Besonderheiten ihres Kindes und erkennen meist auch dessen Motive und Bedürfnisse, weshalb sie viele Dinge im Alltag bewusst »anders« handhaben und immer wieder auch mitunter zu »ungewöhnlichen« Maßnahmen greifen, die von Dritten nicht immer auf den ersten Blick logisch nachvollzogen werden (können). Nicht selten gehen sie in diesen Zusammenhängen auch mit Kritiker/innen direkt in Konfrontation, um ihre Kinder z. B. vor Übergriffen zu schützen, für dessen Rechte zu kämpfen und/oder die – aus ihrer Perspektive – erforderlichen Ansprüche durchzusetzen, was sie dazu noch sehr viel Kraft kostet. Eltern autistischer Kinder werden deshalb im Kontakt mit der Außen- und Fachwelt nicht selten als »schwierig«, »widerständig«, »unverschämt«, »grenzüberschreitend«, »feindselig« oder »unbelehrbar« wahrgenommen, ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen erscheinen »verwunderlich«, werden (schonungslos) kritisiert, mitunter falsch gedeutet oder zumindest in Frage gestellt, was die Familien im Alltag noch zusätzlich belastet und herausfordert.
Aus Mangel an zeitlichen und persönlichen Freiräumen und Ressourcen kommen Eltern und Geschwisterkinder im Familienalltag dabei selbst häufig zu kurz und verlieren ihre individuellen Bedürfnisse völlig aus dem Blick. Statt sich hin und wieder um sich selbst kümmern, schlucken sie eigene ambivalente Gefühle herunter, um für das autistische Familienmitglied (vermeintlich) funktionsfähig zu bleiben und der Außenwelt nicht zur Last zu fallen.
Hinzu kommt, dass sie im Alltag hinter verschlossenen Türen oftmals als »Prellbock«, »Blitzableiter« oder auch als »Tankstelle« des autistischen Kindes fungieren, um es für das Leben da draußen »betriebsbereit« zu halten. Dies kostet sie eine Menge Nerven und Kraft, wird jedoch – aus Angst vor weiterer Kritik, vor Ablehnung oder auch davor, das Gegenüber schlichtweg zu überfordern – selten nach außen hin offen kommuniziert. Im Gegenzug dazu verbringen sie ihre Zeit eher damit, ein Lächeln aufzusetzen und anderen auf Nachfrage hin zu versichern, dass sie alles im Griff haben und alles in Ordnung ist (Hack, 2023, S. 11).
Um die Ausgangssituation vieler Familien mit autistischen Kindern anhand konkreter Alltagsphänomene näher zu verdeutlichen, beschäftigt sich der nachfolgende Abschnitt zunächst exemplarisch mit den Herausforderungen der Diagnostik, um sich anschließend mit den Besonderheiten in der Erziehung autistischer Kinder sowie potenziellen Auswirkungen auf das Familiensystem auseinanderzusetzen.
1.1 Auf dem Weg zur Diagnose
Entwickelt oder verhält sich das eigene Kind (dauerhaft) außerhalb der Norm und steigt dabei noch der individuelle Leidensdruck aller Beteiligten – insbesondere des betroffenen Kindes und seines familiären Umfelds – wird früher oder später auch der Ruf nach einer potenziellen Diagnostik immer lauter.
Eltern tun sich in dieser Entscheidung häufig sehr schwer, da es dabei ja schließlich um viel mehr als »nur einem Schnupfen« geht und eine Diagnose womöglich weitreichende Konsequenzen für das Kind mit sich bringen, potenziellen Zukunftsplänen/-wünschen des betroffenen Kindes entgegenstehen und/oder auch dauerhaft als ein vermeintlicher Makel angesehen werden kann, den das Kind nicht mehr loswird und sich damit auch auf dessen Entwicklung und Selbstwert nachhaltig auszuwirken vermag.
Die Entscheidung für oder gegen eine Diagnostik des Kindes ist für Eltern immer auch ein innerlicher, individueller Prozess, der entsprechend Zeit braucht. Demzufolge wird diese nicht spontan oder leichtfertig getroffen, sondern immer wieder genauestens abgewogen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass die Auffälligkeit nur eine »Phase« ist und sich »das Problem« mit zunehmendem Alter und Reife des Kindes doch noch von selbst auflöst (Hack, 2023, S. 12).
Da es ohne verifizierte Diagnose in Deutschland jedoch auch keine Hilfsmöglichkeiten oder keinen Anspruch auf Förderung gibt, führt am Ende meist kein Weg an dieser vorbei, so dass sich Eltern und deren Kinder diesem Prozedere letztlich fügen müssen. Auf mögliche »Stolpersteine« auf dem Weg zur Diagnose soll nun im nachfolgenden Kapitel näher eingegangen werden.
1.1.1 Mögliche Stolpersteine
Haben sich Eltern (womöglich auch gemeinsam mit dem betroffenen Kind) schließlich für eine Diagnostik entschieden, sind auf dem Weg dorthin zahlreiche (neue) Hürden und Stolpersteine zu bewältigen, die nicht selten dazu führen können, dass der Prozess zwischenzeitlich unterbrochen und/oder auch vorzeitig »ergebnislos« beendet wird, da allen Beteiligten schlichtweg die notwendigen Ressourcen fehlen und sie die damit einhergehende (Zusatz-)Belastung auf die Dauer nicht bewältigen können.
Stolpersteine auf dem Weg zur Diagnose sind u. a.
♦
Kinderärzte, die im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen (offensichtliche) (Entwicklungs-)Auffälligkeiten des Kindes nicht erkennen (können/wollen), ggf. diese (wiederholt) bagatellisieren (»Sie müssen Geduld haben, er/sie ist halt ein Frühchen und braucht einfach noch etwas mehr Zeit!«) und/oder nicht ordnungsgemäß dokumentieren;
♦
fehlende/mangelhafte (familiäre) Unterstützung und adäquate Beratung und Begleitung verbunden mit offenem Anzweifeln, Warnungen vor und anhaltender Kritik an der Entscheidung der betroffenen Eltern bzgl. einer Diagnostik, welche diese zusätzlich verunsichern und belasten;
♦
»Masking« bzw. die eventuell vorhandene hohe Anpassungsfähigkeit des betroffenen Kindes, die dazu führt, dass dessen Besonderheiten und Auffälligkeiten im Rahmen der Diagnostik – je nach Intensität, Qualität und auch Häufigkeit der Behandlungskontakte sowie je nach individueller Tagesform und Reizschwelle des Kindes – mitunter kaum auftreten und damit auch nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden (können);
♦
die – mitunter durch jahrelange Förderung und Therapie – (un-)bewusst angeeigneten und auf den ersten Blick auch funktionierenden (Kompensations-)Strategien des Kindes/Jugendlichen zum Zeitpunkt der Diagnostik, welche bestehende Defizite und Einschränkungen überdecken/überlagern, damit durchaus zu Fehldiagnosen führen können und den Betroffenen dazu noch im Alltag sehr viel Kraft kosten und nicht immer zur Verfügung stehen;
♦
die hohe Stressbelastung sowie Scham- und Schuldgefühle der Eltern, die es ihnen (phasenweise) erheblich erschweren, die erlebten Herausforderungen und die eigentliche Problematik dezidiert darzustellen. Auch lässt sie die damit verbundene Anspannung eventuell wichtige Details zum Zeitpunkt des Gesprächs schlichtweg »vergessen« oder diese nicht für »erforderlich« einstufen, so dass diese Aspekte ihrem Gegenüber in der Beurteilung bzw. Diagnostik verborgen bleiben, insbesondere dann, wenn ihnen das betroffene Kind diese Auffälligkeiten im Kontakt nicht unmittelbar offenbart;
♦
Kliniken und Fachärzt/innen, die einer möglichen (oder auch bereits vorhandenen) Autismus-Diagnostik per se eher skeptisch gegenüber eingestellt und fachspezifisch hier nicht gut aufgestellt scheinen, so dass es bereits nach einem kurzen Anamnesegespräch mit den Eltern zu einem Ausschluss der Diagnose »Autismus-Spektrum« kommen kann, da z. B. »[...] das Kind ja offensichtlich Blickkontakt halten kann!«. Andere wiederum ziehen eine bereits vorhandene Diagnose in Zweifel oder erkennen diese ab, da die Patient/innen beispielsweise (nach jahrelanger Förderung und/oder Autismus-Therapie) zum aktuellen Zeitpunkt scheinbar nicht mehr den sogenannten »Cut-Off Wert im ADOS« erhalten würden;
♦
etc.
Negative Erfahrungen im (medizinischen) System, wie unter anderem lange Wartezeiten, viele Termine, (fachlich) inkompetente Anlaufstellen, der anhaltend defizitäre Blick auf das eigene Kind, potenzielle Fehldiagnosen, das wiederholte Offenbaren der eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit im familiären System verbunden mit dem ständigen in Frage stellen der eigenen Erziehungskompetenzen und damit auch der Bagatellisierung der geschilderten Auffälligkeiten und Problematiken des Kindes, sind dabei keine Seltenheit [...] (Hack, 2023, S. 13).
Aus diesen Stolpersteinen heraus eventuell resultierende »Fehldiagnosen« verbunden mit dysfunktionalen und/oder auch kontraproduktiven Behandlungsansätzen und Interventionsmaßnahmen können häufig (wenn überhaupt) erst viele Jahre später im Rahmen einer erneuten Diagnostik revidiert und aufgelöst werden, was für alle Beteiligten sehr belastend sein kann.
Ferner sind Eltern auf diesem Weg bzw. in diesem Prozess, der mitunter auch mehrere Jahre andauern kann, oftmals auf sich allein gestellt und werden mit ihren Sorgen und Nöten schlichtweg allein gelassen. Hinzu kommt, dass ihnen meist – auch zum Zeitpunkt einer Verdachtsdiagnose – noch keine geeigneten Hilfen, Entlastungs- und/oder Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, so dass sie diese Zusatzbelastung – neben den bereits bestehenden Alltagsherausforderungen – nicht selten an die Grenze ihrer persönlichen Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit führt.
1.1.2 Handlungsempfehlungen
Wurde die Entscheidung für eine Diagnostik des Kindes getroffen, erscheint es nunmehr unumgänglich, den Fokus im Alltag auch explizit auf dessen Auffälligkeiten und Defizite zu legen, was Eltern mitunter vielleicht in der Vergangenheit aus Selbstschutz eher vermieden haben, in der Hoffnung, dass sich die Besonderheiten doch noch »auswachsen« würden oder doch nicht »so schlimm« seien.
Bereits die Suche nach einer geeigneten Praxis, einer Klinik oder auch eines Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ), in dem die Diagnostik vorgenommen werden soll, kann Eltern dabei schon stark verunsichern, da die Erfahrungen mit den verschiedenen Systemen sehr variieren und letztlich stark personenabhängig erscheinen. Dennoch lohnt es sich für Eltern auch bei mehreren Anlaufstellen anzufragen, sich dort auf die Wartelisten setzen zu lassen und erst dann abzusagen, wenn sie einen für sich passenden Diagnoserahmen gefunden, den Diagnoseprozess begonnen und schließlich den Eindruck haben, dass sie sich in der ausgewählten Institution ernst genommen und gut aufgehoben fühlen. Für eine gute Diagnostik müssen Eltern zu ihrem Gegenüber zügig Vertrauen aufbauen, um sich zu öffnen und die bestehende Scham über das vermeintliche innerfamiliäre Versagen überwinden zu können. Sollten Eltern hier innerhalb des Prozesses zunehmend Zweifel verspüren, da sie z. B. fortwährend vermittelt bekommen, dass man ihren Angaben nicht glaubt oder ihnen insgeheim die »Schuld« am Verhalten des Kindes anlastet, sollten Eltern auch nicht davor zurückschrecken, die »Reißleine zu ziehen« und ggf. auch zu einer anderen Institution/Praxis zu wechseln, auch wenn dies wiederum mit erneuter Wartezeit verbunden sein kann. Letztlich tun sie sich und ihrem Kind keinen Gefallen, wenn sie den Prozess bis zum Ende »durchstehen« und mit dem Ergebnis, womöglich auch einer Fehldiagnose, nichts anzufangen wissen. Die Hoffnung auf eine zeitnahe Besserung und adäquate Hilfestellungen kann in diesen Momenten schwinden. Dazu kann die Hürde, sich zukünftig für eine Zweitmeinung erneut an eine alternative Institution zu wenden, umso unüberwindbarer erscheinen, da die Belastungen und Herausforderungen, die damit einhergehen, schlichtweg zu groß sind.
Im Zuge der verschiedenen Diagnostiktermine unseres Kindes wurden wir als Eltern immer auch ausführlich zu den letzten Entwicklungen befragt, die wir anhand von zahlreichen Alltagsbeispielen, aktuellen Herausforderungen und Ereignissen aus unserem Familienalltag offen schilderten. Unser Sohn spielte währenddessen leise, verhielt sich unauffällig, angepasst und höflich, was durchaus den Eindruck hinterließ, als berichteten wir von einem völlig anderen Kind als dem, welches sich zu diesem Zeitpunkt mit im Raum befand.
Als es dann jedoch bei einem der Termine zu einer »ungeplanten« Veränderung (unter anderem ein Bürowechsel) kam, zeigte unser Sohn plötzlich deutliche Überforderungstendenzen und seine Anpassungsstrategien versagten umfassend. Für einen kurzen Augenblick zeigte sich annähernd das Kind, von dem wir in den letzten Monaten so häufig berichteten.
Mir kamen in diesem Moment die Tränen und ich war sehr »dankbar« für diese »herausfordernde« Situation, was ich dem Psychologen auch schilderte. Er antwortete darauf, dass er von Beginn an keine Zweifel an unseren Erzählungen hatte, auch wenn unser Sohn dieses Verhalten oder seine Auffälligkeiten in diesem Kontext nicht ansatzweise zeigte.
Dies war am Ende wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns als Eltern bei ihm so gut aufgehoben gefühlt hatten, da er unsere Angaben zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt hatte.
Aus diesem Grund erscheint eine gute Vorbereitung des Diagnoseprozesses unumgänglich, da sie Eltern in ihrer Entscheidung über dessen Notwendigkeit nochmals bestärkt und ihnen in ihren Argumentationen und Schilderungen der Besonderheiten ihres Kindes bzw. dessen Quantität, Qualität und ggf. auch Komplexität dabei hilft, dass sich das Gegenüber ein umfassendes Bild über das Kind machen kann. In den Gesprächen vor Ort überwiegt in vielen Fällen häufig die Scham, die Aufregung bzw. auch das hohe Belastungsniveau aller Beteiligten, so dass es phasenweise unmöglich erscheint, »spontan« auf die zum Teil umfangreichen Fragen der/des Diagnostizierenden eine vollumfassende, realitätsnahe Antwort zu geben und nicht eine Vielzahl wichtiger Informationen schlichtweg zu vergessen und/oder unter den Tisch fallen zu lassen, da sie in diesem Moment von den Eltern als irrelevant eingestuft wurden. Ferner gilt hier zu berücksichtigen, dass viele potenzielle »Auffälligkeiten« auch zur »Normalität« dieser familiären Systeme gehören, so dass z. B. bestimmte Verhaltensweisen aus ihrer Betrachtung gar nicht erwähnenswert erscheinen, obwohl diese ggf. ein wichtiger Aspekt für die Diagnostik darstellen können (z. B. in Bezug auf vorhandene Stereotypien).
Folgende Punkte/Fragestellungen können dabei für die Vorbereitung auf die Termine sehr hilfreich sein:
♦
Beobachtungsbogen/Tagesprotokoll über einen klar definierten Zeitraum (z. B. 1 – 2 Wochen) erstellen – eignet sich vor allem bei immer wiederkehrenden Verhaltensbesonderheiten/-mustern des Kindes:
Welches Verhalten zeigt das Kind zu welchem Zeitpunkt (Datum, Uhrzeit, etc.)? In welcher Situation tritt das Verhalten auf? Welche Personen waren beteiligt/anwesend? Was ging der Situation voraus? Was passierte kurz danach? Wie war meine Reaktion? Was war hilfreich? Was hat die Situation verschlimmert?
♦
Sachliche (ungeschönte) Dokumentation der beobachteten Auffälligkeiten, z. B. durch detaillierte/konkrete Verhaltensbeschreibungen anhand von Alltagsbeispielen (z. B. Kind dreht sich bei Aufregung im Kreis und flattert mit den Händen):
Welches (konkrete) Verhalten erscheint ihnen im Vergleich zu anderen Kindern auffällig/ungewöhnlich? Welches (konkrete) Verhalten verunsichert sie oder sorgt bei ihnen für Fragen/Unverständnis/Irritationen? Was berichten andere Menschen in ihrem Umfeld? Worauf werden sie explizit angesprochen, obwohl sie es bisher vielleicht als »normal« eingestuft haben?
♦
Aussagen des Kindes protokollieren:
Wie sieht es die Welt? Welche Sprache/Erklärungsmodelle nutzt es? Wo sieht es selbst das Problem? Was fällt ihm/ihr schwer? An welcher Stelle zeigt sich sein/ihr Leidensdruck (besonders)?
♦
Stellungnahmen anderer Institutionen oder weiterer (enger) Bezugspersonen des Kindes:
Was fällt anderen Bezugspersonen auf, mit denen das Kind engeren Kontakt hat? Was berichtet der Kindergarten oder die Schule? Gibt es bereits installierte Fördersysteme (Frühförderung, Ergotherapie, etc.)? Welche Einschätzung gibt es von hier?
♦
Für Folgetermine:
Gibt es noch »Reste« bzw. ergänzende Informationen/Gedanken zum letzten Termin? Welche Fragen sind aufgetaucht?
Einige Diagnosezentren stellen auf ihren Homepages ausführliche Anamnesebögen und/oder Fragenkataloge zum Download zur Verfügung, die als Richtschnur genutzt werden können, um sich beispielsweise im Vorfeld nochmals über wesentliche Fakten zur Entwicklung des Kindes Gedanken zu machen bzw. diese in Erfahrung zu bringen und hier bereits zu Beginn der Untersuchung nicht (vermeintlich) in Verlegenheit zu geraten. Weiterhin sollten sich Eltern ggf. während oder im Anschluss der einzelnen Diagnosetermine offene Punkte und Fragestellungen zeitnah notieren, die dann beim Folgetermin ggf. ergänzt oder auch geklärt werden können. Auch sollten sie sich währenddessen niemals scheuen, immer wieder Rückfragen und Verständnisfragen zu stellen, bis sie als Eltern den Eindruck haben, dass sie alles verstanden haben und für sie die Abläufe klar und nachvollziehbar erscheinen. Dies gilt für Eltern insbesondere in Bezug auf die Äußerung von Verdachts- und/oder Ausschlussdiagnosen, um sich hier einen guten Überblick über die nächsten Schritte zu verschaffen und womöglich aufkeimende Ängste, Befürchtungen und Unsicherheiten zu reduzieren.
Ist die Diagnose »Autismus-Spektrum-Störung (ASS)« am Ende des Weges dann verifiziert, beginnt für Eltern häufig die konkrete Auseinandersetzung mit und Verarbeitung derselben, ein Prozess, der mitunter für alle Beteiligten unterschiedlich verlaufen und (emotional) sehr kräftezehrend sein kann.
Neben zahlreichen Diskussionen, Zweifeln an der Richtigkeit der Diagnose, guten »Rat-Schlägen« und anhaltenden Kritiken an der eigenen Erziehungskompetenz, sehen sich die Eltern im Alltag – trotz Diagnose – damit weiterhin mit Unverständnis, Intoleranz und dem Halbwissen Dritter konfrontiert, was sie wiederum in Erklärungs- und Rechtfertigungsnöte bringt, obwohl sie sich in der Anfangsphase selbst noch auf »neuem Terrain« befinden und nicht auf jede Frage unmittelbar eine Antwort oder gar eine Lösung parat haben. Nur weil es nun eine Diagnose gibt, ändert sich damit nicht automatisch auch das Verhalten des Kindes, so dass dieses weiterhin in seinem Umfeld auf Irritation und Ablehnung stößt. Eltern sehen sich deshalb spätestens zu diesem Zeitpunkt mit der Forderung zum sofortigen Handeln konfrontiert und werden dabei noch zusätzlich von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt, was die Situation für alle Beteiligten sicherlich nicht einfacher macht (Hack, 2023, S. 14 f).
Eltern sollten sich in diesem Kontext vor allem die Zeit nehmen, die sie für sich individuell benötigen, sich dabei nicht unter Druck setzen lassen und von den Erwartungen Dritter gut abgrenzen, um die nächsten Schritte für sich und ihr Kind adäquat zu planen, zu organisieren und umzusetzen. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollten sie sich auch nicht davor scheuen, konkrete (psychosoziale/therapeutische) Unterstützung in Anspruch zu nehmen, die insbesondere der persönlichen Entlastung, Trauerarbeit und familiären Neuausrichtung dienen kann. Diese Anlaufstellen müssen nicht in erster Linie zwingend Autismus-spezifisch ausgerichtet sein, da es im ersten Schritt um die individuelle Stärkung und Stabilisierung der Eltern geht, um einen konstruktiven Umgang mit der neuen Ausgangssituation zu ermöglichen und kreative Lösungswege zu entwickeln. Das Einholen von Informationen sowie die Kontaktaufnahme beispielsweise zu Regionalverbänden (▸ Kap. 2.5.5), Selbsthilfegruppen (▸ Kap. 2.5.6) und/oder sozialen Netzwerken kann für viele Familien ein weiterer möglicher Ansatzpunkt sein, um einen Einstieg in die Thematik und das Hilfesystem zu erhalten und (niedrigschwellig) konkrete Unterstützung und Entlastung zu erfahren.
1.2 Besonderheiten in der Erziehung autistischer Kinder
Wie im vorangegangenen Abschnitt (▸ Kap. 1.1) bereits dargestellt, ist die Diagnostik des Kindes für die betroffenen Familien ein erster wichtiger Schritt, der für sich allein genommen jedoch im Familienalltag im Regelfall nicht ausreichend bzw. wenig hilfreich erscheint, so dass der Leidensweg für alle Beteiligten noch lange nicht zu Ende ist. Denn nun stehen die Familienmitglieder erneut vor unbekannten Aufgaben, Herausforderungen und innerfamiliären Belastungen, für deren Bewältigung ihnen zu diesem Zeitpunkt häufig das Fachwissen, die erforderliche Handlungskompetenz und/oder die Ressourcen fehlen, was wiederum die Notwendigkeit zeitnah passgenaue Hilfe und Unterstützung für sich in Anspruch zu nehmen mit sich bringt (▸ Kap. 1.3).
Nur weil das »Problem« nun einen Namen hat, ist es leider noch lange nicht gelöst (Hack, 2023, S. 13).
Der Zeitpunkt der Autismus-Diagnose des Kindes stellt dabei für betroffene Eltern meist ein sehr einschneidendes Lebensereignis dar, welches durchaus mit äußerst ambivalenten Gefühlen einhergehen kann (z. B. völlige Erleichterung vs. tiefgreifende Trauer) und zunächst von den einzelnen Familienmitgliedern individuell verarbeitet werden muss. Die Trauer über die (dauerhafte) Beeinträchtigung des Kindes, die Akzeptanz der Diagnose sowie die daraus resultierenden Schritte und/oder Konsequenzen für die Familie geschehen dabei nicht zu einem fixen Zeitpunkt, sondern unterliegen einem individuellen Prozess, der durchaus lange andauern kann, da sich das komplette Familiensystem schlichtweg neu (er)finden muss.
Neben dem Umgang mit (unliebsamen) Gedanken und Gefühlen in Bezug auf das autistische Kind/Geschwister und dessen Verhalten, vor allen in Spannungs-, Konflikt- und Überforderungssituationen, muss das Thema Autismus-Spektrum in Verbindung mit den individuellen Besonderheiten des betroffenen Familienmitgliedes von allen Beteiligten intensiv und altersadäquat durchdrungen, erarbeitet und verstanden und Erziehung/Beziehung damit schlichtweg neu erlernt werden.
Eltern autistischer Kinder merken in der Regel bereits sehr früh, dass herkömmliche Erziehungsmethoden wirkungslos zu sein scheinen und das eigene, intuitive Erziehungsverhalten bei ihren Kindern häufig dauerhaft nicht zu den gewünschten Ergebnissen bzw. Erfolgen führt. So benötigen Kinder im Autismus-Spektrum nicht nur ein besonderes Verständnis für ihre speziellen Problemlagen und Verhaltensweisen sowie adäquate Strukturen und Rahmenbedingungen, sondern auch einen anderen Zugang und Blick auf ihre Welt, um ihnen im Alltag effektive Unterstützung und Hilfestellungen zu geben und sie in ihrer Entwicklung zu fördern (Hack, 2023, S. 18).
Da autistische Kinder häufig auf vorhandenes Erziehungswissen der Eltern anders, als erwartet reagieren bzw. deren Verhalten trotz erzieherischer Strategien nur bedingt beeinflussbar scheint, sinkt infolgedessen auch das Selbstwirksamkeitserleben der betroffenen Eltern, die ihre eigene Rolle neu definieren müssen und eigene Kompetenzen mitunter vermehrt in Frage stellen.
Hinzu kommt, dass die Kompetenzen sowie die Herausforderungen autistischer Kinder nach Funke (2023) individuell sehr unterschiedlich sind und sich im Tagesverlauf sowie über Monate und Jahre immer wieder verändern, was die Planbarkeit und Vorhersagbarkeit möglicher Entwicklungsschritte deutlich erschwert und Familien häufig im Ungewissen zurücklässt.
Besitzt mein Kind diese Fähigkeit »noch« nicht oder wird es sie eventuell niemals erwerben? Soll ich weiterhin an diesem Punkt dranbleiben und Geduld haben oder überfordere ich mein Kind damit dauerhaft? Wird mein Kind später überhaupt allein zurechtkommen oder wird es womöglich ein Leben lang auf Hilfestellungen angewiesen sein?