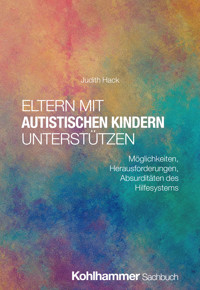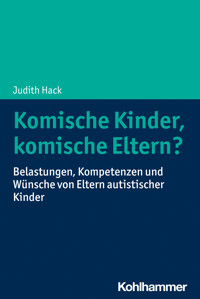
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Erziehung autistischer Kinder stellt an betroffene Eltern besondere Herausforderungen und bringt sie oftmals im Alltag an ihre emotionale und praktische Belastungsgrenze. Wenn das Verhalten ihrer Kinder in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stößt, werden Eltern mit Vorwürfen über fehlgeschlagene Erziehung, mangelnde Erziehungskompetenzen oder auch fehlende Kooperationsbereitschaft konfrontiert, obwohl sie im Hinblick auf ihr autistisches Kind selbst eine Expertenrolle innehaben. Um ihren Kindern eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, handhaben Eltern viele Dinge im Alltag bewusst "anders" und geraten deshalb nicht selten in Erklärungs- und Rechtfertigungsnöte, werden als widerständig, wunderlich oder auch unbelehrbar wahrgenommen. Ihre alltäglichen Leistungen, persönlichen Ressourcen, individuellen Wünsche und Bedarfe geraten dabei jedoch in den Hintergrund. Dieses Buch bietet allen Beteiligten Erklärungsmodelle, um mehr Verständnis für die Eigenarten innerhalb dieser Familiensysteme zu erzeugen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Judith Hack, Dipl. Sozialarbeiterin (FH) und selbst Mutter eines autistischen Kindes, berät in eigener Praxis Angehörige und Fachkräfte und bietet Vorträge und Schulungen zum Thema Autismus-Spektrum an.
Judith Hack
Komische Kinder, komische Eltern?
Belastungen, Kompetenzen und Wünsche von Eltern autistischer Kinder
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-042106-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-042107-3
epub: ISBN 978-3-17-42108-0
Inhalt
Einleitung
1 Herausforderndes und Beachtenswertes im Familienalltag: Was Familien mit autistischen Kindern alltäglich leisten
1.1 Diagnose – und dann?
1.1.1 Aufklärung des Umfelds, Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck
1.1.2 Umgang mit (unliebsamen) Gedanken und Gefühlen
1.1.3 Autismus verstehen lernen, Erziehung neu lernen
1.2 (Verhaltens-)Besonderheiten des Kindes
1.2.1 Der andere Blick auf die Welt
1.2.2 Overload, Meltdown, Shutdown
1.2.3 Leidensdruck und Stimmungsschwankungen
1.2.4 Nähe und Distanz
1.2.5 Personelle Fixierung
1.2.6 Kommunikation
1.2.7 Essensgewohnheiten
1.2.8 Motorische Ungeschicklichkeit und mangelnde Kraftdosierung
1.2.9 Umgang mit Grenzüberschreitungen
1.2.10 Routinen, Rituale und Wiederholungen
1.2.11 »Darfs vielleicht a bisserl mehr sein?«
1.2.12 Wunsch nach Freundschaften vs. sozialer Überforderung
1.2.13 Die Familie als sicherer Hafen, Tankstelle und Blitzableiter
1.2.14 Jedes Verhalten hat seinen Grund!
1.2.15 Das Geschenk autistischer Kinder
2 Zur Situation nicht-autistischer Geschwisterkinder: »Wer kümmert sich um mich?«
2.1 Geschwisterrivalität
2.2 Überforderung
2.3 Schuldgefühle
2.4 Leidensdruck
3 Herausfordernde Kinder oder herausgeforderte Gesellschaft? Familiäre Herausforderungen im gesellschaftlichen Kontext
3.1 Herausfordernde Gesellschaft?
3.1.1 Worte schaffen Wirklichkeiten
3.1.2 »Der Junge hat doch überhaupt nichts!«
3.1.3 Grenzverletzungen
3.1.4 Sanktionen und negative Konsequenzen
3.1.5 Rufe nach Selbstständigkeit
3.1.6 Sozialer Rückzug bis hin zur Isolation
3.2 Umgang mit Behörden und anderen Hilfesystemen
3.2.1 Machtkämpfe und gegenseitiges Kräftemessen
3.2.2 Nicht überall, wo Fachkraft draufsteht, ist auch Fachkraft drin!
3.3 Herausforderung inklusive Beschulung: Das Kind geht auf eine Regelschule, dann muss es sich auch wie ein/e Regelschüler/in verhalten!
3.3.1 Inklusion in Deutschland
3.3.2 Herausforderungen des Schulalltags
3.4 Innere Haltung und Situationsbewertung
3.5 Die Pandemie
4 Auswirkungen auf das Familiensystem: Warum verhalten sich Eltern autistischer Kinder so »komisch«?
4.1 Kämpferische, widerständige, unkooperative, schwierige, anmaßende und besserwisserische Eltern?
4.2 Wünsche von Eltern autistischer Kinder
Schlussbemerkung
Nachwort der Autorin
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Erziehung autistischer Kinder stellt an alle Familienmitglieder besondere Herausforderungen, die sie im Alltag nicht selten an die Grenzen ihrer emotionalen und praktischen Belastbarkeit führen. Wenn das Verhalten autistischer Kinder in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stößt und sich die Eltern den Vorwürfen über fehlgeschlagene Erziehung, mangelnder Erziehungskompetenzen oder auch fehlender Kooperationsbereitschaft ausgesetzt sehen, kommen sie oftmals (ungewollt) in eine Erklärungs- und Rechtfertigungssituation gegenüber den Kritiker/innen und Fachleuten, obwohl sie im Hinblick auf ihr autistisches Kind selbst eine Expert/innenrolle innehaben.
Sie verstehen damit im besten Fall die Besonderheiten ihres Kindes und erkennen meist auch die Motive und Bedürfnisse dahinter, weshalb sie viele Dinge im Alltag bewusst »anders« handhaben und für Außenstehende scheinbar immer wieder zu »ungewöhnlichen« und »unerklärbaren« Maßnahmen greifen, um ihrem Kind im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Nicht selten gehen sie in diesen Zusammenhängen auch mit Außenstehenden direkt in Konfrontation, um ihre Kinder vor Übergriffen zu schützen und für dessen Rechte zu kämpfen. Betroffene Eltern werden deshalb im Kontakt mit der Außen- und Fachwelt häufig als »schwierig«, »widerständig« oder »unbelehrbar« wahrgenommen, ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen erscheinen verwunderlich, werden (schonungslos) kritisiert, falsch gedeutet oder zumindest in Frage gestellt, was den Alltag der Familien jedoch noch zusätzlich belastet.
Demzufolge verhalten sich nicht nur autistische Kinder irgendwie »komisch«, sondern auch das Verhalten ihrer Eltern erscheint in zahlreichen Situationen »komisch« und damit nicht immer nachvollziehbar, worauf der Buchtitel bereits anspielen soll. In diesem Kontext wird »komisch« einerseits im Sinne von »ungewöhnlich«, »eigenartig« oder »bizarr« verstanden, da das Verhalten und die Motive der Kinder und deren Eltern oder auch ihr direkter Umgang mit diesen bzw. der hohe Aufwand, der alltäglich um diese Kinder herum betrieben wird, nicht verstanden und deshalb kritisiert werden. Anderseits kann »komisch« jedoch auch als »lustig«, »witzig« oder »drollig« übersetzt werden, da das befremdliche Verhalten der Kinder von Außenstehenden aus Unwissen nicht selten auch ins Lächerliche gezogen wird. Auch die Reaktions- und Verhaltensweisen der Eltern und Geschwisterkinder erscheinen in manchen Situationen auf den ersten Blick für Außenstehende »belustigend« und können in diesem Zusammenhang für Dritte durchaus zum abendfüllenden Gesprächs- und Lästerthema werden.
Eltern autistischer Kinder haben gerade hierfür häufig äußerst sensible Antennen, weshalb sie dieser Aspekt auch innerlich sehr zerreißen kann. Dennoch gehen sie in diesem Kontext – nicht zuletzt mangels eigener Ressourcen oder fehlender Erfolgschancen – kaum in Konfrontation, sondern ziehen sich zunehmend mit ihren Kindern aus der Öffentlichkeit zurück, was ihren Kritiker/innen jedoch schlimmstenfalls den Nährboden für weiteren Spott, weitere Kritik und auch weitere Spekulationen bereitet, so dass es Eltern am Ende im Prinzip nie richtig machen können.
Das vorliegende Buch hat deshalb zum Ziel, das Schweigen vieler Familien mit autistischen Kindern zu durchbrechen und anhand von Fallbeispielen deren individuelle Herausforderungen, Belastungen, aber auch ihre alltäglichen Leistungen, ihre persönlichen Ressourcen und Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen, die im gesellschaftlichen Kontext häufig nicht gesehen, erkannt, verstanden oder berücksichtigt werden. Da diese auf Seiten der Eltern aus verschiedensten Gründen meist nicht offen thematisiert werden, bleiben sie innerfamiliär eher im Verborgenen und erscheinen damit für andere unsichtbar. Denn Tatsache ist, dass das Thema Autismus-Spektrum von vielen Menschen nach wie vor nicht richtig verstanden wird und die zahlreichen Auswirkungen auf das Familiensystem demzufolge auch häufig völlig unterschätzt oder gar bagatellisiert werden, so dass in diesem Bereich noch viel Aufklärung notwendig ist.
Neben der Offenlegung und Aufklärung, soll das Buch noch Verständnis für die (vermeintlichen) Eigenarten im Verhalten und in den Handlungen innerhalb dieser Familiensysteme erzeugen und Angehörige, Personen aus dem näheren Umfeld der Familie, aber auch Fachkräfte dafür sensibilisieren, warum diese Familien viele Dinge anders machen, anders denken und sich in vielen Situationen auch anders verhalten. Ferner möchte es durch den fachlichen und persönlichen Hintergrund der Autorin eine Brücke zwischen Eltern, autistischen Menschen und der Fachwelt schlagen, um damit eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche, vertrauens- und verständnisvolle Zusammenarbeit zu schaffen.
Das Buch soll somit letzten Endes auch zum Nachdenken anregen, indem es Themen anspricht, über die Familien mit autistischen Kindern selten offen sprechen, aus Scham, Ohnmacht oder auch Hilflosigkeit, und um den Blick für Autismus-spezifische (Verhaltens-)Besonderheiten zu schärfen. Dies vermag wiederum bestenfalls dazu beitragen, dass bei der nächsten (herausfordernden) Begegnung nicht vorschnell geurteilt, sondern einfach nachgefragt und den einzelnen Familienmitgliedern bei Bedarf adäquate Unterstützung angeboten wird.
Damit richtet sich das vorliegende Werk insbesondere an Elternteile, Verwandte, Bekannte und Freund/innen aus dem Umfeld betroffener Familien mit autistischen Kindern, die mit der Diagnose Autismus-Spektrum »hadern«, diese gar anzweifeln und den Eltern im Alltag oftmals aus einem Unverständnis heraus mit (vermeintlich) guten »Rat-Schlägen« zur Seite stehen (wollen). Weiterhin ist es u. a. an Lehrer/innen, Erzieher/innen, Psycholog/innen, Therapeut/innen, Schulbegleiter/innen, Behördenmitarbeiter/innen, sonstige (pädagogische) Fachkräfte und andere am Thema Interessierte adressiert, die sich manchmal über die Verhaltens- und Reaktionsweisen betroffener Eltern und deren autistischen Kinder wundern, diese eventuell sogar insgeheim in Frage stellen und nach möglichen Erklärungsmodellen suchen.
Denn nur ein besseres Verständnis der Thematik vermag das Leben vieler Familien mit autistischen Kindern erheblich zu vereinfachen, nachhaltige Veränderungen zu bewirken und ihnen letztlich eine wahrhafte Teilhabe am Leben innerhalb der Gesellschaft zu ermöglichen.
In diesem Kontext beschäftigt sich Kapitel 1 (Kap. 1) mit den zahlreichen Herausforderungen des Familienalltags, indem es zunächst auf die Diagnose (Kap. 1.1) und anschließend auf ausgewählte (Verhaltens-)Besonderheiten autistischer Kinder (Kap. 1.2) näher eingeht.
Kapitel 2 (Kap. 2) rückt dann die besondere Situation nicht-autistischer Geschwisterkinder in den Mittelpunkt, deren individuelle Belastungen und Einschränkungen sowie die daraus resultierenden Bedarfe häufig auf den ersten Blick gar nicht erkannt und im Familienalltag – mangels persönlicher Ressourcen der Eltern – auch nur selten berücksichtigt werden können.
Kapitel 3 (Kap. 3) stellt anschließend die Herausforderungen der einzelnen Familienmitglieder im gesellschaftlichen Kontext dar, indem insbesondere auf das Verhalten und die Reaktionen Außenstehender (Kap. 3.1) sowie auf Probleme mit Behörden und anderen Institutionen (Kap. 3.2) Bezug genommen wird. Ferner werden in diesem Kapitel noch die Themen »Inklusive Beschulung« (Kap. 3.3), »Innere Haltung« (Kap. 3.4) sowie die Auswirkungen der Pandemie (Kap. 3.5) näher betrachtet.
Kapitel 4 (Kap. 4) gibt zu Beginn nochmals einen zusammenfassenden Überblick über die aus der Behinderung resultierenden Auswirkungen auf das Familiensystem und soll im Anschluss daran auch eine Antwort geben, warum sich autistische Kinder und deren Eltern scheinbar so »komisch« verhalten (Kap. 4.1). Abschließend werden dann noch die Wünsche von Eltern autistischer Kinder dargestellt (Kap. 4.2) und die Gesamtthematik damit abgerundet.
1 Herausforderndes und Beachtenswertes im Familienalltag: Was Familien mit autistischen Kindern alltäglich leisten
Das Leben mit autistischen Kindern stellt alle Familienmitglieder im Alltag vor zahlreiche Herausforderungen, die sie vermehrt an die Grenze ihrer emotionalen und praktischen Belastbarkeit führen und dabei für Außenstehende häufig unsichtbar erscheinen.
Um ihren Kindern eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, wird die Alltagsorganisation aller Familienmitglieder meist vom Verhalten, den Bedürfnissen und dem Stressniveau des autistischen Kindes bestimmt. Das Aushalten eigener Macht- und Hilflosigkeit verbunden mit ambivalenten Gefühlen gegenüber ihren Kindern in Konflikt- und Spannungssituationen, lassen Eltern an sich selbst verzweifeln und ihre eigenen Erziehungskompetenzen dauerhaft in Frage stellen.
Aus Mangel an zeitlichen und persönlichen Freiräumen und Ressourcen kommen Eltern und Geschwisterkinder selbst wiederholt zu kurz und verlieren dadurch ihre individuellen Bedürfnisse völlig aus dem Blick. Statt sich hin und wieder um sich selbst zu kümmern, schlucken sie eigene ambivalente Gefühle herunter, um für das autistische Familienmitglied (vermeintlich) funktionsfähig zu bleiben.
Hinzu kommt, dass sie im Alltag hinter verschlossenen Türen oftmals als »Prellbock«, »Blitzableiter« oder auch als »Tankstelle« des autistischen Kindes fungieren, um es für das Leben da draußen »betriebsbereit« zu halten. Dies kostet sie eine Menge Nerven und Kraft, wird jedoch – aus Angst vor weiterer Kritik, vor Ablehnung oder auch davor, das Gegenüber schlichtweg zu überfordern – selten nach außen hin offen kommuniziert. Im Gegenzug dazu verbringen sie ihre Zeit eher damit ein Lächeln aufzusetzen und anderen auf Nachfrage hin zu versichern, dass sie alles im Griff haben und alles in Ordnung ist.
Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich deshalb zunächst mit dem anstrengenden Weg der Diagnose, um sich anschließend mit einer Auswahl potenzieller (herausfordernder) (Verhaltens-)Besonderheiten des autistischen Kindes auseinanderzusetzen, mit denen die einzelnen Familienmitglieder nahezu täglich konfrontiert sind und umzugehen erlernen müssen. Denn nur so sind sie dauerhaft dazu in der Lage sich den speziellen Herausforderungen des Familienalltags zu stellen und diesen standhalten zu können.
1.1 Diagnose – und dann?
Entwickelt oder verhält sich das eigene Kind (dauerhaft) außerhalb der Norm, wächst bei den betroffenen Eltern meist auch die Sorge und sie sind persönlich bzw. werden auch von Außenstehenden vermehrt dazu aufgefordert, doch mal »genauer hinzuschauen« und möglichst zeitnah zu intervenieren. Steigt dann auch noch der individuelle Leidensdruck aller Beteiligten – insbesondere des betroffenen Kindes und seines familiären Umfelds – wird der Ruf nach einer Diagnostik immer lauter, so dass sich Eltern am Ende auch (scheinbar) nicht länger dagegen wehren können, da ihnen ohne diese viele Hilfesysteme schlichtweg verschlossen bleiben.
Der Entscheidungsprozess
Die Entscheidung für oder gegen eine Diagnostik des Kindes ist für Eltern immer auch ein innerlicher, individueller Prozess, der entsprechend Zeit braucht. Demzufolge wird diese im Regelfall nicht spontan oder leichtfertig getroffen, sondern immer wieder genauestens abgewogen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass die Auffälligkeit nur eine »Phase« ist und sich »das Problem« mit zunehmendem Alter und Reife des Kindes doch noch von selbst auflöst.
Die Befürchtung der Eltern, die ja nicht ganz abwegig erscheint, ist, dass eine Diagnose am Ende auch immer bedeutet, das eigene Kind gegebenenfalls ein Leben lang in eine bestimmte »Schublade zu stecken« oder ihm/ihr (verfrüht) auch einen vermeintlichen »Stempel aufzudrücken«, den es nicht mehr loswird und der ihm/ihr eventuell auch bestimmte Wege oder Möglichkeiten in der Zukunft erschwert oder gar verhindert. Ferner offenbart eine Diagnose meist auch einen weiterführenden Interventionsbedarf, was auf Seiten der Eltern wiederum neue Fragen, Ängste und Unsicherheiten auslösen kann (z. B. die empfohlene Einnahme bestimmter Medikamente).
Da es ohne verifizierte Diagnose in Deutschland jedoch auch keine Hilfsmöglichkeiten oder keinen Anspruch auf Förderung gibt, führt am Ende oftmals kein Weg daran vorbei. Haben sich die Eltern deshalb schließlich für eine Diagnostik des Kindes entschieden, kommen – neben den bereits im Alltag mit der Erziehung des Kindes bestehenden – neue (unbekannte) Anforderungen und Herausforderungen auf sie zu, die sie vermehrt an die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit führen können.
Negative Erfahrungen im (medizinischen) System, wie unter anderem lange Wartezeiten, viele Termine, (fachlich) inkompetente Anlaufstellen, der anhaltend defizitäre Blick auf das eigene Kind, potenzielle Fehldiagnosen, das wiederholte Offenbaren der eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit im familiären System verbunden mit dem ständigen in Frage stellen der eigenen Erziehungskompetenzen und damit auch der Bagatellisierung der geschilderten Auffälligkeiten und Problematiken des Kindes, sind dabei keine Seltenheit und führen auf Elternseite auch immer wieder dazu, die Entscheidung für eine Diagnostik erneut zu hinterfragen oder diese auch wieder abzubrechen.
Steht die Diagnose dann jedoch (endlich) fest, ist der Leidensweg für alle Beteiligten häufig noch lange nicht zu Ende. Nun stehen sie alle erneut vor unbekannten Aufgaben, für deren Bewältigung ihnen zu diesem Zeitpunkt oftmals das Wissen und die Handlungskompetenz fehlen. Nur weil das »Problem« nun einen Namen hat, ist es leider noch lange nicht gelöst.
Trauerarbeit
Der Zeitpunkt der Autismus-Diagnose des Kindes stellt für betroffene Eltern meist ein einschneidendes Ereignis dar und beeinflusst nachhaltig deren Lebensperspektive. Mit der Diagnose beginnt damit häufig auch ein Abschied von der Hoffnung auf ein gesundes und unbeschwert aufwachsendes Kind. So müssen sich alle Familienmitglieder mit der Enttäuschung und Trauer, die mit diesem Abschied verbunden sind, den Folgen und der Bedeutung der Diagnose für die Entwicklung des Kindes sowie den persönlichen Einschränkungen auseinandersetzen, welche die Betreuung und Erziehung voraussichtlich mit sich bringen werden (Sohlmann, 2009). Sie müssen zudem akzeptieren lernen, dass sich der Weg und die Zukunft ihres Kindes womöglich »anders« gestalten wird und sie dessen Entwicklung nur bedingt beeinflussen können.
Persönliche Lebenspläne müssen damit neu geprüft und gegebenenfalls auch aufgegeben bzw. der jeweiligen Familiensituation entsprechend angepasst werden, woraus sicherlich auch Zukunftsängste und Unsicherheiten innerhalb des Familiensystems resultieren können. Gefühle von Wut und Hilflosigkeit über die Unveränderlichkeit der Tatsache, dass das eigene Kind »anders« ist, können aufkommen. Auch Schuldgefühle der Eltern und das Hinterfragen der eigenen Verantwortung an der Situation sind dabei keine Seltenheit.
Die Trauer über die Situation bzw. die Akzeptanz der Diagnose geschieht dabei nicht zu einem fixen Zeitpunkt, sondern unterliegt einem individuellen Prozess. Da die Einschränkungen des Kindes stetigen Einfluss auf die familiären Lebensanforderungen nehmen, kann der Prozess des Annehmens mitunter lange Zeit andauern, aber auch wiederholt im Alltag aktiviert werden.
1.1.1 Aufklärung des Umfelds, Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck
Haben Eltern die Diagnose des Kindes erst einmal verarbeitet und akzeptiert bzw. ist ihrerseits eine erste (konstruktive) Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgt, kann die Diagnose durchaus auch eine Entlastung darstellen, da sie ihnen (und anderen) neue Erklärungsmodelle für das Verhalten des Kindes sowie neue Handlungs- und Förderoptionen eröffnet. Ferner werden die betroffenen Eltern auch ein stückweit – zumindest innerlich – von den Vorwürfen fehlgeschlagener Erziehung oder auch potenzieller Vernachlässigung ihrer Kinder »freigesprochen«, da die Besonderheiten und Auffälligkeiten in der Regel vorrangig im Autismus zu suchen und somit in der Genetik des Kindes begründet sind.
Zu diesem Zeitpunkt gilt es für Eltern nun auch das nähere Umfeld des Kindes, insbesondere die eigene Verwandtschaft, adäquat miteinzubeziehen und entsprechend über dessen individuelle Besonderheiten aufzuklären. Dieser Aspekt geschieht häufig jedoch nicht ohne entsprechende Reibungsverluste und stellt damit eine weitere Herausforderung im Alltag der Eltern dar, die mitunter sehr belastend, frustrierend und kräftezehrend sein kann. Auch scheint es nicht zu jedem Zeitpunkt oder in jeder Situation sinnvoll und förderlich zu sein, den Autismus des Kindes offenkundig zu machen, da diese Thematik beim Gegenüber beispielsweise Berührungsängste oder generelle Vorbehalte auslösen und der »neutrale Blick« auf das Kind dabei verloren gehen kann.
Neben zahlreichen Diskussionen, Zweifeln an der Richtigkeit der Diagnose, guten »Rat-Schlägen« (Kap. 3.1.1) und anhaltenden Kritiken an der eigenen Erziehungskompetenz, sehen sich die Eltern im Alltag – trotz Diagnose – damit weiterhin mit Unverständnis, Intoleranz und dem Halbwissen Dritter konfrontiert, was sie wiederum in Erklärungs- und Rechtfertigungsnöte bringt, obwohl sie sich in der Anfangsphase selbst noch auf »neuem Terrain« befinden und nicht auf jede Frage unmittelbar eine Antwort oder gar eine Lösung parat haben. Nur weil es nun eine Diagnose gibt, ändert sich damit nicht automatisch auch das Verhalten des Kindes, so dass dieses weiterhin in seinem Umfeld auf Irritation und Ablehnung stößt. Eltern sehen sich deshalb spätestens zu diesem Zeitpunkt mit der Forderung zum sofortigen Handeln konfrontiert und werden dabei noch zusätzlich von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt, was die Situation für alle Beteiligten sicherlich nicht einfacher macht. An dieser Stelle wünschen sich Eltern u. a. zeitnah fachlich kompetente Unterstützung, Begleitung und Aufklärung, um sich entlasten, Sicherheit zu erlangen und dauerhaft handlungsfähig bleiben zu können ( Kap. 4.2).
Hinzu kommen die häufig weit verbreiteten (medialen) (Fehl-)Informationen zu der Thematik, die Außenstehenden teilweise ein völlig falsches Bild über das Erscheinungsbild und die Komplexität des Spektrums vermitteln, so dass sich Eltern auch hier entsprechend erklären und rechtfertigen müssen, sollte ihr eigenes Kind nicht auf den ersten Blick diesem Bild exakt entsprechen.
Das herausgeforderte System
Neben der täglichen innerfamiliären Betreuung und Begleitung des autistischen Kindes bewegen sich Eltern mit ihrem Kind innerhalb der Öffentlichkeit in zahlreichen Sub- und Regelsystemen ( Abb. 1.1), die das autistische Kind selbst meist gar nicht auf den ersten Blick erkennen oder auch voneinander unterscheiden kann, so dass es auch die damit verbundene und von ihm geforderte Anpassungsleistung der verschiedenen Systeme gar nicht zu erbringen vermag.
Je nach Intensität, Qualität und auch Häufigkeit der Kontakte und je nach individueller Tagesform, Reizschwelle und Anpassungsfähigkeiten des Kindes, treten auch dessen Besonderheiten und Auffälligkeiten innerhalb dieser Systeme entsprechend unterschiedlich stark auf und werden von den Beteiligten unterschiedlich wahrgenommen, definiert oder auch beurteilt, was für Eltern wiederum nicht immer verständlich erscheint und auf die Dauer auch sehr belastend sein kann.
Außenstehenden hingegen ist diese Vielzahl an Systemen oftmals gar nicht bewusst, da sie das Kind selbst in der Regel nur in ihrem eigenen Bereich für einen begrenzten Zeitraum punktuell erleben, so dass sie niemals das komplette Ausmaß seiner Einschränkungen und Besonderheiten erfahren und damit grundsätzlich auch kein realistisches Urteil über das Kind fällen können. Die Erzählungen der Eltern können hierbei vielfach irritierend auf diese wirken, sofern sie nicht dem Bild entsprechend, welches sie sich selbst von dem Kind gemacht haben. Eltern würden sich an dieser Stelle wünschen, dass man ihren Schilderungen vorbehaltslos vertraut, ohne ihr eigenes Urteil wiederholt in Frage zu stellen ( Kap. 4.2).
Abb. 1.1: Übergeordnetes System eines autistischen Kindes
Hinzu kommt, dass viele dieser aufgeführten Bereiche im Alltag des Kindes eine weitere Überforderung und/oder Belastung darstellen und zusätzlich – z. B. durch mangelndes Verständnis oder Wissen, fehlende Akzeptanz oder Toleranz von »Andersartigkeit«, ungeeignete Strukturen oder Rahmenbedingungen – direkt oder auch indirekt dazu beitragen können, dass sich Auffälligkeiten verfestigen oder unerwünschtes Verhalten zeigt, was die betroffenen Eltern wiederum unter Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck setzt ( Kap. 3).
Die Konsequenz ist häufig, dass Eltern die Anzahl der Auftritte oder Termine ihres autistischen Kindes in der Öffentlichkeit möglichst auf ein Minimum reduzieren, um dieses (und sich selbst) nicht fortwährend zu überfordern. Dies erscheint ihnen jedoch – aufgrund dessen individuellen Einschränkungen – manchmal kaum möglich zu sein. So sind beispielsweise bei vielen Familien – neben der Autismus-spezifischen Förderung – häufig parallel noch zahlreiche weitere Behandlungstermine (z. B. Ergo-, Logo- oder auch Physiotherapie) oder auch zusätzliche (fach-)ärztliche Untersuchungen des autistischen Kindes an der Tagesordnung, die vom Aufwand und in der Menge durchaus für alle Familienmitglieder alltagsbeeinträchtigend und sehr kräftezehrend sein können.
1.1.2 Umgang mit (unliebsamen) Gedanken und Gefühlen
Autistische Kinder stehen – aufgrund ihrer besonderen Bedürfnisse und des daraus resultierenden erhöhten Unterstützungsbedarfs – ihren Eltern häufig auch besonders nahe. Spätestens nach Erhalt der Diagnose erforschen sie ihre autistischen Kinder im Alltag nicht selten bis ins kleinste Detail, um von ihnen zu lernen, sie bzw. ihr Verhalten zu verstehen und sie besser unterstützen zu können. Im Laufe der Zeit wachsen sie (im Idealfall) gemeinsam an den zahlreichen Herausforderungen, die das Leben an sie stellt, und die eigene Sicht auf die Welt verändert sich.
Die Beziehung zwischen Eltern und autistischen Kindern ist deshalb auf der einen Seite häufig durch eine enge Verbundenheit und eine besondere Intensität gekennzeichnet: Ihre Liebe und Freude, ihre Wut und ihr Ärger, ihre Ängste, ihre Sorgen und insbesondere auch ihr Leid treffen sie mitten ins Herz und schweißen sie zusammen.
Aber auch hier liegen – wie so oft – Freud und Leid sehr eng beieinander. Neben der engen Verbundenheit, sind auch Gefühle von Ohnmacht, Macht- und Hilflosigkeit sowie ständige Selbstzweifel und das in Frage stellen der eigenen Elternrolle und Erziehungskompetenzen, Schuld- und Schamgefühle, Gefühle der Überforderung und des Versagens allgegenwärtige Begleiter eines herausfordernden Familienalltags, auch wenn die betroffenen Eltern diese häufig verdrängen und sie möglichst nicht an sich herankommen lassen wollen, da diese sie (womöglich) in ihrer »Funktionsfähigkeit« behindern.
Hinzu kommen ambivalente Gefühle gegenüber dem autistischen Kind selbst, vor allem in Spannungs- und Überforderungssituationen, die sich die betroffenen Eltern selten erlauben, da sie Schuldgefühle erzeugen und mit eigenen Moral- und Wertevorstellungen in Konflikt geraten.
»Manchmal könnte ich dieses Kind…«, »Am liebsten würde ich dieses Kind…« sind nur einige Gedanken, die sich Eltern nicht auszusprechen trauen, da sie befürchten, ihr Umfeld (und sich selbst) damit in eine Ecke zu drängen, in der sie nicht stehen wollen und in die sie auch nicht hingehören.
Indem Eltern diese Gedanken und (unliebsamen) Gefühle jedoch verdrängen, verleugnen und nicht wahrhaben wollen, werden sie mit der Zeit nur noch intensiver oder brechen sich auf andere Weise Bahn, um »gehört« zu werden. Langfristige gesundheitliche Konsequenzen sind dabei keine Seltenheit, welche die Eltern dann jedoch wiederum im Umgang mit oder auch in ihrer Handlungsfähigkeit gegenüber ihren autistischen Kindern stark einschränken können.
1.1.3 Autismus verstehen lernen, Erziehung neu lernen
Eltern autistischer Kinder merken in der Regel bereits sehr früh, dass herkömmliche Erziehungsmethoden wirkungslos zu sein scheinen und das eigene, intuitive Erziehungsverhalten bei ihren Kindern häufig dauerhaft nicht zu den gewünschten Ergebnissen bzw. Erfolgen führt. So benötigen Kinder im Autismus-Spektrum nicht nur ein besonderes Verständnis für ihre speziellen Problemlagen und Verhaltensweisen sowie adäquate Strukturen und Rahmenbedingungen, sondern auch einen anderen Zugang und Blick auf ihre Welt, um ihnen im Alltag effektive Unterstützung und Hilfestellungen zu geben und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.
Eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik sowie ein hohes Maß an Selbstreflektion und Empathie stellen dabei eine wichtige Grundvoraussetzung dar, um den betroffenen Eltern den Umgang mit ihren Kindern im Alltag zu erleichtern, ihnen neue Handlungskompetenzen und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen und damit für nachhaltige Entlastung aller Beteiligten zu sorgen. Erziehung muss somit schlichtweg neu gelernt werden.
Auch bei der meist sehr engagierten und kräftezehrenden Suche nach geeigneten (externen) Hilfs- und Förderangeboten für ihr Kind stoßen die überforderten Eltern häufig an (ihre) Grenzen und werden auf diesem Weg leider noch viel zu oft allein gelassen. So müssen sie sich nach der Diagnose nicht nur das notwendige Wissen und die entsprechenden Wege hierzu selbst aneignen und sich darüber hinaus mit den einzelnen unterschiedlichen Förderansätzen intensiv auseinandersetzen, um wiederum eine wohlüberlegte und gute Entscheidung für ihr Kind treffen zu können. Sie müssen sich darüber hinaus auch noch mit zahlreichen Anträgen und Behördenterminen befassen, um überhaupt eine Kostenzusage und damit auch – mit entsprechenden Wartezeiten – einen Zugang zu diesen Angeboten zu erhalten. So ist es deutschlandweit keine Seltenheit, dass ab der Diagnose noch Jahre vergehen, bis das eigene Kind eine geeignete Förderung erhält, was von den betroffenen Eltern wiederum – trotz begrenzter Ressourcen – immer wieder auch abverlangt im Sinne ihres Kindes aktiv zu werden, zu kämpfen, dranzubleiben und nicht aufzugeben. Ihnen diese Leistung hin und wieder offen anzuerkennen und wertzuschätzen könnte bereits wesentlich dazu beitragen, den persönlichen Blick auf die überforderten Systeme zu verändern und die eigene (kritische) Haltung zu hinterfragen ( Kap. 4.1).
Mit dem Erhalt einer Diagnose ist der Weg der betroffenen Familien damit noch lange nicht abgeschlossen, er hat nur eine neue, bisher unbekannte Abzweigung genommen. Aufgrund der hohen Anforderungen benötigen betroffene Eltern zu diesem Zeitpunkt mehr denn je Verständnis und Wertschätzung, Toleranz und Akzeptanz, professionelle Unterstützung und Begleitung – sowohl bei der Bewältigung von Erziehungs- und Gesundheitsfragen als auch in der emotionalen Auseinandersetzung –, um die kommenden Herausforderungen des Lebens annehmen und dauerhaft gut bewältigen zu können ( Kap. 4.2).
1.2 (Verhaltens-)Besonderheiten des Kindes
Richtet man die Perspektive auf die Verhaltensbesonderheiten autistischer Kinder, so lässt sich zunächst festhalten, dass innerfamiliär eine enorme Bandbreite an herausfordernden und belastenden Verhaltensweisen existiert, deren Ausmaß, Intensität oder auch Vorhandensein für Außenstehende häufig unsichtbar ist bzw. auch nicht gesehen wird. Ferner sind diese Besonderheiten auch immer wieder geprägt von der individuellen Reizschwelle der jeweiligen Familienmitglieder und abhängig von deren persönlicher Tagesform.
So kommt es z. B. wiederholt vor, dass bestimmte Verhaltensweisen des autistischen Kindes, die vielleicht in der Öffentlichkeit bereits als irritierend oder auch herausfordernd wahrgenommen/bewertet werden, für Familienmitglieder völlig normal erscheinen oder auch als »kleineres Übel« hingenommen werden, so dass von dieser Seite keinerlei Reaktion oder Intervention darauf erfolgt. Andere Verhaltensweisen wiederum, die für Außenstehende – z. B. aufgrund des kurzen Kontakts mit dem Kind – als eher wenig belastend oder herausfordernd bewertet werden, können einzelne Familienmitglieder bei deren Auftreten bereits nach kurzer Zeit an den »Rand des Wahnsinns« bringen. Dementsprechend heftig kann auch die Reaktion darauf erfolgen, was bei Dritten wiederum zu Unverständnis und vorschnellen Rückschlüssen (»Das arme Kind!«) führt und der eigentlichen Belastungssituation sowie der alltäglichen Leistung aller Familienmitglieder in keiner Weise gerecht wird.
Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich deshalb intensiv mit einigen ausgewählten (Verhaltens-)Besonderheiten autistischer Kinder sowie dem exemplarischen Umgang der einzelnen Familienmitglieder damit, ohne dass hier ein Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Generalisierbarkeit erhoben wird. Denn so individuell, wie autistische Kinder sind, so individuell können auch ihre (herausfordernden) Verhaltensweisen im Alltag der Familien und letztlich der Umgang aller Beteiligten damit sein.
1.2.1 Der andere Blick auf die Welt
Autistische Kinder haben einen anderen Blick auf die Welt, interpretieren (soziale) Situationen oder auch Worte ihrer Mitmenschen häufig aus einer völlig anderen Logik oder auch Perspektive heraus. Dies führt nicht nur innerhalb des näheren Umfelds oder innerhalb von Institutionen, wie Kindergarten und Schule, immer wieder zu Problemen und Missverständnissen, sondern stellt auch innerfamiliär – trotz Verständnis und verstärkter Rücksichtnahme – eine Herausforderung dar, die nicht selten alle Beteiligten schlichtweg verzweifeln lässt.
Der Blickwinkel des autistischen Kindes ist dabei häufig – nicht zuletzt beeinflusst durch zahlreiche negative Erfahrungen aus dessen Vergangenheit – von außen betrachtet äußerst pessimistisch und defizitorientiert, was für Eltern und Geschwister emotional sehr herausfordernd sein kann und sie manchmal auch innerlich zu zerreißen droht, weil sie den Leidensdruck des Kindes dahinter spüren und es für sie selbst auf die Dauer kaum auszuhalten scheint.
Jeglicher Versuch auf Elternseite dieser Denkweise einen neuen (positiven oder auch neutralen) Rahmen bzw. Impuls zu geben, um das soziale Verständnis des Kindes zu fördern und die Dinge vielleicht auch mal »anders« zu sehen, zu fühlen bzw. mit ihren Augen wahrzunehmen, erscheinen im Familienalltag häufig gänzlich kontraproduktiv und führen auf Dauer eher dazu, dass sich das betreffende Kind auf dieser Welt noch unverstandener, ungeliebter oder auch noch weniger als Mensch respektiert oder gewollt fühlt. Infolgedessen führen diese Versuche nicht selten zu einer weiteren zwischenmenschlichen Eskalation, da das autistische Kind – trotz eigener Anstrengung – kaum in der Lage ist, von seinem Standpunkt abzurücken und damit seine eigene Sicherheit, Orientierung und Struktur ins Wanken zu bringen.
Dabei ist es meist gar nicht das Ziel vieler Eltern ihren Kindern die angebotene »Denkweise« ungefragt aufzustülpen, damit es diese mechanisch übernimmt, sich bedingungslos anpasst und für die Gesellschaft dauerhaft besser funktioniert. Die Hinweise oder Erklärungen dienen letztlich nur dazu, ihm das Verhalten und die Reaktionen der anderen verständlich und damit auch die Welt ein bisschen weniger bedrohlich erscheinen zu lassen.
Neben der gesellschaftlichen Aufklärung über das Thema Autismus-Spektrum braucht es auch für autistische Kinder immer wieder einen (vorurteilsfreien und respektvollen) Raum, in dem ihnen die »neurotypische« Welt mit Herz und Verstand (im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten und Ressourcen) erklärt und offenbart wird, um damit dauerhaft Ängste abzubauen, Ordnung und Orientierung zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden.
Diese Aufklärung findet nicht zuletzt im Wesentlichen innerhalb der Familien statt, ist jedoch mitunter für Eltern und Geschwister zeitweise sehr anstrengend, frustrierend und kräftezehrend, da es von ihnen wiederum viel Geduld, Ausdauer und einen langen Atem abverlangt.