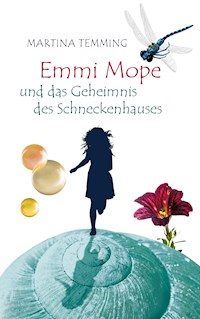
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Fünf Kinder verschwinden während eines Badeausflugs wie vom Erdboden, und nirgends findet sich auch nur der geringste Hinweis. Viele Monate später stößt die 12-jährige Emmi Mope, die schüchterne Außenseiterin des Dorfes, auf ein mysteriöses Schneckenhaus und entdeckt daran unerklärliche Spuren der verschollenen Kinder. Unverhofft gerät sie nun nicht nur in ein verborgenes magisches Reich, sondern auch fast in die Fänge des grausamen Königs, der dort herrscht. Auf ihrer verzweifelten Suche nach dem Ausgang kreuzen zwielichtige und gefährliche Gestalten Emmis Weg. Jedoch trifft sie auch unerwartet freundliche Wesen und findet neue Verbündete. Gemeinsam mit ihnen stellt Emmi sich mutig den vielen Aufgaben und Gefahren, bei denen ihr immer wieder ein kleiner Glücksbringer auf magische Weise hilft. Und für Emmi ist die Zeit gekommen, zu erkennen, was wirklich in ihr steckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Martina Temming wurde 1972 in Gelsenkirchen geboren. Die Leidenschaft für Bücher und Geschichten begleitet sie bereits seit frühester Kindheit. Beruflich schlug sie mit einem Wirtschaftsstudium und Tätigkeiten im Marketing einen völlig anderen Weg ein und widmete sich erst später dem Schreiben eigener Kinder- und Jugendbücher. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Essen.
Für Klara
Kapitel 1 Die verschwundenen Kinder
Kapitel 2 Die Spur
Kapitel 3 Der Eingang
Kapitel 4 Fallen und Landen
Kapitel 5 Die erste Welt
Kapitel 6 Die erste Begegnung
Kapitel 7 Der Durchgang
Kapitel 8 Die Steinwelt
Kapitel 9 Der erste Gefährte
Kapitel 10 Die Wasserwelt
Kapitel 11 Freund oder Feind
Kapitel 12 Beinahe ein Schlaraffenland
Kapitel 13 Der Kompass
Kapitel 14 Lichter in dunkler Nacht
Kapitel 15 Wieder vereint
Kapitel 16 Sieg und Niederlage
Kapitel 17 Der Ausgang
Kapitel 18 Die Zusammenkunft
Kapitel 19 Eine andere Geschichte
Kapitel 20 Der Neuanfang
Kapitel 1
Die verschwundenen Kinder
Kalter, dicker Regen klatschte wie nasse Handtücher an die Fenster. Emmi fühlte sich so furchtbar, als ob gar keine Fenster die Kälte abhielten und es direkt auf ihre Haut regnen würde. Nein, sogar als ob es in sie hinein regnete. Sie kauerte in der Ecke ihres Bettes unter der Dachschräge und versuchte, an nichts zu denken. An etwas Schönes zu denken hatte sie schon längst aufgegeben, es funktionierte sowieso nicht. Bei dem, was ihr durch den Kopf ging, wäre „nichts“ schon ein gutes Resultat gewesen. Aber selbst das vermochte ihr angesichts der Tage, die hinter ihr lagen, nicht gelingen. Und heute, am schrecklichen Höhepunkt der Ereignisse, war sie wie gelähmt und den dunklen, kreisenden Gedanken hilflos ausgesetzt.
Heute, am späten Vormittag des 15. Novembers, hatte das ganze Dorf Little Aspen an einem „Begräbnis“ von fünf Kindern aus Emmis Nachbarschaft teilgenommen – und das, obwohl keines der Kinder jemals tot aufgefunden worden war. Streng genommen hatte sogar niemand auch nur die geringste Ahnung, was den Kindern eigentlich zugestoßen sein könnte. Sie waren einfach wie vom Erdboden verschluckt.
Vor inzwischen gut 15 Monaten nahm die Tragödie ihren Anfang, an einem Bilderbuchtag Ende Juli mit Sonnenschein, Schäfchenwolken und einer Luft wie samtene Schmetterlingsflügel. Am Nachmittag dieses Tages waren die fünf Kinder zum Baden in der Furt des kleinen Flusses Shanding wenige Hundert Meter südlich des Dorfes aufgebrochen. Als sie nach Einbruch der Dunkelheit noch immer nicht aufgetaucht waren, machten sich deren Familien zusammen auf den Weg zur Furt, um die Kinder zu suchen – allerdings vergeblich. Auch Zeichen für einen Unfall oder Überfall waren nirgends zu finden. Abgesehen von den Familien machten sich in Kürze auch die Nachbarn auf die Suche im Umkreis des vermutlich letzten Aufenthaltsortes der Kinder. Nur die ganz Alten und Gebrechlichen blieben zu Hause und taten das ihnen Mögliche, indem sie sich gegenseitig Mut und Hoffnung zusprachen und beteten. Als Einziger blieb wie immer der alte, stets griesgrämige und allen etwas unheimliche Mr. Brutus Blacksabbath für sich und schloss sich in seinem windschiefen Häuschen am Dorfrand ein – nicht ohne zuvor in seiner quäkenden Stimme übelste Prophezeiungen von Tod, Verletzung und Unheil hervorzustoßen, wodurch die ohnehin angstvolle Atmosphäre noch angeheizt wurde.
Eng beieinander durchkämmten die Dorfbewohner Stunde um Stunde die Wälder und Felder, aber nirgendwo fand sich eine nennenswerte Spur. Lediglich ein paar auf dem Weg zur Furt verstreute Stückchen roten Glanzpa piers deuteten darauf hin, dass die Kinder diesen Weg am Nachmittag überhaupt genommen hatten. Billie, die Kleinste der Fünf, fürchtete sich seit jeher davor, sich zu verirren und hatte die Gewohnheit entwickelt, jeden längeren Weg mit Markierungen zu kennzeichnen – und seit ihre Mutter ihr das Märchen von Hänsel und Gretel vorgelesen hatte, verzichtete sie wie bis dahin üblich darauf, die Brösel ihres Pausenbrots zu benutzen. Stattdessen trug sie immer einen Fetzen Papier für diese Zwecke mit sich.
Bis in die frühen Morgenstunden dauerte die Suche, bevor die ersten erschöpften Helfer zu einem wenig erholsamen, von beängstigenden Träumen durchzogenen Kurzschlummer in ihre Häuser zurückkehrten. Von da an wechselten sich die Dorfbewohner bei der Suche ab und ruhten sich in Schichten aus. Diejenigen, die nicht mehr gut zu Fuß waren, sorgten für Getränke und Essen oder nahmen Kontakt zu Freunden und Bekannten in der Umgebung sowie Zeitungsredaktionen und Radiosendern auf, um Suchaufrufe und Personenbeschreibungen durchzugeben. In jedem Aufruf wurde neben dem Aussehen und der Kleidung der Kinder zum Zeitpunkt des Verschwindens auch auf die roten Glanzpapierschnipsel hingewiesen, die einen Anhaltspunkt zu möglichen Aufenthaltsorten oder Wegen der Kinder liefern konnten.
Zu Beginn klammerten sich die verzweifelten Familien und die mitleidenden Nachbarn und Freunde an die Hoffnung, die Kinder seien in einer Anwandlung von Übermut zu einer Abenteuerwanderung aufgebrochen. In den darauffolgenden Tagen redeten sich alle in beschwörender Verbissenheit ein, die Kinder würden sich bestimmt erst einmal nicht nach Hause zurücktrauen, aus Angst vor Strafe. Von Tag zu Tag sank jedoch die Hoffnung, die Kinder wieder wohlbehalten aufzufinden. Keiner der inzwischen landesweiten Suchaufrufe brachte irgendwelche brauchbaren Hinweise ein. Die Gegend um das Dorf herum war inzwischen so oft und nach jedem noch so kleinen Versteck oder nach jeder noch so verborgenen Falle durchforstet worden, dass kein Fleckchen Erde mehr übrig blieb, an dem die Kinder hätten sein können. Und auch die intensive Fahndungsarbeit der Polizei blieb erfolglos.
Stockend begann das Leben im Dorf, wieder in seine Bahnen zurückzukehren. Nachbarn und Freunde gingen wieder zur Arbeit, erledigten ihren Haushalt und schickten die Kinder in die Schule. Die Stühle der verschwundenen Kinder wurden beiseite gestellt und neue Sitzordnungen vergeben. Weihnachten, Ostern und dann auch der schmerzliche Jahrestag des Verschwindens kamen und gingen. Alle griffen den betroffenen Familien so gut wie möglich unter die Arme. Dennoch zogen diese sich immer weiter von den anderen zurück, da sie deren Wunsch nach Normalität und Alltag zwar verstanden, aber nicht ertragen konnten.
Mehr als ein Jahr nach dem tragischen Ereignis, einem windigen Tag Anfang November mit tiefhängender Wolkendecke und trübem Licht, trafen sich die Eltern aller verschwundenen Kinder mit steinernen Mienen und vom vielen Weinen ausgetrockneten Augen im Haus von Mr. Patterson. Er hatte an diesem verhängnisvollen Sommertag seine Tochter Charlene, wegen ihres hohen gackernden Lachens auch „Chickie“ genannt, verloren. Keiner wagte, das erste Wort zu sprechen, doch alle fühlten, dass sie heute eine Entscheidung treffen würden, ja, treffen mussten, um nicht den Verstand zu verlieren und vor allem, um irgendwann wieder am Leben teilnehmen und Kraft für die verbliebenen Kinder und Angehörigen haben zu können. Und als würden Ausnahmesituationen auch die üblichen Rollenverteilungen über den Haufen werfen, meldete sich als Erstes die sonst so wortkarge Mrs. Catty zu Wort.
„Wenn ich noch länger darauf warte, dass Paulus nach Hause kommt, obwohl ich eigentlich weiß, dass dies nicht geschehen wird, wird mein Herz in der Mitte durchreißen“, flüsterte sie. „Dann wird Maisie nicht nur ihren Bruder, sondern auch ihre Mutter verloren haben. Und dass, wo ihr Dad sowieso schon so früh…“.
Vergeblich versuchte sie, diesen Satz zu Ende zu bringen, aber ihre Stimme zerbrach wie Porzellan in kleinste Scherben. Mr. Patterson verzog schmerzlich das Gesicht. Auch für ihn war es nicht der erste schlimme Verlust. Vor knapp 10 Jahren hatte Mrs. Patterson mit der Erklärung, es würde ihr in diesem Dorf zu eng, ihn und die Kinder verlassen. Und nun hatte er auf tragische Weise das zweite Mitglied seiner Familie verloren.
Nacheinander hoben alle Anwesenden die bis dahin zu Boden oder in die Ferne gerichteten Blicke und sahen sich an. Die Stille dehnte sich wie ein Hefeteig aus, und als die Anspannung fast nicht mehr zu ertragen war, stolperten Mr. McFinn die Worte fast ohne sein Zutun aus dem Mund.
„Sie kommen nicht wieder“, krächzte er. „Das spürt ihr doch auch, oder? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was passiert sein könnte, aber ich fühle, das Eric…nicht mehr in dieser Welt ist.“
Einen Moment lang war es, als ob die Zeit stehen geblieben sei, dann rastete sie wieder ein und mehrere Dinge geschahen gleichzeitig. Mrs. Mirron, die Mutter der kleinen Billie, knickte in den Knien ein und stieß einen Laut aus wie ein verletztes Käuzchen. Mr. Mirron fing seine Frau auf und setzte sie dann auf dem Boden ab, da er selbst keine Kraft hatte, um sie zu halten. Mr. Patterson brüllte wie ein Löwe und stürzte sich mit geballten Fäusten auf Mr. McFinn, aber Mr. Lufferton, der Vater von Barney, packte ihn bei den Schultern und hielt ihn mit Gewalt fest. Mrs. Catty entfuhr ein erneuter Schluchzer und Mrs. McFinn wandte sich in einer abgehackten Drehung zum Fenster und drückte Stirn und Hände dagegen, als ob sie die Scheibe herausdrücken wollte.
In dieses Durcheinander schnitt Sekunden später die schrille Stimme von Mrs. Lufferton. „Aber er hat doch recht! Er hat recht, und wir alle spüren dasselbe. Wie oft haben wir es einfach gefühlt, wie es unseren Kindern ging? Wenn sie plötzlich in der Nacht Fieber bekamen, sind wir ohne einen Laut von ihnen aufgewacht und haben nachgesehen, um sie dann glühend heiß in ihren Bettchen vorzufinden. Maureen“, wandte sie sich an Mrs. McFinn, „weißt du noch, du hast mir davon erzählt, dass du einmal zur Schule gelaufen bist, obwohl Eric schon längst allein nach Hause kam. Du hast ihn mit einem verstauchten Fuß in dieser engen verlassenen Gasse am Kirchplatz gefunden, kaum fähig, noch einen Schritt zu laufen. Wir alle haben oft instinktiv gewusst, wenn es unseren Kindern gut geht und wurden unruhig, wenn etwas nicht in Ordnung war. Und jetzt spüre ich…gar nichts! Ich meine, ich spüre mein Kind nicht mehr, als ob jemand diese Verbindung durchgeschnitten hat, mit einem stumpfen, dreckigen Messer, so weh tut dieses Nichts. Und tut nicht so, als wäre es bei euch anders. Wir kennen uns alle schon lange. Wir können uns einfach nicht gegenseitig vormachen, dass einer von uns noch glaubt, das alles hier würde ein gutes Ende nehmen.“
Die letzten Worte verwehten fast mit ihrem Atem, so leise war ihre Stimme geworden. Aber jedes einzelne Wort stand noch einige Momente so klar im Raum, als hätte sie es sichtbar in die Luft geschrieben.
Wieder sagte ein paar Sekunden lang niemand etwas. Aber dann ließ Mr. Lufferton die Hände von Mr. Pattersons Schultern rutschen, sackte in sich zusammen und sah mit einem Mal fast durchsichtig aus, als er mit gebrochener Stimme anfing, zu reden. „Ich wusste es vom Tag des Verschwindens an, dass Barney nicht zurückkommen wird. Es war, als ob ein Wind ihn von der Erde weggeweht hätte, keine Spur von ihm, kein Zentimeter seines Körpers war mehr da. Mein Verstand kann dies nicht fassen, es gibt auch keine passenden Worte hierfür, aber ich spüre es mit absoluter Sicherheit: Er ist fort, oder zumindest an keinem Ort, den irgendwer von uns kennt oder erreichen kann. Selbst den Zwillingen sehe ich an, dass sie so denken, und dabei sind sie erst 9 und haben sicherlich noch nichts Schrecklicheres in ihrem Leben erlebt als Zahnweh.“
Die nach wie vor am Boden kauernde Mrs. Mirron hob den Blick zu Mrs. Catty, mit der sie seit der Schulzeit eng befreundet war. „Ellen…?“, hob sie fragend an, einen Augenblick später nickte Mrs. Catty erst leicht, dann immer heftiger.
Die nächsten Bewegungen machten alle wie auf ein geheimes Kommando, und Sekunden später hielten sich die von ihrer Trauer und ihrer gemeinsamen Erkenntnis bis ins Mark erschütterten Männer und Frauen in einem wilden Knäuel umfangen. Sie wussten nun: Sie alle waren nun Waiseneltern und würden einen Schlussstrich unter die Suche nach ihren Kindern und damit unter ihre Hoffnungen ziehen.
In den folgenden Tagen wurde zunächst die Polizei beauftragt, die Suche nach den Kindern aufzugeben. Auf jegliches Drängen der Polizisten, die Fahndung noch eine Zeitlang aufrechtzuerhalten, reagierten die Eltern übereinstimmend mit entschiedener Ablehnung, so dass die Suche eingestellt wurde. Auch sämtliche Hilfsaufrufe wurden gestoppt und Plakate mit Fotos der Kinder abgehängt. Im Gespräch mit dem Dorfpfarrer wurden die Möglichkeiten einer „personenlosen“ Beerdigung diskutiert. Dieser versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun und zur Not jede geltende Kirchenregel außer Kraft zu setzen oder schlicht zu ignorieren, um den Eltern eine Begräbnisfeier nach ihren Wünschen zu gewähren.
Nachdem der Termin für die Trauerfeier auf den 15. November festgelegt war und auf Wunsch der Eltern das ganze Dorf hierzu eingeladen wurde, bereitete sich in den Tagen davor jeder in Little Aspen auf dieses schmerzliche Ereignis vor. In den Schulen wurden schwarze Tücher aus den Fenstern gehängt, und plötzlich nahmen alle wieder die Leere wahr, die die verschwundenen Mitschüler hinterlassen hatten. Die Lehrerinnen und Lehrer rangen erneut vergeblich um Erklärungen und begnügten sich schließlich mit dem Einzigen, was sie tun konnten: sie hielten Hände, streichelten über Köpfe und tupften Tränen – und saßen dann selbst wie entsetzte Gespenster beisammen im Lehrerzimmer und teilten stumm ihre Trauer.
Für Emmi waren diese Wochen und Monate noch aus anderen Gründen besonders schwer. Ohnehin war sie eine Außenseiterin, da sie erst vor zwei Jahren mit ihrer Mutter ins Dorf gezogen war. Ihre Eltern hatten sich kurz zuvor getrennt. Ihre Mutter trieb bei dem Umzug das Bedürfnis, nach dieser aufreibenden Zeit Ruhe und Frieden außerhalb der gewohnten städtischen Umgebung auf dem Land zu finden. Für die sowieso eher stille Emmi bedeutete dieser Schritt noch mehr Einsamkeit und das Gefühl, völlig entwurzelt zu sein. Die Kinder in der Schule konnten mit ihr nicht viel anfangen. Emmi interessierte sich so gut wie gar nicht für Spiele oder Beschäftigungen, die die anderen Kinder so begeisterten wie Schwimmen, Fußball oder Radfahren. Sie zog es vor, allein stundenlange Spaziergänge zu unternehmen, oder sie verlor sich beim Lesen, Puzzeln oder Basteln aufwändiger Steinchenmosaike.
Ihre größte Leidenschaft war jedoch das Sammeln von Schneckenhäusern. Sie verfügte bereits über eine stattliche Sammlung, die sie in zahllosen Kartons aufbewahrte und alle paar Tage neu sortierte – nach Farbe, nach Fundort, nach Größe und noch nach vielen anderen Merkmalen, die sie sich immer wieder einfallen ließ. Die schönsten Exemplare standen und lagen verteilt auf ihren Regalen, ihrem Schreibtisch und ihrer Fensterbank. Oft schon war sie gefragt worden, was sie denn so an diesen Schneckenhäusern faszinierte. Sie hatte immer nur geantwortet, dass sie sie einfach schön fände. Doch insgeheim spürte sie manchmal eine fast körperliche Sehnsucht nach einem Schneckenhaus für sich selbst. Nach einem Zufluchtsort, in den sie sich – sollte das Leben zu schmerzlich oder gefährlich werden – jederzeit zurückziehen könnte. Dafür würde sie es sogar gern auf sich nehmen, ständig eine Last mit sich herumzutragen, wenn sie dadurch nur über einen stets zugänglichen Schutzraum verfügen würde.
Mit ihrem Aussehen konnte sie zu ihrem Leidwesen auch nicht wirklich punkten. Zwar war ihr Gesicht recht hübsch. Allerdings war sie für ihre 12 Jahre sehr klein und zart und alles andere als sportlich, elegant oder sonst irgendetwas. Ihre glatten dunkelblonden Haare waren auch nichts Besonderes, und ihre grauen Augen hatten seit den familiären Problemen einen noch niedergeschlageneren Ausdruck als es ohnehin schon immer der Fall gewesen war.
Und als sei dies alles noch nicht genug, um zum Außenseiter abgestempelt zu werden, gab es da noch ihren neuen Nachnamen. Obwohl sie sich mit ihrer Mutter ansonsten gut verstand, hasste Emmi sie fast dafür, dass sie und damit auch Emmi selbst nach der Scheidung wieder ihren Mädchennamen Mope angenommen und den schönen, unauffälligen Namen ihres Vaters – Paisley – abgelegt hatte. Mope – Trauerkloß – passte leider wirklich zu gut zu ihr. Vor allem für den Dorfanführer Barney Lufferton und seine Freundin Chickie Patterson war dies ein gefundenes Fressen, um sie so oft wie möglich aufzuziehen und zu verspotten. „Mopey – Dopey – Trauerkloß“ riefen sie hinter ihr her und lachten sie aus, wenn sie daraufhin unbeholfen und mit rotem Gesicht fortstolperte.
Oft hatte Emmi inbrünstig gewünscht, alle diese fiesen, mitleidlosen, in heilen Familien aufgewachsenen Kinder mögen einfach verschwinden oder es möge ihnen etwas Schreckliches zustoßen…
…Und nun war es so gekommen, und Emmi verzehrte sich in Schuldgefühlen. Konnte man etwas so sehr wünschen, dass es tatsächlich geschah? Aber dann wäre ihr Vater noch bei ihnen und sie würde in einer heilen Familie leben. Denn sie konnte sich nicht vorstellen, dass jemals jemand einen stärkeren Wunsch gehabt haben könnte, als sie sich dies wünschte. Außerdem war sie – wenn das überhaupt auf irgendjemandem im Dorf zutraf – so etwas Ähnliches wie befreundet mit dem ebenfalls verschwundenen Eric McFinn, für den sie sicher niemals etwas Schlimmes erhofft hatte. Er war der Einzige, der Emmi ein paar Mal gegen die Aufrührer verteidigt und diese aufgefordert hatte, etwas weniger rüde mit ihr umzuspringen. Manchmal hatte sie sich mit Eric auch unterhalten, zum Beispiel über Bücher, seltener auch über Schneckenhäuser, denn auch dafür hatte er immerhin ein kleines bisschen Interesse gezeigt.
Billie Mirron und Paulus Catty kannte Emmi kaum. Sie hatten ihr nie etwas getan, allerdings hatten sie – vielleicht um nicht selbst zur Zielscheibe zu werden – des Öfteren über die Scherze von Chickie und Barney auf ihre Kosten gelacht.
Eric ausgenommen – um den sie ehrlich trauerte – schwankte Emmi somit in Bezug auf alle anderen verschwundenen Kinder zwischen Schuldgefühl und einem – wenn auch klitzekleinen – Fünkchen Schadenfreude, dass all diese verwöhnten Gestalten endlich mal die Realität kennenlernten. Eine Realität, die für Emmi schon viele Schmerzen bereitgehalten hatte und für die sie aufgrund ihrer melancholischen Natur offenbar besonders empfänglich war.
Das heutige Begräbnis verstärkte nun noch einmal all diese widerstreitenden Gefühle, und es drückte sie innerlich schier zu Boden, als die Bilder der Beerdigung erneut an ihrem inneren Auge vorbeizogen:
Zusammen mit ihren Klassenkameraden, die wie jede andere Klasse aus jeder Schule im Dorf geschlossen zum Begräbnis gekommen war, stand Emmi gegenüber den fünf ausgehobenen Gruben. Nur mit Mühe konnte sie der Rede des Pfarrers folgen – der ebenfalls sichtlich um unmöglich zu findende richtige Worte rang – und fühlte das Entsetzen in sich hochsteigen, als Mr. Patterson als Vertreter der Eltern vortrat. Charlenes Vater brauchte mehrere Anläufe, um seinen Stimmbändern irgendeinen Ton zu entlocken, und der erste klang wie das Klirren einer gesprungenen Glocke. Dann pendelte sich die Schwingung ein und er begann zu sprechen.
„Wir sind heute hier, um unsere verschwundenen Kinder zu begraben, damit wir Verbliebenen weiter existieren können. Kein Mensch kann sich auch nur im Ansatz ausmalen, was dieser Schritt uns abverlangt: wir begraben eine Hoffnung in Form leerer Holzkisten, wir schreiben nur vermutete Sterbedaten auf kalte Steine und zu Hause räumen wir Zimmer und Schränke von Kindern aus, über deren Schicksal wir keinerlei Kenntnis haben. Dennoch haben wir uns gemeinsam für diesen Schritt entschieden, da wir sonst nie und nimmer etwas anderes täten, als auf etwas zu warten, von dem wir überzeugt sind, dass es niemals passieren wird. Für mich persönlich wäre es mir gleichgültig. Aber wir alle haben weitere Kinder, Nichten, Neffen, Partner oder Freunde, die sich sorgen und die uns lieben. Wenigsten um diesen Menschen einen weiteren tragischen Verlust zu ersparen, müssen wir weitermachen, irgendwie. Und deshalb müssen wir heute Abschied nehmen, auch wenn es uns dabei zerreißt. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass die Sorge und Liebe der anderen uns eines Tages zumindest notdürftig wieder heilen kann.“
An dieser Stelle verstummte Mr. Patterson, drehte sich zu den anderen Eltern um und vergewisserte sich mit einem Blick in die Runde, dass alle bereit waren. Die Mütter und Väter traten nun jeweils zu dem Sarg, der ihr verschwundenes Kind symbolisierte. Im Fall der verwitweten Mrs. Catty trat deren Tochter Maisie hinzu, die zwar am ganzen Leib zitterte, aber fest entschlossen schien, ihrer Mutter so viel Stütze zu sein wie möglich.
Auf ein Kopfnicken von Mr. Patterson, der mit Charlenes Schwester Annabell am Grab stand, hoben alle die leeren Särge hoch und ließen sie langsam in die fünf Gruben sinken. Als dies getan war, legten sie die Seile beiseite und blieben mit leeren Blicken einfach stehen, so als ob dies ihre letzten Kräfte gekostet hätte.
Niemand wusste so recht, was zu tun sei, nachdem der bislang führende Mr. Patterson – ebenfalls zu keiner Tat mehr fähig – wie festgewachsen am vermeintlichen Grab seiner Tochter stand. Ms. Alice Gradings – eine alleinstehende ältere Dame und Inhaberin des Cafés am Kirchplatz – trat gefolgt von ihrer Freundin und Mitarbeiterin Charlotte Rumpling vor. Beide lenkten mit behutsamen Gesten die Aufmerksamkeit der völlig hilflosen Eltern auf sich. Fürsorglich führten sie sie in Richtung ihres Cafés, in dem der anschließende Leichenschmaus stattfinden sollte.
Nun lud der Pfarrer die versammelte Gemeinde ein, an die Gräber zu treten und die übliche Schaufel Erde oder eine Blume hineinzuwerfen. Bei der enormen Personenzahl verhedderte sich der Lauf der Trauergäste ein wenig und die Anstehenden kamen nur langsam voran. Emmi blickte sich nach ihrer Mutter um, die einige Meter entfernt stand und ihr über die Menge nur ein trauriges Lächeln zuwerfen konnte. Mit einem unbestimmten Schulterzucken und Kopfnicken erwiderte Emmi die Geste ihrer Mutter, wurde aber durch die hinter ihr stehenden und zu den Gräbern vorrückenden Besucher zur Seite gedrängt.
Unvermittelt stand Emmi plötzlich am Rand der Trauergesellschaft, direkt neben ihrer Klassenlehrerin – und in direkter Nähe des Seitenausgangs des Friedhofs. Einem plötzlichen Impuls folgend – der nicht wenig mit ihrer grundsätzlichen Abscheu vor Menschenansammlungen zu tun hatte – raunte sie ihrer Lehrerin etwas von „Übelkeit und dringend nach Hause“ zu. Diese tätschelte ihr kurz die Schulter, nickte und versprach, ihre Mutter zu informieren. Emmi schlüpfte daraufhin schnell aus dem Tor, und da die ersten Tropfen eines augenscheinlich heftigen Regenschauers auf das Straßenpflaster aufzuschlagen begannen, lief sie rasch los, um Zuflucht in ihrem Zimmer zu suchen.
Kapitel 2
Die Spur
Dort in ihrem Zimmer saß Emmi nun und versuchte, ihre mannigfaltigen und widersprüchlichen Gefühle zu sortieren, die in ihrem Bauch wie tollwütige Schmetterlinge umherschwirrten.
Da war einerseits das nackte Entsetzen angesichts der Tatsache, dass fünf Kinder einfach so verschwinden konnten. Hinzu kamen die Schreckensvisionen von all den Dingen, die ihnen zugestoßen sein könnten. Und immer noch plagten Emmi Schuldgefühle, irgendwie durch ihre boshaften Verwünschungen für das Unglück mit verantwortlich zu sein. Weiterhin fraßen in ihr das Mitleid mit den Familien, die nun ähnlich wie ihre eigene auseinandergerissen worden waren, Scham darüber, dass sie eine Scheidung mit dem viel schlimmeren Verlust eines Kindes gleichsetzte, Angst vor den leeren Stühlen von Chickie und Barney im Klassenraum – und der immer noch leise glimmende Funke eines Gefühls von „geschieht ihnen allen ganz recht“.
Als dieses Gefühl immer größer in ihrer Brust wurde, hielt Emmi es in ihrem Zimmer, dessen Zuflucht sie gerade noch gesucht hatte, nicht mehr aus. Trotz des Regens stürmte sie aus dem Zimmer, kritzelte ihrer Mutter eine Nachricht auf einen Zettel (aufgrund der Ereignisse hatte diese ihr eingebläut, nie mehr ohne Nachricht aus dem Haus zu gehen und ja auf die Sekunde pünktlich zu kommen) und rannte nach draußen. Wie von selbst führten ihre Schritte sie südlich aus dem Dorf hinaus Richtung Fluss zu der Furt, an der die ganze Katastrophe ihren Ausgangspunkt hatte.
Sie hatte gerade die letzten Häuser von Little Aspen erreicht, da krachten auf einmal die Fensterläden von Mr. Blacksabbaths Haus auf und sein zerfurchtes Gesicht mit den durchdringenden hellblauen Augen tauchte am Fenster auf. Er schrillte in seiner quäkenden Stimme so urplötzlich los, dass Emmi wie vom Blitz getroffen zusammenschrak und stehenblieb.
„Sieh dich vor, kleine Lady, dass dich nicht auch der König der gewundenen Welt erwischt und einsperrt. Wärst nicht die Erste und bestimmt nicht die Letzte, die er sich holt!“ Er begann auf eine Art und Weise zu kichern, dass es Emmi von oben bis unten mit Gänsehaut überzog. Mit größter Willensanstrengung befahl sie ihren Füßen, weiterzugehen und beeilte sich, so schnell wie möglich von diesem unheimlichen Menschen fortzukommen.
Trotz ihres Grusels vor Mr. Blacksabbath entschied sie, an ihrem Ziel, das sie zu Beginn noch nicht einmal bewusst gewählt hatte, festzuhalten. Schwer atmend vom schnellen Laufen kam sie am Flussufer zum Stehen und betrachtete die Stelle, zu der die fünf Kinder vor so langer Zeit zu einem völlig alltäglichen Freizeitvergnügen aufgebrochen waren. Die dicht stehenden Bäume hielten einen Großteil des Regens ab, und so war sie dort einigermaßen geschützt. Fast automatisch fing Emmi an, das Flussufer nach den von ihr so geliebten Schneckenhäusern abzusuchen. Sie hatte entlang des Shanding schon etliche gefunden, was ihr eines der wenigen Trostpflaster seit Beginn ihres Lebens hier im Dorf war.
Sie schob mit der Schuhspitze Steine und Äste beiseite, um darunterliegende Schätze zu entdecken. Nach wenigen Metern bemerkte sie auf einmal, dass irgendetwas in ihrem Augenwinkel ihre Aufmerksamkeit erregte. Sie wandte den Kopf in die Richtung und erfasste einen so kurzen Lichtreflex, dass sie diesen schon beinahe als Sinnestäuschung abgetan hätte, wenn er nicht Sekunden später noch einmal aufgeblitzt wäre. Neugierig näherte sie sich der Stelle.
Am Flussufer hatten sich an einem größeren Stein Äste und Laub verfangen, und inmitten dieses Haufens erschien erneut der Lichtreflex. Sie machte einen weiteren Schritt und schnappte überrascht nach Luft. Vom Weg zur Furt aus konnte man das, was da unter dem verhedderten Haufen lag, nicht erkennen. Und als Emmi so darüber nachdachte, wunderte sie sich kurz, woher eigentlich der Lichtreflex stammen sollte, der sie hergelockt hatte, da es nach wie vor in Strömen regnete und die Wolken jeden Sonnenstrahl zuverlässig aussperrten.
Die Besonderheit ihrer Entdeckung erstickte diese Frage jedoch im Keim, denn unter dem angespülten Flusstreibgut lag das größte und schönste Schneckenhaus, das Emmi je gesehen hatte. Es war ungefähr so groß wie ein Basketball. Die Frage, welche Art von Schnecke hier drin einmal gelebt hatte, verdrängte Emmi direkt und war froh, dass das Haus inzwischen leer und unbewohnt war. Und über ihre Farbe musste Emmi sich erst klar werden.
Auf den ersten Blick schien das Schneckenhaus einfach nur strahlend weiß zu sein. Je länger Emmi schaute, desto mehr verwirrte sie allerdings das Spiel der Farben, das sich langsam aus dem Weiß herausschälte. Jede Windung schien eine andere Tönung zu haben: die äußere hatte den gelblichen Cremeton weißfleischiger Pfirsiche, gefolgt von einem Schimmer limettenfarbigen Grün-Gelbs. Weiter ins Innere flossen die Farben von sahnigem Himbeerrosa über Veilchenblau bis hin zum Ton des Fells junger Rehkitze. Der Mittelpunkt der Schneckenwindung war fast das Erstaunlichste: schaute man direkt hin, schien er einfach nur mattgrau, sobald das Auge etwas weiterwanderte, entstand das Gefühl, die Mitte sei von tiefstem Nachtschwarz und zog den Blick somit unweigerlich wieder an wie ein Schwarzes Loch im Universum.
Emmi konnte ihr Glück kaum fassen. Dies würde das Krönungsstück ihrer Sammlung werden. Es schien fast, als würde es ihr Mut und Kraft einflößen. Dennoch hielt Emmi einen Augenblick inne, obwohl alles sie dazu verführte, das Schneckenhaus sofort in die Arme zu schließen. Ein leichtes Unbehagen durchströmte sie. Ging es vom Schneckenhaus aus, oder lag es an den Belastungen der vergangenen Wochen und Monate, die einfach nicht so leicht abzuwerfen waren, zumal an solch einem Tag?
Energisch schüttelte Emmi sich und versuchte, damit auch das Unbehagen loszuwerden. Es war so viel Schreckliches passiert, und damit meinte sie nicht nur das Verschwinden der Kinder. Da war es fast schon recht und billig, dass ihr einmal ein solcher Glücksgriff gelang. Sie streckte die Arme aus, nahm das Schneckenhaus in ihre Hände und hob es aus dem Flussbett heraus. Im selben Moment spürte sie etwas wie einen kribbelnden Stromstoß, der durch ihre Hände ging, und beinahe hätte sie das Schneckenhaus fallen gelassen. Hatte sie es sich nur eingebildet? Emmi hatte schon einmal gehört, dass es Zitteraale gab, die in der Lage waren, bei Gefahr Stromstöße zu produzieren, um damit ihre Gegner zu lähmen oder sogar zu töten. Aber es gab doch wohl keine Zitterschnecken und noch viel weniger zitternde unbewohnte Schneckenhäuser, oder? Emmi flog ein schiefes Lächeln über das Gesicht. ,Das hier wird mich doch nicht sofort meinen Verstand kosten`, dachte sie halb belustigt.
Während sie so dastand, fiel ihr auf, dass sie einen Weg finden musste, um das Schneckenhaus heimlich nach Hause zu bringen. Zum einen wollte sie ihren Schatz zunächst einmal nur für sich haben. Fast im selben Moment fiel ihr allerdings ein, dass die einzigen beiden Menschen, die sich für dieses Prachtstück überhaupt ansatzweise interessiert hätten, ihr abwesender Vater und der verschwundene und soeben symbolisch beerdigte Eric waren. Ihre Mutter hatte ihre Sammelwut immer eher mit Nachsicht als mit Interesse betrachtet und sah in ihren Kostbarkeiten vor allem unpraktische Staubfänger. Wie einen schweren Stein schob sie diese Gedanken sofort beiseite, denn sie wollte die aufkeimende Freude nicht schon wieder zerstört sehen.
Der zweite Grund war ihre jüngste Begegnung mit Mr. Blacksabbath und seine unheilvolle Rede. Was hatte er noch gefaselt vom König der gewundenen Welt? Merkwürdigerweise schien sich in ihrem Kopf eine Verbindung aufzubauen zwischen dieser Bemerkung und ihrem prunkvollen Fundstück. Aber auch diesen Gedanken wollte sie so schnell wie möglich loswerden und so konzentrierte sie sich auf die praktische Problemlösung. Wie brachte man ein wassermelonengroßes Geheimnis unbemerkt durch ein ganzes – wenn auch kleines – Dorf und dann noch ins eigene Zimmer?
Emmi schaute sich suchend um. Weiter flussaufwärts bemerkte sie etwas wie ein Stück Stoff, das bunt zwischen den Steinen hervorschimmerte. Sie ging in die Richtung und sah, dass es eine weggeworfene Plastiktüte war. Die Tüte zeigte den Schriftzug eines Fahrradhändlers aus dem Nachbardorf Great Aspen, der fast zeitgleich mit Emmis Umzug – also vor etwa zwei Jahren – pleite gegangen war und den Laden geschlossen hatte. ,Ein Glück, dass Plastik nicht so schnell verrottet`, dachte Emmi ganz entgegen ihrer sonstigen Überzeugung.
Sie nahm die Tüte hoch und legte das Schneckenhaus hinein. Ihrer Mutter würde sie zur Not sagen, sie hätten in der Schule Bastelarbeiten angefangen, die sie nun zu Hause fertigstellen sollten. Da ihre Mutter bestimmt auch von den Ereignissen des Tages verwirrt und betrübt sein würde, würde sie sich sicherlich keine Gedanken darüber machen, dass es eigentlich unlogisch war, wenn Emmi nun just nach der Beerdigung mit einem solchen Mitbringsel nach Hause käme.
Kurz streifte Emmi der Anflug eines schlechten Gewissens darüber, froh über die Trauer und Verwirrung ihrer Mutter zu sein. Dann machte sie wieder von ihrer inzwischen gut geübten Fähigkeit zum Gedankenwegschieben Gebrauch und begab sich auf den Heimweg.
Sie wählte dieses Mal sicherheitshalber den längeren, aber risikofreieren Weg über den Westeingang ins Dorf, der nicht am Haus des grässlichen Mr. Blacksabbath vorbeiführte. Zwischendurch musste sie sich auf ihrem Weg – sehr zu ihrem eigenen Erstaunen – den Impuls verkneifen, vergnügt zu pfeifen, da sie sich so über ihren famosen Fund freute. Doch das wäre ihr dann entschieden zu respektlos erschienen und sie blieb stumm.
Da sie wie verabredet pünktlich zu Hause eintraf, verlief auch der Schmuggel des Schneckenhauses von der Haustür bis in ihr Zimmer reibungslos.
„Ich gehe nach oben“, rief Emmi ihrer Mutter, die gerade in der Küche rumorte, schnell von der Treppe aus zu.
„Ganz wie du willst, Schatz“, antwortete ihre Mutter ihr mit verständnisvoller Stimme. „Wenn du reden willst, komm´ einfach herunter.“ Wieder stachen Emmi Schuldgefühle, dann aber stieg sie die letzten Stufen hoch, betrat ihr Zimmer, verriegelte die Tür und atmete erst einmal erleichtert durch.
Emmi holte ein Handtuch aus ihrem eigenen kleinen Badezimmer, breitete es auf dem Fußboden aus und legte das Schneckenhaus behutsam darauf. Mit einem feuchten Tuch säuberte sie die glänzende Perlmutthaut und putzte die Rillen der Schneckenspirale sorgfältig aus. Im Licht ihrer Lampe sah das Haus schon wieder ganz anders aus. Das Farbspektrum schien hier etwas weniger kräftig, aber deshalb nicht weniger bezaubernd. Die Farben tendierten nun eher ins Erdige und Grünliche. Was gleich blieb, war das geheimnisvolle grau-schwarze Farbspiel in der Mitte der Schneckenschraube.
Emmi hielt kurz inne und betrachtete es mit Verzückung. Alle anderen Stücke ihrer Sammlung, selbst die schönsten und außergewöhnlichsten erschienen ihr nun im Vergleich langweilig und austauschbar. Sie hielt es sogar nicht für ausgeschlossen, dass sie den Beweis für eine bislang unbekannte, vor Jahrmillionen ausgestorbene Spezies vor Augen hatte.
Rundherum war das Schneckenhaus nun gesäubert und glänzte wie Edelsteine und Perlen. Obwohl ihr dies aufgrund der Phantasie über den ehemaligen Bewohner entschieden unappetitlicher erschien als sonst, wandte sie sich der notwendigen inneren Reinigung ihres Fundstücks zu. Ihr Blick wanderte zum ersten Mal etwas tiefer in die Öffnung des Schneckenhauses hinein…und wieder stockte ihr der Atem, diesmal allerdings nicht vor Entzücken über einen phantastischen Anblick.
In dem gewundenen Gang befanden sich mehrere rote Glanzpapierschnipsel, die – so weit wie Emmis Blick reichte – offenbar tief ins Innere des Schneckenhauses hineingeraten waren. Es waren eindeutig jene, die sie inzwischen dutzendfach auf den Abbildungen der Suchaufrufe nach den verschwundenen Kindern gesehen hatte.
Kein Zweifel: es waren Billies Wegmarken.
Kapitel 3
Der Eingang
Emmi glaubte, ihren Augen nicht trauen zu können. So sehr sie sich auch bemühte, eine andere Erklärung für das vor ihr liegende Phänomen zu finden, ihr wollte einfach nichts einfallen – auch wenn es eigentlich unmöglich war.
Die Papierschnipsel, die an der Innenseite des gewundenen Schneckengangs klebten, waren eindeutig von derselben Farbe und aus demselben Material wie jene, die Billie am Tag des Verschwindens auf dem Weg zur Furt verstreut hatte und die nicht nur für Emmi seither unauflöslich mit der Tragödie verbunden waren.

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











