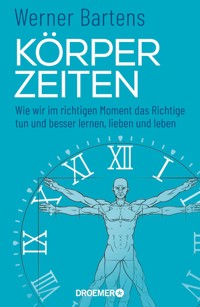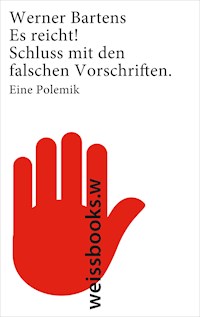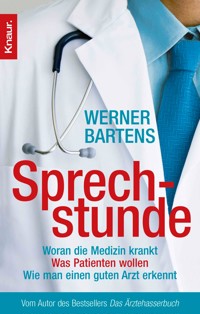9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das große Buch über Empathie und deren Bedeutung für unsere Beziehungen und unser Wohlbefinden, auf dem neuesten Stand der Forschung vom Arzt und Bestsellerautor Dr. med. Werner Barten. Empathie statt Egoismus, Mitgefühl statt Rücksichtslosigkeit. Wer sich in andere hineinversetzen kann, ist nicht nur bei seinen Mitmenschen beliebt, er tut sich auch selbst etwas Gutes. Bestsellerautor Werner Bartens nimmt uns mit auf eine Reise zu unseren edelsten Emotionen und zeigt, wie Einfühlung und Anteilnahme den Körper gesund erhalten, die Seele stärken und die Gemeinschaft festigen. Mit der richtigen Form des Mitgefühls verhindern wir zudem, dass uns das Leiden anderer überwältigt und hinunterzieht – wir werden psychisch stabiler, statt im Burn-out zu landen. - Was ist Empathie? - Kann man Empathie lernen? - Gut zu sich sein: Achtsamkeit und Selbstmitgefühl - Wohltuend teilnahmsvoll: Vom Nutzen der Empathie - Mehr Erfolg mit Mitgefühl - Was uns zusammenhält: die gesellschaftliche und politische Bedeutung von Empathie - Der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl Empathie tut anderen gut und ist gesund. Deutschlands bekanntester Medizinjournalist hat für sein bahnbrechendes Werk Hunderte Studien aus der internationalen Empathie-Forschung ausgewertet. Die Ergebnisse sind so spannend wie vielversprechend: Empathie und Mitgefühl tut nicht nur anderen gut, es ist auch gesund. Menschen, die sich einfühlen können, leiden seltener an Stress und Depressionen, leben länger und sind weniger schmerzempfindlich. Empathie hält die Gesellschaft im Innersten zusammen und hilft uns selbst!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Werner Bartens
Empathie Die Macht des Mitgefühls
Weshalb einfühlsame Menschen gesund und glücklich sind
Knaur e-books
Über dieses Buch
Seit der sensationellen Entdeckung der Spiegelneuronen ergründet die internationale Forschung intensiv das Wesen der Empathie. Die neuen Erkenntnisse sind phänomenal, denn nun ist nachweisbar, dass Empathie nicht nur die Kraft ist, die eine Gesellschaft im Innersten zusammenhält, die Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit steuert, nein, Emapthie macht den Menschen, der sie empfindet, selbst glücklicher und gesünder.
Werner Bartens hat für sein bahnbrechendes Werk hunderte Studien ausgewertet. Erstmals bereitet er die so spannenden wie vielversprechenden Ergebnisse für eine breite Leserschaft auf und weist den Weg, den jeder selbst zu einem empathischeren, gesünderen, glücklicheren Leben gehen kann.
Inhaltsübersicht
Für Helene, Nikolaus, Till,
Jonas, Florian und Silke –
die für ihr Mitgefühl immer wieder
eigene Wege finden
Einleitung
Freude an der Freude und Leid am Leid des anderen,
das sind die besten Führer der Menschen.
Albert Einstein
Was ist denn das für einer? Was ist Wesley Autrey bloß für ein Mensch? Ist er noch klar bei Verstand? Er hat ja nicht lange überlegt an jenem 2. Januar 2007, als er die Gefahr mit ziemlicher Geschwindigkeit heranrasen sah. Autrey wartete mit seinen beiden kleinen Töchtern in einer U-Bahn-Station in Manhattan auf den nächsten Zug. Es war um die Mittagszeit, und ein junger Mann, der 20-jährige Cameron Hollopeter, bekam plötzlich einen epileptischen Anfall. Autrey half dem Studenten sofort und blockierte mit einem Stift dessen Kieferschluss, damit er sich nicht die Zunge zerbeißen konnte. Doch gleich darauf konnte sich Hollopeter nicht mehr halten, und schon drohte die nächste, weitaus größere Gefahr: Der Student wurde ohnmächtig und fiel auf die Gleise.
Autrey sah bereits die Lichter der U-Bahn-Linie 1 durch den Tunnel kommen, und dann handelte er in Bruchteilen von Sekunden. Eine Frau hielt seine beiden Töchter zurück, und der 50-jährige Bauarbeiter stürzte sich im Hechtsprung auf die Gleise. Er dachte, dass er Hollopeter noch aus der Fahrrinne würde herausziehen können, doch die Bahn kam für diese Rettungstat viel zu schnell angerast.
Autrey warf sich deshalb auf den Studenten und drückte ihn und sich so tief es ging ins Gleisbett. Trotz Vollbremsung fuhr fast der komplette Zug über die beiden hinweg – und zwar so dicht, dass hinterher Schmierspuren von der Unterseite der Waggons auf Autreys Kappe zu sehen waren.
Der Lebensretter machte anschließend nicht viel Aufheben um seine Tat, er hielt sie für selbstverständlich. »Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich etwas besonders Spektakuläres geleistet habe«, sagte er später einem Reporter der New York Times. Nichts Besonderes – als ob er gerade Vögel gefüttert hätte. »Ich sah jemanden, der brauchte Hilfe, und dann habe ich das getan, was ich für richtig hielt.« Als Bauarbeiter habe er zudem eine gewisse Erfahrung darin, enge Räume abzuschätzen – und in diesem Fall war Autreys lakonisches Urteil ja durchaus zutreffend: »Der Zug ließ mir noch genügend Platz.«
Wie dankbar und überrascht die Medien wie auch die Bürger der USA waren, dass sie einer der Ihren an die grundlegenden Impulse der Menschlichkeit und des Miteinanders erinnert hatte, zeigte sich in den ersten Reaktionen auf Autreys Heldentat. Der Präsident der New York Film Academy, an der Hollopeter studierte, schenkte Autrey 5000 Dollar in bar und ein Stipendium in gleicher Höhe für seine Tochter. Vom Milliardär Donald Trump erhielt Autrey 10000 Dollar.
Zudem bekam der »Held von Harlem« ein lebenslanges Playboy-Abo geschenkt, eine Familienreise in die Disney World nach Orlando, einen neuen Jeep Patriot und mehrere Gutscheine – darunter für ein Beyoncé-Konzert –, Computer für seine Töchter mit regelmäßigen Updates und eine Dauerkarte für das Basketballteam der New Jersey Nets. Besonders erfreut haben wird ihn wohl die kostenlose einjährige Parkerlaubnis überall auf den Straßen New Yorks.
Nur wenige Tage nach seiner Rettungsaktion bekam Autrey die höchste zivile Auszeichnung verliehen, die die Stadt New York zu vergeben hat – und der damalige Präsident George Bush lud ihn Ende Januar 2007 zu seiner Ansprache zur Lage der Nation (»State of the Union«) nach Washington ein. Ausdrücklich hob er den besonderen Mut und die Bescheidenheit Autreys hervor – um gleich im Anschluss das Land zu preisen, das solche außergewöhnlichen Menschen hervorbringt.
Offenbar ist Empathie eine automatische Reaktion, eine Art Reflex. Der ist zwar bei vielen Menschen verschüttet oder wird von negativen Gefühlen, von Stress, Wut, Ärger oder Angst überlagert. Aber spontan kann sich kein Mensch der Empfindung des Mitgefühls entziehen, es sei denn, er ist ein Soziopath, bei dem längst alle Emotionen für andere erloschen sind. Man muss emotional auf besonders schöne oder besonders traurige Situationen reagieren, in denen sich andere befinden, ob man will oder nicht. Dies geschieht nicht aus Kalkül, sondern intuitiv, mögliche eigene Vorteile spielen dabei keine Rolle. »Ginge es nur um die Ausbeutung anderer, hätte sich die Evolution nie mit der Empathie abgegeben«, schreibt der Verhaltensforscher Frans de Waal, der viele Beispiele dokumentiert hat, die zeigen, dass Menschen – und auch viele Tiere – für andere Lebewesen einstehen.[1]
In diesem Buch geht es darum, zu zeigen, wie vielseitig Mitgefühl und Empathie sind – und was sie Erstaunliches bewirken und auslösen können.[2] Natürlich ist es immer ein schönes Gefühl, wenn man spürt, dass andere sich kümmern, sorgen und einfühlen und einem auf diese Weise nahe sind. Ergreifende Momente der Mitmenschlichkeit, aber auch stille Augenblicke des Glücks entstehen, wenn Menschen sich auch ohne große Erklärungen verstehen und ahnen oder fühlen, wie es dem anderen geht.
Anteil zu nehmen an Leben, Lust und Leid anderer ist aber nicht nur angenehm für jene, die spüren, dass man mit ihnen fühlt, egal ob man bangt oder hofft. In jüngster Zeit hat sich gezeigt, dass auch die Menschen erheblich davon profitieren, die empathisch sind und sich für das Leben und Erleben anderer öffnen. Mitgefühl stärkt Körper wie Seele, macht psychisch robuster, physisch stärker und stimuliert nebenbei das Immunsystem. Wer mit anderen fühlt und leidet, ist gesünder, seelisch gefestigt und hat bessere Abwehrkräfte.
Offener und einfühlsamer zu sein wirkt sich auf nahezu alle Organe und Körpersysteme positiv aus. Zudem laufen Entzündungsreaktionen (wie sie beispielsweise bei vermehrtem Stress häufiger entstehen) weniger heftig ab, selbst Erkältungen sind bei jenen Menschen seltener, die auf konstruktive Weise zu Anteilnahme und Mitgefühl in der Lage sind. Kein Wunder, dass die Lebenserwartung jener Menschen steigt, die sich anderen nahe fühlen, die zufrieden und einfühlsam sind und sich von einem engen Freundeskreis getragen und unterstützt wissen.
Mitfühlende Menschen leiden außerdem seltener an Depressionen und anderen seelischen Erkrankungen. Sie sind weniger empfindlich gegenüber Schmerzen; ihre Schmerzschwelle liegt höher und wird daher nicht so schnell überschritten. Gefühle der Verbundenheit und Nähe lösen die Freisetzung von körpereigenen Endorphinen aus – Opiaten, die im Gehirn bei Lust, aber auch großer Erschöpfung entstehen. Der Mensch ist auf diese Weise selbst dazu in der Lage, durch Mitgefühl erst entstandene Schmerzen zu lindern. Manche Forscher behaupten deshalb sogar, dass Mitgefühl süchtig machen kann – schließlich ist die körpereigene Droge ja ständig verfügbar.
Bei so vielen angenehmen Folgen der Empathie stellt sich die Frage, warum besonders einfühlsame Menschen so reich belohnt werden und jene, die Mitgefühl zeigen, gesünder und glücklicher werden. Ist vielleicht doch – trotz aller Scheußlichkeiten, die Homo sapiens begeht – das Gute im Menschen angelegt und nur gelegentlich versteckt und verschüttet? Braucht es nicht zwingend das empathische Miteinander, damit Gemeinschaften und Gesellschaften überleben, verbunden mit der Erkenntnis, dass es ohne die anderen nicht geht? Die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält und ob man tatsächlich ergründen kann, ob der Mensch »von Natur aus« zum Guten neigt oder vom Teufel geritten ist, wird in diesem Buch ebenfalls immer wieder eine Rolle spielen.
Vielleicht haben Sie für sich ja längst entdeckt, in welchen Situationen Sie besonders mitfühlend sind und wie gut Ihnen das tut. Im Konkurrenzkampf, im Stress und unter anderen widrigen Bedingungen fällt es schwer, sich in andere einzufühlen. Lesen kann man ganz entspannt. Das ist die richtige Stimmung, um sich einzulassen auf Themen, die vom Trösten des weinenden Säuglings über die Verständnisfallen in der Partnerschaft bis zum fragilen Miteinander in einer Welt voller Konflikte reichen.
Und wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, schreiben Sie – versuchen Sie es doch mal möglichst mitfühlend – an:
www.werner-bartens.de
Raum für Mitgefühl
Das Mitleid bleibt immer dasselbe Gefühl, ob man es für einen Menschen oder für eine Fliege empfindet. Der dem Mitleid zugängliche Mensch entzieht sich in beiden Fällen dem Egoismus und erweitert dadurch die moralische Befriedigung seines Lebens.
Leo Tolstoi
Ich kann mich ja nicht um alles kümmern, erst recht nicht um das Leid der ganzen Welt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Er wird schon darüber hinwegkommen, sie natürlich auch. Dafür habe ich jetzt wirklich keinen Kopf. Tja, das Leben ist kein Ponyhof.
Es gibt eine Reihe von Ausflüchten und Erklärungen, mit denen Menschen begründen, warum ihnen das Leben anderer nicht nahegeht – oder sie zumindest nicht wollen, dass es ihnen zu nahe kommt. Häufig werden die Probleme anderer als lästig empfunden, gar als Belästigung. Sich jetzt auch noch damit beschäftigen zu müssen raubt nicht nur Zeit, sondern vor allem Energie, so die Annahme. Und man will sich ja nicht ständig runterziehen lassen.
Dass Mitgefühl Kraft kostet und auslaugt, dass andere wie ein »Energievampir« unsere Reserven anzapfen, wenn sie Einfühlung einfordern, ist eine verbreitete Vorstellung. Dabei tut Mitgefühl, wenn es richtig verstanden wird, unendlich gut und stärkt, statt zu schwächen! Um die zahlreichen positiven Auswirkungen des Mitgefühls wird es später ausführlich gehen. Ebenso darum, dass Mitgefühl nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass man ausgebrannt und erschöpft ist, im Gegenteil.
Trotzdem gibt es Situationen, in denen wir eher bereit sind, empathisch und sensibel auf unsere Mitmenschen zu reagieren, während wir in anderen Momenten nichts für sie übrighaben. Zu erkennen, in welcher Lage sich Mitgefühl gleichsam automatisch ausbreitet und wann es geradezu blockiert ist, kann ziemlich hilfreich sein. Nicht nur für andere, sondern auch für einen selbst.
Weniger Stress, mehr Mitgefühl
Einfühlsamkeit ist eine Gabe, die dem abgeht, der nur sich selber kennt.
Peter Amendt
Mitgefühl ist eine launische Luxusemotion. Auf diese Idee könnte man durchaus kommen, denn Menschen wie Tiere leisten es sich offenbar nur zu ausgewählten Gelegenheiten, mitfühlend gegenüber anderen zu sein. Wie sonst ist es zu erklären, dass zur Empathie fähige Lebewesen mal einfühlsam nachspüren und erahnen, wie es den anderen in ihrer Umgebung geht – und dann wieder stumpf und völlig unberührt von deren Schicksal sind? Alles eine Frage von Konkurrenz, Stress und anderen Belastungen, behaupten Psychologen aus Kanada und den USA.[3] Wenn der Stress abnimmt, entsteht hingegen sofort mehr Raum für Mitgefühl.
Wissenschaftler der McGill University in Montreal haben in verschiedenen Konstellationen untersucht, wie Freiwillige auf Schmerzreize reagieren, die ihnen oder ihren Nachbarn zugefügt werden. Die Probanden waren dabei mal allein, mal in Gesellschaft von Freunden oder aber mit Fremden zusammen. In ungewohnter Atmosphäre und von Fremden umgeben zu sein bedeutet puren Stress für die meisten Menschen. Dermaßen angespannt zeigten sie auch weniger Mitgefühl mit anderen, deren Hand in vier Grad kaltes Eiswasser getaucht wurde, was schon nach kurzer Zeit ziemlich schmerzhaft ist. Wurden sie selbst der gleichen Pein ausgesetzt, wenn Unbekannte neben ihnen saßen, teilten sie ihre Empfindungen nur sparsam mit und ließen sich den Schmerz weniger anmerken.
In vertrauter Gesellschaft hingegen fühlten die Teilnehmer einerseits stärker mit anderen. Zudem signalisierte ihre Mimik wie Gestik viel deutlicher den eigenen Schmerz, wenn sie selbst die Kälte an der Hand ertragen mussten. »Der Grund dafür, dass Empathie zwischen Fremden so viel seltener ist, heißt ganz einfach Stress«, sagt Jeffrey Mogil, der Leiter der Forschungsgruppe. »Besonders der soziale Stress, den die Nähe Fremder auslöst, blockiert unsere Anteilnahme.«
Die »Gefühlsansteckung«, mittels deren wir in vertrauter Umgebung deutlich machen, wie es uns geht, und besser spüren, was andere spüren, funktioniert dann nicht mehr so gut, und wir sind zurückhaltender und zeigen weniger intensiv, wie es um unsere eigenen Gefühle steht.
In weiteren Versuchen der Wissenschaftler wurde das Stressniveau experimentell gesenkt – und zwar bei Menschen wie bei Tieren: Versuchsmäuse bekamen ein Medikament, mit dem die Synthese des Stresshormons Cortisol blockiert werden kann. Auch menschliche Probanden nahmen dieses Mittel ein oder entspannten sich bei dem Musikvideospiel Rock Band, in dem es darum geht, einen Song gemeinsam nachzuahmen und virtuell Instrumente zu bedienen.
Wer sich auf diese Weise entspannt, kann das Leid der anderen intensiver und besser nachvollziehen, auch wenn es sich immer noch um Fremde handelt. Nach nur 15 Minuten Videospiel ist der Stress übrigens genauso verflogen wie nach der Gabe des Medikaments – und die Bereitschaft zum Mitgefühl entsprechend größer. Bei Tieren zeigt sich mehr Anteilnahme, wenn sie sich umsorgend und ein wenig unruhig verhalten. Dieses Verhalten legen sie sonst nur an den Tag, wenn Käfiggenossen leiden.
»Gemeinsame Erfahrungen, und seien sie auch nur kurz und oberflächlich, können schon in kurzer Zeit aus einem Bedrohungsszenario eine Komfortzone machen«, sagt Mogil. »Daraus entwickelt sich bereits erstaunlich viel Mitgefühl, und aus einem Mangel wird ein Übermaß.« Fremdheitsgefühle und Anspannung im Miteinander abzubauen müsse daher das oberste Ziel sein. Schließlich wissen Psychologen, dass es schon reicht, wenn Fremde für denselben Fußballverein oder für die gleiche Band schwärmen, um mehr Mitgefühl für andere zu empfinden.
Das Rezept für einen mitfühlenderen Umgang ist also eigentlich ganz einfach: weniger Stress und mehr Miteinander sowie ein paar Augenblicke Zeit, um das Fremde und Trennende abzubauen.
Zu viel Leid, zu wenig Zeit?
Muss nur noch kurz die Welt retten,
danach flieg ich zu dir.
Noch 148 Mails checken,
wer weiß, was mir dann noch passiert.
Tim Bendzko
Beschleunigung und Entfremdung gelten als typische Krisensymptome der Moderne. Der populäre Soziologe und Zeittheoretiker Hartmut Rosa aus Jena, den manche als Entschleunigungspropheten missverstehen, beschreibt anschaulich, was vielen Menschen fehlt. Sie suchen nach sogenannten Resonanzoasen, nach Austausch, der sich nicht nur mit anderen, sondern auch in der Natur, im Gebet, in der Musik oder der Kunst ereignen kann. Längst nicht immer gelingt es, genügend Widerhall zu finden, und Rosa fragt zu Recht, ob wir als »schuldige Subjekte«, die permanent ein schlechtes Gewissen haben, weil wir zu wenig arbeiten, zu wenig kommunizieren, zu wenig entspannen, und das eine vernachlässigen, während wir das andere nachzuholen versuchen, überhaupt noch so etwas wie Muße kennen.[4]
Vielleicht könnte man im ländlichen Raum noch diese entspannte, manchmal fast muffig anmutende Selbstgenügsamkeit antreffen, mutmaßt Rosa. Dort mag es Menschen geben, die nicht den Drang verspüren, ständig etwas zu erledigen, vorzubereiten, nachzubesprechen, und die noch das wohlige Gefühl des Feierabends kennen. Die Zeit, in der alles gut ist, so wie es ist. Vielleicht kommt man auf solche Vermutungen aber auch besonders leicht, wenn man wie Rosa unweit des Stammsitzes der Rothaus-Brauerei aufgewachsen ist, wo sich zwischen Schwarzwald-Behäbigkeit und Tannenzäpfle-Dunst eine ganz eigene Form des In-sich-Ruhens ausgebildet haben könnte.
Stimmig scheint Rosas Analyse der großen Krisen auf jeden Fall zu sein, egal ob es sich um ökonomische, ökologische, politische oder kommunikative handelt: Demnach kommt es zuvor immer zur Desynchronisation, das heißt, eine Entwicklung verläuft schneller als die andere, und der Mensch bleibt zurück, fühlt sich überholt oder überfordert. Da sich nicht nur Technik, Arbeitswelt und Kommunikation beschleunigen und verdichten, aber Zeit nun mal eine begrenzte Ressource ist und sich nicht steigern lässt, kommt das überforderte Ich irgendwann nicht mehr mit. Nicht mit sich – und erst recht nicht mit anderen.
Da die Menschen kaum noch »Zeit für sich« haben und ständig das Gefühl, ihren eigenen Ansprüchen und Verpflichtungen hinterherzurennen, nehmen sie sich erst recht weniger Zeit für andere, und das Mitgefühl bleibt auf der Strecke. Die Momente werden seltener, in denen Zeit und Muße ist, um richtig zuzuhören oder auch nur beieinanderzusitzen und sich wortlos zu verstehen.
Wie soll das auch gehen? Wie sollte man nicht überfordert sein bei dem, was um uns herum Aufmerksamkeit begehrt? Ein typischer Haushalt um 1900 umfasste etwa 400 Gegenstände; heute umgeben wir uns mit durchschnittlich 10000 Dingen, die befasst, besehen, benutzt werden wollen – oder mit denen wir uns beschäftigen, weil wir sie für überflüssig halten, uns aber noch nicht von ihnen trennen konnten. Und ein Pendler sieht morgens auf dem Weg zur Arbeit im Bus oder in der U-Bahn heute wahrscheinlich mehr Zeitgenossen – von Begegnung kann man da ja wohl nicht sprechen – als ein Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben. Ist Empathie also in erster Linie eine Frage der eigenen Ressourcen, nach dem Motto: Wenn das Tagewerk erledigt ist und dann noch Zeit bleiben sollte, leiste ich mir auch ein wenig Mitgefühl?
Dass nach der Eskalationslogik des Schneller-höher-weiter im Beruf (und manchmal auch im Privatleben) abgehängt wird, wer zu langsam ist oder zu sperrig, spüren viele Menschen schon länger auf schmerzhafte Weise. Zunächst gibt es noch den Versuch, das Lebenstempo zu beschleunigen und sich den rasenden Stillstand schönzureden: Die paar Minuten mit der Familie werden zur »Quality Time« aufgehübscht, das Ruhebedürfnis zum »Power Nap« verkürzt, aus dem man hochschreckt, sobald der Tiefschlaf naht und der Bleistift in der Hand runterfällt – diesen Trick empfehlen moderne Managementratgeber allen Ernstes.
Aber dann geht bald gar nichts mehr, sondern da ist nur noch: innerer Stillstand, fehlende Schwingungsfähigkeit, Entfremdung. Ärzten und Therapeuten ist es herzlich egal, ob man diesen Zustand als Burn-out, Depression, zynische Weltbeziehung oder Verstummen aller Resonanzebenen bezeichnet. Sie sehen die Folgen und nehmen auch die Ursachen ins Visier. »Etliche Krankheiten treten bei Langzeitarbeitslosigkeit doppelt so häufig auf wie sonst«, sagt Harald Gündel, Chef der Psychosomatik an der Universitätsklinik Ulm. »Das Erlebnis von Ausgrenzung, Hilflosigkeit oder Überforderung hat enorme Auswirkungen auf die körperliche wie seelische Gesundheit.«
Neuerdings gibt es gar einen eigenen Forschungsbereich, die »Social Genomics«, der die Auswirkungen gesellschaftlicher Unterschiede auf molekulare Vorgänge und ihre Verankerung im Erbgut untersucht. Steven Cole von der University of California in Los Angeles hat gezeigt, dass Gefühle der Nutz- und Wertlosigkeit nicht nur die Fähigkeit zum Mitschwingen mit anderen deutlich verringern, sondern auch mit einer eingeschränkten Immunabwehr einhergehen, und dass sich die Neigung zu erhöhten Entzündungswerten dauerhaft im Genom festsetzt.[5]
Während der Behandlung müssen Patienten wie Therapeuten allerdings aufpassen, dass sie als Strategien gegen Teilnahmslosigkeit und innere Abstumpfung nicht genau jene konsequente Ökonomisierung des Verhältnisses zu sich selbst anmahnen, an der der Kandidat gerade erst zerbrochen ist: »Sich mit seiner Leistung identifizieren«, »Den eigenen Marktwert überprüfen und, wenn möglich, steigern«, »Sich auf Krisen vorbereiten und jede Krise als Chance sehen«, »Der Handelnde bleiben und nicht zum Behandelten werden« sind entsprechende Slogans, wie sie erstaunlicherweise immer wieder in Fachzeitschriften für Psychologen empfohlen werden.
Doch diese Ratschläge stammen ja genau aus dem Inventar der krank machenden »vermarktlichten Arbeitsverhältnisse«, wie es der Freiburger Soziologe Ulrich Bröckling ausdrückt: »Der Speer, der die Wunde schlug (und sie auch weiter schlägt), soll sie auch heilen – am Ende weiß man nicht, was man mehr fürchten soll, die Zeitkrankheit oder die Vorschläge zu ihrer Therapie.«
Wo bleibt die Menschlichkeit?
Den Strom der Trauer mildert, wer ihn teilt.
Edward Young
Der Schock sitzt tief und wird es lange bleiben. Als am 7. Januar 2015 die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo mitten in Paris von den Brüdern Kouachi in weiten Teilen ausgelöscht wurde, war nicht nur Frankreich in Aufruhr, sondern die ganze Welt. Der Anschlag zielte ins Herz von Kultur und Zivilisation und griff die Meinungsfreiheit direkt an. Die Täter waren mit Maschinenpistolen und Sprengsätzen vorgegangen – gegen Journalisten, die lediglich mit Stiften bewaffnet waren. Auf der Flucht schossen die Terroristen dem Polizisten Ahmed Merabet, der bereits verletzt am Boden lag, aus nächster Nähe in den Kopf. Der französische Beamte war Moslem, wie die Attentäter auch.
Sofort waren sich die Menschen rund um den Globus einig, dass dieses Verbrechen unmenschlich war. Unmenschlich, das ist in fast allen Sprachen die – eigentlich unlogische – Kennzeichnung dafür, dass Menschen ein abscheuliches Verbrechen begehen. Besondere Grausamkeiten als »unmenschlich« zu etikettieren zeugt aber auch von so etwas wie einer stillen Übereinkunft darüber, dass Menschen anderen Menschen zwar schreckliche Dinge antun können, aber dass es trotzdem eine Art Code gibt, was zum Wesen des Menschseins gehört und was nicht.
Sogar für den Krieg gibt es schließlich Benimmregeln, sie sind in der Genfer Konvention festgelegt. Und schon Kinder auf dem Schulhof lernen, dass man einen Gegner nicht von hinten angreift und niemanden tritt oder weiter misshandelt, der bereits am Boden liegt. Für viele Kinder gilt unausgesprochen auch die Grenze, dass – wenn man sich schon prügelt – nicht ins Gesicht geschlagen wird. Die Anschläge von Paris hatten also auch eine Selbstvergewisserung zur Folge. Die zivilisierte Welt bestätigte sich anschließend auch in ihrer Abscheu sowie darin, welche Formen von Gewalt toleriert werden können und welche nicht.
»Unmenschlich« bedeutet in derartigen Fällen immer auch so viel wie: ohne Mitgefühl. In das Grauen über die schrecklichen Taten mischt sich zudem das Entsetzen darüber, dass die Terroristen etwas tun, mit dem sie sich selbst aus dem Kreis der zivilisierten Menschheit ausschließen, mit dem sie ihr Leben verwirken und zeigen, »dass sie sich selbst nichts wert sind«.[6]
Es ist von einer zynischen Logik, dass die mordenden Brüder kurz vor ihrem Tod so etwas wie ihre Menschlichkeit zurückbekamen. Sie hatten sich auf ihrer Flucht am 9. Januar vormittags in einer Druckerei in Dammartin-en-Goële verschanzt, nördlich von Paris. Dort hielt sich der Besitzer noch auf, Michel Catalano. Der rief einem seiner Mitarbeiter zu, sich in dem Schrank unter der Spüle im zweiten Stock zu verstecken, wo er acht Stunden ausharrte und von den Attentätern nicht bemerkt wurde.
Catalano selbst blieb verhältnismäßig gefasst, redete mit den Brüdern, bot ihnen Kaffee an und versorgte die Wunde eines der Attentäter. Er habe erstaunlicherweise in diesem Moment keine Angst gehabt, erklärte Catalano später im französischen Fernsehen, nur Sorge um den Kollegen im Schrank. Die Brüder hätten sich ihm gegenüber ordentlich verhalten und ihn um 10.20 Uhr freigelassen. Gegen 17 Uhr wurden Saïd und Chérif Kouachi im Schusswechsel mit Spezialeinheiten getötet.
21 einfühlsame Wahrheiten über die Bereitschaft zum Mitgefühl
Die Probleme anderer werden oft als lästig empfunden. Man will sich nicht ständig herunterziehen lassen.
Mitgefühl stärkt, statt zu schwächen.
Zu erkennen, wann sich Mitgefühl automatisch einstellt und wann es blockiert ist, kann hilfreich sein. Nicht nur für andere, sondern auch für einen selbst.
Menschen sind mal einfühlsam, mal teilnahmslos. Sie können aber nicht empathisch reagieren, wenn sie sich gestresst, in Konkurrenz und ausgelaugt fühlen.
Nimmt der Stress ab, entsteht sofort mehr Raum für Mitgefühl.
In vertrauter Gesellschaft fühlen Menschen stärker mit anderen mit – und zeigen deutlicher den eigenen Schmerz.
Der soziale Stress, den die Nähe Fremder auslöst, blockiert unsere Anteilnahme. Die »Gefühlsansteckung«, mit der wir zeigen, wie es uns geht, und spüren, was andere spüren, funktioniert mit Fremden nicht gut.
Gemeinsame Erfahrungen können in kurzer Zeit aus einem Bedrohungsszenario eine Komfortzone machen. Daraus entwickelt sich erstaunlich viel Mitgefühl.
Man empfindet mehr Mitgefühl für Menschen, die für denselben Fußballverein oder die gleiche Band schwärmen – auch wenn es Fremde sind.
Vielen Menschen fehlt Austausch, Resonanz – sei es mit anderen, in der Natur, im Gebet, der Kunst oder in der Musik.
Menschen fühlen sich schuldig, haben ein schlechtes Gewissen, weil sie zu wenig arbeiten, zu wenig kommunizieren, zu wenig entspannen und das eine vernachlässigen, während sie das andere nachzuholen versuchen.
Das Gefühl der Muße geht verloren, ebenso der Feierabend, an dem nichts mehr zu erledigen, vorzubereiten oder nachzubesprechen ist.
Der Mensch ist überfordert, da sich Technik, Arbeit und Kommunikation verdichten und beschleunigen, Zeit aber eine begrenzte Ressource ist und sich nicht steigern lässt.
Da Menschen kaum noch Zeit für sich haben und das Gefühl, ihren Ansprüchen hinterherzurennen, nehmen sie sich weniger Zeit für andere, das Mitgefühl bleibt auf der Strecke.
Ein typischer Haushalt um 1900 umfasste 400 Gegenstände; heute umgeben uns 10000 Dinge. Ein Pendler sieht auf dem Weg zur Arbeit mehr Zeitgenossen als ein Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben.
Bei chronischer Überforderung geht bald nichts mehr. Innerer Stillstand, fehlende Schwingungsfähigkeit, Entfremdungsgefühle sind die Folge.
Ausgrenzung, Hilflosigkeit oder Überforderung haben enorme Auswirkungen auf die körperliche wie seelische Gesundheit.
Gefühle der Nutzlosigkeit mindern die Fähigkeit zum Mitschwingen mit anderen und beeinträchtigen die Immunabwehr. Die Neigung zu erhöhten Entzündungswerten setzt sich dauerhaft im Genom fest.
Die Strategie gegen Teilnahmslosigkeit und Abstumpfung darf nicht jene konsequente Ökonomisierung des Verhältnisses zu sich selbst sein, an dem der Patient gerade erst zerbrochen ist.
Verbrechen als »unmenschlich« zu bezeichnen zeugt von einer stillen Übereinkunft, dass Menschen anderen Menschen zwar schreckliche Dinge antun, es aber trotzdem eine Art Code gibt, was zum Wesen des Menschseins gehört und was nicht.
»Unmenschlich« bedeutet auch: ohne Mitgefühl. In das Grauen über schreckliche Taten mischt sich Entsetzen darüber, dass Menschen etwas tun, mit dem sie ihr Leben verwirken und zeigen, dass sie sich selbst nichts wert sind.
Die gute Seite des Menschen
Mach, Herr, mich treu und kindlich,
Für andrer Not empfindlich;
Damit ihr Glück und Wehe
Mir recht zu Herzen gehe.
Unbekannt
Alle Jahre wieder, kurz vor Weihnachten, aber auch nach jeder großen Katastrophe, geht das Gebot aus, dass alle Welt den Bedürftigen helfen solle. Millionen sind auf der Flucht, haben weder genug zu essen noch eine passable Unterkunft. Sind von Überschwemmungen, Erdbeben, Dürre oder Kälte bedroht – oder, mindestens so schlimm: von üblen Despoten, die sie verfolgen, einkerkern oder gleich umbringen wollen.
Doch wer folgt schon tatsächlich dem Aufruf, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen und ihnen eine Bleibe anzubieten? Man weiß ja nicht, wie riskant das ist, ob man sich nicht Elend, Gewalt und Krankheit ins Haus holt – und überhaupt: Sollen sich doch die anderen kümmern. Oder jeder um sich selbst.
Sobald der Mensch überlegt, sobald er abwägt, ob es nicht auch mit weniger oder gar nichts getan ist, bleibt die unmittelbare Fürsorge schnell auf der Strecke. Ein bisschen spenden, vielleicht. Aber sonst?
Erklärungen, warum man nicht das tut, was aus Anteilnahme und Brüderlichkeit geboten wäre, gibt es viele: Ist man nicht selbst in Gefahr, wenn man einen Fremden zu sich holt, der durch Mord und Totschlag traumatisiert wurde? Als Einzelner kann man doch sowieso nichts machen. Und schließlich: Wenn man sich für alles Elend dieser Welt verantwortlich fühlt, kann man sich ja mit nichts anderem mehr beschäftigen.
Stimmt es also doch? Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, wie Thomas Hobbes 1651 im Leviathan schrieb, ständig im Krieg aller gegen alle? Genügend Beispiele gäbe es ja. Wie fand man denn unseren frühen Urahn vom Alpenhauptkamm 1991 in seinem eisigen Grab? Mit einer Pfeilspitze in der Schulter wurde Ötzi am Gletscher zurückgelassen, Wunden an Kopf und Brust, Schnitte an den Händen.
Aber das ist ja nicht alles. Der Mensch zeigt immer wieder, dass er auch anders kann, dass er zu Mitgefühl und Güte fähig ist – nur sind diese Anlagen eben manchmal versteckt oder verschüttet.
Mitfühlen wie ein Hund
Wir haben wirklich diese Nacht
Gemeinsam friedlich zugebracht.
Was so ein Schneesturm alles macht!
Tilde Michels/Reinhard Michl: Es klopft bei Wanja in der Nacht
Um die Natur des Guten zu entdecken, muss man die Ursprünge der Gefühle vielleicht manchmal dort suchen, wo sie noch unverfälscht zu beobachten sind, bei Kleinkindern und Tieren. Wie im Fall des Neugeborenen, das allein dalag, nackt und kalt. Vielleicht hatte ihr ausgeprägtes Mitgefühl damit zu tun, dass sie selbst gerade Nachwuchs bekommen hatte.
Sie fand den wenige Stunden alten Jungen auf einem Feld am Stadtrand von Buenos Aires. Wimmernd lag das Baby dort, es war von seiner 14-jährigen Mutter ausgesetzt worden. Das Neugeborene wäre unweigerlich erfroren, denn die Temperaturen lagen in jenen Tagen des Jahres 2008 nur knapp über dem Gefrierpunkt. Doch da war ja sie – kein Mensch, sondern eine Schäferhündin namens China.
Sie nahm das menschliche Neugeborene vorsichtig mit der Schnauze auf und trug es zu den sechs Welpen, die sie erst vor kurzem geboren hatte. Die Wärme der Hundefamilie rettete das Kleinkind vor dem sicheren Tod, denn es dauerte Stunden, bis ein Anwohner das schreiende Baby bemerkte und die Polizei alarmierte. Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass der kleine Junge unverletzt geblieben war und kaum Unterkühlungen aufwies. In Argentinien wurde die Hündin daraufhin wie ein Held gefeiert.
Bemerkenswert ist auch der Fall der Königstigerin, die ein Ferkel zusammen mit ihrem eigenen Nachwuchs säugte. Verschiedene Zoos haben darüber berichtet. Ellbogenökonomen und Politiker, die den Egoismus als zentrale Triebfeder der menschlichen wie der tierischen Existenz verstehen, sprechen in solchen Fällen gerne von einem »Versehen« der Natur oder einer Verwechslung. Eine Verwechslung oder ein Irrtum liegt hier aber keineswegs vor, denn Säugetiere haben nun mal von sich aus den Impuls, sich hilfloser Jungtiere anzunehmen. Sie tun das von Natur aus, und nicht, weil sie mal eben nicht aufgepasst haben.
Auch in anderen Situationen stellen sich Hunde lebensrettend vor Menschen. Im kalifornischen Roseville rettete der schwarze Labrador Jet seinem sechsjährigen Freund Kevin Haskell das Leben, als dieser von einer Klapperschlange angegriffen wurde. Statt des Jungen wurde der Hund gebissen und schwer verletzt. Die Eltern des Kindes waren so dankbar, dass der Labrador anschließend mit aufwendigen Bluttransfusionen behandelt wurde und nach etlichen Aufenthalten in der Tierklinik doch noch gerettet werden konnte.
Aber auch Lebewesen, die keine Haustiere sind und an Menschen nicht gewöhnt, können offenbar Empathie mit Homo sapiens empfinden. An der Nordküste Neuseelands wurden im Herbst 2004 vier Schwimmer plötzlich von Delphinen bedrängt. Die Tiere schwammen in engen Kreisen um die Menschen herum und ließen sie nicht aus der Umkreisung heraus. Erst nach einiger Zeit verstanden die Schwimmer, warum sie Gesellschaft hatten und sogar zurückgedrängt wurden, wenn sie woanders hinschwimmen wollten: In unmittelbarer Nähe war ein mehr als drei Meter langer Weißer Hai unterwegs, den die Schwimmer erst viel später bemerkten. Die Delphine blieben bei den Menschen und beschützten sie, bis der Räuber verschwunden war. Nach 40 Minuten ließen die Delphine von ihnen ab, und sie konnten erleichtert ans Ufer zurückschwimmen.
Selbstsüchtige Motive können allen diesen Tieren kaum unterstellt werden. Sie haben impulsiv mitfühlend und unter Einsatz ihres eigenen Lebens gehandelt, ohne dass sie eine Belohnung dafür erwarten konnten. Und sie verstanden, dass hier Gefahr drohte, auch wenn die Angriffe nicht ihnen galten.
Tiere zeigen in zahlreichen Situationen ein erstaunliches Maß an Mitgefühl. Bekannt geworden ist beispielsweise auch der Kater Oscar, der in einer Klinik an der amerikanischen Ostküste heimisch ist, in der vorwiegend ältere Menschen behandelt werden. Er läuft dort von Zimmer zu Zimmer, aber wenn jemand im Sterben liegt, bleibt er plötzlich länger. Oscar schnurrt dann besonders einfühlsam, legt sich neben den Patienten und begleitet den Todkranken. Oftmals verlässt der Kater das Zimmer erst, wenn auch der Patient es – für immer – verlassen muss.
Mit seinem unheimlichen Instinkt hat es Oscar sogar schon zur Titelfigur der renommiertesten medizinischen Fachzeitschrift der Welt gebracht.[7] Und die Ärzte und Pfleger vertrauen mittlerweile so sehr auf Oscars Gespür, dass sie die Familie benachrichtigen, sobald sich das Tier auffällig lange in einem der Krankenzimmer aufhält und einem Patienten Gesellschaft leistet. Falls kein Angehöriger mehr vorhanden ist oder kommen kann, ist es Oscar, der die Sterbenden in den Tod begleitet. Er scheint zu spüren, wenn es den Patienten schlechtergeht und sie seinen Beistand besonders nötig haben.
Das Gute, ein Luxusverhalten?
Es gibt kein grausameres Tier
als einen Menschen ohne Mitleid.
August von Kotzebue
Und der Mensch? Was hat er dem Menschen schon alles angetan? Hat gemordet und gemeuchelt und sich am Leid der Unterdrückten ergötzt. Und dann, wie zum Hohn, das verbreitete Phänomen, das man vom erbarmungslosen Tyrannen kennt: lässt feindliche Volksgruppen oder politische Gegner abschlachten oder in der Haft verrotten, zeigt sich aber zu Hause als liebevoller Kümmerer, der seine Kinder verhätschelt, sich um die Katze sorgt und weinen muss, wenn der Hund Blähungen bekommt. Das abgrundtief Böse zeigt seine gute Seiten?
Etliche Verhaltensforscher sind sich einig, dass die Bereitschaft, gut zu sein, viel mit Identifikation zu tun hat, sich also gerne unter Wohlfühlbedingungen zeigt. Das Gute, ein Luxusverhalten?
Mitgefühl empfinden wir besonders mit jenen, die wir als zugehörig zu unserer Gruppe ansehen – egal ob es sich um weltanschauliche, ethnische, religiöse oder berufliche Zeichen der Wiedererkennung handelt. »Einer von uns«, das kann sogar die Leidenschaft für denselben Verein bedeuten und die Verbrüderung der Fans, die sonst nichts gemeinsam haben – oder die Schwärmerei für die eine ganz besondere Band. Und besonders ausgeprägt ist die Anteilnahme bei Verwandten oder Mitgliedern der Familie.
Tiere kennen diese Formen der Abstufung ebenfalls. Von Mäusen ist bekannt, dass sie besonders stark den Schmerz von Artgenossen mitfühlen können, wenn es sich dabei um Mitbewohner des eigenen Käfigs handelt.[8] Allerdings zeigen dieselben Tiere, die eben noch großen Anteil am Schicksal anderer genommen haben, ein erstaunliches Maß an Brutalität, wenn sie kurz darauf in eine Konkurrenzsituation geraten. Affen, die gemeinsam aufgewachsen sind und sich das Fell gepflegt und gestreichelt haben, bekämpfen sich bis aufs Blut, beißen und quälen einander, wenn sie später im Kampf um die territoriale Vorherrschaft in ihrem Lebensraum aneinandergeraten.
Tiere sind in dieser Hinsicht offenbar wie Menschen: Es kommt auf den Zusammenhang an, in dem sie anderen begegnen. Sie können eben noch enge, liebevolle Bindungen eingegangen sein, doch im nächsten Moment verhalten sie sich wie Ungeheuer und verletzen und schänden einander auf grausamste Weise und lassen Unterlegene sterbend in ihrem Blut auf dem Schlachtfeld zurück, ohne sich weiter um sie zu kümmern.
Das Gute im Krieg
Wir tranken im Niemandsland Champagner, wir rauchten, und wir unterhielten uns. Es war eine Verbrüderung im gemeinsamen Gefühl, den Krieg endlich beenden zu müssen. Die Generäle erfuhren erst danach davon und taten fortan alles, dass so etwas nie wieder vorkommen könne.
Student Rickmer, deutscher Kriegsfreiwilliger 1914
Der Soldat beginnt zu singen, erst leise, dann mit immer festerer Stimme. »Stille Nacht, heilige Nacht« tönt es über die Schlachtfelder von Flandern. Es ist Heiligabend 1914 und vor nicht allzu langer Zeit erst dunkel geworden. In den Schützengräben haben sich die Truppen des Deutschen Reiches eingebuddelt, und nur hundert Meter entfernt hocken Briten, Belgier und Franzosen in ihren Unterständen in Dreck und Lehm. Der Boden ist vom wochenlangen Regen aufgeweicht, Hunderttausende junge Männer sind bereits gestorben. Jetzt hat es gefroren, und im Niemandsland entlang des Frontverlaufs liegen erstarrte Leichen, die der Schnee nur notdürftig bedeckt.
Die Geschichte von der Front klingt wie ein Märchen, aber sie ist wahr. Es gibt unzählige Dokumente darüber, auch wenn es den damaligen Machthabern gar nicht recht war, dass die Ereignisse bekannt wurden. Erst singt einer, dann stimmen »Tausende von Männerkehlen rechts und links« in das Weihnachtslied ein, wie Michael Jürgs anschaulich beschreibt.[9] Es sind zunächst nur die Deutschen, die ihre Stimme erheben, doch dann, nach einer Minute Pause, reagieren die Männer, die sich in Rufweite eingegraben haben. Erst klatschen sie Beifall für das schöne alte Weihnachtslied, dann rufen sie »Good, old Fritz« und verlangen nach »More, more« und »Encore, encore« – einer Zugabe.
Die deutschen Soldaten antworten mit »Merry Christmas, Englishmen« und bieten zugleich eine Feuerpause an: »We not shoot, you not shoot«, rufen sie und stellen vorsichtig ein paar Kerzen auf ihren Verteidigungswällen auf. Keiner schießt, und immer mehr Lichter werden entzündet. Man sieht die Gesichter der Soldaten im Schein der kleinen Feuer. Ein paar Tage zuvor wäre das noch ihr sicheres Todesurteil gewesen. Es ist klirrend kalt, windstill, der Vollmond und ein klarer Sternenhimmel stehen über der Westfront – und unten leuchtet eine Kerzenkette über den Schützengräben.