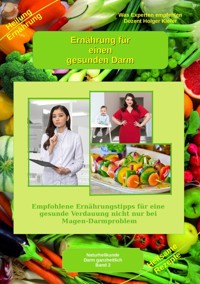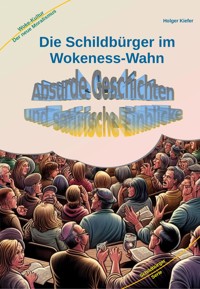2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein alleinstehender Mann (Franz) Mitte 40 lernt im Urlaub eine Fünfzehnjährige (Iska) kennen. Im Verlauf eines kurzen Liebesverhältnisses kommt es zu einem Autounfall, nach dem die junge Frau ins Koma fällt. Franz bleibt in Iskas Nähe und rekapituliert in den folgenden zwei Jahren sein Leben. Er stellt und beantwortet sich Fragen zu seinem bisherigen Leben, zu Freundschaft, Glück und dem Sinn des Lebens. Zwischen Glück und Trauer trifft Franz auch auf alte Bekannte sowie neue Bekanntschaften, um mit ihnen das Wesentliche im Leben zu eruieren und zu diskutieren, bis er die letzte Entscheidung trifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Holger Kiefer
Endlich glücklich,endlich frei
© 2021, Holger Kiefer, 1. Auflage
Autor: Holger Kiefer
Umschlaggestaltung: Holger Kiefer
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
978-3-347-25003-1 (Paperback)
978-3-347-25004-8 (Hardcover)
978-3-347-25005-5 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elekt-ronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbrei-tung und öffentliche Zugänglichmachung.
Letztes Kapitel
Franz Bebiotai hatte sein Leben gelebt. Er saß im Sessel, nahm behutsam das Glas in die rechte Hand und trank den letzten Schluck. Er setzte die Spritze an und drückte die gesamte Luft aus dem 2,5ml-Zylinder in die Verbindungsvene der linken Ellenbeuge. Er zog die Kanüle aus der Vene, legte die Spritze neben sich auf den Tisch und hielt eine Druckwatte ein paar Sekunden lang auf die Einstichstelle. Er legte auch dies auf den Tisch und atmete entspannt durch. Kurz darauf stellte das gesunde Herz nach fünfzig Jahren seine Funktion ein. Und der Kerzendocht ertrank neben ihm im geschmolzenen Restwachs, das nun erkaltete. Die CD spielte weiter, und der dritte Satz begann. Aber das hörte er schon nicht mehr.
Die Liebe
Was ist Liebe? Am Ende war die Antwort klar. Aber er hatte lange gebraucht, um sie zu finden – die Antwort und die Liebe. Mit 50 Jahren konnte er sich sicher sein, dass all das, was die Literatur und die Menschen unter Liebe verstehen, ein Trugschluss und eben nicht die Liebe ist. Hansi hatte immer gesagt: Die Liebe ist ein Scheißdreck. Dem stimmte Franz aber nicht zu.
Liebe hat nichts mit zwei Menschen zu tun. Liebe war für ihn die Hingabe an eine Sache um ihrer selbst willen, ohne etwas von ihr zu erwarten. Er liebte zum Beispiel die klassische Musik, hatte als Kind und Jugendlicher Querflöte und Klavier und später als reifer Mann noch Cello gelernt, also blasen drücken streichen. Schlagen mochte er nicht.
Er genoss die traurigen Arien, wenn sie von Cecilia Bartoli oder Gundula Janowitz gesungen wurden und konnte sie wieder und wieder hören, leise und laut, so dass manchmal der Nachbar gegen die Wand schlug oder nachts vor die Haustür ging und die Klingel mit dem Namen „Bebiotai“ betätigte. Sprechen mochte er nicht.
Er liebte die Erkenntnis und das Wissen, Informationen im Allgemeinen, auf Griechisch: Philosophie. Auch wenn in den Büchern viel Unbrauchbares steht, findet sich doch auf der Straße, wenn man genau hinsieht, genug Philosophie, mit der man etwas anfangen kann. Manchmal findet man aber auch einen Wissensgenossen wie zum Beispiel Lucius Annaeus Seneca, Michel de Montaigne oder Friedrich Nietzsche, die einem beweisen, dass nichts neu und man mit den eigenen Gedanken auf dem richtigen Weg ist („the one less travelled by“).
Er liebte den Himmel in bestimmten Farben, wenn er wie ein Aquarell in die Höhe gemalt scheint, oder wenn der Mond von einem Halo umgeben über einem Fluss oder einem Meer steht und sein Licht trichterförmig über die Oberfläche zu ihm hinfunkeln lässt.
Er liebte die Ruhe, die nicht gestört wurde vom unterschiedlichen Treiben der Mitbewohner und Mitbürger: Kindergeschrei und Säuglingsgejammer, Motoren-geräusche aller Art und Stimmen, die unwichtiges Gewäsch von sich gaben. Daraus ergibt sich automatisch, dass natürlich die Momente in der Nacht, wenn er bei einem Glas Wein oder Whiskey in seinem Sessel musikhörend in einem Buch las, für ihn mit Gold nicht aufgewogen werden konnten.
Menschen liebte er nicht.
Was die anderen als Liebe bezeichnen, ist oft genug nur Befriedigung von Trieben oder Eitelkeiten, ist Prostitution, Bequemlichkeit oder gespielte, unwahre Abhängigkeit, ist Hunger oder Versagen. Es gibt treffendere Worte. Warum alles mit dem Wort „Liebe“ bezeichnen? Was die anderen als „Liebe“ bezeichnen, ist oft genug nur ein Schlachterladen, vor dem Realität und Ehrlichkeit draußen bleiben müssen.
Iska – der Erste Tag
Es sind zehn Jahre vergangen, seitdem er das letzte Mal in Dänemark gewesen war. Am Abend zuvor hatte ihn der Himmel über Sæby bei der Ankunft vor dem Ferienhaus mit einem überwältigenden Schauspiel aus übereinander getürmten Wolken in intensivem Orange und Graublau begrüßt. Das Meer lag unruhig vor ihm und trank den niederfallenden Regen wie eine verspätete Opfergabe in sich hinein.
Das Haus roch nach ungestörter Ruhe und einem befristeten Leben am Meer, das in zehn Metern Entfernung seine flachen Wellen lockend und labend auf den Strand ergoss.
Nachdem er seinen Koffer ausgepackt hatte, stand er noch lange vor dem Haus und blickte auf das Meer hinaus, fing die Regenbögen mit seinen Augen ein, die sich zweimal als Paar am Horizont zeigten – doppeltes Glück, dachte er in jedem Augenblick, und sah den vorbeifliegenden Möwen zu, die ihn neugierig beäugten und ebenfalls zu begrüßen schienen. Als die Sonne für diesen Tag verschwunden war, entfachte er Feuer im Ofen und genoss den Abend: Das erste Glas Rotwein, der erste Mond, das erste Knistern der abbrennenden Scheite, die erste Nacht im Bett dieses Hauses.
Am nächsten Morgen relativ pünktliches Erwachen, was bei ihm etwa zehn Uhr bedeutete. Mehrere Tassen Kaffee und Zigaretten – französisch eben. Nebenbei ein Kreuzworträtsel auf Dänisch, denn er lernte diese Sprache weiter. Ein „Warum“ konnte er nur so beantworten: Er liebte es.
Um zwölf ging er das erste Mal am Strand spazieren, hatte die Schuhe ausgezogen und senkte seinen Blick oft auf den Sand, in dem er unbeschädigte Muscheln oder anderes Interessantes zu finden gedachte. Und manchmal beugte er sich nieder und hockte danach mit angewinkelten Knien einen kleinen Stein oder die Porzellanscherbe eines Marmeladenglases betrachtend, die vielleicht von einem Kutter gefallen oder geworfen und mit der Flut an Land gespült worden waren, in der Sonne und ließ sich vom leichten Wind der Ostsee umwehen.
Während er so langsam Schritt für Schritt in Richtung Hafen schlenderte, sah er plötzlich in etwa dreißig Metern Entfernung ein weibliches Wesen auf den Steinen des nächsten Steinwalls sitzen, der als Schutz vor hohen Wellen fünfzig Meter in das Meer hinein aufgeschüttet worden war. Nein: Sie hatte, so weit er das erkennen konnte, keinen Fischschwanz. Aber sie saß in der gleichen Haltung wie die kleine Meerjungfrau im Kopenhagener Außenhafen auf einem großen Stein und blickte nicht sehnsüchtig zum Land hin, sondern traurig auf das Meer hinaus.
Als sie mich näher kommen sah, wurde sie etwas unruhig und überlegte vielleicht, ob sie flüchten solle. Das verrieten ihre Bewegungen. Aber sie glitt nicht unversehens vom Stein ins Meer hinab, um ins Unsichtbare zu verschwinden, sondern blieb sitzen und tat so, als ob sie mich ignoriere. Ich wollte sie irgendwie ansprechen, aber mir fiel mal wieder kein passender Anfang ein. Also tat ich so, als ob mich etwas am Boden interessieren und aufhalten würde. Ich versuchte einfach mein Glück.
„En skøn dag, ikke sandt?“ Ich versuchte es auf Dänisch, weil sich an diesem Ort normalerweise zu dieser Jahreszeit keine Deutschen aufhielten.
Sie schaute mich überrascht, aber verständnislos an und hob nur beide Arme in die Luft, um mir anzudeuten, dass sie mich nicht verstanden habe. Dabei lächelte sie und machte mir durch dieses Lächeln Mut.
„Ein schöner Tag, nicht wahr?“, wiederholte ich auf Deutsch.
„Naja“, sagte sie entmutigt und blickte auf das Meer hinaus.
Wir waren im Gespräch.
Nachdem ich bemüht war, alle Register der angebrachten Höflichkeit und des ernst gemeinten Interesses an den Tag, besser in ihren Schoß zu legen, erzählte sie mir, warum sie so bedrückt war:
Wir hatten Streit – ich und meine Freundin – sie hat da jemanden gefunden – und jetzt verbringt sie die ganze Zeit mit ihm – dabei sind wir doch zusammen in Urlaub gefahren – ich bin ihr überhaupt nicht mehr wichtig – ich bin hierhergekommen, um meinen Vater zu fragen – er wusste für alles einen Rat – hatte auf alles eine Antwort – aber er ist tot – seit zwei Jahren – Krebs – obwohl er nie geraucht hat – es war schrecklich – ich vermisse ihn so sehr – Kennen Sie das?: Jemand, der gerade noch da war, ist plötzlich weg – für immer – meine Mutter – ja – sie ist lieb – aber sie ist nicht mein Vater– und manchmal ist sie nicht da – sie arbeitet viel – aber ich liebe sie – sie bemüht sich – sie ist manchmal richtig süß und versucht, eine gute Mutter zu sein – das ist sie auch – ach, warum erzähle ich Ihnen das alles?
Ich war mir nicht sicher, ob dies eine rhetorische Frage war, und wartete ein paar Sekunden. Aber es kam nichts nach. Sie schwieg. Es war tatsächlich eine richtige Frage, nach der sie auf eine Antwort wartete.
„Weil ich zuhören kann.“, antwortete ich.
Sie drehte sich zu ihm hin. Ihre Augen klarten ein wenig auf. Und es sah für ihn eine kurze Zeit so aus, als ob sie sich zu ihm hinbeugen und ihn umarmen wollte.
Er musste ein Zeichen geben – irgendetwas. Früher hätte er sich nicht getraut und alles so belassen. Aber er hatte gelernt und wollte dieses Mal nicht die Möglichkeit vorbeiziehen lassen, einem Hilferuf zu antworten. Er hielt ihr seinen rechten Arm entgegen, die Handfläche offen nach oben gewendet.
Zuerst sah sie mit ihren feuchten Augen auf den Arm, danach auf die Hand, dann in sein Gesicht, daraufhin wieder auf die Hand. Niemand außer ihr selbst weiß, was ihr in dem Moment durch den Kopf ging: Vorsicht, Angst, Erinnerungen, Zurückhaltung oder anderes.
Schließlich nahm sie seine Hand in ihre beiden Hände, umschloss sie wie einen Schatz, den man nicht verlieren will, oder wie ein kleines Tier, das man schützen und nicht davonspringen lassen will. In der nächsten Sekunde öffnete sie diesen Käfig und betrachtete seine Hand, fing an mit ihr zu spielen, zeichnete mit ihrem rechten Zeigefinger die Linien in seiner Hand nach, hob sie vor ihre Augen, legte sie auf ihren rechten Oberschenkel, ohne die Augen davon zu lassen, hob sie wieder mit beiden Händen hoch und legte sie an ihre Stirn, dachte einen Augenblick lang nach und drückte ihre Lippen in die geöffnete Hand.
„Was haben Sie jetzt vor?“, fragte Franz.
„Ich weiß nicht. Aber zurück möchte ich nicht. Dort bleiben? Ein Horror.“
„Sie könnten mit ihrer Freundin reden.“
„Hab ich schon. Sie liebt ihn, hat sie gesagt. – Ich glaub, ich fahr wieder zurück.“
Eine lange Pause. Beide dachten an etwas, Verschiedenes, Entferntes, Vergangenes, Zukünftiges.
„Geben Sie nicht auf! Lassen Sie sich Ihren Urlaub nicht vermiesen! Gehen Sie eigene Wege! Sie brauchen Ihre Freundin nicht. Und Ihre Freundin braucht Sie offensichtlich auch nicht mehr.“
Wieder eine lange Pause, in der beide an Verschiedenes, Gleiches, Gegenwärtiges dachten.
„Ich werde darüber nachdenken.“, sagte sie und stand auf. „Und vielen Dank! Sie haben mir sehr geholfen.“
„Gern. Dafür nicht!“
„Doch. Dafür schon!“
Sie ging. Kletterte den Steinwall hinab, lächelte Franz noch einmal zu, aber drehte sich nicht mehr um; ging zielstrebig dem Zeltplatz entgegen und war nach zehn Minuten endgültig hinter dem Schilfgras verschwunden, hinter dem er ihr nur noch in Gedanken folgen konnte.
1. Kapitel
Ich saß noch eine Weile auf den Steinen und blickte auf das Meer hinaus, so wie sie es getan hatte. Aber ihren Gedanken konnten meine nicht mehr folgen. Ihre waren schon zu weit draußen auf dem Meer oder sonst irgendwo. Aber ich musste ihren Gedanken auch nicht folgen. Ich hatte meine eigenen.
Ich dachte an meinen Urlaub, an diese Zeit hier und versuchte jede Minute zu genießen: Den Sonnenschein, das Rauschen des Meeres, den leichten Wind, das Kreisen und Kreischen der Möwen, den freien Blick auf die wogenden Wellen, den freien Atem, die einzigartigen Augenblicke am jungen Morgen und die Momente am späten Nachmittag, die stillen Minuten am dunkelnden Abend und die schweigenden Stunden in der tiefen Nacht.
Ich kann und werde tun, wozu ich Lust habe. Keine Arbeit, kein Zeitmangel, keine Termine und kein frühes Aufstehen, kein unnötiges Gespräch mit unnötigen Menschen, keine Anrufe (das Handy war ausgeschaltet und sollte nur im Notfall dienen), keine störenden Mitmenschen, keine unwillkommenen Geräusche, kein Lärm – mit einem Wort: Nichts Negatives.
Ich suchte meine Zigaretten und steckte mir eine an. Man kann mit einer Zigarette manchmal besser denken. Sie entspannt und sorgt für eine sichtbare Pause. Nicht umsonst haben sie am Vorabend von Revolutionen in den Kneipen und Kellern geraucht wie die Schlote. Während solcher Diskussionen ging der Tabak kiloweise über den Tisch. Das wollen sie jetzt verbieten. Weil sie keine Revolutionen mehr wünschen. Vielleicht werden sie Erfolg haben – vielleicht aber auch nicht. Einerseits gut, weil es ohne Blut nicht geht, sagte Professor Huber zu Hans Scholl. Andererseits schlecht, weil Revolutionen ein Zeichen setzen. Welches, entscheidet die Zeit danach. Es kann positiv oder negativ sein. In der Vergangenheit waren sie leider immer negativ. Aber vielleicht kommt die positive Revolution noch.
Rauchen kann auch friedenstiftend wirken. Nach indianischer Legende sollen sich zwei fremde Stämme einmal feindlich gegenüber gestanden haben. Beide bereiteten sich auf den vermutlichen Kampf am nächsten Tag vor. Doch zuvor trafen sich die Häuptlinge auf einer abgelegenen Insel. Sie sprachen verschiedene Sprachen und wussten beide nicht, wie sie das Gespräch beginnen sollten. Mehr aus Verlegenheit als aus Zuvorkommendheit nahm einer seinen Tabaksbeutel und stopfte seine Pfeife. Der andere sah ihm dabei zu, und beide sprachen kein Wort miteinander. Als der erste Häuptling seine Pfeife gestopft hatte, zündete er den Tabak an, zog ein paar Mal und reichte seine Pfeife dem anderen Häuptling. Sie gestikulierten und lobten den Tabak. Später gestikulierten sie über andere Themen. Genaueres bleibt dem Leser überlassen. Nachdem sie dieses Treffen beendet hatten, kehrten sie zu ihren Stämmen zurück und befahlen den Rückzug. Sie hatten die gleichen Interessen, aber stellten fest, dass man diesen nicht immer zur gleichen Zeit am selben Ort nachgehen kann. Und man wollte Zukunft für den eigenen Stamm und nicht seinen eventuellen Untergang.
Rauchen ist generell eine Form des Kennenlernens. Es ist einfacher jemandem eine Zigarette anzubieten als ihm eine interessante Frage zu stellen. Das unbeholfene und oberflächliche Anbiedern erspart man sich dabei.
Man sagt auch, dass die rauchenden Mitarbeiter einer Firma besser informiert seien als die langweiligen Nichtraucher, weil man sich beim Rauchen trifft und Informationen austauscht – oft genug relevante Informationen, die selbstsüchtige Gesundheitsfanatiker entweder nicht bekommen oder nicht weitergeben, weil sie eben nur an ihrem eigenen Wissenspool interessiert sind. Raucher sind das nicht.
Und nicht zuletzt tötet man Viren im eigenen Körper. Denn Nikotin ist bekanntlich ein Nervengift, was diese kleinen Schädlinge auch nicht vertragen. Wie oft waren seine nichtrauchenden Kollegen krank und wunderten sich, dass er als Raucher in zehn Jahren null Krankheitstage vorweisen konnte. Es gab sicherlich auch andere Gründe und Umstände, die man berücksichtigen muss. Aber das Rauchen war eben einer davon – ganz im Gegensatz zu der Verschleierungspolitik der Volksbeherrschenwollenden. Hansi hatte immer gesagt: Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin. Doch ohne Schnaps und Rauch stirbt die andere Hälfte auch. Also ist es egal, ob ich rauche oder nicht. Wenn ich darin einen Vorteil sehe und spüre, sollte ich es tun. Es ist wie mit der Religion: Viele Menschen glauben auch an das Positive an ihr, an die Rettung und Erlösung … und was ist?
Also rauchte ich diese Zigarette zu Ende und steckte mir bald danach noch eine zweite an. Der Rauch dieser Religion verschwand ins Nichts und hinterließ positive Gefühle, die mich aufstehen hießen und weiter in Richtung Hafen schlendern ließen, um dem Lauf der Zeit zu folgen, was immer er auch bringen würde.
Die Wellen glitten flach und ohne Schaum auf den Sand – eine nach der anderen – ohne Unterbrechung – und das schon seit tausenden von Jahren, als ob es nichts Natürlicheres gäbe. Ein beruhigender Vorgang, der einen minutenlang auf sie starren lässt – mit und ohne Gedanken. Und die Gedanken fliegen auf wie die Möwen und schwingen sich entlang der Küste in die Entfernung oder aufs Meer hinaus, kehren vielleicht wieder oder bleiben draußen. Mancher Gedanke stirbt hier auch, so wie die Wellen und die Möwen sterben, ohne einen Laut von sich zu geben. Das Wasser versickert im Sand, und die toten Körper der Möwen treiben eine Weile auf dem Wasser oder verwesen mit verrenkten Flügeln zwischen dem Gras in den Dünen. Kein Gedanke an Späteres, kein Jammern wegen verschlossener Zukunft, keine Angst vor dem Tod.
Eine Welle kommt und geht. Vor ihr waren Millionen anderer da, und nach ihr kommen Millionen anderer. Warum tun sich die meisten Menschen schwer damit: Einfach zu gehen, ohne zu jammern – rechtzeitig zu gehen, bevor sie zur Last anderer Menschen werden und am Ende doch sterben, nur nicht auf anständige, sondern auf erbärmliche und peinliche Weise?
Der Tod ist doch ein Freund, der einen von der letzten Haltestelle abholt. Würde er Whiskey trinken, lüde ich ihn zu Haus auf eine oder zwei Flaschen ein. Aber von dem, was ich gehört habe, trinkt er keinen Whiskey. Auch gut. Dann gibt es wenigstens keine Diskussion um die richtige Sorte. Denn bei mir müsste er mit irischem Whiskey Vorlieb nehmen. Sollte er auf Bourbon oder Scotch stehen, hätte er sich seine eigene Flasche mitzubringen. Aber mit dem Tod diskutiert man nicht. Wenn Er da ist, lohnt sich keine Diskussion, erübrigt sich jegliches Argumentieren. Vielleicht fällt es deshalb den meisten Menschen schwer, ihn freiwillig zu begleiten, weil viele von ihnen heillose Schwätzer sind und zu jedem Thema ihre Meinung abgeben müssen, ob man sie nun gefragt hat oder nicht, ob sie zu dem Thema einiges wissen oder nicht, ob ihre Meinung wichtig ist oder nicht. In den meisten Fällen labern sie nämlich einfach drauf los. Und auch das gefällt mir am Tod: Dass Er ihnen einfach das Maul zumacht. Er ist damit für mich also ein wahrer Freund. Und auch in meinem eigenen Fall bin ich ihm dankbar. Denn er trennt mich von einer Welt, die mir einiges bot, im Guten wie im Schlechten, so dass es am Ende auf ein Unentschieden hinauslief, aber nun nichts mehr zu bieten hat – wie bei jedem Menschen. Nichts beeindruckt mich mehr. Und ich erwarte es auch nicht mehr. Würde Er mich nicht abholen, ginge ich zu ihm.
Aber noch ist es nicht so weit. Allerdings bin ich so weit gekommen, dass ich nun auf der kleinen, hölzernen Brücke stehe, die direkt am Hafen über den Sæbyfluss führt, und die Enten beobachte, die sich dort auf dem Wasser schwimmend oder am Ufer liegend die Zeit vertreiben. Im Hafen liegen unterschiedliche Boote: Die eine Hälfte kleine Jachten für den reinen Genuss bei einer Fahrt auf dem Meer, die andere Hälfte meist hellblau gestrichene Fischerboote, auf denen die Männer arbeiten, wenn sie draußen sind.
Hinter dem roten und zweistöckigen Hafenrestaurant liegt zentral das Hafenkontor, die Dienststelle für alle bürokratischen Angelegenheiten. Daneben eine große Halle, in der Schiffe repariert werden – die Schiffswerft. An der südlichen Hafenseite die Promenade (allerdings sehr kurz), Butiken (drei hatten dort Platz) und ein paar teure Neubauwohnungen. Was allerdings nach kurzem Betrachten die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die „Frau vom Meer“, eine etwa zehn Meter hohe, doppelfigürige Skulptur aus Beton, deren eines Gesicht aufs Meer hinausschaut und deren anderes auf die Stadt blickt – die Brüste zur Stadt hin bedeckt von einem Kleid, zum Meer hin beide Brüste bar nach vorn gestreckt wie eine Gallionsfigur.
Warum überall dieser Jungfrauenkult? Ob Isis oder Maria, Yü-niu oder Hera, Goldregen oder heilger Geist? In fast allen Kulturen die Zeugung besonderer Menschen ohne Ficken? Nun, das haben wir heute ja auch durch unsere künstliche Befruchtung. Aber warum dieser Kult? Das Besondere an einer jungen Frau ohne sexuelle Erfahrung scheint zu sein, dass sie etwas zum ersten Mal macht, dessen Folge ein neues Leben sein kann. Aber das machen Kühe und Meerschweinchen auch. Und es gibt für alles ein erstes Mal: Das erste Mal atmen, das erste Mal Milch aus weiblichen Brüsten trinken (weshalb wir Männer und oft genug auch Frauen wahrscheinlich das ganze Leben so fasziniert von ihrem Anblick sind), das erste Mal betrunken an einem fremden Ort aufwachen und so weiter. Warum also dieser Kult um die Jungfräulichkeit? Irgendwann ist es mit dem ersten Mal, und heute immer früher, dahin mit der Unerfahrenheit. Man will aus dem Neugeborenen etwas Besonderes machen. Niemand kommt auf die Welt, ohne dass seine Mutter und sein Vater gefickt hätten. Ohne Ficken nun mal keine Geburt, auch die des Jesus oder Buddhas oder anderer nicht. Wieder einmal nur die Mär vom Übernatürlichen.
Und dann das Gehabe der Väter und Ehemänner in der Vergangenheit und teilweise heute noch! Man will aus der Jungfrau etwas Besonderes machen? Keine erfahrene Frau heiraten wollen, entjungferte Töchter lieber schlachten oder hinrichten als ihnen beizustehen. Ein toller Glaube! Eine tolle Liebe! Eine tolle Hoffnung für die jungen Frauen, denen das Leben genau wie allen anderen Menschen etwas bietet, was sie ausprobieren möchten. Jeder Mensch ist etwas Besonderes und Einzigartiges. Da spielt es keine Rolle, ob er schon einmal Geschlechtsverkehr hatte oder nicht.
Aber was gehen mich Religion und falsche Moral an? Ich bin auf diese Welt gekommen, um diesen Schmarrn, wie die Bayern sagen, nicht mitzumachen, sondern ihre wahre Identität zu erkennen und nicht das zu glauben, was andere mir aus Machtgelüsten einzutrichtern versuchen; ihre Schönheit mit eigenen Augen zu sehen und mich nicht blind machen zu lassen von Unwissenden. Und ich habe erkannt. Die Brüste der Frau vom Meer sind wunderschön, nur etwas zu groß, zu kalt und zu hart für mich.
Also ging ich weiter – durch die kleinen Straßen in der Nähe des Hafens, in denen noch einige der typischen kleinen Fachwerkhäuser aus dem 19. Jahrhundert stehen – vorbei am Touristenbüro und dem Heimatmuseum – durch die Fußgängerzone, in der ich ein Geschäft suchte, das elektronische Geräte verkaufte. Ich brauchte noch einen CD-Spieler, um meine klassischen CDs hören zu können. In dem Ferienhaus gab es nur einen Fernseher mit Parabolantenne. Das diente mir zu gar nichts, außer meine Zeit dort zu verschwenden. Und das wollte ich nicht. Denn so viel Zeit blieb mir nicht mehr. Ich ging mit dem erworbenen CD-Spieler in der rechten Hand am Landgericht vorbei und kaufte beim Købmand noch zwei Schachteln Zigaretten, die bis zum nächsten Morgen reichen würden. Außerdem nahm ich das Wichtigste für ein Frühstück mit: Kaffee, Eier, Wurst, Brot, Butter – natürlich die gesalzene. Vorbei am Ferienhauscenter und wieder am Meer. Noch fünfzig Meter bis zu meinem Haus. Tür aufgeschlossen, den Duft eingeatmet und schon daheim.
Am Abend ging ich noch einmal los, um die andere Seite, den Wald kennen zu lernen. Die Sonne stand schon tief. Aber ich wollte nur einen kurzen Spaziergang machen, die nähere Umgebung nur flüchtig begrüßen, wissen, was vor und hinter mir liegt – wie ein Stier, der sich nach ein paar Minuten in der Arena seine Querencia gesucht hat, seinen Platz, an den er nach einem Angriff immer wieder zurückkehrt, weil er sich dort sicher und unangreifbar fühlt.
Der Kildevej führte mich nach ein paar Minuten hinaus aus dem kleinen Ort und eine kleine Anhöhe hinauf in ein größeres bewaldetes Gebiet. Von hier kann man einzelne Dächer zwischen den vielen Bäumen des Ortes sehen und dahinter natürlich wieder das Meer, das sich bis zum Horizont erstreckte, und auf dem die letzte Fähre für diesen Tag von Læsø nach Frederikshavn fuhr.
Ich ging weiter in den Wald hinein und folgte einem schmalen Pfad, der sich an den Stämmen der Bäume vorbeischlängelte und mir einen unbekannten Weg mit unbekanntem Ausgang wies. Es wurde jetzt schneller dunkel, und bald musste ich wirklich den Blick senken und auf den Weg achten, denn die Blätter und Zweige entzogen sich in der Unerkennbarkeit durch die Dunkelheit immer mehr meinem Blick. Ich dachte gerade daran, wieder umzukehren, wenn sich der Weg nicht bald wieder dem Meer zuwenden würde, als ich einen Hilferuf aus dem Inneren des Waldes vernahm. Ich blieb stehen und versuchte die Richtung zu orten, aus der der Ruf kam. Ich hörte wieder ein „Hjæ…“ – der Rest war nicht mehr zu hören, offenbar unterdrückt oder mit einer Hand oder etwas anderem verhindert worden.
Ohne an die Dunkelheit zu denken, tastete ich mich auf direktem Weg an den Bäumen vorbei in die Richtung, aus der die Stimme an mein Ohr drang. Dabei fand ich einen relativ robusten Knüppel, den ich vorsichtshalber aufhob und zur Verteidigung mitnahm. Während ich versuchte, trotz der pflanzlichen Hindernisse zügig an das Ziel zu kommen, horchte ich aufmerksam in alle Richtungen. Aber ich hörte nichts mehr außer meinem Atem und ging ohne anzuhalten weiter.
Nach einer weiteren Minute hörte ich plötzlich ein gedämpftes Stöhnen und eine leise Stimme, die leise, aber bedrohlich etwas murmelte, was ich nicht verstand. Ich konnte in etwa zehn Meter Entfernung eine Bewegung ausmachen. Zwei Personen lagen am Boden und schienen zu kämpfen. Eine Frau wand sich auf dem Rücken liegend von links nach rechts, während ein Mann auf ihr lag und versuchte, ihr die Kleider vom Körper zu reißen.
Die beiden bemerkten mich nicht. Sie waren zu sehr mit sich und dem anderen beschäftigt, atmeten beide heftig und rangen um den Sieg. Als ich noch überlegte, ob es sich um ein Liebesgerangel oder doch wie vermutet um eine Vergewaltigung handelte, blitzte plötzlich ein Messer an der Kehle der Frau auf, was mir weiteres Nachdenken ersparte.
Ich achtete darauf, mich so zu nähern, dass der Mann mich nicht aus den Augenwinkeln wahrnehmen konnte. Als ich direkt über ihm stand, nahm ich den Knüppel in beide Hände, hob die Arme über meinen Kopf und schlug mit voller Wucht auf seinen Schädel. Man hörte, wie er brach.
Der Kopf sackte auf die Schulter der Frau, und für einen kurzen Moment lagen beide unbeweglich wie eine Skulptur da. Ich rollte seinen leblosen Körper mit dem linken Fuß von der Frau und beobachtete ihn eine Weile in der Erwartung, dass er durch eine Bewegung oder ein Röcheln ein Lebenszeichen von sich geben würde. Aber es kam nichts mehr.
Nachdem die Frau realisiert hatte, was geschehen war, nahm sie das Messer, das neben ihr lag, in die rechte Hand und stand unsicher auf. Mit aufgerissenen Augen richtete sie die Klinge gegen mich und verharrte in dieser Stellung.
„Gå hjem!“, sagte ich und bemühte mich um einen ruhigen und beruhigenden Ton.
Sie raffte ihre aufgerissene Bluse und Jacke vor der Brust zusammen und setzte ihren rechten Fuß vorsichtig nach hinten. Danach den linken, bis sie sich schließlich umdrehte und immer schneller ging, bald lief, wobei sie sich immer wieder umdrehte und sich vergewisserte, dass ich mich nicht bewegte und an der Stelle stehen blieb, an der ihr getöteter Peiniger lag. Ich wartete noch etwa eine Minute und ging ebenfalls – den Weg zurück, den ich gekommen war.
Es fing zu regnen an. Und wie immer, wenn es regnete, hielt ich den herabfallenden Tropfen mein Gesicht entgegen und ließ sie meine Wangen und Stirn kühlen. Gleichzeitig dachte ich daran, dass der Regen jede eventuelle Spur von mir an dem Toten und im Wald beseitigen würde, und dass die Polizei wohl nicht auf den Gedanken kommen könnte, bei mir an die Haustür zu klopfen und Fragen zu diesem Fall zu stellen. Den Knüppel hatte ich noch in der Hand, nahm ihn auch weiterhin mit, um ihn und das an ihm klebende Blut und Gehirn im Ofen zu verbrennen. Durch seine Länge konnte ich ihn als Spazierstock benutzen, weshalb es wohl niemandem, dem ich begegnen könnte, in den Sinn kommen würde, dass es ein Opferwerkzeug war. Denn so, wie ich den Mann getötet hatte, hatten die Priester einer frühen Andenkultur jungen Mädchen den Schädel gespalten, um sie ihrem Gott zu opfern. Der Unterschied war nur, dass ich an keinen Gott dachte und keine kleinen Mädchen tötete.
Auf dem Heimweg kam mir niemand mehr entgegen. Die Leute saßen in ihren Häusern und nahmen vielleicht gerade ihr abendliches Mahl ein. Aus den Fenstern drang ein mattgelbes Licht nach draußen und erzeugte in mir die Vorfreude auf eine gleichartige Gemütlichkeit in meinem Haus. Der Regen wurde stärker und wirkte reinigend auf alles, was mich umgab und alles, was mich antrieb.
Zuhause angekommen zündete ich den Ofen an, nahm eine Dusche und setzte mich danach in sauberen Kleidern auf das kleine Sofa vor dem Feuer, hörte dem langsamen Satz aus Beethovens fünftem Klavierkonzert zu und trank den wärmenden Whiskey in kleinen und bedächtigen Schlücken, die nach anfänglichem purifizierendem Feuer in meiner Speiseröhre meine Gedanken auf sanften Wogen behutsam in eine ruhigere Welt trugen.
In der Nacht
Der Raum war hell. Auf der linken Seite sitzt der tote Mann aus dem Wald. Er trägt ein weißes Kleid, das seinen gesamten Körper bedeckt, und eine blaue Wollmütze auf dem Kopf, damit man seine Wunde am Hinterkopf nicht sieht. Auf der rechten Seite sitzt der Staatsanwalt, in der Mitte der Richter. Vor dem Richter sitzen in einem Halbkreis vier Frauen auf Stühlen.
„Wir haben uns hier versammelt“, sagt der Richter, „weil der Tote, Herr Paulus Stuper, in Berufung gegangen ist und seinen Tod neu verhandelt wissen möchte. Zur Klärung der Sachlage haben wir Zeugen geladen. Ich bitte nun zuerst Frau Lene Mikkelsen, ihre Aussage zu machen. Bitte, Frau Mikkelsen!“
„Ja, also… Ich ging am 24. Quartember gegen 20 Uhr im Sæbygård Skov spazieren, als plötzlich hinter einem Baum dieser Mann da hervortrat.“ Sie zeigt auf Paulus Stuper. „Ich drehte mich sofort um, weil ich Angst bekam, und rannte weg. Aber der Mann rannte hinter mir her. Ich rief um Hilfe und rannte so schnell ich konnte. Aber er war schneller und holte mich bald ein. Er schlug mir mit der Hand ins Gesicht, so dass ich auf den Boden fiel. Er hockte sich zuerst mit den Knien auf meine Brust und hielt mir ein Messer an den Hals. ‚Wenn du nicht mitmachst, stech ich dich gleich hier ab.’, hat er gesagt. Ich habe mich nicht mehr gerührt. Und er hat angefangen, an meinen Kleidern zu zerren, zerriss meine Bluse und wollte meine Hose ausziehen. Er bekam plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf und sackte auf mich drauf und blieb so liegen. Hinter ihm stand ein Mann mit einem Knüppel. Ich nahm instinktiv das Messer, das neben meinen Kopf gefallen war, und stand langsam auf und lehnte mich dabei an den nächsten Baum. Das Messer richtete ich gegen den fremden Mann. Ich wusste ja nicht, was der wollte. Aber der stand nur da und blickte zunächst auf den toten Mann zwischen uns. Er sagte ‚Gå hjem!’, und ich bin fortgelaufen, zuerst langsam, dann immer schneller. Aber der Mann blieb an der Stelle stehen.“
„Kannten Sie den Mann?“
„Nein.“
„War er Däne oder Ausländer?“
„Ich glaube Däne. Er hat ‚gå hjem’ gesagt.“
„Wie sah der Mann aus?“
„Groß, blond, blaue Augen.“
„Sie sagten, es sei 20 Uhr gewesen. War es da nicht schon dunkel?“
„Es fing an dunkel zu werden. Aber seine Augen hatten ein eigenartiges Leuchten. Ich erinnere mich deutlich an diesen hellblauen Strahl, der mir entgegenschien.“
„Danke, Frau Mikkelsen!“
„Möchten Sie dazu etwas sagen, Herr Stuper?“
Der Mann mit der blauen Wollmütze überlegte ein paar Sekunden. Danach entschloss er sich: „Ja, ich habe versucht, diese Frau zu vergewaltigen. Aber deshalb schlägt man doch keinen tot. Ich habe das Recht, am Leben zu bleiben.“
„Mein Sohn ist kein schlechter Mensch, Herr Richter. Das müssen sie mir glauben.“
Eine der vier Frauen aus dem Stuhlkreis hatte plötzlich ungefragt das Wort ergriffen. Es war die Mutter des Toten.
„Er war immer so ein lieber Junge. Er hat mir oft, wenn er im Wald war, Blumen mitgebracht. Und beim Einkauf hat er mir immer tragen geholfen.“
„Vielen Dank, Frau Stuper! Aber wir möchten als nächste Frau Isabell Offer hören. Frau Offer, bitte sagen Sie uns, was Sie zu diesem Fall beizutragen haben!“
„Ja, gern. Also, vor fünfzehn Jahren – so lange bin ich ja nun schon tot – ging ich im Wald bei Frederikshavn spazieren. Es war ebenfalls der 24. Quartember, und es war auch gegen 20 Uhr, als dieser Mann dort (sie zeigt auf Stuper) hinter einem Baum hervortrat. Ich lief weg, aber der Mann folgte mir und holte mich bald ein. Er warf mich auf den Boden und sagte: ‚Wenn du nicht mitmachst, stech ich dich gleich hier ab.’ Ich habe nichts mehr gemacht, und er hat mich vergewaltigt. Es war schrecklich. Am Ende hat er seine Hose zugemacht und mir sein Messer in die Kehle gestochen.“
„Wollen Sie dazu etwas sagen, Herr Stuper?“
„Ich hatte Panik. Wenn die mich angezeigt hätte, wär ich doch in Bau gegangen. Ich musste das tun.“
„Was mussten Sie tun: Die Frau vergewaltigen oder sie töten?“
„Für die Vergewaltigung kann ich nichts. Ich hatte eine schwere Kindheit. Aber nach der Vergewaltigung musste ich sie töten, damit sie mich nicht verrät.“
„Er war immer so ein lieber Junge. Aber am 24. Quartember ist mein lieber Mann gestorben. Paulus war erst sechzehn. Verstehen Sie, Herr Richter? Das hat der Junge nicht verkraftet. Plötzlich der Vater nicht mehr da. Was soll er denn machen, der liebe Junge?“
„Vielen Dank, Frau Stuper! Aber wir möchten als nächste Frau Inger Fremtiden hören. Frau Fremtiden, bitte sagen Sie uns, was Sie zu diesem Fall beizutragen haben!“
„Ja, gern. Am nächsten Donnerstag ist der 24. Quartember. Ich werde im Wald bei Brønden spazieren gehen. Es wird etwa 20 Uhr sein. Hinter einem Baum würde plötzlich dieser Mann da (sie zeigte auf Stuper) hervortreten und mich vergewaltigen wollen. Ich werde versuchen zu fliehen. Aber der Mann würde schneller sein und mir sein Messer an die Kehle halten. Am Ende würde er mich doch töten, weil ich nicht gegen ihn aussagen soll und er nicht ins Gefängnis will.“
„Danke, Frau Fremtiden. Sie haben uns sehr geholfen.“
„Möchten Sie etwas dazu sagen, Herr Stuper?“
„Ja. Wie kann die Frau wissen, dass ich sie am nächsten 24. Quartember vergewaltigen und umbringen würde. Das habe ich doch noch gar nicht gemacht. Sie können mich nicht für etwas verurteilen, was ich nicht gemacht habe. Das ist ungerecht.“
„Das tun wir auch nicht, lieber Herr Stuper. Seien Sie unbesorgt! Aber Sie haben nun einmal zwei Frauen vergewaltigt und eine von ihnen auch umgebracht. Außerdem sagen Sie selbst, dass Sie für die Vergewaltigung nichts können. Also müssen wir davon ausgehen, dass Sie ein weiteres Mal eine Frau vergewaltigen und umbringen würden. Glücklicherweise hat Sie beim zweiten Versuch ein unbekannter Mann davon abgehalten, ein zweites Mal zu töten. Für die begangenen Delikte ergeht folgendes Urteil: Herr Paulus Stuper bleibt tot. Sein Tod bleibt ungesühnt, weil es für die Gemeinschaft das Beste ist, wenn Herr Stuper tot bleibt. Die ausgesetzte Belohnung für die Befreiung der Gemeinschaft von Herrn Stuper kann leider dem Retter und Erlöser nicht ausgehändigt werden, da dieser unbekannt ist. Daher erhält Frau Mikkelsen die Belohnung als Entschädigung für angetanes Leid.“
„Und was bekomme ich, Herr Richter? Schließlich habe ich meinen Sohn verloren.“
„Sie erhalten die Aufgabe, sich als Mutter dieses Mannes bis an Ihr Lebensende zu schämen und zu bereuen, dass Sie sich nicht besser um ihn gekümmert haben, als es nötig war. Die Verhandlung ist hiermit geschlossen.“
In den Saal trat eine wunderschöne Frau mit langen schwarzen Haaren. Sie trug ein knöchellanges, weißes Kleid, das sich über ihre Brustwarzen spannte und ihre schlanken, nackten Füße nicht bedeckte. Sie blieb vor Stuper stehen und forderte ihn durch ein Zeichen auf, ihm zu folgen. Als Stuper aufstand, konnten alle seine Erektion sehen.
Iska – der Zweite Tag
Am nächsten Morgen schlief er lange – bis 12 Uhr. Er stand erholt auf und duschte ausgiebig. Danach ein Frühstück nach seinem Wunsch: Kaffee, Eier, Wurst, Brot, gesalzene Butter – und dänisches Radio. Ein Kreuzworträtsel auf Dänisch, der Blick vom schmalen Esstisch hinaus aus dem Fenster direkt aufs Meer, das zwanzig Meter vor ihm begann und im Nirgendwo endete. Die Zigaretten im Zwanzig-Minuten-Takt, einen neuen Kaffee jede halbe Stunde.
Nach zwei Stunden das kleine KWR mit Hilfe des Wörterbuchs gelöst, als er sie dort unten langsam vorbeischlendern sah, den Kopf gesenkt und den Blick auf den Sand gerichtet. Er zog ein T-Shirt an und trat barfuß hinaus, um sie zu begrüßen.
„Hallo!“, rief er schon von der Haustür aus. Sie wandte ihr Gesicht in seine Richtung und lächelte, winkte freundlich und hielt die rechte Hand augenschirmend an die Stirn, ohne Pause lächelnd. Er ging zu ihr und fragte nach der Stimmung.
„Hast du Lust auf einen Kaffee? Ich wohne gleich da oben.“
Sie überlegte kurz und sah auf die Muschel in ihrer Hand. „Ja, gern. Ich hatte heute noch keinen.“
Sie gingen gemeinsam zum Haus. Sie setzte sich links von der Tür an den Gartentisch, während er hineinging und den Kaffee holte. Nachdem sie die Muschel auf den Tisch gelegt hatte, legte sie ihre Hände übereinander in den Schoß, blickte entspannt auf das Meer und wartete.
„Hast du schon gefrühstückt? Das Frühstück steht noch auf dem Tisch. Es ist heute bei mir etwas später geworden.“
Sie überlegte wieder einen Augenblick lang. „Ja, ehrlich gesagt, habe ich noch nichts gegessen und könnte etwas vertragen.“ Dabei lächelte sie ihn unverkrampft an.
Er ging wieder hinein, um die Sachen zu holen.
„Soll ich mitkommen?“
„Nein. Bleib nur sitzen! Bin gleich wieder da.“
Das tat sie. Und das tat er.
Sie aß langsam und kaute bedächtig, schnitt sich immer nur kleine Stücke von der Wurst ab. Er hatte seinen Stuhl meerwärts gestellt und blickte hinaus, wollte sie nicht mit Blicken stören, nippte ab und zu an seinem Kaffee und steckte sich erst eine Zigarette an, als sie offenkundig nichts mehr essen wollte.
„Möchtest du auch eine?“
„Nein, danke. Ich rauche nur abends – beim Bier oder so.“
„Bier habe ich nicht da. Aber ich kann dir einen Whiskey anbieten.“
„Nein, danke.“, lachte sie. Es ist wirklich noch zu früh.“
Er stellte die Lebensmittel in den Kühlschrank, stellte das Radio drinnen etwas lauter und setzte sich wieder zu ihr.
„Rauchen Sie viel?“
„Etwa 25 pro Tag, mal mehr, mal weniger. Aber meistens mehr.“
„Haben Sie keine Angst? Ich meine vor Krankheiten oder so.“
„Oder so? Du meinst den Tod?“
„Ja.“