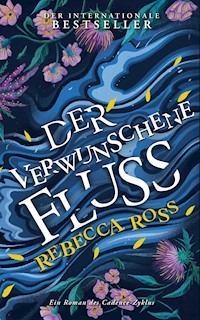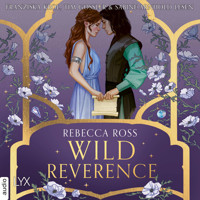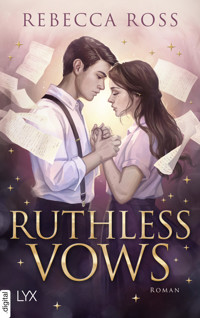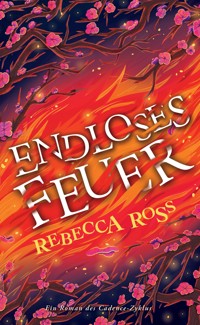
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Endloses Feuer
- Sprache: Deutsch
Teil zwei der magisch-mystischen Cadence-Duologie von Bestsellerautorin Rebecca Ross. Die Insel Cadence hat sich selbst und ihre Bewohner immer in einem empfindlichen Gleichgewicht gehalten. Doch nun hat Bane, der Geist des Nordwinds, alles und jeden, der ihm im Weg steht, ins Schwanken gebracht, um die Herrschaft über Menschen und Geister gleichermaßen zu erlangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
AUSSERDEM BEI PANINI ERHÄLTLICH:
REBECCA ROSS: DER VERWUNSCHENE FLUSS
ISBN 978-3-8332-4336-3
GINNY MYERS SAIN: DARK AND SHALLOW LIES
Von seichten Lügen und dunklen Geheimnissen
ISBN 978-3-8332-4180-2
GINNY MYERS SAIN: SECRETS SO DEEP
Flüstern aus der Tiefe
ISBN 978-3-8332-4334-9
Nähere Infos und weitere phantastische Bände unter:
paninishop.de/phantastik/
Ins Deutsche übertragen von Michaela Link
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright © 2023 Rebecca Ross. All rights reserved.
Titel der Amerikanischen Originalausgabe: »A Fire Endless« by Rebecca Ross, published in the US by Harper Voyager an imprint of HarperCollins Publishers LLC.
Designed by Paula Russle Szafranski
Map Design by Nick Springer / Springer Cartographics LLC
Fire illustrations © Shutterstock
Deutsche Ausgabe 2023 Panini Verlags, Schloßstr. 76, 70176 Stuttgart.
Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Michaela Link
Lektorat: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDROSS002E
ISBN 978-3-7569-9977-4
Gedruckte Ausgabe:
1. Auflage, November2023, ISBN 978-3-8332-4401-8
Findet uns im Netz:
www.paninicomics.de
PaniniComicsDE
Für Suzie Townsend, Ausnahmeagentin. Danke für den Zauber, den du diesem Buch verliehen hast. (Und den anderen fünf davor.)
Prolog
Einst hatte Kae tausend Worte in Händen getragen. Als Geist des Windes hatte sie die Macht genossen, etwas so Zartes und doch so Spitzes zu halten, und sie hatte sie stets mit Freude losgelassen und den Klang der vielen Stimmen gefühlt, von tief bis hauchig, von melodisch bis rau. Einst hatte sie Gerüchte und Neuigkeiten durch die Finger gleiten und wie den Faden einer Spule über den Hügeln von Cadence abrollen lassen, hatte die Reaktion der Menschen beobachtet, wenn die Worte sie wie Hagel oder Distelwolle trafen.
Es hatte sie jedes Mal aufs Neue erheitert.
Doch damals war sie jünger, hungriger und unsicherer gewesen. Die älteren Geister hatten hämisch Stücke aus ihren Flügeln herausgebissen und sie dadurch geschwächt, um ihre Wege zu übernehmen. König Bane hatte sie noch nicht zu seiner bevorzugten Botin ernannt, selbst mit ausgefransten Flügeln und Stimmen der Sterblichen als engsten Begleitern. Erst jetzt, als Kae über das östliche Cadence dahinglitt und Erinnerungen nachhing, konnte sie diese einfachere Zeit richtig würdigen.
Es war ein Moment gekommen, von dem an hatte sich etwas verändert. Ein Moment, den Kae im Nachhinein genau bestimmen konnte, weil sie erkannte, dass er eine Nahtstelle in ihrer Existenz war.
Lorna Tamerlaine und ihre Musik.
Sie hatte nie für die Geister der Luft gesungen, obwohl Kae häufig aus den Schatten zusah, wenn die Bardin das Meer oder die Erde anrief. Kae war anfangs erleichtert gewesen, dass Lorna nicht die Winde beschwor, obwohl der Geist sich oft danach sehnte. Sie wusste, dass Lornas Klänge nur für sie erschaffen worden waren, und sie spürte sie tief im Innern vibrieren.
Das war der Moment, in dem Kae aufgehört hatte, Worte zu tragen und sie zu bringen. Sie wusste, was Bane Lorna angetan hätte, wäre ihm bekannt gewesen, was sie tat: für die Geister von Erde und Wasser zu spielen, um deren Zustimmung und Bewunderung zu gewinnen.
Kae, die durch einen stürmischen Nordwind ins Leben gerufen worden war, die einst über Tratsch gelacht und die Flügel über den Höfen von Cadence hatte heulen lassen, hatte gespürt, wie ihr das Herz brach, als Lorna viel zu jung gestorben war.
Sie flog nun über den östlichen Teil der Insel und bewunderte die Gipfel und Täler, die glänzenden Lochs und die plätschernden Flüsse. Rauch stieg aus den Schornsteinen der Cottages, die Gärten waren voller Sommerfrüchte und Schafherden weideten auf den Hügeln. Kae näherte sich gerade der Clanlinie, als sich der Druck in der Luft drastisch veränderte.
Ihre Flügel erzitterten und ihr indigoblaues Haar flog ihr ins Gesicht. Sie musste sich ducken und winden, und sie wusste, dass der König sie rief. Sie war spät dran und hätte längst Bericht erstatten sollen. Er war ungeduldig.
Mit einem Seufzen flog Kae höher hinauf.
Sie ließ das grüne Bild von Cadence hinter sich und durchbrach die Wolkenschichten. Das Licht wich endloser Dunkelheit. Sie spürte, wie die Zeit ringsum gefror; hier in der Halle des Windes gab es keinen Tag, keine Stunde. Sie wurden zwischen den Sternbildern bewahrt. Das Gefühl hatte Kae einst erschüttert: zu sehen, wie die Zeit so ungehindert unter den Menschen auf der Insel dahinfloss, und sie dann hinter sich zu lassen wie einen mottenzerfressenen Umhang.
Denk an deine Aufgabe, ermahnte sich Kae, als sich die letzte Sekunde sterblicher Zeit löste und wie Eis von ihren Flügeln fiel.
Sie musste sich auf die Begegnung vorbereiten, denn Bane würde sie nach Jack Tamerlaine fragen.
Sie erreichte die Gärten und unterdrückte ein Aufwallen von Furcht, einen Anflug von Widerstand. Der König würde beides spüren und sie konnte sich seinen Zorn nicht leisten. Sie ließ sich Zeit und atmete tief durch, während sie zwischen den Reihen von Blumen aus Frost und Schnee hindurchging, die Flügel eng an den Rücken angelegt. Sie erinnerten an Libellenflügel und trugen Kaes eigene Farbe: den Ton des Sonnenuntergangs, wenn der Tag in die Nacht überging – ein dunkles Lila, das von quecksilberfarbenen Adern durchzogen war. Sie glitzerten im Licht der Sterne, die in den Kohlebecken brannten, während Kae weiter auf die Halle zuging.
Blitze zuckten durch die Wolken unter ihren Füßen. Kae spürte die Hitze durch die Sohlen und kämpfte erneut gegen den Drang an, den Kopf einzuziehen. Es gefiel ihr gar nicht, dass sie es schon unwillkürlich tat, nachdem sie jahrelang Banes Missbilligung ausgesetzt gewesen war.
Dann war er also zornig, weil er auf sie warten musste.
Kae wappnete sich zitternd, während sie die Säulen der Halle durchschritt. Der flachshaarige Hof war bereits vollzählig versammelt, die Flügel unterwürfig angelegt. Alle sahen ihr entgegen – ältere Geister, die ihr einst das Fliegen beigebracht hatten und ihr außerdem die Flügel zerfetzt hatten. Jüngere Geister, die sie mit einer Mischung aus Angst und Ehrfurcht betrachteten und ihren Platz als Botin einnehmen wollten. Unter der Last der Blicke und des Schweigens fiel Kae das Atmen schwer, als sie auf den König zuging.
Bane sah ihr entgegen, die Augen wie Glut, das Gesicht so regungslos, als wäre es aus Kalkstein gemeißelt. Seine blutroten Flügel waren zum Zeichen seiner Autorität gespreizt und er hielt eine von Blitzen erhellte Lanze.
Kae kniete vor dem Nordwind nieder, weil sie keine andere Wahl hatte. Sie fragte sich jedoch: Wann wird es das letzte Mal sein, dass ich vor dir aufs Knie gehe?
»Kae«, sagte Bane und zog ihren Namen mit geheuchelter Geduld in die Länge. »Warum hast du mich warten lassen?«
Ihr gingen zahlreiche Antworten durch den Kopf, die alle auf der Wahrheit beruhten. Weil ich dich verabscheue. Weil ich nicht länger deine Dienerin bin. Weil ich von deinen Befehlen die Nase voll habe.
Doch laut antwortete sie: »Vergib mir, mein König. Ich hätte früher kommen sollen.«
»Was gibt es Neues von dem Barden?«, fragte Bane. Er versuchte zwar, träge zu klingen, doch Kae hörte die Nervosität in seiner Stimme. Jack Tamerlaine machte dem König unglaubliche Angst.
Kae richtete sich auf. Die Silberringe ihrer Kettenrüstung klirrten bei jeder Bewegung.
»Er schmachtet dahin«, erwiderte sie und dachte daran, wie sie Jack zurückgelassen hatte. Er hatte im Gemüsegarten der Weberin gekniet und auf den Lehm in seinen Händen gestarrt.
»Und spielt er? Singt er?«
Kae wusste, dass ihresgleichen nicht lügen konnte. Das machte die Antwort auf Banes Frage zu einer Herausforderung, aber seit Lorna … Kae war geschickt darin geworden, ihn abzulenken.
»Sein Kummer scheint ihn niederzudrücken«, sagte sie wahrheitsgemäß. Seit Adaira fort war, war Jack nur noch ein Schatten seiner selbst. »Er will nicht spielen.«
Bane schwieg.
Kae hielt den Atem an, während ein Raunen durch die Halle ging. Sie widerstand der Versuchung, einen Blick über die Schulter zum Hofstaat zu werfen.
»Der Barde scheint schwach zu sein, wie der Obstgarten es uns gezeigt hat«, setzte sie an, brach jedoch ab, als Bane sich erhob. Sein langer Schatten kroch über die Stufen des Podiums hinab. Als er Kae berührte, versetzte die Kälte ihr einen Schock.
»Er scheint schwach zu sein, sagst du«, donnerte der König. »Und doch hat er uns alle heraufbeschworen. Er wagt es, im Freien zu spielen. Ich war doch barmherzig zu ihm, nicht wahr? Wieder und wieder habe ich ihm Zeit gegeben, sich zu bessern und seine Musik aufzugeben. Doch er weigert sich und lässt mir keine andere Wahl, als ihn erneut zu bestrafen.«
Kae schloss den Mund und ihre spitzen Zähne klapperten aufeinander. Lorna war eine kluge Musikerin gewesen. Sie hatte von dem Barden des Ostens vor ihr gelernt, der sich ebenfalls vor Bane und dem Geisterreich in Acht genommen und jahrzehntelang unversehrt musiziert hatte. Doch Lorna war vor Jacks Rückkehr nach Cadence gestorben. Manchmal beobachtete Kae ihn, wie man es ihr in jüngster Zeit befohlen hatte, und sie wünschte sich nichts mehr, als vor ihm zu erscheinen und ihm zu sagen …
»Ich will, dass du Whin von den Wildblumen eine Botschaft überbringst«, sagte Bane und überraschte Kae damit.
»Welche Botschaft, mein König?«
»Dass sie den Gemüsegarten der Weberin verfluchen soll.«
Kae stieß den Atem aus, während ihr ein Frösteln über den Rücken rieselte. »Mirin Tamerlaines Garten?«
»Ja. Den Garten, aus dem sie diesen Barden ernährt. Whin soll dafür sorgen, dass die gesamte Ernte sofort eingeht und nichts mehr wächst, bis ich es sage. Das gilt auch für jeden anderen Garten, der ihn mit Nahrung versorgen könnte. Und wenn es jeder Gemüsegarten des Ostens ist, dann soll es so sein. Lasst die Hungersnot kommen. Es würde den Sterblichen nicht schaden, aufgrund des Barden zu leiden.«
Wieder ging Gemurmel durch den Hof. Bemerkungen und Ausrufe, Freudenschreie. Kae vermutete, dass die Hälfte der Windgeister – diejenigen, die den Hofstaat des Königs bildeten – Banes Grausamkeit guthießen. Es würde unterhaltsam sein, sie auf ihren Wegen zu beobachten. Diejenigen jedoch, die stumm blieben … Kae fragte sich, ob sie es ebenso leid waren wie sie, erleben zu müssen, wie Bane der Erde, dem Wasser und dem Feuer völlig unsinnige Befehle gab und die Menschen zu seiner Unterhaltung leiden ließ.
»Du zögerst, Kae?«, bemerkte Bane, als sie schwieg.
»Mein König, ich frage mich nur, ob Whin von den Wildblumen und ihre Erdgeister diesen Befehl nicht wahnwitzig oder vielleicht übertrieben finden werden.«
Der König lächelte. Kae wusste, dass sie zu weit gegangen war, und doch wich sie nicht zurück, als Bane die Stufen des Podiums herabstieg. Als er auf sie zukam, begann sie zu zittern.
»Fürchtest du mich, Kae?«
Sie konnte nicht lügen, also sagte sie: »Ja, König.«
Bane stand nun dicht vor ihr. Sie konnte den Geruch der Blitze in seinen Flügeln riechen und fragte sich, ob er sie schlagen würde.
»Selbstverständlich wird Whin meinen Befehl wahnwitzig finden«, gestand er. »Doch wenn sie sich weigert, den Barden durch Aushungern von der Insel zu vertreiben, werde ich das als Zweifel an meiner Herrschaft ansehen und die Zerstörung ausweiten. Sag ihr das. Sie wird zusehen, wie ihre Jungfern fallen, eine nach der anderen, und ihre Brüder werden krank werden, von der Wurzel zum Ast und zur Blüte. Ich werde die Erde verheeren, denn sie müssen daran erinnert werden, dass sie mir dienen.«
Kae erkannte, dass es keine einfache Lösung gab. Wenn Whin dem Befehl Banes Folge leistete, würden die Menschen und die Erdgeister trotzdem leiden. Dem alten Volk war klar, dass der Nordwind von den Erdgeistern bedroht wurde, die die zweitmächtigsten Geister unter ihm waren. Whin weigerte sich oft, die unsinnigen Anweisungen des Königs auszuführen. Sie hatte keine Angst vor ihm; sie zog nicht den Kopf ein, wenn sein Blitz oder eine Krankheitzuschlug, und Kae konnte nur über sie staunen.
Und so sagte Kae etwas Törichtes – und Mutiges.
»Fürchtest du Lady Whin von den Wildblumen, König?«
Bane schlug so schnell zu, dass Kae seine Hand nicht kommen sah. Der Schlag ins Gesicht brachte sie aus dem Gleichgewicht, doch es gelang ihr, stehen zu bleiben, während ihre Augen brannten. Sie hatte ein Brüllen in den Ohren. Sie wusste nicht, ob es ihre Gedanken waren oder das Flügelrauschen fliehender Höflinge.
»Weigerst du dich, meine Nachricht zu überbringen, Kae?«
Sie stellte sich vor, wie sie Whin die Botschaft ausrichtete. Den Ausdruck tiefer Empörung auf dem Gesicht der Lady, das Lodern in ihren Augen. Es war eine sinnlose Nachricht, denn Kae wusste, dass Whin Jack nicht hungern lassen und von der Insel vertreiben würde. Sie würde sich weigern, nicht nur, um sich Bane zu widersetzen, sondern weil Jacks Musik ihnen Hoffnung schenkte, und wenn er Cadence verließ, würden ihre verbotenen Träume zu Staub zerfallen.
»Ja«, flüsterte Kae und sah ihm in die funkelnden Augen. »Such dir jemand anderen.«
Sie wandte sich von ihm ab und ihr Trotz verlieh ihr ein berauschendes Gefühl von Stärke.
Doch sie hätte es besser wissen müssen.
In einem Moment stand sie aufrecht da. Im nächsten hatte Bane ein nachtdunkles Loch in den Boden gerissen, eine heulende Leere. Er hielt Kae darüber – sie konnte sich nicht bewegen, konnte nicht atmen, nur denken und in den tintendunklen Kreis starren, in den sie gleich stürzen würde.
Trotzdem glaubte sie nicht, dass er es tun würde.
»Ich verbanne dich, Kae vom Nordwind!«, rief Bane. »Du bist nicht länger meine bevorzugte Botin. Du bist meine Schande. Ich werfe dich auf die Erde zu deinen geliebten Sterblichen, und solltest du den Wunsch verspüren, wieder aufzusteigen und an meinen Hof zu kommen … wirst du klug sein müssen, meine Kleine. Es wird keine leichte Aufgabe sein, dich zu erheben, nachdem du so tief gefallen bist.«
Kae verspürte einen sengenden Schmerz im Rücken und schrie auf. Sie hatte noch nie einen solchen Schmerz verspürt – es brannte, als würde ein Stern zwischen ihren Schultern stecken –, und sie verstand erst, was ihn verursacht hatte, als Bane mit ihren beiden schlaffen, zerfetzten rechten Flügeln vor sie hintrat.
ZweiihrerFlügel. Die Farbe des Sonnenuntergangs, der mit der Nacht verschmolz. Die Farbe, die nur ihr allein gehört hatte. Zerstört, gestohlen. Sie baumelten in den Händen des Nordkönigs.
Er lachte über den Ausdruck auf ihrem Gesicht.
Sie spürte, wie ihr das Blut heiß und dick über den Rücken rann. Es verbreitete einem süßen Duft, während es ihr über die Rüstung und das Bein strömte und von den nackten Zehen in die Leere tropfte. Tropfen aus Gold.
»Hinfort mit dir, Erdliebchen!«, donnerte Bane, und die verbliebenen Höflinge, die spitzzähnigen Geister, die danach hungerten, Kaes Verderben zu sehen, lachten und jubelten über ihre Verbannung.
Ihr fehlte die Kraft, sich gegen seinen Griff zu wehren oder auf seinen Spott zu reagieren. Schmerz breitete sich in ihrer Kehle aus, eine Mischung aus Tränen und Demütigung, und plötzlich stürzte sie durch das Loch in den Wolken in den kalten Nachthimmel. Obwohl sie wusste, dass ihre rechten Flügel abgerissen waren, versuchte sie, die Luft zu beherrschen und mit ihren verbliebenen linken Flügeln hinabzugleiten.
Sie schwankte und überschlug sich wie ein anmutloser Sterblicher, der von Wolke zu Wolke fiel.
Endlich bekam Kae die Luft unter die Fingerspitzen. Sie musste ihr verbliebenes Flügelpaar eng an den Rücken anlegen, damit es nicht zerriss. Sie sah, wie die Zeit sich verschob und wieder in Bewegung geriet. Sie sah, wie die Nacht mit sonnenbeschienenen Prismen und einem dunkelblauen Himmel in den Tag überging. Tief unter ihr konnte sie die Insel Cadence ausmachen – ein langer Streifen grüner Erde, umgeben von einem schäumenden grauen Meer.
Kae wollte sich in Luft verwandeln, stellte jedoch fest, dass sie ihre manifestierte Form nicht verlassen konnte. Ihre Arme und Beine, ihr Haar, ihre verbliebenen linken Flügel, ihre Haut und ihre Knochen, all das war in der körperlichen Welt gefangen. Eine weitere Strafe von Bane. Wenn sie auf dem Boden aufschlug, würde sie das umbringen.
Ob Whin sie finden würde, zerschmettert im Farnkraut?
Sie spürte die Wolken auf dem Gesicht und lauschte dem Zischen des Windes, der ihr durch die Finger strömte. Sie schloss die Augen und gab sich dem Sturz hin.
1
EIN LIED FÜR DIE ASCHE
1
Ein Junge war im Meer ertrunken.
Sidra Tamerlaine kniete neben ihm im feuchten Sand und tastete nach seinem Puls. Seine Haut war kalt und bläulich verfärbt, die Augen offen und glasig, als schaue er in eine andere Welt. Goldene Algen klebten wie eine unförmige Krone an seinem braunen Haar, und Wasser und Blut sickerten ihm aus den Mundwinkeln und glänzten von Muschelsplittern.
Sie hatte versucht, ihn zurückzuholen, war ins Wasser gesprungen und hatte ihn aus der Flut gezogen. Nachdem sie ihn an Land gezerrt und ihm auf die Brust gedrückt hatte, hatte sie ihm Atem gespendet, wieder und wieder, als könne sie seinen Geist und dann seine Lungen und sein Herz ins Leben rufen. Doch Sidra hatte schnell das endlose Meer in ihm gekostet – Salz, kalte Tiefen, schillernder Schaum – und die Wahrheit akzeptiert.
Es spielte keine Rolle, wie begabt sie als Heilerin war, wie viele Wunden sie genäht, wie viele gebrochene Knochen sie gerichtet oder Krankheiten und Fieber sie verjagt hatte. Es spielte keine Rolle, wie viele Jahre sie ihrer Kunst gewidmet hatte und auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod gewandelt war. Sie war zu spät gekommen, um diesen Jungen zu retten, und als sie ihm die milchigen Augen schloss, wurde sie an die Gefahren des Meeres erinnert.
»Wir haben am Ufer geangelt«, berichtete einer der Gefährten des Jungen. Er klang hoffnungsvoll, als er neben Sidra trat. Hoffnungsvoll, dass sie seinen Freund ins Leben zurückholen konnte. »In einem Moment stand Hamish noch auf dem Felsen da, und dann ist er plötzlich ausgerutscht und untergegangen. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht mit Stiefeln schwimmen soll, aber er wollte sie nicht ausziehen!«
Sidra schwieg und lauschte dem Wechsel der Gezeiten. Das wilde Tosen des Meeres, das gleichzeitig zornig und vielleicht entschuldigend klang, schien zu sagen, dass es nicht die Schuld des Wassergeistes sei, dass der Junge ertrunken war.
Ihr Blick ging zu Hamishs Füßen. Er trug kniehohe Schnürstiefel aus gegerbtem Leder, während seine Freunde barfuß waren, wie alle Inselkinder es sein sollten, die im Meer schwammen. Ihre Großmutter hatte ihr einst gesagt, dass die meisten Heiler die Gabe der Vorahnung besäßen und dass sie diesem Gefühl immer folgen solle, ganz gleich, wie seltsam es sei. Sidra konnte die Gänsehaut nicht erklären, die plötzlich ihre Arme überzog. Sie hätte beinahe nach den Schnürbändern gegriffen, doch dann hielt sie in der Bewegung inne und drehte sich stattdessen zu den drei Jungen um, die sie umstanden.
»Lady Sidra?«
Wenn ich doch nur ein paar Augenblicke früher hier gewesen wäre, dachte sie.
An dem Nachmittag wehte ein scharfer Ostwind. Sidra war auf der Nordstraße gegangen, die an der Küste entlangführte. Sie hatte einen Korb mit warmen Haferkeksen und mehreren Flaschen Kräuterelixieren getragen und in den Wind gespäht. Die hektischen Rufe der Jungen hatten ihre Aufmerksamkeit erregt, und sie war ihnen zu Hilfe geeilt, doch am Ende war sie zu spät gekommen.
»Er kann nicht tot sein«, sagte einer der Jungen wieder und wieder, bis Sidra ihm die Hand auf den Arm legte. »Er kann nicht tot sein! Du bist eine Heilerin, Lady. Du kannst ihn retten!«
Sidra hatte einen Kloß im Hals, sodass sie nicht sprechen konnte, aber ihr Gesichtsausdruck musste den Jungen, die sich um sie scharten und im Wind zitterten, genug sagen. Die Atmosphäre verdüsterte sich.
»Geht und holt Hamishs Vater und seine Mum«, sagte sie schließlich. Sand hatte sich unter ihren Nägeln und zwischen ihren Fingern gesammelt. Sie spürte ihn auch auf den Zähnen. »Ich werde hier bei ihm warten.«
Sie sah den drei Jungen nach, wie sie am Ufer entlang zu dem Pfad eilten, der sich einen grasbewachsenen Hügel hinaufschlängelte, und Stiefel, Verpflegung und Angelnetze in ihrer Hast zurückließen. Es war Mittag, die Sonne stand im Zenit und verkürzte die Schatten an der Küste. Der Himmel war wolkenlos und schmerzhaft grell, und Sidra schloss kurz die Augen und lauschte.
Es war Hochsommer auf der Insel. Die Nächte waren warm und sternenklar, die Nachmittage stürmisch, und in den Gärten mit ihren fruchtbaren dunklen Böden stand die Ernte unmittelbar bevor. Süße Beeren wuchsen an wilden Ranken, große Strandschnecken sammelten sich bei Ebbe in Felslachen, und oft waren Rehkitze auf den Hügeln zu sehen, die ihren Müttern durch Farne und kniehohe Wildblumen folgten. Es war die Jahreszeit, die in Ost-Cadence für ihre Fülle und ihren Frieden bekannt war. Eine Jahreszeit der Arbeit und Ruhe, und doch hatte sich Sidra noch nie so leer, so erschöpft und unsicher gefühlt.
Dieser Sommer war anders. Als sei ein neuer Abschnitt zwischen der Sonnenwende und der Herbst-Tagundnachtgleiche eingetreten. Doch vielleicht kam es Sidra nur so vor, weil sie eine unklare Bedrohung verspürte und noch immer versuchte, sich darauf einzustellen.
Sie konnte kaum glauben, dass vier Wochen gekommen und gegangen waren, seit Adaira in den Westen aufgebrochen war. Manchmal war es morgens so, als habe Sidra sie erst am Tag zuvor zum letzten Mal umarmt, an anderen Tagen schien es ihr, als seien bereits Jahre vergangen.
Die Flut stieg und legte sich wie zwei kalte Hände mit langen Fingernägeln um Sidras Knöchel, brachte sie zurück in den Augenblick. Erschrocken öffnete sie die Augen und blinzelte in die Sonne. Ihr schwarzer Zopf hatte sich gelöst. Meerwasser tropfte ihr daraus auf die Arme, während sie ihrer Intuition folgte.
Sie machte sich daran, Hamishs nasse Stiefel aufzuschnüren.
Als sie ihm den linken ausgezogen hatte, kam ein bleiches Bein mit einem großen Fuß zum Vorschein. Nichts Ungewöhnliches. Vielleicht irrte sich Sidra. Sie wollte ihre Untersuchung schon abbrechen, doch dann kam die nächste Welle, als wollte sie sie drängen, weiterzumachen. Gischt, tote Meeresschnecken und ein Haifischzahn umspülten sie.
Sie zog dem toten Jungen auch den rechten Stiefel aus und das gegerbte Leder fiel spritzend in das seichte Wasser.
Sidra erstarrte.
Hamishs Wade war mit violetten und blauen Flecken übersät, die wie frische Prellungen aussahen. Seine Adern traten hervor und schimmerten golden. Die Verfärbung schien an seinem Bein hinaufzukriechen und hatte schon fast sein Knie erreicht. Es war klar, dass er sein Leiden vor seinen Freunden unter dem Stiefel verborgen hatte, und er musste es schon eine ganze Weile getan haben, da es sich so weit ausgebreitet hatte.
Sidra hatte noch nie so unheimliche Male gesehen und dachte an die magischen Verletzungen und Erkrankungen, die sie in der Vergangenheit geheilt hatte. Es gab zwei Arten: Wunden, die mit verzauberten Klingen geschlagen worden waren, und Gebrechen als Folge der Ausübung von Magie. Weber, die Geheimnisse in Plaids woben, und Schmiede, die Zaubersprüche in Stahl hämmerten. Fischer, die Netze mit Amuletten knüpften, und Schuster, die Schuhe aus Leder und Träumen fertigten. Im Osten forderte das Wirken von Magie durch das eigene Handwerk einen schmerzhaften Preis, und Sidra besaß eine Sammlung von Tränken, um die Symptome zu lindern.
Doch die Ursache für die Verfärbung von Hamishs Bein gab ihr Rätsel auf. Sie konnte nicht von einer Klinge stammen, da es keine wirkliche Wunde gab. Sidra hatte dieses Symptom auch noch nie bei anderen Magiebenutzern gesehen, nicht einmal bei Jack, als er für die Geister gesungen hatte.
Warum bist du nicht zu mir gekommen?, wollte sie den Jungen weinend fragen. Warum hast du es niemandem gezeigt?
In der Ferne hörte sie Rufe. Hamishs Vater näherte sich. Sie wusste nicht, ob Hamish seinen Eltern von seinem rätselhaften Zustand erzählt hatte. Wahrscheinlich nicht, denn sonst hätten sie ihn zu Sidra gebracht, damit sie ihn behandelte.
Schnell zog sie ihm die Stiefel wieder an und verschnürte sie, um die fleckige Haut zu verbergen. Sie würde später mit Hamishs Eltern darüber reden, denn gleich würde Trauer ihre Herzen erfassen und diesen warmen Sommertag zerstören.
Das Wasser zog sich flüsternd zurück. Am Nordhimmel brauten sich Wolken zusammen. Der Wind drehte und plötzlich war es kalt. Über ihr krächzte ein Rabe.
Sidra blieb an Hamishs Seite. Sie wusste nicht, woran der Junge gelitten hatte. Was sich unter seine Haut gestohlen und sein Blut verfärbt hatte, was ihn im Wasser in die Tiefe gezogen hatte, sodass er ertrunken war.
Sie wusste nur, dass sie so etwas noch nie gesehen hatte.
Mehrere Kilometer südlich landeinwärts stand Torin unter derselben hohen Sonne und demselben dunkelblauen Himmel und betrachtete einen Obstgarten. Es stank nach Fäulnis. Er hatte keine andere Wahl, als die schlechte Luft einzuatmen, die von der feuchten Erde, den harzenden Bäumen und den verdorbenen Früchten ausging. Er wollte sich noch nicht eingestehen, was er da sah, obwohl er es schmecken konnte.
»Wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen?«, fragte er, den Blick weiter auf die Apfelbäume gerichtet und auf die Flüssigkeit, die aus den geborstenen Stämmen sickerte. Der Saft war zähflüssig und violett, und er glitzerte im Licht, als würde er winzige Goldsplitter enthalten.
Rodina, die Bäuerin, ging auf die achtzig zu. Als sie neben Torin trat, reichte sie ihm kaum bis zur Schulter und blinzelte in das Sonnenlicht. Sie schien sich nicht die geringsten Sorgen um ihren kranken Obstgarten zu machen. Doch Torin bemerkte, dass sie ihr Schulterplaid enger um sich zog, als wolle sie sich unter den verzauberten Fäden verstecken.
»Vor vierzehn Tagen, Laird«, erwiderte Rodina. »Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht. Es war nur ein Baum. Aber dann hat es sich auf die anderen in der Reihe ausgebreitet. Ich fürchte, bald wird mein ganzer Obstgarten befallen sein, und dann ist es um meine Ernte geschehen.«
Torin senkte den Blick auf den Boden. Kleine unreife Äpfel übersäten das Gras. Die Früchte waren zu früh von den kranken Bäumen gefallen, und er konnte ihnen ansehen, dass ihr Fleisch mehlig war. Einige Äpfel verrotteten bereits, sodass ihr Kerngehäuse freilag, in dem sich Würmer wanden.
Er hätte beinahe einen der Äpfel mit dem Stiefel angestupst, doch er hielt sich zurück. »Hast du die Früchte berührt, Rodina? Oder die Bäume?«
»Natürlich nicht, Laird.«
»War sonst noch jemand in deinem Obstgarten?«
»Der Junge, der für mich arbeitet«, sagte Rodina. »Er hat die Krankheit als Erster bemerkt.«
»Und wer ist das?«
»Hamish Brindle.«
Torin schwieg für einen Augenblick, während er in seinem Gedächtnis kramte. Er hatte sich Namen nie gut merken können, obwohl er Gesichter wiedererkannte. Wahrlich ein Fluch für einen Hauptmann, der zum Laird geworden war. Er war beeindruckt von Sidra, die Namen wie durch Zauberei heraufbeschwören konnte. Jüngst hatte sie ihn in einigen Fällen aus großer Verlegenheit gerettet. Er schob es auf den Druck, unter dem er während des vergangenen Monats gestanden hatte.
»Ein schlaksiger Bursche mit braunem Haar und zwei Raupen als Augenbrauen«, half Rodina ihm auf die Sprünge, als sie Torins inneres Dilemma spürte. »Vierzehn Jahre alt und spricht nicht viel, hat aber Köpfchen und kann anpacken. Beschwert sich nie, wenn ich ihm eine Aufgabe gebe.«
Torin nickte und wusste wieder, warum ihm der Name so bekannt vorgekommen war. Hamish Brindle war der jüngste Sohn von James und Trista, einem Bauern und einer Lehrerin. Der Junge hatte erst kürzlich Interesse bekundet, der Ostwacht beizutreten. Obwohl Torin vor einigen Wochen gezwungen gewesen war, seinen Titel als Hauptmann an Yvaine abzutreten, seine Stellvertreterin, hatte er es sich nicht verkneifen können, sich einzumischen. Die leidgeprüfte Yvaine erlaubte ihm glücklicherweise zu kommen und zu gehen, wie es nötig war, in der Kaserne zu frühstücken, auf dem Übungsplatz als Beobachter dabei zu sein und neue Rekruten zu beurteilen, als sei Torin noch immer einer von ihnen und nicht der neue Laird, der versuchte, die Rolle zu erlernen, die Adaira scheinbar so selbstverständlich eingenommen hatte.
Doch die Wahrheit war, dass es ihm immer schwergefallen war, etwas loszulassen. Rollen, die zu ihm gepasst hatten. Orte, die er ins Herz geschlossen hatte. Menschen, die er liebte.
»War Hamish heute Morgen hier?«, fragte Torin. Plötzlich spürte er eine Kälte, die sich ihm wie ein weiches Leichentuch um die Schultern legte. Er unterdrückte ein Schaudern und richtete den Blick auf den Obstgarten.
»Er hat sich den Vormittag freigenommen, um mit seinen Freunden zu angeln«, antwortete Rodina. »Warum, Laird? Musst du mit ihm sprechen?«
»Ja, ich denke schon.« Torin führte Rodina behutsam von den Bäumen fort. Der faulige Gestank folgte ihnen bis zum Gemüsegarten der Bäuerin. »Ich werde ihn bitten, deinen Obstgarten mit einem Seil abzusperren. In der Zwischenzeit solltest du weder die Bäume noch die Früchte berühren, solange ich nicht mehr über diese Krankheit weiß.«
»Aber was ist mit meiner Ernte, Laird?«, fragte Rodina und blieb an dem rostigen Gartentor stehen. Eine ihrer Katzen – Torin wollte gar nicht wissen, wie viele sie besaß – sprang auf die Steinmauer neben ihr und rieb sich miauend an ihrem Arm.
Torin zögerte, hielt aber dem entschlossenen Blick der Frau stand. Sie glaubte, dass ihre Ernte noch zu retten sei, doch Torin spürte, dass in dem Obstgarten noch viel mehr im Argen lag. Seit Jack und Adaira mit dem Wasser-, Erd- und Windvolk gespielt und gesprochen hatten, hatte Torin mehr über die Geister der Insel erfahren. Zum Beispiel, was ihre Hierarchie betraf. Ihre Grenzen und ihre Kräfte. Über die Furcht vor Bane vom Nordwind, ihrem König. Es schien, dass im Reich der Geister einiges rumorte. Es würde ihn nicht überraschen, wenn jeder Baum von der Krankheit befallen wurde – einer Krankheit, wie er sie in den fast siebenundzwanzig Jahren, die er die Ostseite der Insel durchstreifte, noch nie gesehen hatte. Ratlos fuhr er sich durchs Haar.
»Mach dir wegen der Ernte keine Sorgen«, sagte er mit einem Lächeln, das nicht ganz seine Augen erreichte. »Ich werde bald zurück sein, um dafür zu sorgen, dass die Seile sicher befestigt sind.«
Rodina nickte, runzelte jedoch die Stirn, als sie zusah, wie Torin sein Pferd bestieg. Vielleicht spürte sie genau wie er das hoffnungslose Schicksal der Bäume, die viel älter waren als sie beide. Ihre knorrigen Wurzeln verliefen tief unter der Erde von Cadence bis hinab zu einem verzauberten Ort, von dem Torin nur träumen konnte.
Das alte Volk war scheu und launisch und hörte nur auf die Musik eines Barden. Soweit Torin wusste, waren Jack und Adaira die einzigen lebenden Tamerlaines, denen sie sich gezeigt hatten. Und doch betete eine große Zahl der Tamerlaines die Erde und das Wasser, den Wind und das Feuer an. Anders als Sidra tat Torin es nur gelegentlich, war jedoch trotz seiner seltenen Lobpreisungen mit ihren Legenden aufgewachsen. Graeme, sein Vater, hatte ihn jeden Abend mit Geschichten über die Geister gefüttert wie mit Brot, und Torin wusste um das Gleichgewicht zwischen Menschen und Geistern auf Cadence und dass eine Seite die andere beeinflusste.
Er dachte über seine Möglichkeiten nach, während er auf der Straße zum Hof der Brindles ritt. Der übliche Nachmittagssturm stand kurz bevor, und im Schatten war es kalt geworden, als Torin vor sich eine Frau und ein Kind die Straße entlanggehen sah. Dann erkannte er, dass es sich um Mirin und Frae handelte, Jacks Mutter und ihre kleine Tochter. Torin brachte sein Pferd zum Stehen.
»Haupt… Laird«, korrigierte sich Mirin und nickte ihm zu.
Torin hatte sich daran gewöhnt, dass sein alter Titel zugunsten des neuen abgeschnitten wurde, wenn man ihn begrüßte. Er fragte sich, ob »Laird« jemals wirklich zu ihm passen würde oder ob der Clan in ihm immer den »Hauptmann« sehen würde.
»Mirin, Fraedah«, begrüßte er die beiden und bemerkte, dass Mirin einen Kuchen in den Händen hielt. »Sieht so aus, als wärt ihr zwei auf dem Weg zu einem Fest?«
»Nein, nicht zu einem Fest«, sagte die Weberin mit schwerer Stimme. »Dann hast du die Neuigkeiten noch nicht im Wind gehört?«
Torin krampfte sich der Magen zusammen. Für gewöhnlich lauschte er stets dem Wind, falls Sidra oder sein Vater nach ihm riefen. Heute jedoch war er abgelenkt gewesen. »Was ist passiert?«
Mirin sah Frae an. Die Augen des kleinen Mädchens waren groß und traurig, und es senkte den Blick zu Boden, als wolle es nicht sehen, wie die Nachricht ihn traf.
»Was ist passiert, Mirin?«, fragte Torin. Sein Hengst spürte seine Nervosität, tänzelte von der Straße und zertrat die Gänseblümchen unter seinen großen Hufen.
»Ein Junge ist im Meer ertrunken.«
»Welcher Junge?«
»Tristas jüngster Sohn«, berichtete Mirin. »Hamish.«
Es dauerte einen Augenblick, bis die Nachricht bei Torin ankam, und dann hatte er das Gefühl, als sei ihm eine Klinge zwischen die Rippen gestoßen worden. Er konnte kaum sprechen und trieb sein Pferd weiter, galoppierte den Rest des Weges bis zum Hof der Brindles.
Als er ihn erreichte, war sein blondes Haar zerzaust, und seine kniehohen Stiefel und sein Plaid waren schlammbespritzt. Es hatte sich bereits eine Menge versammelt. Wagen, Pferde und Gehstöcke säumten den Pfad zum Gemüsegarten. Die Haustür stand weit offen, Klagelaute drangen heraus.
Torin saß ab und ließ sein Pferd mit einer Fußfessel an einer Ulme zurück. Doch als er unter den Zweigen stand, zögerte er unsicher. Er blickte auf seine Hände hinab, auf seine schwieligen, vernarbten Handflächen. Der Siegelring der Tamerlaines steckte an seinem Zeigefinger. Das Wappen seines Clans war kunstvoll in das Gold eingraviert. Ein kapitaler Zwölfender sprang durch einen Ring aus Wacholder. Manchmal musste er ihn ansehen, musste spüren, wie er sich ihm ins Fleisch schnitt, wenn er die Finger krümmte, um sich daran zu erinnern, dass dies kein Albtraum war.
Innerhalb von fünf Wochen hatten drei verschiedene Lairds diesen Ring getragen.
Alastair. Adaira. Und jetzt Torin.
Alastair, der in seinem Grab ruhte. Adaira, die jetzt bei den Breccan lebte. Und Torin, der die Bürde des Amtes und seine furchterregende Macht nie gewollt hatte. Dennoch hatte der Ring den Weg an seinen Finger gefunden wie ein Fluch.
Torin schloss die Hand zur Faust und sah, wie der Ring im Gewitterlicht blitzte.
Nein, aus diesem Albtraum gab es kein Erwachen.
Die ersten Regentropfen fielen. Torin schloss die Augen, beruhigte sein Herz und versuchte, das Wirrwarr seiner Gedanken zu ordnen: das Rätsel um den kranken Obstgarten, der ertrunkene Junge, der in dem Obstgarten gearbeitet hatte, und Eltern, deren Herz gebrochen waren. Was konnte Torin der Familie sagen, wenn er ihr Cottage betrat? Was konnte er tun, um ihren Schmerz zu lindern?
Falls jemand dachte, seine Zeit als Hauptmann hätte ihn auf das Amt des Lairds vorbereitet, irrte er sich. Denn allmählich wurde ihm klar, dass das Erteilen von Befehlen, das Befolgen von Strukturen und das Finden von Lösungen ihn nicht darauf vorbereitet hatten, ein großes Volk zu repräsentieren, eine Rolle, zu der es gehörte, die Träume, Hoffnungen, die Ängste, die Sorgen und die Trauer der Menschen zu tragen.
Adi, dachte er, und ein Stich durchzuckte seine Brust.
Er gestattete sich in letzter Zeit nicht oft, an sie zu denken, denn er ging immer vom Schlimmsten aus. Er stellte sich Adaira in Ketten in der Festung des Westens vor, stellte sie sich krank und misshandelt vor. Oder tot und begraben in westlichem Lehm. Vielleicht war sie ja auch glücklich mit ihren Blutseltern und ihrem Clan und hatte ihre anderen Verwandten und Freunde im Osten vollkommen vergessen.
Wirklich, Torin?
Er konnte sie vor sich sehen, wie sie an seiner Seite stand, das Haar zu Zöpfen geflochten, Schlammspritzer auf dem Kleid, die Arme verschränkt und einen ironischen Unterton in der Stimme, bereit, seinen Pessimismus zu schüren. Sie war seine Cousine, doch sie war ihm mehr wie die kleine Schwester gewesen, die er sich immer gewünscht, aber nie bekommen hatte. Er konnte beinahe ihre Gegenwart spüren, denn sie war immer bei ihm gewesen, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie waren zwei wilde Kinder gewesen, die einander durch die Heide gejagt hatten, im Meer geschwommen waren und Höhlen erkundet hatten. Und dann, als sie älter waren, hatten sie Liebeskummer, Hochzeiten, Geburten und Todesfälle erlebt.
Adaira war immer an seiner Seite gewesen. Doch jetzt tadelte Torin spöttisch sich selbst. Er hätte es besser wissen sollen. Alle Frauen in seinem Leben verschwanden in der Erinnerung, als sei er dazu verflucht, sie zu verlieren. Seine Mutter. Donella, seine erste Frau. Maisie für wenige Tage um Mittsommer, bevor man sie aus dem Westen zurückgeholt hatte. Und jetzt Adaira.
Ich denke, du würdest es wissen, wenn ich tot wäre, sagte sie.
»Würde ich das?«, konterte Torin voller Bitterkeit, und die Worte zerstörten seine Vision von ihr. »Warum schreibst du mir dann nicht?«
Der Wind frischte auf und hob das Haar von seiner Stirn. Er war allein, nur der Regen flüsterte in den Ästen über ihm. Torin öffnete die Augen und wusste wieder, wo er war. Was er tun musste.
Er ging durch den Garten und trat über die Schwelle des Cottages.
Seine Augen brauchten einen Moment, um sich an das Licht im Haus zu gewöhnen, aber schon bald sah er die Menschen, die sich im Wohnraum versammelt hatten. Er sah die Speisen, die man der Familie gebracht hatte: Körbe mit Bannockbroten, Töpfe mit Käse und Butter, Teller mit Rostbraten und Kartoffeln, Kräuter und Honig und Beeren, und dazu eine Kanne mit dampfendem Tee. Durch eine offene Tür sah er den Jungen Hamish auf einem Bett aufgebahrt, als würde er nur schlafen.
»Laird.«
James Brindle trat aus der Gruppe der Trauergäste hervor und begrüßte ihn. Torin streckte die Hand aus, besann sich dann aber und umarmte James.
»Danke, dass du gekommen bist«, sagte James und trat zurück, damit er Torin ansehen konnte. Die Augen des Bauern waren rot vom Weinen und seine Haut fahl. Seine Schultern waren gebeugt, als ob er eine schwere Last tragen würde.
»Es tut mir leid«, flüsterte Torin. »Falls du und Trista in den nächsten Tagen etwas braucht … bitte, lasst es mich wissen.«
Er konnte kaum glauben, dass der Clan schon wieder ein Kind verloren hatte. Es schien, als habe Torin gerade erst das schreckliche Rätsel um die spurlos verschwundenen Mädchen gelöst: Moray Breccan, der Erbe des Westens, hatte die Entführung gestanden und verbüßte nun seine Strafe im Kerker der Tamerlaines. Die Mädchen waren alle wohlbehalten wieder bei ihren Familien, doch Hamish konnte Torin ihnen nicht zurückbringen.
James nickte und fasste Torin mit überraschender Kraft am Arm. »Es gibt da etwas, das du sehen solltest, Laird. Komm mit. Sidra … Sidra ist ebenfalls hier.«
Beim Klang ihres Namens löste sich Torins Anspannung und er folgte James in das kleine Schlafzimmer.
Mit einem schnellen Blick erfasste er die Umgebung: Steinwände, die nach Feuchtigkeit rochen, ein schmales Fenster mit geschlossenen Läden, die im Sturm klapperten, brennende Kerzen, deren Wachs auf einen Holztisch tropfte. Hamish, in seinen besten Kleidern, lag auf dem Bett, die Hände über der Brust gefaltet. Trista saß neben ihm und wischte sich mit einem Schulterplaid die Augen ab. Sidra stand mit ernster Miene hinter ihr, den Kleidersaum voller Sand.
James schloss die Tür, sodass nur sie vier und der tote Junge im Raum verblieben. Torin sah Sidra an, und sein Herz schlug schneller, als sie sagte: »Du musst dir etwas ansehen, Torin.«
»Dann zeig es mir.«
Sidra trat ans Bett. Sie flüsterte Trista etwas zu, die sich ins Tuch schluchzend erhob. James legte seiner Frau den Arm um die Schultern, und sie traten zurück, damit Torin zusehen konnte, wie Sidra Hamishs Leichnam den rechten Stiefel auszog.
Torin wusste nicht, was er erwartet hatte, aber gewiss kein Bein, das ihn an die Krankheit im Obstgarten erinnerte. Die gleiche Farbe, das gleiche faszinierende Schimmern von Gold.
»Ich kenne dieses Leiden nicht«, sagte Sidra. Sie sprach leise, dann biss sie sich auf die Lippe, und Torin wusste, was das bedeutete: Sie hatte Angst. »James und Trista wussten nichts davon, daher lässt sich nicht sagen, wie lange Hamish gelitten oder was es verursacht hat. Es gibt keine Wunde, seine Haut ist unversehrt. Ich habe keinen Namen hierfür.«
Torin hatte einen Verdacht. Panik stieg in ihm auf, ließ seine Zähne klappern, doch er unterdrückte sie. Er nahm drei tiefe Atemzüge und stieß sie durch den Mund wieder aus. Ruhe. Er musste Ruhe bewahren. Und er musste sich seines Verdachts sicher sein, bevor eine solche Nachricht bekannt und vom Wind verbreitet wurde und Angst und Sorge im Clan säte.
»Es tut mir leid, das zu sehen«, sagte Torin mit Blick zu James und Trista. »Und es tut mir leid, dass es euch und eurem Sohn widerfahren ist. Ich habe noch keine Erklärung dafür, aber ich hoffe, bald eine zu finden.«
James neigte den Kopf, während Trista weiter an seiner Schulter weinte.
Torins Blick kehrte zu Sidra zurück, und es schien, als lese sie seine Gedanken. Sie nickte ihm leicht zu, dann verschnürte sie Hamishs Stiefel wieder und verbarg die fleckige Haut.
Seit Torin das Amt des Lairds übernommen hatte, hatte Sidra lernen müssen, dass nachts die einzige Zeit war, in der sie mit ihrem Mann allein sein konnte – in ihrem Schlafzimmer über ihre Tochter hinweg flüsternd, die darauf bestand, zwischen ihnen zu schlafen.
Sidra saß am Tisch und notierte ihre Beobachtungen des Tages in ihre Heilbücher. Ihre Feder kratzte über das Pergament, während sie die Seiten mit allen Einzelheiten über Hamishs Bein füllte, an die sie sich erinnern konnte. Farbe, Geruch, Temperatur. Sie wusste nicht, wie hilfreich diese Angaben sein würden, da sie Teil einer Leichenschau waren. Als sie bemerkte, dass ihre Hand zitterte, unterbrach sie ihre Notizen.
Es war ein langer und anstrengender Tag gewesen. Sie hörte Torin zu, der Maisie im Bett eine Geschichte vorlas.
Eigentlich hätten sie in der Burg leben sollen. Sie hätten die Gemächer des Lairds bewohnen sollen, geräumige Zimmer mit Wandteppichen und Sprossenfenstern, die das Licht wie ein Prisma brachen, mit Dienern, die sich um die Feuer, die Laken und die Sauberkeit kümmerten. Doch dieser kleine Hof auf dem Hügel war ihr Heim und sie wollten es nicht verlassen. Nicht einmal, wenn das Amt des Lairds wie Spinnweben an ihnen klebte.
Sidra schaute von ihrer Arbeit auf und sah Torin und Maisie in dem fleckigen Spiegel an der Wand vor ihr. Sie beobachtete, wie die Lider ihrer Tochter schwerer und schwerer wurden und das Mädchen allmählich von der tiefen Stimme seines Vaters in den Schlaf gelullt wurde.
Maisie war gerade sechs geworden. Unglaublich, dass so viel Zeit vergangen war, seit Sidra sie das erste Mal im Arm gehalten hatte, und manchmal dachte sie an ihr altes Leben zurück, bevor sie Torin und Maisie begegnet war. Sidra war jung und insgeheim rastlos gewesen. Eine Heilerin, die das Handwerk ihrer Großmutter erlernte, Schafe hütete und im Gemüsegarten ihres Vaters half. Sie glaubte, ihr Leben sei vorhersehbar, bereits festgelegt, trotz der Tatsache, dass sie nach etwas anderem hungerte. Etwas, das sie hierher, zu diesem Augenblick geführt hatte.
Maisie begann leise zu schnarchen und Torin klappte das Märchenbuch zu.
»Soll ich sie in ihr Bett legen?«, fragte er. Seine schlafende Tochter lag auf seinem linken Arm. Er deutete auf die kleine Pritsche, die sie in der Ecke des Zimmers aufgestellt hatten. Sie versuchten schon seit Tagen, Maisie dazu zu bewegen, in ihrem eigenen Bett zu schlafen, aber ohne Erfolg. Sie wollte sich zwischen sie zwängen, und zu Anfang war es für Sidra tröstlich gewesen, Maisie und Torin nachts bei sich zu haben. Doch sie hatte Torin oft dabei erwischt, wie er sie über Maisies ausgestreckte Gestalt im Mondlicht betrachtet hatte.
Sie mussten dieser Tage einfallsreich sein und sich schnelle Momente in Ecken und staubigen Lagerräumen stehlen und sogar auf dem Küchentisch, wenn Maisie ein Nickerchen hielt.
»Nein, lass sie heute Nacht bei uns schlafen«, bat Sidra.
Sie dachte unweigerlich an James und Trista. Sidra hatte selbst vor nicht allzu langer Zeit ein Echo jenes Schmerzes erfahren, den die beiden nun durchlitten, und betrachtete Maisie für einen langen Augenblick, bevor sie ihr Tintenfass verkorkte und die Schreibfeder beiseitelegte.
Einige Minuten verstrichen, während Sidra ihre Aufzeichnungen noch einmal durchlas. Plötzlich wurde ihr bewusst, wie still es im Raum war. Nicht einmal der Wind wehte jenseits der Mauern. Es war unheimlich. Wie die Ruhe vor einem tödlichen Sturm. Sidra drehte sich auf dem Stuhl zu Torin um und schaute, ob er ebenfalls eingeschlafen war. Er war wach und starrte mit gerunzelter Stirn in die Schatten des Raums. Er schien weit fort zu sein, in sorgenvollen Gedanken versunken.
»Du wolltest vorhin mit mir sprechen«, sagte Sidra leise, um Maisie nicht zu wecken. »Über Hamish.«
Torin richtete sich auf und sah sie an. »Ja. Ich wollte nicht, dass seine Eltern hören, was ich dir gleich sagen werde.«
Sidra erhob sich schaudernd. »Worum geht es?«
»Komm erst ins Bett.«
Sie lächelte trotz der Angst, die sie belastete, und blies eine Kerze nach der anderen aus, bis nur noch ein Binsenlicht übrig war, um ihr den Weg zum Bett zu erhellen.
Sie schlüpfte unter die Decken und wandte sich Torin zu, während ihre Tochter träumend zwischen ihnen lag.
Torin schwieg. Er strich Maisie übers Haar, als müsse er etwas Weiches, Greifbares fühlen. Doch dann erzählte er von dem kranken Obstgarten. Von dem glitzernden, sickernden Baumsaft und von den faulen, unreifen Früchten, die von Bäumen gefallen waren, die Hamish gepflegt hatte.
Angst schnürte Sidra die Kehle zu. Die Worte kamen ihr nur schwer über die Lippen: »Er hat sich bei den Bäumen angesteckt. Bei den Geistern.«
Torin sah sie an. Seine Augen waren blutunterlaufen. Sein Bart und sein Haar waren von grauen Strähnen durchzogen. In dem Moment fühlte er sich uralt und traurig, und Sidra beugte sich vor und strich ihm über die Hand.
»Ja«, flüsterte Torin, »das denke ich auch.«
»Meinst du, es hat etwas mit Jacks Musik zu tun?«
Torin wurde nachdenklich. Sidra konnte seine Gedanken lesen.
Als Torin Laird geworden war, hatte Jack ihnen anvertraut, dass Lorna Tamerlaine einst jedes Jahr für die Geister des Meeres und der Erde gespielt hatte. Ihr Lobpreis hatte dafür gesorgt, dass der Osten gedieh, und als gegenwärtiger Barde des Clans würde Jack das auch.
Es war ein Geheimnis, in das aus Respekt vor den Geistern nur der Laird und der Barde eingeweiht waren. Es würde jedoch unmöglich sein, ein solches Geheimnis vor Sidra zu verbergen, da sie bereits den Verdacht hegte, dass Jack für die Geister sang. Danach wurde er jedes Mal krank.
»Er hat für die Erde und das Meer gesungen«, fuhr Torin fort. »Als er und Adaira vergangenen Monat nach den Mädchen gesucht haben.«
»Aber er hat auch für den Wind gespielt und einen tagelangen Sturm verursacht.«
Torin verzog das Gesicht. »Vielleicht haben wir den Nordwind mit irgendetwas verstimmt?«
»Ja, vielleicht«, pflichtete Sidra ihm bei. »Aber ich würde mir diesen Obstgarten gern selbst ansehen.«
»Denkst du, du findest dort eine Erklärung, Sid?«
Sidra öffnete den Mund, doch sie zögerte. Sie wollte ihn nicht beunruhigen, solange sie nicht mehr wusste.
»Ich bin mir nicht sicher, Torin. Aber ich glaube allmählich, dass die Krankheit ein Symptom für etwas viel Schlimmeres ist, und nur die Geister der befallenen Bäume kennen die Antwort. Und das bedeutet …«
Torin seufzte und starrte zur Decke empor. »Es bedeutet, dass Jack wieder für die Erde singen muss.«
2
Scheiße.«
Jack rutschte auf einem Kuhfladen aus und hätte um ein Haar das Gleichgewicht verloren. Er ruderte mit den Armen, um sich zu fangen, und sah die weit aufgerissenen Augen seiner kleinen Schwester. Frae war stehen geblieben, als hätte der Kraftausdruck sie auf dem von zertrampeltem Kohl übersäten Boden erstarren lassen.
»Das habe ich nicht so gemeint«, beeilte Jack sich, ihr zu versichern. Er war jedoch noch nie ein guter Lügner gewesen. Der ganze Tag war scheiße – der vergangene Monat war scheiße gewesen –, und er und Frae versuchten gerade, die Nachbarskuh aus ihrem Garten zu verjagen, ohne ihn dabei noch mehr zu zerstören.
Die Kuh muhte und lenkte Fraes Aufmerksamkeit wieder ab.
»O nein!«, rief sie aus, als die Kuh auf die Bohnen losging.
Jack versuchte, das Rindvieh nach vorn zum offenen Gartentor zu treiben. Das Tier geriet in Panik, machte kehrt und riss dabei die Stangen heraus. Jack blieb nichts anderes übrig, als noch einmal in den Kuhfladen zu treten, um ihr den Weg abzuschneiden.
»Jack!«
Er schaute nach rechts, wo Mirin auf dem gepflasterten Weg stand, einen karierten Stoffstreifen in der Hand. Er brauchte sie nicht zu fragen, was sie meinte; er nahm den Stoff und jagte die Kuh in den hinteren Garten.
Nach einem weiteren Katz-und-Maus-Spiel ließ Jack endlich den Stoffstreifen über den Hals der Kuh gleiten und hielt ihn wie ein loses Seil. Seufzend besah er sich den Schaden. Frae schien am Boden zerstört.
»Das wird schon wieder, kleine Schwester«, sagte er und hob ihr mit dem Finger das Kinn.
Frae würde bald neun werden, wenn der Winter kam. Jack hatte sie erst vor einem Monat kennengelernt und doch war sie bereits gewachsen. Sie war eine halbe Handbreit größer geworden, und er fragte sich, ob sie eines Tages genauso groß sein würde wie er.
Während seine Mutter und seine Schwester sich daranmachten, den Garten in Ordnung zu bringen, zog Jack die Kuh hinter sich her. Er vergewisserte sich, dass das Tor verriegelt war, dann führte er das Tier einige Kilometer nach Norden zum Hof der Elliotts, der halb verborgen zwischen mit Heidekraut bedeckten Hügeln lag.
Die Elliotts hatten beim letzten Überfall der Breccan alles verloren. Ihr Vieh war zusammengetrieben und über die Clanlinie gebracht worden. Man hatte ihr Haus und die Nebengebäude niedergebrannt. Doch langsam wurde ihre Farm wiederhergestellt. Gerade waren ein neues Cottage, ein neues Lagerhaus und ein neuer Kuhstall errichtet worden. Die Zäune hingegen waren nicht so wichtig und befanden sich immer noch in einem schlechten Zustand. Die neue Kuhherde wanderte oft auf Mirins Grundstück, und Jack, der sich inzwischen versucht fühlte, einen Hund zu kaufen, hatte die Tiere bisher immer pflichtschuldig zurückgebracht. So langsam wurde er des Ganzen jedoch müde. Er hatte das Gefühl, wieder und wieder den gleichen Tag zu erleben.
Seine Brust schmerzte, als er nach links schaute, wo der dichte Aithwood halb in der Morgensonne, halb im Schatten lag. Jenseits der Bäume lag die Clanlinie und jenseits der Clanlinie befand sich der Westen. Früher war Jack besorgt gewesen, weil Mirin so nah beim Gebiet der Breccan lebte. Vor Jahren, als er noch ein Junge gewesen war, hatte der westliche Clan ihr Haus überfallen und ihre Wintervorräte gestohlen. Die Erinnerung an jene Nacht war ihm noch immer lebhaft im Gedächtnis, eine Erinnerung, die von Angst und Hass geprägt war.
Sorgen im Winter gehörten für die Tamerlaines jedoch einfach dazu, selbst mit der Magie der Clanlinie – einer Grenze, die nicht überquert werden konnte, ohne dass die andere Seite davon erfuhr. Die Breccan kamen in den kargen, kalten Monaten herüber, um Nahrung und Vieh zu stehlen. Sie mussten schnell zuschlagen, bevor die Ostwacht eingriff und sich ihrer annahm.
Das war der Preis, den die Breccan für die Verzauberung der Clanlinie zahlen mussten. Obwohl sie mühelos Magie wirken konnten, konnten sie sich nicht von ihrem eigenen Land ernähren, und so versuchten sie durch Diebstahl zu überleben.
Bei den Tamerlaines war es genau andersherum: Magie zu wirken machte sie krank, doch sie besaßen Vorräte im Überfluss und kamen bequem über den Winter. Daher die brutalen Überfälle und das gelegentliche Blutvergießen, wenn die Clans aneinandergerieten. Jack fragte sich, ob sich dieses Muster ändern würde, jetzt, da Adaira im Westen war.
Sie hatte sich als Austausch für Moray angeboten. Ihr Zwillingsbruder würde so lange im Osten in Ketten liegen, wie Adaira im Westen blieb. Ein Gefangener für einen anderen. Wenngleich Jack bemerkt hatte, wie Innes Breccan, Laird und Anführerin des Westens, Adaira angesehen hatte. Innes hatte Adaira nicht als Druckmittel gesehen oder als Feindin, die es in Ketten zu legen galt, sondern als verlorene Tochter, als einen Menschen, den sie kennenlernen wollte, jetzt, da die Wahrheit ans Licht gekommen war.
Ich wünsche mir, dass auf der Insel Frieden herrscht, hatte Adaira zu Innes gesagt, als sie den Gefangenenaustausch vereinbart hatten. Wenn ich mit dir in den Westen komme, hören die Überfälle auf die Tamerlaines auf.
Innes hatte nichts versprochen, aber Jack vermutete, dass Adaira – wie er seine Frau kannte – alles in ihrer Macht Stehende tun würde, um weitere Überfälle zu verhindern und zumindest einen vorläufigen Frieden auf der Insel aufrechtzuerhalten. Ihre Verbundenheit zu Cadence war so stark, dass sie ihre Pflicht über ihr Herz gestellt und Jack zurückgelassen hatte, als sie fortgegangen war.
Musik ist im Westen verboten.
Adaira hatte ihm diese Bürde kurz vor ihrem Aufbruch auferlegt. Eigentlich konnte er sich als Musiker ein Leben ohne seine erste Liebe nicht vorstellen. Doch je öfter Jack dieses qualvolle Gespräch noch einmal durchlebte, umso klarer wurde ihm, dass er in zweierlei Hinsicht eine Bedrohung darstellte: als Barde und als unehelicher Sohn des Breccan, der ihn Jahrzehnte zuvor an die Tamerlaines weggegeben hatte.
Jack war außer Atem. Die Kuh hinter ihm sträubte sich weiterzugehen.
»Sie hat mir nur zweimal geschrieben«, erzählte er der Kuh, als sie den Gipfel des Hügels erreichten. In der Ferne konnte er den Hof der Elliotts sehen. »Zwei Mal in fast fünf Wochen, als hätte sie vor lauter Breccan-Arbeit keine Zeit für mich.«
Es tat gut, diese Worte endlich laut auszusprechen. Worte, die er wie Steine geschluckt hatte. Doch Jack spürte den Südwind im Rücken, der ihm das Haar zerzauste. Wenn er nicht aufpasste, würde die Brise seine Worte auf ihren Flügeln davontragen, damit andere sie hörten, und Jack war bereits genug gedemütigt worden.
Und doch sprach er weiter mit der Kuh.
»Im ersten Brief hat sie natürlich geschrieben, dass sie mich vermisst. Ich habe ihr nicht sofort geantwortet.«
Die Kuh stupste ihn mit der Nase am Ellbogen an.
Jack warf ihr einen finsteren Blick zu. »Na schön, ich habe sofort geantwortet, als ich ihren Brief bekommen hatte. Aber ich habe fünf Tage gewartet, bis ich ihn abgeschickt habe.«
Es waren fünf lange, schreckliche Tage gewesen. Jack hatte seine Wunden und seinen Stolz, und Adaira hatte klargemacht, dass sie auch gut ohne ihn zurechtkam. Am Ende hatte er eingesehen, welch ein Fehler es gewesen war, so lange mit dem Abschicken des Briefes zu warten. Denn dann hatte Adaira einige Zeit verstreichen lassen, bevor sie wieder schrieb, als spüre sie die wachsende Kluft zwischen ihnen. Vielleicht versuchten sie auch beide, sich vor dem Unausweichlichen zu schützen – dass ihr Ehegelübde nach dem obligatorischen Jahr und einem Tag gebrochen werden würde –, denn Jack sah keine Möglichkeit, wie sie bei diesem Leben vermählt bleiben konnten.
Er legte sich die Hand auf die Brust und befühlte seine Hälfte der Münze, die er unter dem Hemd verbarg. Er fragte sich, ob Adaira die ihre immer noch trug. Sie hatten jeder bei ihrer Vermählung eine Hälfte der geteilten Goldmünze erhalten. Sie war das Symbol für ihr Gelübde und Jack hatte sie noch nicht abgenommen.
Die Kuh muhte.
Jack seufzte. »Ich habe ihr zuletzt vor neun Tagen geschrieben. Es wird dich schockieren, aber sie hat noch nicht geantwortet.«
Der Wind frischte auf.
Jack schloss kurz die Augen und fragte sich, was geschehen würde, wenn der Wind seine Worte über die Clanlinie und durch die Schatten des Westens zu Adaira tragen würde. Was würde sie tun, wenn sie seine Stimme in der Brise hörte? Würde sie ihm schreiben, dass er zu ihr kommen soll?
Das war es, was er wollte.
Er wollte, dass Adaira ihn bat, zu ihr in den Westen zu kommen. Sie sollte ihn zu sich einladen, damit sie wieder zusammen waren. Er wollte sie nicht anflehen, ihn bei sich aufzunehmen, und er fürchtete sich davor, an einem Ort zu sein, an dem er unerwünscht war. Er weigerte sich, sich in eine solche Lage zu bringen, daher blieb ihm nichts anderes übrig als so zu tun, als würde er sich nicht unterkriegen lassen, während er darauf wartete, dass sie entschied, was aus ihnen werden sollte.
»Es ist ungerecht«, rief eine Stimme, und Jack schrak zusammen, weil es war, als habe jemand seine Gedanken gelesen.
Es ist ungerecht, ihr die Entscheidung allein aufzubürden, wenn du genau weißt, dass ihr Leben zerstört worden ist und eine neue, fremde Form erhalten hat.
Jack beschirmte die Augen und schluckte den Kloß in seinem Hals herunter. Er sah den alten Hendry Elliott den grasbewachsenen Hügel zu sich heraufkommen, ein Lächeln und einen Schmutzfleck im Gesicht.
»Da habe ich mich abgeschuftet, um die Zäune aufzustellen, und die Kühe schaffen es immer noch, auszubüchsen«, begrüßte Hendry ihn. »Ich entschuldige mich noch einmal, falls sie dich oder deine Mum belästigt hat.«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen«, sagte Jack und händigte die lästige Kuh ihrem Besitzer aus. »Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut.«
»Ja, danke«, antwortete Hendry, dann musterte er Jack genauer. »Wie kommst du zurecht, Barde?«
Jack biss die Zähne aufeinander. »Ging mir nie besser.«
Der alte Mann schenkte ihm nur ein trauriges Lächeln, und Jack lenkte sich damit ab, dass er der Kuh die Flanke klopfte, als hätte er eine neue Freundin gewonnen.
Er verabschiedete sich fröhlich von Hendry und der Kuh und wandte sich ab, um den langen Weg zurück zum Hof seiner Mutter anzutreten. Das Land spürte offenbar, wie er sich durch das Gras und das Farnkraut schleppte, denn die Kilometer schmolzen dahin, während die Hügel flacher wurden. Manchmal waren die Erdgeister gütig und man kam durchs Moor viel schneller voran als über die Straße. Dann wieder trieben sie Schabernack und stellten die Bäume, die Felsen, die Wiesen und die Hügel und Täler um. Es war noch gar nicht so lange her, dass Jack sich auf der Insel gleich mehrmals verlaufen hatte, nachdem die Geister die Landschaft verändert hatten, und er war froh, als er Mirins Cottage vor sich sah.
Rauch quoll aus dem Schornstein und verdunkelte das Mittagslicht. Das Cottage war aus Steinen gebaut und hatte ein Strohdach. Es stand auf einem Hügel mit Blick auf den gewundenen Lauf eines tückischen Flusses, der von Westen nach Osten floss. Es war ein Fluss, der alles verändert hatte.
Als Jack sich dem Haus näherte, richtete er den Blick nicht auf den fernen Glanz der Stromschnellen, sondern auf den Gemüsegarten. Seine Mutter und Frae hatten ihn wiederhergestellt, so gut es ging, und Jack dachte an die vielen Aufgaben, die er erledigen musste – das Dach musste vor dem nächsten Regen geflickt werden, er musste Frae dabei helfen, einen weiteren Kuchen für die Brindles zu backen, und er musste noch mehr Flusskiesel sammeln, um mit der Schleuder zu üben.
»Hast du die Beeren für den Kuchen vorbereitet, Frae?«, fragte Jack, als er das Cottage betrat. Das Haus war von vertrauten Gerüchen erfüllt – dem Staub von Wolle, von frisch gebackenen goldgelben Bannocks, dem salzigen Duft von Muschelsuppe. Als er aufschaute, dachte er, Mirin an ihrem Webstuhl vorzufinden, während Frae ihr entweder half oder sich am Tisch mit ihren Schulaufgaben beschäftigte. Der Letzte, mit dem er im Wohnzimmer seiner Mutter gerechnet hatte, war Torin Tamerlaine, der dastand wie ein verwurzelter Baum.
Jack hielt abrupt inne und sah Torin an. Der Laird stand am Kamin. Das Silber in seinem Lederwams, der Griff seines Schwertes in der Scheide, sein goldfarbenes Haar und das Grau, das wie Frost in seinem Bart schimmerte, obwohl er noch keine dreißig war, glänzten im Schein des Feuers. Eine Rubinbrosche funkelte an seiner Schulter und hielt seinen roten Plaid.
»Laird«, begrüßte Jack ihn, und seine Sorgen wuchsen. Nichts Gutes konnte Torin hergeführt haben. Er war keiner, der auf einen Höflichkeitsbesuch vorbeikam.
»Jack«, antwortete Torin in einem vorsichtigen Ton, und in dem Moment wusste Jack, dass der Laird etwas von ihm wollte, das er ihm höchstwahrscheinlich nicht zu geben bereit war.
Jack schaute zu seiner Mutter. Sie trat vom Webstuhl weg und ging zu Frae, die gerade Kuchenteig ausrollte.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte er und richtete den Blick wieder auf Torin.
»Ich würde dich gern sprechen, Jack«, erwiderte Torin.
»Wir sind draußen im Garten«, sagte Mirin, nahm Frae an die Hand und führte sie zur Hintertür.
Jack sah, wie seine kleine Schwester das Nudelholz beiseitelegte und ihm einen besorgten Blick zuwarf. Er schenkte ihr ein Lächeln und nickte ihr zu, um sie zu beruhigen, während er selbst sich zu entspannen versuchte.
Als die Türen und Fensterläden zum Schutz gegen die Neugier des Windes geschlossen waren, senkte sich Stille über das Cottage. Jack fuhr sich mit der Hand durchs wilde Haar, das die Farbe von dunkler Bronze hatte. Es war länger geworden. Die silbernen Fäden, die an seiner linken Schläfe schimmerten, waren eine Erinnerung an Banes Zorn, den er jedoch überlebt hatte. Nachdem er aber dem Tod so nah gewesen war, hatte er nicht die Absicht, bald wieder für die Geister zu spielen.
»Darf ich dir etwas zu trinken anbieten, Laird?«, fragte er.
Torin stand noch immer am Kamin. Seine Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengepresst und seine Finger zuckten nervös. »Nenn mich einfach Torin. Und ich möchte nichts, danke. Deine Mum hat mir eine Tasse Tee gemacht, während ich auf dich gewartet habe.«