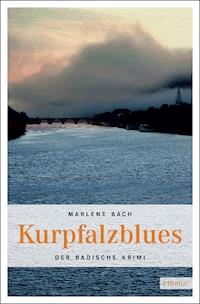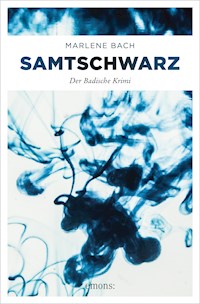Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Badische Krimi
- Sprache: Deutsch
An einem rabenschwarzen Tag verliert Mila Böckle nicht nur ihren Job, sondern ihren Freund gleich mit dazu. In Heidelberg soll sie für eine Weile die Pension einer Bekannten übernehmen – und sich wieder neu verlieben. Doch dann fällt ihr am Bahnhof eine tote Frau vor die Füße. Wie es der Teufel will, gelangt deren Handtasche in Milas Besitz. Und schon steckt Mila mitten in der mörderischen Jagd nach dem Geheimnis der Toten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marlene Bach wurde 1961 in Rheydt geboren und wuchs nahe der holländischen Grenze auf. Sie ist promovierte Psychologin und lebt seit 1997 in Heidelberg. Im Emons Verlag erschienen bereits ihre Romane »Elenas Schweigen«, »Kurpfälzer Intrige«, »Ab in die Hölle«, »Kurpfalzblues« und »Kurpfalzgift«.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlung, Personen und manche Orte sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: shutterstock.com/Elena Dijour Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Dr.Marion Heister eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-080-5 Der Badische Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen…
Titus Maccius Plautus (ca.254–184
1
Die Schrift auf dem Grabstein war kaum noch zu erkennen. Die Sonne hatte die Farbe ausbleichen lassen und der Regen die Buchstaben ausgewaschen, als wäre es an der Zeit, dass dieser Name endlich von der Erde verschwände. Von der Seite näherte sich eine kleine Gruppe von Menschen, allen voran ein Mann im hellen Trenchcoat, der einen blauen Regenschirm in die Höhe hielt.
»Wenn Sie mir nun bitte hierher folgen würden.«
Er wartete, bis auch die Letzten sich am Grab versammelt hatten und endlich still waren. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um besser hören zu können, was er sagte.
»…ein besonders tragischer Fall… Sie wurde in den Jahren bis zu ihrem Tod durchgängig ausgezeichnet als die weltbeste…«
Mehr konnte ich nicht verstehen. Ein Arm reckte sich in die Höhe.
»Und weshalb ist sie so jung gestorben?«, fragte ein Mädchen.
Die Antwort ging in einem ungläubigen Raunen unter.
»Wir gehen jetzt hier weiter. Hier entlang, bitte!«
Sobald sie wieder verschwunden waren, trat ich an den Rand des Grabes. Dort also lag jemand, der etwas besser konnte als jeder andere auf dieser Welt. Eine Berühmtheit. Ich beugte mich nach vorn, um lesen zu können, was auf dem glänzenden schwarzen Marmor stand. Dabei berührte mein Fuß den Rand des Grabes, ganz kurz nur, doch schon gab die Erde unter meinen Füßen nach. Sie sackte einfach weg. Ich wollte zurücktreten, aber es war zu spät. Ich rutschte in das riesige Loch, das sich vor mir auftat, versuchte verzweifelt, mich am Rand festzuklammern, aber die weiche Erde zerkrümelte unter meinen Händen und riss mich mit hinab in die Tiefe. Im Fallen konnte ich die Inschrift auf dem Grabstein sehen: »Hier ruht Mila Böckle, die weltbeste Versagerin«. Ich schrie, rutschte immer tiefer und tiefer in das dunkle Loch hinein, schrie lauter und lauter.
Als ich aufwachte, presste ein eisernes Band meine Brust zusammen. Ich setzte mich auf die Bettkante und versuchte, tief durchzuatmen. Zum Glück fühlte sich der Holzboden unter meinen Füßen kühl und fest an.
Seit Wochen war es der gleiche Traum, der mich quälte, und nur mein Schrei, von dem ich jedes Mal wach wurde, bewahrte mich davor, Nacht für Nacht am Boden irgendeines Abgrundes zu zerschellen. Ich stürzte nicht immer in mein Grab, manchmal war es auch ein Kerker ohne Boden im Heidelberger Schloss, in den mich ein Zwerg mit roter Säufernase lockte. Oder ich stand auf einem halb verfallenen Turm, und die Mauer brach unter mir weg. Ich war zur Absturzspezialistin geworden, zumindest nachts. Und seitdem klar war, dass ich nach Heidelberg gehen sollte, fiel ich besonders gern in Kurpfälzer Abgründe.
Durch das geöffnete Fenster zog die frische Morgenluft herein. So weit ich schauen konnte, hingen grauschwarze Wolken über dem flachen Land. Und in Ülske kann man verdammt weit schauen, da gibt es keine Berge, nicht einmal einen Hügel. Der Sommer war drückend und schwül gewesen und hatte sich anscheinend so verausgabt, dass kein Sonnenstrahl mehr übrig war. Seit Tagen hingen die grauen Wolken am Himmel. Ein Grau, das in meinen Kopf gekrochen war und sich über all meine Gedanken gelegt hatte– und über meine Seele gleich mit dazu.
Das sah nicht nach einem Tag aus, für den es sich lohnte aufzustehen. Besser, ich ging wieder ins Bett und hoffte, dass der Traum nicht wiederkam. Eine Stunde schlafen bedeutete immerhin auch, eine Stunde nicht zu grübeln. Ein guter Deal. Selbst auf die Gefahr hin, noch einmal in einen Abgrund zu stürzen. Aber ich hatte mich kaum hingelegt, da stand der Alptraum persönlich auf dem Bettvorleger.
»Mila. Zeit, aufzustehen! Der Zug wartet nicht!«
Der Wecker zeigte kurz vor acht. Normalerweise saß Tante Flo um diese Zeit schon vor dem Fernseher, versunken in irgendeinen Thriller oder Schmachtfetzen. Erstaunlich, dass sie es geschafft hatte, bis in den ersten Stock zu kommen.
»Heute geht es endlich los!« Tante Flo strahlte über das ganze runzlige Gesicht. »Auf ins Abenteuer! Raus aus den Federn!«
Eigentlich hieß sie nicht Flo, sondern Florentine, aber in Ülske nannten sie alle Flo, weil sie so klein und dünn war, dass ein langer Name einfach nicht passen wollte. Die Haare standen wirr von ihrem Kopf ab. Sie sah aus wie ein zerrupftes Huhn, auch wenn der knallgelbe Bademantel, den sie trug, eher an einen Kanarienvogel erinnerte.
Ich zog die Bettdecke höher, sodass Tom, der kleine getigerte Kater, der an meinen Füßen geschlafen hatte, aufschreckte und vom Bett sprang.
»Gleich«, murmelte ich.
Wenn er nun heute kam, ausgerechnet heute? Und wir waren gerade ins Auto gestiegen, um zum Bahnhof zu fahren? Jens würde vor verschlossener Tür stehen und das vielleicht als Wink des Schicksals deuten.
Es war bestimmt ein Fehler, früher abzureisen. Aber Tante Flo hatte in den letzten Tagen alles darangesetzt, mich davon zu überzeugen, dass es viel besser wäre, bereits heute nach Heidelberg zu fahren. Dann könnte ich mich am Wochenende schon einmal in aller Ruhe in der Stadt umsehen.
Ich wusste, worum es eigentlich ging. Sie wollte mich endlich los sein. Und ich konnte es ihr nicht einmal verübeln. Mit zweiundsiebzig hatte man nicht unbedingt Lust, sich jeden Tag das verweinte Gesicht seiner Nichte anzuschauen. Eine, die mit Anfang dreißig wieder Single und arbeitslos war und bei ihrer einzigen noch lebenden Verwandten unterkriechen musste, weil sie sich keine eigene Wohnung mehr leisten konnte. Was hatte man von so einer Nichte noch zu erwarten? Außer, dass sie irgendwann auf dem heimischen Sofa verenden würde?
»Ich habe es mir überlegt«, sagte ich und drehte mich zur Wand. »Ich fahre erst morgen. Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen.«
Ein Ruck, und meine Bettdecke war weg.
»Die Kanalratte kommt nicht mehr. Hörst du! Weder heute noch morgen noch übermorgen. Du wartest jetzt seit drei Monaten. Es reicht.«
Manchmal war sie mir unheimlich. Vielleicht konnte sie doch in meinen Kopf sehen.
»Es wird dir in Heidelberg gefallen. Da gibt es zauberhafte kleine Lokale. Und um diese Jahreszeit soll es dort besonders schön sein. In der Heidel kann man sogar baden.«
»Du musst es ja wissen. So oft, wie du schon in Heidelberg warst.«
Tante Flo war noch nie in Heidelberg gewesen. Alles, was sie über diese Stadt wusste, hatte sie von ihrer Freundin Rosel.
»Du hast zugesagt, dich um die Pension zu kümmern, also wirst du es auch tun! Es gibt jetzt kein Zurück mehr.«
»Wir sollten mal warten, was die im Krankenhaus sagen. Vielleicht braucht Rosel gar kein neues Hüftgelenk.«
»Da gibt es nichts abzuwarten. Rosel bekommt eine neue Hüfte, und hinterher geht sie in Kur. Du hast versprochen, dass du ihre Pension solange übernimmst, also wirst du dich an dein Wort halten.«
»Aber Rosel hat doch gesagt, im Moment wären gar keine Gäste da!«
»Das ändert nichts. Zusage ist Zusage.«
Eine Pension zu leiten, davon verstand ich ungefähr so viel wie vom Orgelbau oder vom Sockenstricken. Ich sollte dafür von Rosel sechshundert Euro im Monat bekommen, was in meiner Situation ein verdammt gutes Angebot war. Aber eigentlich hatte ich mich nur aus einem Grund darauf eingelassen: Tante Flo sollte endlich aufhören, deshalb unablässig auf mich einzureden.
»Die Ausflugsschiffe fahren noch, hat Rosel gesagt. Und auf dem Schloss gibt es Theateraufführungen. Da sitzt man im Schlosshof und trinkt Sekt. Rosel hat erzählt, sie hätte dabei einmal einen sehr netten jungen Mann kennengelernt, der sei extra aus Amerika angereist…«
Ich hörte nicht mehr hin. Den Rest kannte ich schon. Tante Flos Loblied auf Heidelberg: Romantik, wo man nur hinschaut, und so viele ledige, gut aussehende Männer, dass man an jeder Straßenecke über sie stolpert.
»Am besten machst du gleich eine Stadtführung mit. Es wird sich bestimmt ein netter junger Mann finden, der dir mal ein bisschen was zeigt.« Sie hängte das Federbett über die Stuhllehne. »Du weißt doch, was Lilo Pulver…«
»Ja, ja.« Ich zog die geblümte Überdecke hoch, die am Fußende lag.
»Die hat auch eine Stadtführung gemacht«, fuhr Tante Flo unbeirrt fort. »Und der Stadtführer war sogar ein Doktor. Da haben sie viele Doktoren in der Stadt. Lilo Pulver hatte damals auch Kummer…«
»Ja, ich weiß.«
Ich kannte die Geschichte des Films inzwischen auswendig: Eine junge Amerikanerin reist nach Heidelberg, um ihren abtrünnigen Verlobten zur Raison zu bringen, trifft auf einen charmanten Stadtführer, der natürlich gar keiner ist, und am Ende fallen sich alle verliebt in die Arme. »Heidelberger Romanze«, ein Herzschmerz-Streifen aus den fünfziger Jahren mit Lilo Pulver.
Tante Flo hatte ihn in der letzten Woche mindestens viermal angeschaut und mir außerdem bei jedem Frühstück, Mittag- und Abendessen davon erzählt, wenn sie mir nicht gerade von Sascha Hehn, dem neuen Traumschiffkapitän, vorschwärmte.
»Die Pulver hat da auch einen Mann gefunden, dann wirst du in Heidelberg ganz bestimmt auch jemand Nettes kennenlernen.«
»Das war nur im Film so. Gespielt, verstehst du! Lilo Pulver hat da nicht den Mann fürs Leben gefunden. Vielleicht solltest du mal noch etwas anderes tun, als dir jeden Tag von morgens bis abends irgendwelche Schnulzen anzusehen.«
Wobei das nicht stimmte. Tante Flo sah sich nicht nur Schnulzen an, sondern alles querbeet. Sophia Loren auf dem Hausboot, schweigende Lämmer, Kommissar Rex bei der Arbeit. Seit dem Tod ihrer Zwillingsschwester Alma, mit der sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, war Tante Flo abgetaucht, bei Warner Brothers, Walt Disney, MGM oder wo auch immer. Verschwunden in schönen Illusionen oder Horrorszenarien, je nachdem. Hauptsache, weit weg von der Realität. So weit weg, dass sie manchmal nicht mehr zurückfand. Es konnte durchaus passieren, dass sie behauptete, bei Tiffany gewesen zu sein, wenn sie am Kiosk um die Ecke einen Kaffee trinken war, den schwulen Ralf von der Tankstelle nannte sie neuerdings »Mister Hudson«, und den Tisch deckte sie auch schon mal für drei, nur für den Fall, dass Commissario Brunetti überraschend zum Abendessen vorbeikam.
»Ich habe eben noch einmal mit Rosel telefoniert«, zwitscherte der Kanarienvogel. »Sie hat gesagt, wenn du mal einen Ausflug in den Odenwald machen willst, kannst du gern ihr Auto nehmen. Und du sollst die Palme nicht vergessen, sie steht auf der Terrasse. Rosel hat dir alles aufgeschrieben. Sie hat sie noch einmal gewässert, bevor sie gegangen ist.«
»Na prima. Dann eilt es ja nicht. Ich fahre morgen. Oder übermorgen. Wenn du mich jetzt bitte schlafen lässt.«
»Milena!« Tante Flo stemmte die Hände in die mageren Hüften. »Du stehst jetzt auf, ziehst dich an, und dann fahren wir zum Bahnhof. Genau so, wie wir es besprochen haben!«
Ich konnte nicht fahren. Jens würde garantiert heute kommen. Ich spürte es mit jeder Faser meines Körpers.
»Am Sonntag. Ich fahre am Sonntag.« Ich wickelte mich demonstrativ in die geblümte Tagesdecke und drehte mich wieder zur Wand. »Mach bitte die Tür zu, wenn du rausgehst.«
»Du hast es nicht anders gewollt!«
Tante Flo stürmte aus dem Zimmer. Kurz darauf hörte ich das Gartentor quietschen. Es war das Tor zum Hof der Reschkes, unseren Nachbarn. Eigentlich ging Tante Flo nicht zu den Reschkes rüber. Nicht, nachdem ihre Schwester Alma dort beim Eierholen mit einem Herzinfarkt und einem letzten entschiedenen Seufzer rücklings ins Gemüsebeet gefallen war.
Keine fünf Minuten später stand Tante Flo wieder vor meinem Bett. In der Hand hielt sie das Gewehr, mit dem der alte Reschke die Kaninchen jagte. Sie legte es an und zielte auf mich.
»Raus aus dem Bett!«
Das Gewehr war nicht geladen. Das konnte gar nicht anders sein. Alle im Dorf kannten Flo. Der hätte niemals jemand ein geladenes Gewehr gegeben.
»Nun beruhige dich mal.«
Das war ein klarer Fall von John-Wayne-Rausch. Flo hatte garantiert die halbe Nacht Western geguckt.
»Ich fahr ja. Aber eben am Sonntag. Jetzt hör auf, hier so einen Terz zu veranstalten, und bring das Gewehr wieder zurück!«
Als der Schuss die Tapete über meinem Kopf zerfetzte, hörte mein Herz für einen Moment auf zu schlagen. Feiner weißer Putz rieselte mir auf die Haare. Tante Flo ließ das Gewehr sinken. Sie war kreidebleich geworden.
»Du fährst!«
»Ist ja gut.« Mit zitternden Knien stieg ich aus dem Bett. »Überredet. Ich fahre.«
»Heidelberg wird dir gefallen! Du wirst schon sehen!«
2
Eine Entschuldigung wäre das Mindeste gewesen. Eine mit Tränen, viel Verzweiflung und ehrlicher Reue. Eine ohne Tränen und mit geheuchelter Reue hätte es auch getan. Aber Tante Flo sagte nichts, und ich beschloss, nie wieder ein Wort mit ihr zu reden. Also fuhren wir schweigend zum Bahnhof.
Dort musste ich dann doch etwas sagen, weil ich noch einen Moment in der Halle warten wollte und Angst hatte, sie schießt wieder auf mich oder zieht vielleicht eine Axt aus der Tasche, weil sie denkt, ich will nicht abreisen.
Jens hatte ich eine SMS geschrieben, obwohl ich mir geschworen hatte, ihm nie mehr eine Nachricht zu schicken. Aber das hier war ein Notfall. »Verlasse heute Ülske. Sozialer Einsatz im Ausland. Komme vielleicht nie mehr zurück.« Eine zweite SMS mit meiner Abfahrtszeit hatte ich gleich noch hinterhergeschickt.
So ganz verkehrt war das mit dem Ausland nicht. Wenn man aus dem Norden kommt, ist eine Stadt, die so weit im Süden liegt, schon so gut wie Ausland. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass »Böckle«, mein Familienname, angeblich von irgendeinem Ururururvorfahren aus dem Süddeutschen stammte. Natürlich hatte ich im Internet einiges über Heidelberg gelesen, und danach war völlig klar: Ich ging in die Fremde. Statt Wiesen und Äcker bis zum Horizont gab es Berge, und angeblich wuchsen dort Feigen und Kiwis statt Kartoffeln und Rüben.
Wir waren fünfzehn Minuten zu früh am Bahnhof. In der Halle war niemand. Ich meine wirklich niemand. Nur der Fahrkartenautomat. Also wartete ich und starrte zum Eingang. Nach langer Zeit hatte ich mich mal wieder zurechtgemacht, einen meiner kürzesten Röcke angezogen und meine störrischen Haare so lange geglättet, bis auch die letzte Locke aufgegeben hatte. Draußen fing es an zu regnen. Ich schaute auf die Uhr. Noch sieben Minuten. Noch sechs. Noch fünf.
Tante Flo zog an meinem Ärmel.
»Nun lass gehen. Der kommt nicht mehr. Du wirst in Heidelberg schon einen anderen kennenlernen.«
Ich schleppte Koffer und Rucksack die Treppe hinunter und konnte kaum die Stufen erkennen, weil ich kurz davor war, loszuheulen. Fünf Jahre, und der Scheißkerl kam nicht mal, um sich zu verabschieden.
Sobald wir auf dem Gleis waren, fuhr auch schon der Zug ein. Ich stieg hinein und wollte das Fenster aufmachen, aber dieses verdammte Ding ließ sich nicht öffnen. Tante Flo stand draußen auf dem Bahnsteig und sah ziemlich zufrieden aus. Zwei Meter daneben umarmte sich ein Pärchen, das sich gar nicht trennen wollte. Von Jens weit und breit keine Spur.
Zwanzig Minuten nachdem der Zug Ülske verlassen hatte, waren meine Augen vom Weinen zugeschwollen und alle meine Taschentücher aufgebraucht. Eine ältere Dame schenkte mir gleich ein ganzes Päckchen und ein kleiner Junge ein paar klebrige Gummibärchen, die aussahen, als hätte er sie seit Stunden in seiner verschwitzten Faust gehalten.
Wäre ich doch an diesem verfluchten Tag nicht zu früh nach Hause gekommen! Aber ich hatte gar keine Wahl gehabt. Mein Chef hatte mich rausgeschmissen und mir den Schlüssel zum Laden abgenommen, mit der freundlichen Aufforderung, sofort zu verschwinden und mich dort nie wieder blicken zu lassen. Er wollte meine Version der Geschichte, warum die zweihundert Euro in der Kasse fehlten, nicht glauben. Obwohl es die Wahrheit war und nichts als die Wahrheit, zumindest was meinen Teil dabei anging. Also war ich drei Stunden zu früh zu Hause aufgetaucht und hatte Jens mit Sarah im Bett erwischt.
Zwei Einschläge, die mich aus meinem Leben katapultiert hatten, wie ein Planet, der von einem riesigen Kometen getroffen wird und aus der Bahn gerät. Nun trudelte ich ziellos durch das Weltall.
Die Fahrt war lang genug, dass ich mir überlegen konnte, wie es in meinem Leben weitergehen sollte. Oder ob überhaupt, denn an besonders grauen Tagen schlich sich manchmal auch die Idee von einer Abkürzung ins Jenseits in meine Gedanken.
Tante Flo war der festen Überzeugung, durch Heidelberg fließe die Heidel. Ich hatte gelesen, dass es der Neckar ist. Auf jeden Fall gab es dort einen Fluss. Ich konnte also ins Wasser gehen. Aber mir war klar, dass ich sofort anfangen würde, mit den Armen zu rudern, sobald ich keinen Boden mehr unter den Füßen spürte. Vielleicht war es einfacher, sich in Rosels Bett zu legen, sich die Decke über den Kopf zu ziehen und nie mehr aufzustehen.
Nach ungefähr zweihundertfünfzig Kilometern war mein Kopf dumpf, und meine Augen waren so geschwollen, dass ich mir vorkam wie eine Kröte. Auf dem Platz neben mir lag das Bahnjournal mit schönen Bildern und leckeren Rezepten. Heile Welt in Hochglanz. Es beruhigte mich, darin herumzublättern. Ein Bericht über Neuseeland, Fotos von saftigen grünen Weiden und tiefen Fjorden. Daneben ein Interview mit einem gut aussehenden Mann, der lauter kleine Lachfalten um die Augen hatte.
Er war früher Manager in einer Firma gewesen, mit Chauffeur und mehreren Sekretärinnen. Aber dann hatte er alles hingeschmissen, und jetzt war er endlich mit sich selbst im Reinen. Und mit der Natur. Überhaupt mit allem. Er hatte eine Schaffarm, kannte jedes seiner Tiere mit Namen, und alles, was er tat, war ökologisch ausgesprochen sinnvoll. Einer von den Guten eben. Am Ende des Artikels stand sein Leitsatz, die Essenz eines bewegten Lebens, wie die Journalistin schrieb. Und die lautete: »Nur wer loslässt, kann gewinnen.«
Der gut aussehende Mann lächelte mich in Hochglanz an, und mit einem Mal war mir klar, warum ich immer im Fluss mit den Armen rudern würde: Eigentlich wollte ich nicht sterben. Ich wollte nur loslassen! Mein altes Leben. Das, in dem ich am Ende immer als die Verliererin dastand.
Das Beste aber war: Mein altes Leben loszulassen würde nicht einmal besonders schwer werden, denn es hatte mich schon losgelassen. Jens lag mit meiner ehemals besten Freundin Sarah im Bett, mein Chef hatte mich gefeuert und meine Tante auf mich geschossen, damit ich ihr nicht mehr reinquatschte, wenn Doris Day den Liebesschwüren von Rock Hudson lauschte.
Ich brauchte einen Neuanfang, dort, wo mich niemand kannte und alle eine Chance hatten. Wo es diese sympathischen Männer mit den wettergegerbten Gesichtern gab. In Neuseeland eben. Es musste ja nicht unbedingt eine Schaffarm sein, aber vielleicht ein kleines Café mit Apfelkuchen und Kirschtorte. Hauptsache, es war am anderen Ende der Welt. Neuseeland. Berge, Meer, grüne Weiden. Männer, die es ehrlich meinen. Dieser Schafzüchter aus dem Journal ging bestimmt nicht fremd. Pech nur, dass ich nie und nimmer das Geld haben würde, mir ein Flugticket ans Ende der Welt zu kaufen.
Wir hielten an. Die Menschen auf dem Bahnsteig verschwanden im Zug wie Krümel in einem Staubsauger. Noch ein Halt– und wieder einer. Dazwischen rauschte die Landschaft vorbei.
In Essen musste ich umsteigen. Menschenmassen drängten sich in den Gängen, und ich war froh, als ich endlich das Gleis gefunden hatte, auf dem mein Anschlusszug abfahren sollte.
Reisende standen neben ihrem Gepäck, sprachen in ihr Handy, liefen vorbei, saßen auf Bänken und warteten. Auf dem Display über dem Bahngleis wurde nichts angezeigt, was mich wunderte, denn nach meinem Plan sollte es hier in drei Minuten weitergehen.
Ich ging zu einer der Informationstafeln, an der das Plakat mit den Abfahrtszeiten hing. Eine Frau mit langen roten Haaren stand davor, die Arme verschränkt. Sie starrte in die andere Richtung und versperrte mir die Sicht.
»Entschuldigung«, sagte ich, aber sie schien mich nicht zu hören.
Ich tippte ihr auf die Schulter. Sie drehte sich um und wich sofort einen Schritt zurück.
»Was wollen Sie?«, stieß sie erschrocken hervor.
Sah ich noch so verheult aus? Mila Böckle, das Phantom des Essener Bahnhofs? Ich zeigte auf die Tafel hinter ihr.
»Auf den Plan schauen.«
Die Frau strich sich eine Haarsträhne aus dem bleichen Gesicht, klemmte ihre Handtasche unter den Arm und rückte zur Seite. Doch noch bevor ich meine Verbindung auf dem Aushang gefunden hatte, verkündete eine Stimme die nahende Ankunft des Zuges. Zum Glück hielt er so, dass sich die Türen genau vor mir öffneten. Erleichtert hievte ich meinen Koffer die Stufen hoch ins nächste Großraumabteil.
Meine Mitreisende mit den roten Haaren hatte schon am Gang Platz genommen und ihren Mantel auf den Sitz neben sich gelegt, ein nicht zu übersehendes Signal, dass sie keinen Wert auf eine nette Zugbekanntschaft legte. Ich schob Koffer und Rucksack ins Gepäckfach und suchte mir einen freien Vierer. Geschafft, dachte ich erleichtert, da schlug mir von hinten etwas gegen den Kopf.
»Oh, das tut mir leid. Wie ungeschickt.«
Ich schaute hoch und sah in das Gesicht aus dem Bahnjournal. Der Neuseeländer lächelte mich bedauernd an, während er versuchte, seine Reisetasche in der Ablage über unseren Köpfen zu verstauen.
»Ist der Platz neben Ihnen noch frei?«, fragte er.
Natürlich war es nicht der Neuseeländer aus dem Journal, nicht genau der. Allerdings sah er ihm verblüffend ähnlich. Kleine Fältchen im markanten Gesicht, dichtes schwarzes Haar, und Augen von einem so intensiven Blau wie das Trikot von Ülskes Fußballverein. Er ließ seine Tasche über mir im Gepäckfach verschwinden, dann beugte er sich zu mir.
»Alles in Ordnung?«
Immerhin schaffte ich es zu nicken.
»Darf ich?«
Ich nickte noch einmal.
Auf der anderen Seite des Tisches waren noch zwei Plätze frei. Aber er ließ sich auf den Sitz neben mir fallen! Ich konnte Tante Flo förmlich hören: Jetzt mach den Mund auf. Rede was, Mila! Du wirst doch wohl nicht neben einem neuseeländischen Traummann sitzen und die Zähne nicht auseinanderkriegen, während die Kanalratte mit Sarah im Bett liegt!
Aber was sollte ich sagen? Ganz schön voll heute? Viel zu einfältig. Außerdem war es nicht sehr voll. Witzig musste es sein, und intelligent.
Der Neuseeländer hatte sich zur Seite gebeugt und schaute den Gang hinunter.
»Wo geht es denn hin?« Ich hätte mir wegen meiner dämlichen Frage am liebsten sofort in den Hintern getreten.
Der Neuseeländer schaute kurz zu mir. »Was?«
»Bis wohin fahren Sie?«
»Ich…« Schon wieder beugte er sich über die Lehne. »…bis Heidelberg.«
Wir hatten also eine Gemeinsamkeit. Ein guter Anknüpfungspunkt.
»Ich auch. Ich werde dort eine Pension übernehmen. Ich heiße übrigens Milena. Milena Böckle. Aber alle nennen mich Mila.«
Den Neuseeländer schien das nicht besonders zu interessieren. Er schaute immer noch nach vorn, in den Gang hinein. Ich lehnte mich ein wenig zur Seite, um zu sehen, was es dort so Interessantes gab. Meine schreckhafte Mitreisende mit den roten Haaren, die ein paar Plätze weiter saß? Der ältere Herr mit den grau melierten Haaren und der spitzen Nase, der mit grimmigem Gesicht nahe der Tür stand?
»Kennen Sie Heidelberg schon?«, versuchte ich es noch einmal. »Ich war noch nie da. Das Heidelberger Schloss ist angeblich gar kein richtiges Schloss mehr, sondern nur noch eine Ruine. Ich werde es mir trotzdem mal ansehen.«
Wieder bekam ich keine Antwort. Die Wärme kroch meinen Hals hoch bis über mein Gesicht. Wahrscheinlich war ich schon puterrot. Noch einer, der mich abblitzen ließ.
Der Neuseeländer schaute weiter den Gang entlang, aus den Augenwinkeln, den Kopf hinten an den Sitz gelehnt, wie jemand, der etwas sehen will und so tut, als würde es ihn nicht interessieren. Das Einzige, was man so von seinem Platz aus gut sehen konnte, war die rothaarige Frau. Hatte er deshalb neben mir sitzen wollen? Ihre Haare sahen wirklich phantastisch aus. Kupferrot und gelockt. Aber sie musste viel älter sein als er. Mindestens fünfzig. Und er war höchstens Mitte dreißig.
Ich verstehe schon, wenn jemand nicht mit mir reden will. Also hielt ich den Mund und verbrachte die folgenden drei Stunden damit, weiter über mein verkorkstes Leben nachzudenken, bis endlich angekündigt wurde, dass der nächste Halt Heidelberg war.
Von mir aus hätte ich kein Wort mehr mit meinem Sitznachbarn geredet, aber als er seine Reisetasche aus dem Gepäckfach zog, fiel ihm wohl wieder ein, dass er mich damit fast erschlagen hatte.
»Ich hoffe, es tut nicht mehr weh«, sagte er und schenkte mir noch einmal ein Lächeln. »Schöne Zeit noch.«
»Ihnen auch. Wenn Sie eine Unterkunft suchen, kommen Sie doch vorbei. Die Pension liegt…«
Doch schon hatte er sich in die Menschenschlange eingereiht. Ich schulterte meinen Rucksack und zog meinen Koffer hinter mir her, raus aus dem Zug, die Stufen hoch, bis in die Bahnhofshalle. Immerhin gab es hier einige Geschäfte. Ich überlegte, ob ich mir in der Buchhandlung einen Reiseführer über Heidelberg kaufen sollte. Den würde ich auswendig lernen und Tante Flo erzählen, ich hätte die Infos von einem ultrahässlichen Stadtführer, der verheiratet war und zehn Kinder hatte. Aber in meinem Portemonnaie waren nur noch ein paar Euro, und mein Konto war bis zum Limit überzogen. Also gab es keinen Reiseführer.
Draußen nieselte ein feiner Regen vom Himmel herab. Es war einer von diesen Bahnhofsvorplätzen, wie man sie überall findet. Die Filiale einer Schnellimbiss-Kette, ein Hotel, ein Taxistand und ungefähr tausend Fahrräder. Von Romantik war hier weit und breit nichts zu sehen. Kein Schloss, keine Brücke, kein Fluss.
Dafür schaute auf der gegenüberliegenden Straßenecke ein riesiges Metallpferd mit einem blauen Auge auf die Fußgänger hinab. Es war bestimmt über zehn Meter groß und sah aus, als versuchte es verzweifelt wegzurennen, ohne vom Fleck zu kommen. Kein Wunder, das arme Tier hatte nur drei Beine. Mir war klar, dass manche Menschen in der Stadt dachten, Kühe wären lila. Aber dass Pferde vier Beine haben, das musste man doch wissen? War denen das Geld ausgegangen? Man sparte sich einfach das vierte Bein und erklärte den verwirrten Bürgern, das wäre Kunst?
Meine Spekulationen über die Heidelberger Kulturszene wurden von wütendem Geschrei unterbrochen, das von der anderen Seite des Platzes kam. Ich war nicht die Einzige, die hinüberging, um zu sehen, was dort los war. Auf dieser Seite des Bahnhofsplatzes führte eine Straße um eine Gruppe hoher Bäume herum. Einige Taxis standen in einer Schlange und warteten auf Kundschaft. Auf dem Gehsteig davor drängte sich ein Pulk von Leuten. Alle schauten zu einem älteren Mann in dunkler Lederjacke, der mit hocherhobenen Fäusten unter den Bäumen daherlief.
»Ihr Drecksviecher!«, schrie er. »Ich sehe euch genau. Glaubt bloß nicht, ihr könntet euch da oben verstecken!«
Die Bewohner der Bäume schien das wenig zu interessieren. Aus den Baumwipfeln war ein munteres Tschilpen zu hören. Ab und zu sah man einen Vogel davon- oder heranflattern, klein und grün. Ich traute meinen Augen nicht: Das waren Papageien. In Ülske gab es Krähen und Spatzen und ab und zu einen Fasan, was eben in die Landschaft passte. Aber Papageien? War das ein Werbegag? Heidelberg, die exotische Stadt im Süden? Warum noch nach Brasilien reisen, wenn es Papageien in der Kurpfalz gibt? Nach dem Lärm, den sie veranstalteten, musste dort oben eine ganze Kolonie hausen.
»Ich knall euch ab!«, schrie der Mann. »Ich mach euch fertig!«
Er blieb stehen und zog tatsächlich eine Pistole aus der Innentasche seiner Jacke. Jemand aus der Menschenmenge schrie erschrocken auf. Eine Frau mit einem kleinen Kind an der Hand lief fort.
»Ihr scheißt mir nicht mehr auf mein Auto. Ich mach euch alle!«
Ein ohrenbetäubender Knall zerriss die Luft. Mit einem Mal war der Himmel voller grüner Vögel. Nach allen Seiten stoben sie aus den Baumkronen und flatterten hektisch umher.
Noch einmal zielte der Mann in die Bäume. Ein Tumult brach aus. Menschen schrien durcheinander. Unmittelbar vor mir, am Rand des Gehsteigs, stürzte jemand nach vorn auf die Straße. Eine Gestalt im grünen Anorak, die Kapuze über den Kopf gezogen. Im Fallen riss sie die Arme nach hinten, sodass die Tasche, die sie in der Hand gehalten hatte, durch die Luft geschleudert wurde und in der Menge landete. Sie fiel direkt vor mir auf den Boden. So nah, dass ich nur meinen Arm ausstrecken musste, um an sie heranzukommen. Eine weiße Handtasche. Es war wie ein Reflex: bücken, aufheben.
Es griff noch eine andere Hand nach der Tasche, behaart, mit kurzen Fingern, aber ich war schneller. Als ich mich wieder aufrichtete, sah ich in das Gesicht eines Mannes, der so nah vor mir stand, dass ich jeden der grauen Stoppeln auf seinen unrasierten Wangen erkennen konnte. Seine bernsteinfarbenen Augen waren schmal und voller Hass. Er packte mein Handgelenk, so fest, dass es wehtat.
»Gib her!«, zischte er und riss mit der anderen Hand an der Tasche.
Ich aber hatte meine Finger in das weiche Leder geschlagen wie das Raubtier seine Krallen in die Beute. Ich lasse mir nicht gern etwas wegnehmen, keinen Mann und auch keine Handtasche.
Der Fremde drehte meinen Arm nach hinten weg, sodass ich vor Schmerz fast aufgeschrien hätte.
»Gib sie her!«
Plötzlich heulten die Sirenen eines Polizeiwagens auf, so laut, als wäre er schon ganz in der Nähe. Wie ein Tier, das den Feind wittert, reckte der Fremde den Kopf in die Höhe. Dann ließ er mich los und verschwand so schnell in der Menge, wie er aufgetaucht war.
Mit klopfendem Herzen presste ich die Handtasche an mich und suchte nach meinem Koffer. Ich musste die Tasche zurückgeben. Sehen, was geschehen war. Doch ich kam nicht mehr durch die Menge. Nur auf Zehenspitzen konnte ich noch über die Köpfe hinwegschauen. Zwei Männer knieten neben der Gestalt auf der Straße, ein dritter stand mit betretenem Gesichtsausdruck daneben.
Es war eine Frau, die da auf dem Boden lag. Man hatte sie auf die Seite gedreht und ihr die Kapuze abgestreift. Ihr Gesicht war leichenblass. Ihre Locken schimmerten kupferfarben auf dem dunklen Asphalt.
3
Wie aus dem Nichts tauchten zwei Polizisten auf und versuchten, die aufgeregten Menschen zurückzudrängen. Als ich es endlich geschafft hatte, bis zu einem von ihnen durchzukommen, fuhr der mich an, noch bevor ich auch nur den Mund aufmachen konnte.
»Treten Sie zurück!«
»Aber ich…«
»Jetzt treten Sie zurück!«
»Ich wollte doch nur…«
»Zurücktreten!«
Eine ältere Frau, an der ich mich vorbeigeschoben hatte, keifte mich von hinten an: »Haben Sie nicht gehört? Sie sollen Leine ziehen! Sie behindern die Rettungskräfte!«
Neben ihr stand ein kleiner kahlköpfiger Mann. Er zog mich an meiner Jacke zurück.
»Am besten die Nase direkt ins Blut stecken, was?«, fuhr er mich an.
»Aber ich…«
»Hier gibt es nichts zu sehen.« Der Polizist drängte mich mit einer Handbewegung zurück, als wollte er eine lästige Fliege verscheuchen. »Jetzt machen Sie schon Platz!«
Hinter ihm hielt ein Krankenwagen. Zwei Sanitäter sprangen heraus. Erst war alles ganz eilig. Bis sie sich zu der rothaarigen Frau hinabgebeugt hatten. Dann war die Eile vorbei. Keine Wiederbelebungsversuche, kein hektisches Herauszerren der Trage. Nichts.
Einige Meter entfernt sah ich den Neuseeländer stehen. Er hielt das Handy noch in der Hand, als hätte er gerade telefoniert, und war mindestens so bleich wie die Frau, die auf der Straße lag. Den Ausdruck auf seinem Gesicht hatte ich bisher nur einmal in meinem Leben gesehen: als der alte Reschke wie von Höllenhunden gejagt durchs Dorf gerannt kam, weil ihm angeblich auf dem Friedhof der leibhaftige Teufel begegnet war.
»Sie ist tot«, giftete die Frau von hinten, als wäre ich persönlich dafür verantwortlich. »Haben Sie jetzt genug gesehen?«
Ich nahm meinen Koffer und ging. Wenn die glaubten, ich sei eine Gafferin, dann würde ich die Tasche eben nicht abgeben. Zumindest nicht hier. Der Nieselregen hatte meine Jacke durchweicht, und mir war kalt. Ich würde in die Pension fahren, mir etwas Trockenes anziehen und danach zur Polizei gehen und dort die Tasche einem netten, freundlichen Beamten übergeben, der mein Engagement zu schätzen wusste.
Vor allem aber wollte ich weg von diesem Platz. Von den gehässigen Menschen. Dem unfreundlichen Polizisten. Den Handtaschendieben. Den Verrückten, die in der Gegend rumballerten.
In Essen hatte ich noch mit dieser Frau gesprochen, und jetzt lag sie leichenblass auf dem Asphalt. Einfach auf die Straße gekippt. Wieso schoss hier auch jemand in der Gegend herum? Sich zu Tode erschrecken, so sagte es die Redewendung. Ich hatte mir nie Gedanken gemacht, ob das wirklich passieren konnte. Aber wenn man ein schwaches Herz hatte, sowieso kurz vor dem Infarkt stand?
Wie es aussah, war ich vom Regen in der Traufe gelandet. In Heidelberg machte man Jagd auf Papageien, in Ülske auf harmlose Langschläfer. Am besten war wahrscheinlich, mich wirklich ins Bett zu legen und nie wieder aufzustehen.
Nur musste ich dazu erst einmal die Pension finden. Rosel hatte mir den Weg erklärt. Das Haus lag in der Altstadt, und die war ein gutes Stück vom Bahnhof entfernt. Den Bus sollte ich nehmen oder mit der Straßenbahn fahren und dann die Fußgängerzone langgehen. Doch ich entschied mich, zu Fuß zu gehen, nach der ganzen Sitzerei im Zug konnte Bewegung nicht schaden.
Ein netter Mensch erklärte mir den Weg. Die Handtasche der Rothaarigen hatte ich unter meinen Arm geklemmt. An einen großen Platz müsse ich kommen, den Bismarckplatz, da gehe es dann in die Fußgängerzone. Als ich endlich dort war, war der Arm, mit dem ich den Koffer hinter mir herschleifte, schon mindestens zehn Zentimeter länger als der andere. Wenigstens hatte der Nieselregen aufgehört. Gleich zu Beginn der Fußgängerzone, die sinnigerweise auch »Hauptstraße« hieß, saß eine lebensgroße bronzene Figur auf einer Bank, scheinbar in eine Zeitung vertieft. Eine Pause konnte nicht schaden. Ich nahm neben dem erstarrten Zeitungsleser Platz, die fremde Tasche auf dem Schoß.
Vielleicht hätte ich sie doch nicht mitnehmen sollen. Möglicherweise war man bei der Polizei davon nicht begeistert. Andererseits hatte ich die Tasche vor diesem Mann gerettet, und der hatte nicht den Eindruck gemacht, als wollte er sie wieder abgeben. Sein seltsam kantiges Gesicht konnte ich noch jetzt vor mir sehen, seine auffallenden Augen. Bernsteinfarben. Wie die eines Wolfes.
Der Reißverschluss an der Tasche war zur Hälfte offen. Besser, ich machte ihn zu, damit nichts herausfiel. Aber er ließ sich nicht zuziehen. Etwas hatte sich von innen dazwischengesetzt. Ich fuhr mit der Hand in die Tasche und zog aus den gefräßigen Metallzähnen ein Papier hervor, das nun am Rand zerrissen war.
Es sah aus wie die Kopie eines Zeitungsartikels. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto lachte eine alte Frau, die Haare streng zurückgekämmt. Sie hatte eine Art Kittelschürze und grobe Schuhe an, wie jemand, der gerade aus dem Garten kommt. Ihre Hand ruhte auf der Schulter eines kleinen Jungen, der aussah wie der Jüngste der Reschke-Brüder, als er noch klein und niedlich war und außer Frösche aufzublasen nicht viel angestellt hatte. Die beiden auf dem Foto strahlten um die Wette.
Darunter stand etwas in einer Schrift, die ich nicht lesen konnte. Nicht nur, weil ich die Sprache nicht beherrschte, ich kannte schon die Buchstaben nicht. Was war das? Auf jeden Fall nichts Asiatisches. Jemand hatte am Rand handschriftlich eine Notiz auf Deutsch hinzugefügt: »Hier die Geschichte, wie alles begann. Aus einer Ausgabe der Tretjakowskaja Prawda. Ich dachte, du freust dich darüber! Gruß, Erik«.
Tretjakowskaja Prawda, das hörte sich sehr russisch an. Dann war die Schrift im Artikel wohl Kyrillisch. Ich faltete den Ausschnitt wieder zusammen und steckte ihn zurück in die Tasche.
Ich sollte weitergehen, sonst würde ich heute nicht mehr ankommen. Nachdem ich mich von meinem stummen Nachbarn verabschiedet hatte, zog ich mit Tasche und Koffer weiter. Das also war Heidelbergs Einkaufsmeile. Ein Geschäft reihte sich ans nächste. Buchhandlungen, Eisdielen, Cafés, Läden, in denen es Kleidung, Seife oder Dessous gab, und eine einladende Bank vor einem Schaufenster mit einem Schild darauf: »Reserved for Forrest Gump«. Die Fußgängerzone schien nicht enden zu wollen. Aber egal, was ich sah, immer wieder schwirrte das Bild der toten Frau in meinem Kopf herum und wollte sich einfach nicht vertreiben lassen. Ihre roten Haare auf dem Asphalt. Ob einer der Schüsse sie getroffen hatte? Aber das konnte nicht sein. Der Mann hatte doch nur in die Baumkronen gezielt.
Nach gefühlten zwanzig Kilometern kam ich endlich an eine große Kirche aus rötlichen Steinen. In ihre Außenmauern waren kleine Nischen eingelassen, in denen Verkaufsstände nicht etwa Bibeln und Rosenkränze, sondern Kuckucksuhren und Crêpes anboten.
Hier sah Heidelberg schon eher so aus, wie ich es mir nach Tante Flos Schwärmereien vorgestellt hatte. Ein hohes, altes Haus, das eine goldene Schrift als »Hotel zum Ritter« auswies, war bis zum Giebel hin verziert mit steinernen Schnörkeln und Büsten. Auf dem Platz hinter der Kirche prangte auf einem Brunnen eine männliche Figur mit einem Waschbrettbauch, der manchen Bodybuilder vor Neid hätte erblassen lassen. Holzbänke luden erschöpfte Menschen zum Ausruhen ein, groß genug, dass schon auf einer von ihnen locker alle Pfadfinder von Ülske Platz gefunden hätten.
Leider setzte der Regen wieder ein, nicht als feiner Sprühnebel, sondern in dicken Tropfen. Ich bückte mich, um meinen Schirm aus der Seitentasche des Koffers herauszuholen, und stieß beim Aufrichten fast gegen einen Mann in Lodenjacke, der mir seinen Bauch entgegenstreckte.
»Rücken Sie mal auf, junge Frau. Hier hinten versteht man nichts.«
Sein Interesse galt einer Dame im knallroten Regencape, die auf den Stufen des Brunnens von Herkules erzählte. Der schaute dort oben schon seit über dreihundert Jahren mit stolzem Blick in die Ferne und sollte angeblich früher einmal der kriegsgeplagten Bevölkerung beim Wiederaufbau der Stadt Mut machen. Da war sie also, meine erste Stadtführung. Aber das musste jetzt nicht sein. Ein andermal gern, wenn es nicht regnete.
Als ich mich an den Menschen vorbeidrängte, sah ich abseits der Gruppe einen Mann, die Hände tief in den Taschen vergraben. Suchend ließ er den Blick über die Menge schweifen. War das nicht der vom Bahnhof? Der Mann mit dem eckigen Kinn und den Wolfsaugen, der versucht hatte, mir die Tasche wegzureißen?
Besser, ich begegnete dem nicht noch einmal. Schnell spannte ich meinen Schirm auf. Der Trupp um mich herum setzte sich in Bewegung. Ich ging einfach mit, verborgen unter dem bunten Dach der aufgespannten Regenschirme. Wir umrundeten die Kirche, bis die Dame im roten Cape abrupt stehen blieb und mit dem Finger gen Himmel zeigte, als hätte sie eine Erscheinung.
»Oh, sehen Sie nur! Ein Wanderfalke. Da lernen Sie gleich einen der Bewohner unseres Kirchturms kennen!«
Fünfundzwanzig Schirme klappten nach hinten, fünfundzwanzig Köpfe schauten in die Luft. Ich nutzte meine Chance, reckte mich und schaute über sie hinweg. Ich konnte den Mann vom Bahnhof nirgends entdecken. Oder? War das der Typ, der in einiger Entfernung, nach allen Seiten Ausschau haltend, über den Platz schlenderte?
Der Gruppe setzte sich wieder in Bewegung. Ich drängte mich mehr in die Mitte. Vor dem Portal an der Westseite blieb die Dame im Regencape erneut stehen.
»Hier in der Heiliggeistkirche war einst auf den Emporen einer der größten Schätze der Renaissance untergebracht. Hat jemand eine Ahnung, worum es sich dabei handelte?«
»Diamanten?«, kam es aus der Menge.
»So etwas Ähnliches«, sagte die Dame. »Bücher. Hier stand einmal die weltberühmte ›Bibliotheca Palatina‹. Alles Weitere erkläre ich drinnen. Wenn Sie mir nun bitte folgen würden.«
Wie auf Kommando schlossen sich die Schirme um mich herum, und alles strömte in die Kirche hinein. Ich blieb vor der Tür zurück. Allein. Kein Mann mit Wolfsaugen weit und breit. Nur zwei Chinesen, die mit ihren Handys Fotos machten.
War das ein Zufall? Ein Taschendieb, der durch die Stadt zog, zu den Plätzen, an denen sich die Touristen drängten?
Vielleicht hatte ich mich auch einfach getäuscht. Seit ich wieder bei Tante Flo wohnte, war ich etwas ängstlich geworden. Wenn Flo Krimis anschaute, dann am liebsten solche, bei denen das Blut unten aus dem Fernseher tropfte und irgendwelche Serienkiller über wehrlose Frauen herfielen. Das tat nicht gut, wenn es einem sowieso schon saudreckig ging und man viel Phantasie hatte, so wie ich.
Zur Vorsicht hielt ich mir den Schirm so tief wie möglich vor das Gesicht. Ab und zu drehte ich mich um, aber der Mann mit den Wolfsaugen war verschwunden.
Rosels Pension sollte in einer der Gassen in der Nähe der Kirche liegen. Nach einigem Suchen fand ich das richtige Haus. Rosels Name stand in winzigen Buchstaben auf dem Klingelschild, aber nirgends stand etwas von einer Pension. Schon seltsam.
Wenn man gewohnt war, dass ein ordentliches Haus mindestens hundertfünfzig Quadratmeter hat und einen Stellplatz für einen Trecker, wirkte das hier ziemlich beengt: keine vier Meter breit, eine niedrige Tür mit einem dicken Holzbalken quer darüber. Der Schlüssel, den Rosel mir geschickt hatte, hakte ein wenig, doch schließlich sprang die Tür auf. In dem schmalen Flur, der vor mir lag, suchte ich vergeblich nach dem Lichtschalter.
Ich stellte mein Gepäck bei der Garderobe ab und tastete mich im Halbdunkel vorwärts. Neben der Holzstiege, die am Ende des Flurs ins obere Stockwerk führte, hielt eine mit Blumen bemalte Milchkanne eine Auswahl von Gehstöcken bereit. Gegenüber dem Treppenaufgang befand sich eine Tür, durch die man bei eins neunzig Körpergröße wahrscheinlich nur mit eingezogenem Kopf unbeschadet hindurchkam. Dahinter lag die Küche, mit einem großen Holztisch in der Mitte und einer der üblichen, langweiligen Küchenzeilen. Die Spüle glänzte, als wäre sie stundenlang gewienert worden, nirgends sah man eine benutzte Tasse oder einen schmutzigen Teller. Rosel schien sehr ordentlich zu sein. Der Messerblock auf der Ablage war der beste Beweis dafür. Ein schickes Teil, an dem die Messer mit der Schneide magnetisch zu haften schienen. Sie waren exakt der Größe nach geordnet, vom kleinen Schälmesser bis zum Riesenmesser, perfekt, um das Hausschwein zu schlachten, und so groß und schwer, dass es schon halb vom Messerblock runtergerutscht war.
Von der Küche aus führten gleich zwei Türen weiter. Eine, auf der ein großer gusseiserner Schlüssel steckte, als wäre es der Eingang zu einem Verlies oder zu einem Geheimgang, der zum Heidelberger Schloss führte. Beides stimmte nicht. Als ich die Tür öffnete, schaute ich in einen kleinen Innenhof, in dem die Mülltonnen standen. Hinter der anderen Tür lag offensichtlich die Waschküche, sofern ich es bei der spärlichen Deckenbeleuchtung erkennen konnte. Ich ging einen Schritt in den kahlen Raum und spürte, wie hinter mir kühle Luft hereinzog. Es war nur ein Hauch, kaum wahrnehmbar, als hätte jemand irgendwo im Haus eine Tür geöffnet. Rosel hatte doch gesagt, es wäre niemand da.
Ein Räuspern. Kam das aus dem Flur? Ein Einbrecher? Hatte jemand mitbekommen, dass Rosel verreist war? Oder war es der Mann vom Bahnhof? Vielleicht hatte ich mir nichts eingebildet, vielleicht war er mir wirklich gefolgt.
Es knarrte. Dann war einen Moment Ruhe. Dann knarrte es wieder.
Ich drückte mich neben die Waschmaschine, auf der ein ganzes Bataillon von Plastikflaschen mit Waschmitteln stand. Ein fataler Fehler. Mit meinem Ellbogen stieß ich gegen die Flaschen, die wie Dominosteine zur Seite kippten. Polternd fiel eine von ihnen zu Boden.
Wenn das ein Einbrecher da draußen war, irgendeiner, der nicht mich meinte, dann würde er jetzt weglaufen. Der würde nicht so dumm sein und nachschauen, wer in der Waschküche herumpolterte.
Aber es lief niemand weg. Im Gegenteil. Ich hörte Schritte. Sohlen, die für einen Moment auf dem Küchenboden zu haften schienen. Dann ein seltsames metallenes Geräusch. Der Messerblock!
Was tun? Ich hatte mich doch nicht die letzten drei Monate durch mein Leben gequält, um dann in der Stadt der Romantik gleich am ersten Tag umgebracht zu werden. Ich presste mich an die Wand und griff nach der Fünf-Liter-Flasche Persil neben mir auf der Waschmaschine.
4
Mit voller Wucht schleuderte ich ihm die Waschmittelflasche entgegen. Der Mann im Türrahmen stöhnte auf und taumelte nach vorn, in die Waschküche hinein, direkt auf mich zu. So fest ich konnte, stieß ich ihn zur Seite und stürmte an ihm vorbei, zog die Tür hinter mir zu und schloss ab. Einmal. Zweimal. Mehr ging nicht.
Mein Handy. Wo war mein Handy? Ich musste die Polizei rufen. Es war in meiner Jacke. Ganz bestimmt. Aber wo? Da war es. Es rutschte mir aus der angstverschwitzten Hand, schlitterte über den Boden und landete unter dem Küchenschrank. Mit ausgestrecktem Arm tastete ich danach.
Von der anderen Seite der Waschküchentür klopfte es.
»Die Polizei ist unterwegs«, schrie ich. »Ich habe schon angerufen.«
»Sehr gut. Dann kann ich Sie gleich wegen gefährlicher Körperverletzung anzeigen.«
»Sie…«, vor lauter Aufregung bekam ich kaum Luft, »…Sie sind mit dem Messer auf mich los. Dafür werden Sie jahrelang sitzen!«
»Mit einem Messer? Was für ein Messer? Was haben Sie überhaupt hier zu suchen?«
»Das geht Sie nichts an.«
Endlich. Mein Handy. Jetzt hatte ich es.
»Das geht mich nichts an?«, rief es aus der Waschküche. »Das sehe ich aber anders. Die Pension gehört meiner Tante. Rosel Niesmer.«
Der hatte bestimmt vorher alles ausgespäht und Rosels Namen an der Tür gelesen.
»Sind Sie Mila? Ich dachte, Sie kommen erst morgen. Ich bin Hugo. Hugo Benske. Ich wohne in der Vier.«
»Sie lügen! Hier wohnt niemand. Rosel hat gesagt, es sind keine Gäste da.«
»Ich bin auch kein Gast. Ich wohne hier. Ich meine, ich wohne immer hier. Ich gehöre sozusagen zum Inventar. Jetzt machen Sie schon die Tür auf. Sonst zeige ich Sie auch noch wegen Freiheitsberaubung an.«
»Sicher wohnen Sie hier. Und ich bin die Königin von Saba.«
»Dann sehen Sie doch nach, wenn Sie mir nicht glauben. Hugo Benske. In meinem Zimmer liegt meine Brieftasche. Da ist mein Ausweis drin.«
Mein Blick fiel auf den Messerblock. Es hingen noch alle Messer dort, nur hingen jetzt alle gerade. Auch das Riesenmesser. Und die Silhouette, die ich eben im Türrahmen gesehen hatte, war ziemlich schmal gewesen. Nicht so wie der Mann vom Bahnhof. Außerdem kannte der Mensch in der Waschküche offensichtlich meinen Namen. Wenn ich nun die Polizei rief und er wohnte tatsächlich hier?
Die Türen im ersten Stock waren jeweils mit einer Zahl versehen. Die Vier hatte ich schnell gefunden. Ein kleiner Raum mit einem akkurat gemachten Bett und einem winzigen Schreibtisch, auf dem ein Computer stand. In der Brieftasche, die auf dem Nachttisch lag, war ein Ausweis, ausgestellt auf einen Mann namens Hugo Benske. 1984 geboren, eins dreiundsiebzig groß.
Unten klopfte es immer noch. Ich schlich zurück in die Küche.
»Sind Sie wieder da? Hallo?«
»Also gut«, rief ich ihm durch die Tür zu. »Ich sehe von einer Anzeige gegen Sie ab. Und das mit der Flasche war Notwehr. Da sind wir uns doch einig, oder?«
»Notwehr. Klar«, kam es von der anderen Seite. »Jetzt machen Sie endlich auf.«
Ich nahm das riesige Messer und hielt es hinter meinem Rücken versteckt. Für den Fall, dass dieser Kerl doch ein superraffinierter Lügner war. Dann drehte ich den Schlüssel um.
Er sah nicht aus wie ein Mann, vor dem man sich fürchten musste. Hugo Benske hätte sich hinter dem Herkules auf dem Brunnen dreimal verstecken können, so schmal war er. Mit den glatten Haaren, die ihm ins Gesicht fielen, und den Sommersprossen auf der hellen Haut erinnerte er mich an Harry Potter. Auf seiner Stirn befand sich allerdings keine Narbe, sondern eine Beule, die schon anfing, rot-blau anzulaufen.