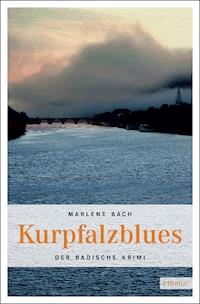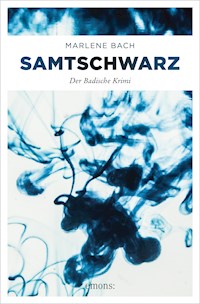10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein diabolisches Spiel im idyllischen Neckartal. Mila Böckle hat Liebeskummer. Mal wieder. Doch eine Begegnung in den malerischen Gassen der Heidelberger Altstadt bringt sie auf andere Gedanken. Sie trifft dort auf Emma, die an einer geheimnisvollen Schnitzeljagd teilnimmt – am Ende soll ein kostbarer Gewinn warten. Mila beschließt zu helfen, aber was als harmloses Spiel beginnt, entpuppt sich als mörderischer Plan. Kann Hauptkommissarin Maria Mooser die beiden Frauen noch rechtzeitig aus der Schlinge des Teufels befreien?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marlene Bach wurde 1961 in Rheydt geboren und wuchs nahe der holländischen Grenze auf. 1997 zog die promovierte Psychologin nach Heidelberg, wo sie seit 2006 als Schriftstellerin tätig ist. Neben Kriminalromanen schreibt sie Kurzgeschichten, mit denen sie unter anderem den Walter-Kempowski-Literaturpreis gewann.
www.marlene-bach.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: photocase.de/.marqs
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr.Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-100-3
Der Badische Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Verlassen sei, was selber sich verlässt.
Das erste Rätsel ist in der Welt. Es erscheint schwierig, ist aber letztlich einfach zu lösen. Es ist den Hexen gewidmet, denn die Hexen sind schuld, sie waren schuld, und sie werden immer schuld sein. An allem. Natürlich sind sie auch dafür verantwortlich, dass Menschen krank werden. Wer bitte schön hat denn die Pest verursacht? Gott kann es nicht gewesen sein, er hätte all die Toten niemals zugelassen. Das muss schon Teufelswerk gewesen sein, und die Hexe, das weiß jeder, ist die Verbündete des Teufels. Die Hexen waren schuld an der Pest, sie waren es, die den Schwarzen Tod brachten, sie sind es, die Öl in die Flammen jeder Pandemie gießen.
Alles Übel, das sich nicht einfach erklären lässt, kann man getrost den Hexen und ihrer Zauberei zuschreiben. Heute heißen Hexen nur anders und sehen auch anders aus. Schließlich sind sie extrem schlau, sie passen sich an, erscheinen zum Beispiel als Sendemasten, die mit ihrer 5G-Strahlung Viren verbreiten. Früher wurden sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt, heute werden Sendemasten angezündet. Das ist nur folgerichtig.
Es ist ein schönes Rätsel. Eigentlich kann ich zufrieden damit sein, wie es bisher gelaufen ist. Ausgenommen diese eine Panne natürlich. Ein Mord kam in meinem Plan eigentlich nicht vor. Eine unschöne Angelegenheit. All das Blut. Aber ich war sehr vorsichtig.
1
Heute glaube ich, der Himmel wollte mich warnen. Vielleicht war es auch meine Tante Flo, die mir aus dem Jenseits eine Botschaft schickte: Da draußen lauert das Böse. Wenn du jetzt hinausgehst, kannst du ihm nicht mehr entkommen. Ich hätte das tun sollen, was Menschen tun, wenn der Wind den Hahn von der Kirchturmspitze weht und abgebrochene Äste Autodächer zertrümmern. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Aber ich verstand die Nachricht nicht.
Die ganze Nacht über hatte der Sturm mich wachgehalten. Ein wütender Drache, der seinen zerstörerischen Atem in die Stadt hineinspie und damit endgültig den schwülheißen Sommer vertrieb. Die alten Holzläden an der Pension hatten geklappert, als würde die nächste Böe sie abreißen, und der Regen war mit einer solchen Wucht auf das Dachfenster über meinem Bett geprasselt, dass ich glaubte, wir müssten alle ertrinken. Hugo, Emilio, unsere Pensionsgäste und die ganze Mäuseschar, die in unserem Keller lebte. Doch es war nicht nur der Sturm, der mich wachhielt. Es war vor allem der Kummer, der wieder einmal dafür sorgte, dass ich nachts grübelte, statt zu schlafen.
Erst am späteren Vormittag ließ der Regen endlich nach. Die zwei Gäste, die zurzeit bei uns wohnten, waren auf ihren Zimmern verschwunden, die Küche war aufgeräumt, also zog ich meine Jacke über und ging aus dem Haus. Es war auf jeden Fall besser, als mich wieder in meine Dachkammer zu verkriechen, selbst bei diesem Wetter.
Im Eingang vor der Haustür lag noch die Zeitung vom Morgen. Oder, besser gesagt, der Rest davon. Der Wind hatte sie auseinandergezerrt und einen Teil davon auf die Gasse geweht. Eine Seite hatte er in die Höhe gewirbelt, sodass sie an der regenfeuchten Haustür kleben geblieben war wie ein Steckbrief. »Brutaler Raubmord – Leiche am Königstuhl gefunden«, stand dort. Daneben war das wächsern bleiche Gesicht eines Mannes abgebildet. Es war nicht zu übersehen, aber ich schenkte dem Toten keine Beachtung, ich war viel zu sehr in Gedanken.
Der Kummer, der mich aus dem Haus trieb, hatte einen Namen: Emilio. An ihn dachte ich, als ich mich in die Augustinergasse treiben ließ. An seine braunen Augen und das kleine Grübchen, das an seinem Kinn auftauchte, wenn er lachte. An den flüchtigen Kuss, den er mir gestern Abend auf die Wange gedrückt und der für ihn wahrscheinlich nichts bedeutet hatte. Denn Emilio liebte meinen Chef Hugo, der mein bester Freund war. Und Hugo liebte Emilio. Genauso wie ich. Mit jeder Faser meines vierunddreißigjährigen Herzens. Die Tatsache, dass Emilio in der Vergangenheit auch einmal eine Freundin gehabt hatte, machte die Sache nicht einfacher. Ganz im Gegenteil, sie war der Quell all meiner Hoffnung.
Wir drei betrieben gemeinsam die kleine Pension »Chez Rosel« in der Heidelberger Altstadt und lebten auch zusammen dort. Alles hätte so gut laufen können, aber seit einigen Wochen fuhr ich jeden Tag Achterbahn. Ein liebes Wort von Emilio, eine zufällige Berührung, und ich war die glücklichste Frau auf Erden. Dann wieder hatte ich ein schlechtes Gewissen Hugo gegenüber, dass ich so für seinen Freund empfand. Und nachts, allein in meiner Dachkammer, fühlte ich mich wie der einsamste Mensch auf der Welt. Flo, meine Tante, die mich großgezogen hatte, war vor einigen Monaten gestorben. Mein altes Zuhause in Ülske gab es nicht mehr, weil es Flo nicht mehr gab. Und nun hatte ich Angst, auch mein neues Zuhause zu verlieren, denn wenn ich in der Pension blieb, würde ich auf Dauer an Emilios und Hugos Glück zugrunde gehen.
Wäre ich nicht so mit meiner Misere beschäftigt gewesen, vielleicht hätte ich die verstörte Frau früher bemerkt. Doch ich nahm sie erst wahr, als sie direkt auf mich zukam, mit einer Verzweiflung auf dem blassen Gesicht, als wäre sie die letzte Passagierin auf der untergehenden »Titanic«.
»Kennen Sie sich hier aus?«, fragte sie.
Der Wind hatte ihre halblangen roten Haare zerzaust, und auf ihren Wangen schimmerten hektische Flecken. Die Ärmel ihrer hellblauen Regenjacke reichten fast bis über ihre Hände. Vielleicht wirkte sie deshalb so verloren.
»Ich muss etwas über die Hexen hier wissen. Ich meine, über einen Ort …« Ihr Blick irrte umher. »Der Turm da im Hof ist doch der Hexenturm, nicht wahr?«
Sie deutete in Richtung des hohen Gittertors, durch das man in den Innenhof der »Neuen Universität« gelangte. Darin gab es nicht nur eine große Rasenfläche mit kniehohen Steinen drumherum, wo man im Sommer die Nase in die Sonne halten konnte, sondern auch einen hohen Turm aus rotem Sandstein, an den sich rechts und links die Gebäude der Universität anschlossen.
»Ja, genau, das ist der Hexenturm.«
»Ich suche etwas.« Die Unbekannte strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Aber es ist da nicht. Ich habe überall nachgeschaut. Vielleicht bin ich hier falsch.« Sie zog ein zerknittertes Papier aus ihrer Jackentasche. »Hier, da muss ich hin: ›Roter Sandstein, von des Kurfürsten Gnaden. Fünfzig Meter hoch, genug Platz für Riesen. Suche dort, wo eine der bösen Frauen, die den Schwarzen Tod über Heidelberg brachten, verlor, was niemand gern verliert.‹«
Sie hielt das Blatt mit beiden Händen fest, damit der Wind es ihr nicht entriss.
»Der Schwarze Tod, das ist die Pest. Da bin ich mir ziemlich sicher«, sagte sie. »Dann ist mit der bösen Frau bestimmt eine Hexe gemeint. Die hat man früher für die Pest verantwortlich gemacht. Der Turm da drin ist aus rotem Sandstein. Und es ist der Hexenturm. Dann muss das doch hier sein!«
Ich stülpte die Kapuze meines Anoraks über. Lange, lockige Haare waren nichts für dieses Wetter, sie entwickelten im Wind ein Eigenleben wie Seetang im Meer.
»Ich glaube nicht, dass der Turm hier für die Hexen gedacht war. Soviel ich weiß, war das einmal ein Gefängnis. Der Turm heißt nur Hexenturm, aber da waren keine drin.«
Seit ich wegen meiner Unwissenheit über den Faulen Pelz einmal fast gestorben wäre, hatte ich fleißig dazugelernt und jede Menge Reiseführer studiert. Inzwischen wusste ich so viel über Heidelberg, dass ich sogar ab und zu kleine Führungen für unsere Pensionsgäste anbot. Der Turm war einmal Teil der Stadtmauer gewesen, aber davon, dass dort angebliche Hexen ermordet worden waren, hatte ich nirgends etwas gelesen. Wahrscheinlich hatte es auch in Heidelberg solche Gräueltaten gegeben, aber ich hatte keine Ahnung, wo.
»Der Turm ist bestimmt auch nicht fünfzig Meter hoch«, wandte ich ein.
Vielleicht waren es zwanzig, dreißig Meter, aber keine fünfzig.
»Gibt es denn in der Stadt einen Turm, der so hoch ist?«
»Auf jeden Fall gibt es höhere als den Hexenturm. Zum Beispiel den an der Jesuitenkirche. Oder oben am Schloss, da sind mehrere Türme. Aber wie hoch die genau sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir leid.«
»Ja, schon gut.« Die rothaarige Unbekannte steckte den Zettel wieder ein, den Kopf leicht gesenkt. Dabei wirkte sie so enttäuscht, dass es mir leidtat, ihr nicht weiterhelfen zu können.
Ob das eine neue Idee des Heidelberger Stadtmarketings zur Touristenunterhaltung war? Aber irrte man deshalb kreidebleich bei diesem Wetter in der Stadt herum? Wie auch immer, für enttäuschte Menschen war ich im Moment die falsche Ansprechpartnerin, ich hatte genug mit mir zu tun.
»Dann viel Glück!«, wünschte ich und ging weiter.
Hätten meine Finger in der Jackentasche nicht das Bonbon berührt, das dort geduldig darauf wartete, gegessen zu werden, wäre es mir wahrscheinlich nicht mehr eingefallen. Emilio liebte diese Bonbonsorte genauso wie ich. Ich überlegte, noch zum Zuckerladen zu gehen, um ihm eine Tüte davon mitzubringen. Der Heidelberger Zuckerladen mit dem Zahnarztstuhl im Schaufenster. Bonbons. Zahnarzt. Zähne. Dann erinnerte ich mich: an die Geschichte von der Hexe, die ihre Zähne in Heidelberg verloren hatte. Ich hatte sie in einem der Reiseführer gelesen. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber das kam davon, wenn man nachts kaum schlief.
Ich drehte mich um und kehrte zurück, doch die Fremde war verschwunden. Ich fand sie im Hof der Universität, wo sie an der Mauer des Turms entlanglief, offenbar immer noch suchend.
»Hallo!«, rief ich. »Mir ist da etwas eingefallen!«
Sie sah hoch, dann kam sie mit schnellen Schritten auf mich zu.
»Vielleicht sind es die Zähne! Das, was niemand gern verliert. Oben am Schloss gibt es einen Turm mit einem Türklopfer. Einem großen eisernen Ring. Angeblich hat sich daran einmal eine Hexe die Zähne ausgebissen, weil der Kurfürst versprochen hatte, dass der alles von ihm erbt, der den Ring durchbeißen kann. Es sollen die Spuren von den Hexenzähnen daran zu sehen sein. Wenn man’s denn glauben will. Auf jeden Fall heißt er Hexenring.«
»Ein Turm, eine Hexe und etwas, das niemand gern verliert. Zähne. Das würde passen.« Die hübsche Fremde schaute zurück zum Hexenturm. »Dann ist das der falsche Turm.«
Ich hatte gedacht, sie würde sich über meinen Einfall freuen, aber sie schaute nur hektisch auf ihre Uhr.
»Ich muss zu diesem Hexenring! Wie komme ich von hier aus dorthin?«
»Mit der Bergbahn. Oder zu Fuß, das geht wahrscheinlich genauso schnell. Sie können den Stufenweg nehmen, dann kommen Sie gleich oben in der Nähe des Turms raus.«
»Zeigen Sie mir, wo dieser Weg ist? Ich kenne mich nicht so gut aus, ich wohne noch nicht lange in Heidelberg. Bitte, es ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich!«
Ihre Augen waren so hellblau wie ihre Regenjacke. Sie glänzten, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Der Stufenweg hoch zum Schloss war eigentlich nicht zu verpassen, aber zurück zur Pension musste ich sowieso in dieselbe Richtung.
»Am besten, wir gehen da hinten raus, zur Seminarstraße. Ich heiße übrigens Mila«, stellte ich mich vor. »Mila Böckle.«
»Und ich bin Emma«, erwiderte sie und eilte gleich los. »Danke. Nett, dass du mir hilfst, Mila.«
Emma duzte mich mit einer Selbstverständlichkeit, als wären wir alte Bekannte. Zum ersten Mal tauchte der Anflug eines Lächelns auf ihrem Gesicht auf. Eines, in das sich schon kleine Falten um Mund und Augenwinkel eingegraben hatten. Sie sah aus, als wäre sie ein wenig älter als ich. Vielleicht Ende dreißig, Anfang vierzig, konditionsmäßig aber war sie von uns beiden definitiv die Jüngere, so schnell, wie sie die Straße langlief.
»Was suchst du denn am Hexenring?«, fragte ich.
»Also … Es ist so …«
Emma zog ein Taschentuch heraus und putzte sich umständlich und ausgiebig die Nase. Sie hätte sich auch ein Schild umhängen können: Dazu will ich nichts sagen.
»Schon gut.« Dann eben nicht.
»Doch, doch.« Sie steckte das Taschentuch wieder ein. »Wenn du mir hilfst, willst du auch wissen, um was es geht. Das kann ich verstehen. Ich … mache bei einem Spiel mit. Einem ganz besonderen Spiel. Man kann dabei etwas gewinnen.«
»Wenn du deshalb bei diesem Wetter vor die Tür gehst, muss sich das aber richtig lohnen.«
Natürlich hatte ich erwartet, Emma würde mir jetzt erzählen, was für ein Spiel das sein sollte. Vor allem, was man gewinnen konnte: einen kleinen Goldbarren, einen Reisegutschein, ein Ticket nach Neuseeland? Aber Emma schwieg.
»Und was ist der Gewinn?«, ließ mich meine Neugier schließlich fragen.
Emma hatte die Hände tief in den Taschen ihrer Jacke vergraben. Sie drehte sich im Gehen kurz um, als wollte sie sicher sein, dass niemand hinter uns war, der ihre Antwort mithören konnte.
»Es ist etwas Wertvolles. Etwas sehr Wertvolles. Aber um was es genau geht, das ist ein Geheimnis. Das gehört zum Spiel dazu. Tut mir leid. Mehr kann ich darüber nicht sagen.«
»Wir müssen da drüben in die Straße.« Ich zeigte auf die andere Seite, wo der Untere Faule Pelz begann.
Ohne sich umzudrehen, trat Emma in der Kurve auf die Fahrbahn. Ich hatte den Radfahrer nicht gehört und nicht gesehen. Er musste hinter uns die Straße entlanggekommen sein. Einer dieser Kamikaze-Radler, bei denen man besser schnell die Bahn räumt. Emma war schon einen guten Meter auf der Fahrbahn. Er hätte noch an ihr vorbeikommen können, doch eine Böe trieb eine leere Plastikflasche über die Straße. Der Radfahrer wich aus, schrie noch etwas, dann prallte er mit Emma zusammen. Er stürzte und rutschte mitsamt Rad über den regenfeuchten Asphalt. Auch Emma war zu Boden gegangen.
Für den Bruchteil einer Sekunde schien die Welt den Atem anzuhalten. Im Nachhinein hätte ich schwören können, dass sogar der Wind aussetzte. Emma wimmerte leise. Wenige Meter weiter kroch der Radfahrer auf allen vieren über die Straße.
»Emma!« Ich kniete mich neben sie. »Alles in Ordnung?«
»Ja … ich glaube schon.«
Der Radfahrer war inzwischen wieder auf den Beinen und kam zu uns gelaufen. In seiner eng anliegenden schwarzen Kleidung und mit dem futuristischen neongelben Helm auf dem Kopf sah er aus wie ein riesiges Insekt. Der Schreck stand ihm ins hagere Gesicht geschrieben. Auch er beugte sich zu Emma hinunter.
»Ist Ihnen etwas passiert?«
»Nein, nein!«, antwortete Emma. »Es ist alles in Ordnung. Ich brauche nur einen Moment.«
An ihrem Kinn quollen kleine Blutstropfen aus der Haut. Auch an der Stirn hatte sie Abschürfungen.
»Kommen Sie, wir helfen Ihnen hoch«, sagte das Radfahrer-Insekt. »Mal sehen, ob Sie verletzt sind.«
Gemeinsam packten wir Emma und zogen sie in die Höhe. Als sie den rechten Fuß aufsetzte, stöhnte sie vor Schmerzen.
»Haben Sie sich etwas gebrochen?«, fragte der Radfahrer, der selbst ganz bleich war. »Können Sie auftreten?«
»Es ist alles gut.« Emma fuhr sich mit der Hand übers Kinn und betrachtete erstaunt ihre blutigen Finger. »Nur eine kleine Schramme. Mehr nicht. Nichts passiert.«
»Sind Sie sicher? Sollen wir Sie nicht lieber zu einem Arzt …«
»Nein! Kümmern Sie sich um Ihr Fahrrad«, wehrte Emma schroff ab. »Mir geht es prima. Wirklich. Ich habe nicht zur Seite gesehen, als ich auf die Straße getreten bin. Es tut mir leid. Vergessen wir das Ganze einfach. Ich gebe Ihnen Geld für Ihr Fahrrad, wenn es kaputt ist. Ist es kaputt? Wenn nicht, dann fahren Sie einfach weiter.«
Es war nur zu offensichtlich, dass sie ihn loswerden wollte.
»Sollten wir nicht doch lieber …«, versuchte es der Unfallradler noch einmal.
»Haben Sie nicht gehört: Alles ist gut!«, blaffte sie ihn an. »Ist Ihr Fahrrad nun kaputt oder nicht? Wenn nicht, dann fahren Sie!«
»Okay, okay.« Der Radfahrer hob abwehrend die Hände. »Wie Sie möchten. Auf Ihre Verantwortung. Aber ich habe Ihnen meine Hilfe angeboten, damit das klar ist.«
Er ging zurück zu seinem Fahrrad, nicht ohne uns noch einmal einen skeptischen Blick zuzuwerfen, hob das Rad auf und prüfte es kurz, dann stieg er auf und fuhr davon. Emma war zurück auf den Gehweg gehumpelt und lehnte sich mit dem Rücken an die Hauswand.
»Ist wirklich alles in Ordnung?«
Kaum hatte ich es ausgesprochen, glitt sie langsam zu Boden, bis sie in der Hocke zu sitzen kam.
»Nur … einen Moment«, flüsterte sie. »Ich muss nur … kleinen Moment.«
Sie fasste sich an die Stirn. Ihre Augenlider flatterten.
»Mir ist so schwindlig.«
»Emma! Emma!«
Aber Emma schwieg. Ihre Stirn fing an, sich rot-blau zu verfärben. Möglicherweise war sie doch schwerer verletzt, als zu sehen war. Eine Hirnblutung. Irgendetwas Schreckliches, an dem sie sterben würde, wenn ich nichts unternahm. Ich holte mein Handy heraus.
»Ich rufe jetzt einen Krankenwagen.«
»Bitte nicht«, protestierte sie leise. »Ich muss aufs Schloss! Bitte!«
»Dann steh doch auf und geh«, sagte ich.
Sie rührte sich nicht. Ich hatte es nicht anders erwartet.
»Es ist besser, Emma. Glaub mir. Ich rufe jetzt Hilfe.«
»Keine Polizei! Bitte! Es hat keinen Unfall gegeben. Ich bin über die Flasche gefallen! Keine Polizei!«
Ich wählte die 112 und meldete eine Person, die gestürzt war. Als ich alles durchgegeben hatte, was benötigt wurde, setzte ich mich neben Emma und wartete. Nach einer Weile lehnte sie den Kopf an die Wand, schloss die Augen und bewegte sich nicht mehr. War sie bewusstlos?
»Emma? Emma!«
Da riss sie die Augen auf, packte meinen Arm und krallte ihre Finger hinein, wie eine Ertrinkende, die sich voller Verzweiflung an einen vorbeitreibenden Ast klammert.
»Du musst für mich hoch zum Schloss. Wenn der Hexenring die richtige Antwort ist, liegt dort ein Umschlag. Den musst du für mich holen.«
Ich wollte keinen Umschlag holen. Ich wollte, dass der Krankenwagen kam, Emma mitnahm, und dann würde ich in die Pension zurückgehen und diesen Scheiß-Morgen vergessen.
»Aber du darfst niemandem davon erzählen. Es ist so wichtig für mich!« Die Regentropfen mischten sich mit den Tränen auf Emmas Gesicht. »Bitte, Mila! Hilf mir doch!«
Das Blut tropfte von der Wunde am Kinn auf ihre Jacke. Endlich war das Martinshorn zu hören. Ich hatte dieses seltsame Rätsel für sie gelöst. Ich hatte Emma schon geholfen. Aber sie wirkte so verzweifelt, dass ich es nicht fertigbrachte, Nein zu sagen.
»Also gut«, antwortete ich. »Dann gehe ich und hole den Umschlag.«
Es war die letzte Chance, meinem Schicksal zu entrinnen. Ich hatte sie verpasst.
2
Sobald die Sanitäter aus dem Krankenwagen gestiegen waren und sich neben Emma knieten, erzählte sie stockend die Geschichte von der Plastikflasche, über die sie gestürzt sei. Als sie fertig war, beugte sie sich vor und übergab sich auf den Asphalt. Es war wohl das entscheidende Argument, sie mitzunehmen.
Ich stand an der Seite und wartete. Einer der Männer fragte mich, ob ich die Frau kennen würde. Nein, sagte ich, und beließ alles andere bei Emmas Version. Wenn sie es unbedingt so wollte, mir sollte es egal sein. In meiner Geldbörse hatte ich zum Glück eine Visitenkarte der Pension, und in meiner Jackentasche fand ich einen Bleistiftstummel. Ich schrieb meine Handynummer hinten auf die Karte und gab sie einem der Sanitäter mit der Bitte, sie an Emma weiterzureichen.
Der Wagen fuhr davon, und ich machte mich auf den Weg. Inzwischen ärgerte ich mich, dass ich mich auf diese Sache eingelassen hatte, aber ich hatte noch nie gut aushalten können, wenn jemand weinte. Ein paar Tränen, und man konnte mir aus den Rippen leiern, was immer man von mir haben wollte. Emma hatte anscheinend Angst davor, dass die Polizei von ihrem Spiel erfuhr. Etwas Wertvolles in einem Umschlag. Vielleicht eine Kette mit Diamanten, die jetzt in irgendeiner der Villen am Neckarufer fehlte? Hoffentlich nicht. Ich war in Heidelberg schon zweimal ins Visier der Polizei geraten, das reichte mir für die nächsten zwanzig Jahre.
Die Schlossruine lag am Nordhang des Königstuhls, ein wenig erhaben über der Stadt. Der schnellste Weg zum Turm mit dem Hexenring führte über den Kurzen Buckel. Ein Buckel, der es in sich hatte. Es waren gut dreihundert Stufen und eine ziemliche Herausforderung für eine Couch-Potato wie mich. Die Alternative wäre gewesen, die Bergbahn zu nehmen, die immerhin zwei Meter pro Sekunde schaffte und damit eindeutig schneller war als ich. Aber etwas für die Kondition zu tun, konnte nicht schaden. Emilio war sehr sportlich.
Ich zurrte meine Kapuze fest und begann mit dem Aufstieg. Ab und zu musste ich stehen bleiben, weil ich Seitenstiche bekam. Die Treppe wand sich in einigen Biegungen nach oben. Ich brauchte fast fünfzehn Minuten, bis ich endlich nach Luft schnappend die letzten Stufen erreichte.
Auf der Treppe war ich etwas geschützt gewesen, aber kaum stand ich oben auf der Straße, traf mich eine Windböe mit einer solchen Wucht, dass es mir den Atem nahm. Leicht nach vorn gebeugt kämpfte ich mich vorwärts. Von hier aus waren es nur noch wenige Meter bis zum Schlossgelände.
Rechter Hand lag das Gebäude, in dem man die Eintrittskarten kaufen konnte, linker Hand das Brückenhaus, vor dem normalerweise jemand stand, der die Karten kontrollierte. Von dort aus gelangte man über eine steinerne Brücke zum Turm mit dem eigentlichen Eingangstor. Normalerweise tummelten sich hier die Besucher, um in den Schlosshof zu gelangen und sich das gigantische Weinfass anzuschauen oder um vom Großen Altan, einer Art Terrasse, auf die Altstadt und den Neckar zu schauen. Heute aber schien der Sturm alle davongeweht zu haben, ich war mutterseelenallein. Sogar die Eingangskontrolleure fehlten. Meine Chance, Geld zu sparen.
Rasch ging ich durch das Brückenhaus auf den Turm zu. Er war auf jeden Fall höher als der Hexenturm unten in der Stadt. Und da oben standen sie, auf halber Höhe: zwei überlebensgroße steinerne Ritter, auf kleinen Vorsprüngen, bewaffnet mit Schwertern und Lanzen, ganz so, als würden sie Wache halten. Ich war schon häufiger hier gewesen, trotzdem hatte ich die beiden Figuren nie bemerkt. Das sollten sicher die Riesen sein, die im Rätsel erwähnt waren.
Die mächtigen dunklen Torflügel waren zur Seite geklappt und an den Wänden dahinter mit eisernen Haken festgemacht. Im linken Torflügel befand sich eine kleine Tür. In früheren Zeiten bestimmt sehr praktisch, um ohne viel Aufwand den Zugang zum Schloss zu ermöglichen. Perkeo, der Heidelberger Hofzwerg, der hier gelebt haben soll, hat sich sicher gefreut, dass es einen Eingang passend in seiner Größe gab. An dieser kleinen Tür hing der Hexenring. Um daran den Abdruck der Hexenzähne zu entdecken, brauchte man allerdings schon eine blühende Phantasie. Für mich sah es eher so aus, als wäre irgendwann einmal ein Stück Metall herausgebrochen.
Ich hatte gehofft, den Umschlag gleich zu finden. Dass man ihn vielleicht ans Tor geklebt hatte, damit der Wind ihn nicht davontrug, aber da war nichts. Also suchte ich die Umgebung ab. Zwischen den aufgeklappten Torflügeln und der Wand war jeweils ein Spalt, in den ein Mensch gerade so hineinpasste. Erst auf den zweiten Blick entdeckte ich dort einen Ziegelstein auf dem Boden. Etwas Weißes lugte darunter hervor. Ich kroch in den Spalt und hob den Stein an. Da lag er, ein jungfräulich weißer Briefumschlag. Weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite stand etwas. Und wie es sich für einen mysteriösen Brief gehörte, war er zugeklebt. Aber ganz bestimmt war da keine Kette drin. Was war flach und so wertvoll? Ein Scheck? Ein Brief von Emmas Liebstem?
Nun kamen doch einige Besucher, die schon im Schloss gewesen waren, aus dem Hof auf mich zu. Rasch steckte ich den Umschlag ein und machte mich auf den Rückweg. Inzwischen war mein Anorak so klamm, als hätte ich unter einem Rasensprenger gestanden. Ich wollte nur noch nach Hause, Kaffee in unserer warmen Küche trinken und mit etwas Glück dort auf Emilio treffen. Der Gedanke trieb mich voran und ließ mich unachtsam werden. In einer der ersten Biegungen geriet ich mit dem Fuß auf einen Haufen nasser Blätter. Ich rutschte aus und konnte mich im letzten Moment am Handlauf festhalten. Mit klopfendem Herzen blieb ich stehen, froh, nicht gestürzt zu sein. Jetzt, als der Wind im Schatten des Berghanges nur noch ein Säuseln war, hörte ich die Schritte. Jemand musste hinter mir sein. Ich drehte mich um, aber ich konnte nicht sehen, wer da oben den Weg hinunterkam. Und schon war es wieder still.
Bis jetzt hatte ich nicht mehr an den Mord gedacht, an die Zeitungsseite, die der Wind an unsere Haustür geweht hatte. Der Tote vom Königstuhl. Brutaler Raubmord. Warum nur hatte ich nicht den Rest gelesen? War der Mörder noch hier in der Gegend, vielleicht auf der Suche nach seinem nächsten Opfer? Ich hatte in meiner Geldbörse nicht mehr als zwanzig Euro. Wie wütend wurde so jemand, wenn es keine Beute gab? Besser, ich beeilte mich, von hier wegzukommen.
Bilder schwirrten durch meinen Kopf. Ein Mann, muskulös, mit blutunterlaufenen Augen, der nur ein paar Meter hinter mir war, der leise und geschmeidig wie ein Raubtier daherschlich, mit dem Ziegelstein in der Hand, unter dem der Brief gelegen hatte, um mir damit den Kopf einzuschlagen und mich dann auszurauben. Ich hastete die Stufen hinab und rutschte hinter der nächsten Biegung erneut aus. Unsanft fiel ich auf den Boden. Das war gerade noch mal gut gegangen. Nichts gebrochen, nichts verstaucht.
Jetzt war es genug. Schluss mit dem Quatsch. Ich wusste, ich war die Weltmeisterin des Kopfkinos. Ich konnte mir problemlos zehn solcher Geschichten ausdenken, eine schauriger als die andere, und noch nie war eine davon wahr geworden. Dafür würde ich mir den Hals brechen, wenn ich weiter in Panik hier runterrannte.
»Gespenster musst du dir ansehen«, hatte meine Tante Flo gesagt, wenn ich als Kind vor Angst nicht schlafen konnte, weil ich glaubte, ein Gespenst läge unter meinem Bett. Dann hatten wir uns zusammen auf den Boden gekniet und nachgeschaut. Wie wahrscheinlich war es, dass mir jemand hinterherlief, um mich auszurauben und gleich auch noch umzubringen? So wahrscheinlich wie das Gespenst unter dem Bett?
Ich rappelte mich auf, lehnte mich ans Geländer, holte mein Handy heraus und tat so, als wollte ich etwas nachsehen.
Der Mann, der wenige Sekunden darauf mit angewinkelten Armen an mir vorbeilief, hatte einen dünnen Schlaufenschal bis über die Nase gezogen, so wie es Sportler tun, um sich vor kalter Luft zu schützen. Die dunkle Mütze reichte ihm bis tief in die Stirn. Nur ein schmaler Spalt seines Gesichts war unbedeckt, gerade breit genug, um dazwischen herauszuschauen. Die anliegende Sporthose war etwas zu kurz, sodass man die hellblauen Socken mit den gelben Figuren darauf sehen konnte. Ich wusste gleich, was für eine Figur das war: Homer Simpson, ein alter Serien-Freund von mir. Solche Socken hatte ich Hugo einmal zum Geburtstag geschenkt. Sie hatten das gleiche leuchtende Hellblau wie das T-Shirt, das unter der königsblauen Windjacke des Mannes hervorschaute. Eine Jacke mit Taschen an den Seiten, in denen ganz offensichtlich kein Ziegelstein steckte.
Das also war der Killer, der mich verfolgte. Einer von diesen fanatischen Sportlern, die egal bei welcher Windstärke meinten, ihren Körper stählen zu müssen, bis ihnen beim Sturm eine Blumenampel auf den Kopf fiel. Der brachte eher sich selbst in Gefahr als mich. Trotzdem war ich heilfroh, als ich schließlich in die Gasse nahe der Heiliggeistkirche einbog, in der die Pension lag.
Unsere Haustür war nicht ganz so klein wie die am Torturm, aber auch nicht so hoch wie eine normale Tür. Eine alte Tür in einem alten Haus, das ein bisschen schief und krumm war. Das Zeitungsblatt mit dem Gesicht des Toten war fort, wahrscheinlich hatten Emilio oder Hugo es hereingeholt.
Im Flur roch es, wie so oft bei uns, nach Kaffee. Leise zog ich meine nassen Schuhe und den Anorak aus. Dann holte ich den Brief heraus. Hier im Geborgenen tastete ich den Umschlag noch einmal ab. Da gab es nicht die kleinste Unebenheit. Es konnte nichts anderes außer Papier darin sein. Vielleicht Fotos? Ich hielt ihn gegen das Licht der Flurlampe. Nichts war zu sehen.
Für einen Moment geriet ich in Versuchung. Ich könnte den Umschlag aufmachen, schauen, was Emma so dringend hatte haben wollen, und es einfach in einen neuen Umschlag tun. Es war ein Allerwelts-Umschlag, so einen hatten wir bestimmt noch. Ich schnupperte daran. Er roch nach nichts außer nach feuchtem Papier. Aber Emmas Angst vor der Polizei musste einen Grund haben. Besser, ich ließ die Finger davon.
»Mila, bist du das?«
Das war Emilios Stimme. Rasch legte ich den Umschlag in die Schublade des Schränkchens bei der Garderobe. Ich ging zu ihm in die Küche, den Raum, in dem sich das Leben in unserer Pension abspielte, meist an dem großen Holztisch, um den lauter verschiedene Stühle standen.
Emilio, in weißem T-Shirt und Jeans, war dabei, Geschirr in die Spülmaschine zu räumen. Er sah aus wie der Typ aus der Coca-Cola-Reklame: schlank, durchtrainiert, mit dunklen kurzen Haaren. Es war schon ein Wunder, dass er und Hugo zusammengefunden hatten. Hugo war schmal, blass und erinnerte mich immer ein wenig an Harry Potter. Aber sie waren nur äußerlich so verschieden, in ihrem Wesen waren sie sich sehr ähnlich und die nettesten Menschen, die ich kannte. Ich weiß nicht, wie ich die ersten Wochen nach Flos Tod ohne sie überstanden hätte. Sie hatten mir geholfen, die Beerdigung zu organisieren, und mich danach mit durch den Alltag geschleppt, bis ich wieder halbwegs funktionierte.
»Wo warst du?«, fragte Emilio.
»Ach, nur spazieren.« Ich holte die Milchtüte aus dem Kühlschrank. »Oben am Schloss.«
»Bei dem Wetter? Bist du lebensmüde?«
»Ich brauchte ein bisschen frische Luft.«
»Ist etwas mit dir?« Emilio kam auf mich zu. »Du bist so blass.«
»Da war ein Unfall. Eine Frau ist gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Ich musste den Krankenwagen rufen.«
Ich hätte ihm auch den Rest erzählen können. Die Wahrheit. Vom geheimnisvollen Umschlag mit seinem wertvollen Inhalt. Aber ich schwieg. Solidarität mit einer Verzweifelten. Vielleicht hatte Emma mich verhext.
»Hör mal, Mila, ich finde es nicht gut, dass du da draußen allein rumläufst. Nicht bei dem Wetter.« Emilio legte die Hand unter mein Kinn, damit ich den Kopf hob und ihn ansah. »Wieder traurig wegen Flo?«
Ab und zu hatte meine verstorbene Tante als Ausrede herhalten müssen, wenn ich morgens mit verquollenen Augen aus meiner Dachkammer auftauchte. Ich konnte Emilio ja schlecht sagen, dass ich wegen ihm weinte.
»Oje.« Hugo war in der Tür aufgetaucht. »Was ist denn hier los?«
»Sie vermisst Flo«, erklärte Emilio.
Die beiden bugsierten mich an den Tisch, ich bekam einen Kaffee, das Croissant, das vom Frühstück übrig war, und einen Haufen aufmunternder Worte. Ich genoss es und konnte es trotzdem kaum ertragen, weil ich mir wie eine Betrügerin vorkam. Nach dem Kaffee flüchtete ich, begann die Zimmer sauber zu machen, schrubbte die Toilette und klaubte die Haare vom Badezimmerboden.
Ich hatte gedacht, Emma würde sich schon bald nach ihrer Einlieferung melden, so dringend, wie sie den Umschlag haben wollte. Aber es wurde Nachmittag, und ich hatte immer noch nichts von ihr gehört. Dafür klingelte es an der Haustür.
Manchmal, wenn jemand besonders fest auf den Klingelknopf drückte, blieb er stecken. Die Menschen, die das hinbekamen, nannten wir die Aggro-Klingler, weil es fast immer die Pensionsgäste waren, die Ärger machten, nachts betrunken durchs Haus polterten und neben die Toilette pinkelten. Es klingelte. Klingelte noch mal. Beim dritten Mal hörte es nicht mehr auf. Emilio und Hugo waren inzwischen zu einem Freund unterwegs, also lief ich hinunter und öffnete.
Vor mir stand eine leicht untersetzte ältere Frau in einem zeltähnlichen Regencape. Ihre halblangen dunklen Haare waren von grauen Strähnen durchzogen. Auf den ersten Blick sah sie aus, als wäre sie sympathisch, harmlos, vielleicht sogar gutmütig. Aber das war ein fataler Irrtum, wie ich nur zu gut wusste, denn ich kannte sie: Es war Maria Mooser, Hauptkommissarin bei der Kripo Heidelberg. Wir waren schon einmal in Heidelberg aufeinandergetroffen. Genauer gesagt, zweimal. Beide Male war ich in Verdacht geraten, an einem Verbrechen beteiligt zu sein. Wenn Frau Mooser in meinem Leben auftauchte, stand ich meistens schon mit einem Fuß im Gefängnis.
Wir hatten seit Monaten nichts mehr voneinander gehört. Weshalb war sie hier? Emma, schoss es mir durch den Kopf. Es konnte nur um Emma gehen.
»Kripo Heidelberg«, sagte Frau Mooser unnötigerweise. »Ich komme, um Sie zur Vernehmung abzuholen.«
Es lief mir eiskalt den Rücken hinunter. War Emma gestorben? Hatte sie sich deshalb nicht gemeldet? Doch eine Hirnblutung? Bestimmt hatte die Polizei die Karte von der Pension bei ihr gefunden.
»Kommen Sie wegen Emma?«, fragte ich gegen den schrillen Klingelton an. »Sie ist doch nicht tot, oder?«
Frau Mooser legte den Kopf leicht schräg und musterte mich mit diesem für sie so typischen undurchdringlichen Blick. Das Krokodil, so hatte ich sie im Geheimen genannt. Erst fixiert es sein Opfer, dann schnappt es ganz plötzlich zu. Krokodile sind Lauerjäger, Frau Mooser gehörte eindeutig dazu.
War es strafbar, bei einem Unfall nicht die Polizei zu rufen? Wussten sie von dem mysteriösen Umschlag?
»Ich wollte gleich die Polizei informieren. Emma wollte das nicht«, verteidigte ich mich. »Sie hat mich regelrecht angefleht, dass ich es nicht tue. Ich habe den Um…«
Da erst sah ich den Koffer. Er stand neben Frau Mooser, halb verdeckt von ihrem Regencape. Wenn man jemanden zur Vernehmung abholte, wozu brauchte man dann einen Koffer?
»Wieso haben Sie einen Koffer dabei?«
»Wollen Sie nicht erst einmal weitererzählen? Ich bin ganz Ohr.«
Ganz bestimmt nicht. Nicht bevor ich wusste, was hier eigentlich los war. Für ein paar Sekunden standen wir uns wortlos gegenüber, während die Klingel ihren grellen Dauerton von sich gab.
»Eigentlich wollte ich nur einen kleinen Witz machen«, erklärte Frau Mooser, nachdem ihr wohl klar geworden war, dass ich nichts mehr sagen würde. »Und jetzt wäre es nett, wenn Sie mich reinlassen würden.«
Ein Witz. Über Frau Moosers Witze lachte niemand außer sie selbst. Und ich Idiotin war darauf reingefallen.
»Moment mal.«
Ich ließ sie vor der Tür stehen und lief in die Küche, um ein Messer zu holen und mich innerlich zu wappnen. Warum hatte ich nicht einfach die Klappe gehalten! Nur jetzt nicht noch mehr herausplappern. Mit dem Messer in der Hand kehrte ich an die Tür zurück. Frau Mooser wich einen Schritt zurück.
»Ist nur wegen der Klingel«, sagte ich und hebelte den Knopf mit der Messerspitze wieder aus der Versenkung. Endlich war es still.
»Möchten Sie mir noch mehr über Emma erzählen?« Frau Mooser nahm ihren Koffer. »Ansonsten wäre ich Ihnen dankbar, wenn ich jetzt reinkommen könnte. Ich habe ein Zimmer bei Ihnen gebucht. Das mit dem Fernseher.«
»Davon weiß ich nichts. Sind Sie ganz sicher?«
»Vielleicht sollten Sie Ihre interne Kommunikation verbessern. Ich habe am Telefon mit einem freundlichen jungen Mann gesprochen, Elio oder so ähnlich. Ist der neu bei Ihnen?« Sie drängte sich mitsamt Koffer an mir vorbei in den Flur. »Wir haben einen Wasserrohrbuch im Haus. Da kann ich nicht bleiben. Wenn Sie mir den Zimmerschlüssel gegeben haben, müssen Sie mir aber unbedingt noch erklären, warum diese Emma tot sein soll.«
Ich ignorierte ihre Bemerkung einfach und schaute in unserer Anmeldeliste nach. »Mooser«, da stand es. Emilio hatte sie tatsächlich eingetragen. Eine Katastrophe. Emilio kannte sie nicht. Der wusste nicht, dass sie bei der Polizei war. Weder Hugo noch ich hätten ihr jemals ein Zimmer vermietet.
Ich mochte Frau Mooser. Eigentlich. Irgendwie. Schließlich hatte sie mir einmal das Leben gerettet. Übel gelaunt war sie allerdings, gelinde gesagt, eine Herausforderung für ihre Mitmenschen. Viel schlimmer jedoch war, dass sie überall ihre Nase hineinsteckte.
Alle zwei Wochen bot Hugo für besondere Freunde einen Pokerabend in unserer Küche an, bei dem es um mehr Geld ging, als ich im Monat verdiente. Ein Zuverdienst, der uns über die schwierigen Corona-Zeiten hinweggeholfen hatte. Auch bei so einigem anderen bewegten wir uns nicht im Bereich der Legalität, schon allein aus steuerlichen Gründen. Eine Hauptkommissarin passte eindeutig nicht hierher. Aber vielleicht war sie gar nicht mehr bei der Polizei. Das letzte Mal, als ich sie getroffen hatte, trug Frau Mooser sich mit dem Gedanken, in den Ruhestand zu gehen. Wenn wir Glück hatten, war sie nur noch ein zahnloses Krokodil.
»Sie sind nicht mehr im Dienst, oder?«, platzte ich heraus.
»Doch, ich habe den Antrag auf vorzeitigen Ruhestand zurückgezogen. Es gab gute Gründe. Im Moment habe ich allerdings Urlaub.«
»Ach, und da sind Sie nicht bei Ihrem Freund?«
Ich wusste, sie hatte einen.
»Nein, Arno ist in Lappland. Ein neuer Reiseführer. Seine Wohnung liegt über meiner, da sieht es noch schlimmer aus als bei mir. Außerdem fahre ich wahrscheinlich noch kurzfristig zu meiner Tochter an die Nordsee, das klärt sich sicher bald. Da ich momentan nicht in meiner Wohnung sein kann, dachte ich, ich unterstütze unsere Heidelberger Jungunternehmer. Und so mittendrin in der Altstadt ist es doch auch ganz schön.«
Darüber allerdings gab es in Heidelberg durchaus geteilte Meinungen.
»Okay«, sagte ich, auch wenn es überhaupt nicht okay war. Aber was blieb mir schon übrig. »Dann zeige ich Ihnen Ihr Zimmer.«
Frau Mooser folgte mir die Treppe hoch.
»Also, wie war das? Weshalb vermuten Sie, dass Emma tot ist? Gehen Sie von einem natürlichen Tod aus?«
Natürlich ließ das Krokodil nicht locker, ich hätte es mir denken können.
»Ach, das.« Ich bemühte mich um einen gelassenen Tonfall. »Das war so eine Art Unfall heute Morgen. Eigentlich keine große Sache. Eine Frau ist unglücklich gestürzt. Als Sie auftauchten, dachte ich erst, es ginge darum. Sie ist auf den Kopf gefallen, deshalb hatte ich mir Sorgen gemacht.«
»Eine Freundin von Ihnen?«
»Nein. Ich habe sie noch nie vorher gesehen. Es war purer Zufall, dass ich dabei war.«
Ich hörte nicht mehr als ein Schnaufen hinter mir. Keine Nachfragen. Sehr gut. Ich zeigte ihr das Gemeinschaftsbad, vor allem den Haken mit ihrer Nummer, an den sie ihr Handtuch zu hängen hatte.
»Hugo ist da ziemlich penibel, besser, Sie halten sich dran.«
Dann gingen wir in ihr Zimmer. Frau Moosers Blick schweifte im Raum umher, über das Bett mit der geblümten Tagesdecke, das kleine Sofa mit den bunten Kissen und den Fernseher.
»Sehr gemütlich«, bemerkte sie.
»Sie können die Küche mitbenutzen, wenn Sie sich etwas kochen wollen. Sie müssen aber hinterher spülen und alles sauber hinterlassen. Auch den Herd.«
»Oh, kein Problem.« Frau Mooser hievte ihren Koffer auf das Bett. »Und weshalb wollte die Frau, von der Sie dachten, sie könnte tot sein, nicht, dass Sie die Polizei rufen?«
Wie konnte ich nur auf ihre blöde Masche mit der Vernehmung reinfallen und gleich von Emma anfangen! Aber vielleicht war das auch kein Witz gewesen, sondern ein Test, ob wieder einmal irgendetwas in meinem Leben los war, das die Polizei interessieren könnte. Zuzutrauen war es dem Krokodil. Aber diesmal hatte ich wirklich nichts Unrechtes getan. Jemandem zu helfen, war kein Verbrechen. Trotzdem musste Frau Mooser nichts davon wissen. Vor allem nicht, solange der geheimnisvolle Umschlag noch unten in der Schublade lag.
»Sie wollte es nicht, weil es nicht nötig war.« Ich lächelte harmlos. Unschuldig. »Sie ist über eine leere Plastikflasche gestolpert. Ich war im ersten Moment so aufgeregt, dass ich die Polizei rufen wollte. Die Polizei, dein Freund und Helfer, so heißt es doch. Aber sie war ja nur gestolpert, und Sie haben sicher genug anderes zu tun.«
»Das stimmt allerdings.« Frau Mooser befreite sich aus ihrem Regencape. »Sie glauben gar nicht, weshalb manche Leute bei uns anrufen. Weil die Katze nicht nach Hause gekommen ist oder der Nachbarjunge den Ball vor den Zaun gekickt hat. Wirklich unglaublich.«
Ich hatte den richtigen Punkt getroffen. Geschickt abgelenkt.
»Also dann, gutes Eingewöhnen. Frühstück gibt’s von acht bis elf. Das ist im Preis inbegriffen.«
»Möchten Sie einmal ein Foto von meinem Enkelkind sehen?«
»Gern, später. Jetzt muss ich erst einmal weitermachen.«
Vor allem musste ich Hugo eine Nachricht schicken. Wenn er hier unvorbereitet auf Frau Mooser traf, würde ihn der Schlag treffen. Ich war noch nicht auf der Hälfte der Treppe, da klingelte mein Handy. Die Stimme am anderen Ende erkannte ich sofort. Es war Emma.
»Was ist mit dem Umschlag?«, stieß sie hastig hervor. »Hast du ihn?«
Mein schöner Plan – sabotiert! Erst glaubte ich, es läuft alles, wie es laufen soll. Dann sehe ich, dass die Frau, die zum Torturm geht, die falsche ist. Zunächst dachte ich, es wäre eine Touristin, wie sie da steht und zu den Rittern hochschaut. Aber dann beginnt sie zu suchen und schnappt sich den Umschlag. Sie hat danach gesucht! Sie wusste, dass er dort liegen würde.
Jetzt weiß so eine blöde Schlampe von meinem Spiel. Am liebsten hätte ich sie mit bloßen Händen erwürgt. Ich war auf dem Stufenweg hinter ihr. Ich habe mit meiner Wut gekämpft wie mit einem Löwen, der ein Stück blutiges Fleisch vor der Nase hat und es nicht fressen darf. Ich hätte meine Hände um ihre Kehle legen und zudrücken können. Aber ich habe mich beherrscht.
Mein Spiel, das ich mit so viel Herzblut erdacht habe, wurde verraten. Jeder einzelne Ort hat seine Berechtigung. Nichts habe ich dem Zufall überlassen.
Und jetzt? Was jetzt?
Wenn ein Spiel Regeln hat, dann, damit sie eingehalten werden. Ich habe gedacht, der Druck wäre so groß, dass befolgt wird, was ich verlange. Wie viel weiß die blonde Schlampe? Wer sonst weiß Bescheid? Was wird noch passieren?
Dieser Verrat ist die letzte verfickte Scheiße, aber es ist nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass ich nachlässig war. Ich kann mir selbst nicht trauen. Als ich oben im Schlosshof stehe und warte, entdecke ich die Blutspritzer auf meinen Turnschuhen. Dunkelrotes, getrocknetes Blut. Dabei war ich mir so sicher, alles beseitigt zu haben! Es hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Was, wenn ich noch etwas übersehen habe? Dabei war ich so vorsichtig. Ich habe bei allem Handschuhe getragen, mich bis zur Unkenntlichkeit hinter Maske oder Schal verborgen, die Haare abgedeckt. Sie werden von mir nichts finden, keine Spucke, keinen Fingerabdruck, kein Haar, gar nichts. Und dann das! Sein Blut auf meinen Schuhen!
3
Emma sprach so leise, dass ich mein Handy ans Ohr pressen musste, um sie zu verstehen.
»Hast du den Umschlag?«, fragte sie noch einmal.
»Ja, er lag oben am Turm unter einem Stein. Wie geht es dir?«
»Einigermaßen. Ich habe eine leichte Gehirnerschütterung, und die Achillessehne ist angerissen. Ich kann kaum auftreten. Würdest du mir den Umschlag geben? Heute Abend?«
»In welchem Krankenhaus bist du denn?«
»Am besten, du kommst zu mir nach Hause. Ab neunzehn Uhr bin ich auf jeden Fall wieder dort, dann bringt mein Cousin meine Tochter wieder. Ich brauche den Umschlag heute noch.«
Dann eben heute noch. War mir nur recht, Hauptsache, ich war ihn los.
Emma nannte mir ihre Adresse.
»Du hast doch niemandem etwas verraten, oder?«
Im Hintergrund erklangen Stimmen. Anscheinend stand Emma auf dem Klinikflur.
»Nein, ich habe kein Sterbenswort darüber verloren.«
»Gut. Danke. Ich gebe dir auch etwas dafür. Du willst sicher etwas dafür haben. Ich bezahle dich natürlich.«
Es war bestimmt nett gemeint, aber es machte mich sauer. Was sollte das? Sah ich so aus, als wollte ich aus allem Profit schlagen?
»Ich will kein Geld. Ich will nur den Umschlag loswerden. Und vor allem will ich in nichts reingezogen werden, von dem die Polizei nichts wissen darf!«
»Wirst du nicht, ganz bestimmt nicht. Dann bis heute Abend. Und mach dir keine Sorgen. Glaub mir, es ist wirklich nur ein Spiel.«