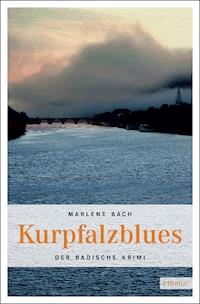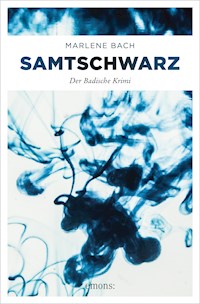
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Badische Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein packender Kriminalroman im romantischen Heidelberg – klug, charmant und erfrischend anders. Gleich bei der ersten Begegnung in ihrer Heidelberger Pension fühlt sich Mila Böckle zu dem attraktiven Fremden hingezogen – wenig später verschwindet er unter mysteriösen Umständen. Mila bittet Hauptkommissarin Maria Mooser um Hilfe. Die Suche führt das ungleiche Duo nach Handschuhsheim, einst Zentrum der europäischen Füllerproduktion, wo ein kostbarer Füller aufgetaucht sein soll. Über Feder und Tinte geraten Mila und Maria in den Kampf einer radikalisierten Gruppe, aus dem es nur eine Chance gibt, lebend herauszukommen: gemeinsam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marlene Bach wurde 1961 in Rheydt geboren und wuchs nahe der niederländischen Grenze auf. 1997 zog die promovierte Psychologin nach Heidelberg. Nach ihrem Umzug in die Kurpfalz begann sie, Romane und Kurzgeschichten zu schreiben. 2011 erhielt sie den Walter-Kempowski-Literaturpreis.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen, Personen und manche Orte sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Lindsay Basson/Arcangel Images
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-616-6
Der Badische Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Der alte Grundsatz »Auge um Auge«macht schließlich alle blind.
Eine Hütte nahe Wilhelmsfeld
Wenn ich lebend hier rauskomme, werde ich Franka sagen, dass ich sie liebe. Der Gedanke war sein Anker im Sturm. Er bewahrte ihn davor, von der Verzweiflung davongerissen zu werden. Ich liebe dich, nur dich. Er hatte es ihr viel zu lange nicht mehr gesagt. Das letzte Mal, als Cloe auf die Welt gekommen war.
Der Geruch von dunklem Grün und dem Harz der Bäume füllte den kleinen Raum. Es war der Geruch von Waldspaziergängen mit Franka und den Kindern, von der kleinen Cloe, die vertrauensvoll nach seiner Hand griff, von Philipp, der Tannenzapfen aufhob, weil sie im Kindergarten Wichtel basteln wollten. Es roch nach heiler Welt. Ein Geruch, der nicht zu dem passte, was hier geschah. Es hätte nach Moder riechen müssen, nach Tod und Verwesung.
Im schummrigen Licht der Hütte saßen sie ihm gegenüber, auf weißen Klappstühlen, an einem verdreckten Campingtisch. Aufgereiht, wie der Richter mit den Schöffen. Ein Affe, ein Frosch und eine Katze. Mit Masken aus Pappmaché, als wollten sie zum Karneval. Solange sie ihm ihre Gesichter nicht zeigten, so lange konnte er hoffen. Wenn sie die Absicht hatten, ihn umzubringen, dann brauchten sie diese Vorsichtsmaßnahme nicht, dann war es egal, ob er ihre Gesichter kannte oder nicht. Aber sie verbargen ihre Gesichter, also gab es Grund zur Hoffnung. Er würde wieder in seinem Büro sitzen und auf die Skyline der Stadt schauen. Er würde den alten Bruns endlich auf dem Golfplatz besiegen. Und er würde Franka sagen, dass er sie liebte.
Die Stimmen hinter den Masken hörten sich jung an. Sie hatten ihn mit einer Waffe am Kopf dazu gezwungen, ein »Geständnis« zu schreiben. »Ich bin ein skrupelloser Egoist. Ich habe aus Profitgier zugelassen, dass die Menschen in der Umgebung meiner Fabrik leiden müssen.« Was für ein Witz. Das waren ein paar von diesen durchgeknallten Ökofreaks, die glaubten, mit Bio und Windkraft könnte man die Welt retten.
Er spürte seine Hände kaum noch. Sie hatten sie ihm hinter dem Rücken zusammengebunden, sodass er leicht gebeugt dasitzen musste. Wenn er sich bewegte, schnitt ihm die Plastikschnur ins Fleisch. Er durfte etwas zu seiner Verteidigung sagen. Er würde ihnen erzählen, was sie hören wollten. Die Wandlung vom Saulus zum Paulus.
»Möglich, dass ich Fehler gemacht habe«, begann er. »Die Tatsache, dass Sie bereit sind, so weit zu gehen, macht mich nachdenklich. In meiner Position widerspricht einem niemand mehr. Dann wird es schwierig, sich nicht in das zu verrennen, was am einfachsten erscheint. Vielleicht ist die Kritik an dem Gutachten berechtigt. Aber die ganze Firma lebt vom Verkauf dieses Produkts. Da hängen eine Menge Arbeitsplätze dran. Ich habe versucht, den Betrieb in der Gewinnzone zu halten. Das ist meine Aufgabe, das erwarten schließlich alle von mir. Aber jetzt, wo ich hier sitze und um mein Leben fürchten muss, wird mir klar, was wirklich wichtig ist. Das Wohlergehen anderer hat immer Vorrang. Wenn die Herstellung unseres Produktes Probleme bereitet, werde ich das erneut prüfen lassen.«
Die wollten nur, dass er klein beigab. Das hier war pure Machtausübung. Sie machten ihn fertig. Sie, die Guten. Und dann würden sie versuchen, ein fettes Lösegeld abzukassieren, um sich damit ein bequemes Leben zu machen.
»Manchmal braucht man eine Lektion«, fuhr er fort, »ein Erlebnis wie das hier, das einen dazu bringt, einen neuen Weg in Betracht zu ziehen. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich verspreche Ihnen, ich werde alles überdenken, was Sie mir vorgeworfen haben. Ich habe verstanden, glauben Sie mir.« Dann senkte er den Kopf und flüsterte: »Bitte! Ich habe einen Sohn, der ist erst sechs. Meine kleine Tochter ist vier. Ich liebe meine Kinder. Sie brauchen ihren Vater noch. Bitte, lassen Sie mich gehen!«
Statt zu antworten, zog der Affe ein Papier aus der Hosentasche. Er faltete es auseinander und begann mit monotoner Stimme vorzulesen, was darauf geschrieben stand.
»Im Namen der Menschen, die wegen Ihnen leiden mussten, verkünde ich folgendes Urteil: Lutz Creumer soll für seine Vergehen eine Strafe erhalten. Da er geständig war, wird ihm erlaubt, die Art der Strafe zu wählen: Er kann trinken oder nicht trinken.«
Die Katze stand auf, leise und geschmeidig. Sie zog aus einem Rucksack einen kleinen Kanister hervor. Er kannte den Aufdruck auf dem blauen Etikett nur zu gut: Es war das Pflanzenschutzmittel, das seine Firma herstellte.
Affe und Katze kamen auf ihn zu, hoben den Stuhl an, auf dem er saß, und stellten ihn unmittelbar vor dem Tisch wieder ab. Die Katze steckte einen dünnen starren Schlauch in den Kanister, sodass er wie der Stil einer Blume herausragte. Sie platzierte den Kanister vor ihm auf dem Tisch und schob ihn so nah heran, dass er sich nur vorbeugen musste, um mit dem Mund an den Schlauch zu kommen. Dann packten die drei ihre Sachen und gingen zur Tür.
»Das können Sie nicht machen!«, rief er. »Sie wollen doch etwas Gutes für die Welt tun. Sie werden mich doch hier nicht allein lassen! Keiner weiß, wo ich bin! Wer soll mich denn hier finden?«
Als er am Mittag losgefahren war, hatte er alle belogen. Niemand wusste, wo er war. Keine Menschenseele.
Die Tür wurde zugeschlagen.
»Hey, ihr Arschlöcher! Kommt gefälligst zurück!«
Er hörte, wie von außen abgeschlossen wurde. Dann war es totenstill.
1
Heidelberg, Altstadt
Am Himmel war keine einzige Wolke zu sehen. Dafür schwebte ein großer schwarzer Vogel über mich hinweg. Flo hätte gesagt, dass es ein böses Omen ist. Als ihre Zwillingsschwester Alma starb, hatten die Krähen den ganzen Tag im Baum vor dem Haus gesessen. Flo hasste Krähen. Mir waren sie egal, erst recht an einem so schönen Tag, an dem der Himmel blau war, wie er nur blau sein konnte.
Ich hatte den Liegestuhl auf die Dachterrasse geschafft, ihn mit einigen Mühen aufgeklappt und mich häuslich eingerichtet: Eine Karaffe mit Wasser, ein paar Kekse, ein Glas und die Flasche mit der verheißungsvoll grünlich schimmernden Flüssigkeit standen auf der umgekippten Holzkiste, die mir als Tisch diente. Margeriten und Geranien reihten sich längs der Brüstung auf dem Boden, sehr zur Freude einer dicken Hummel, die über den Blüten torkelte, als wäre sie gerade erst aus dem Winterschlaf erwacht. Hugo hatte ganze Arbeit geleistet und unsere Dachterrasse in eine Art botanischen Garten verwandelt.
Ich nahm die Gießkanne und gab den Blumen einen Schluck Wasser, dann ließ ich mich im Liegestuhl nieder. Jetzt musste ich nur noch den Arm ausstrecken, um mich an meiner kleinen Bar zu bedienen. Mata Hari und ich, wir würden uns einen schönen Nachmittag machen.
Das Gemurmel der Stadt drang herauf, leise, wie Musik im Hintergrund. Ich wusste genau, was da unten los war. Auf dem Marktplatz schlenderten die Menschen mit suchendem Blick umher, weil sie hofften, einen freien Platz in einem der Cafés zu ergattern. Reisegruppen folgten in die Höhe gereckten Regenschirmen, um die Heiliggeistkirche zu fluten, und vor den Eisdielen in der Fußgängerzone wartete man in langen Schlangen auf Joghurt-Kirsch und Malaga. Es war Frühling in Heidelberg, und durch die Altstadt schwappten Wogen von Touristen und sonnenhungrigen Einheimischen. Gab es da einen besseren Platz, um die wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen, als eine Dachterrasse ganz für mich allein? Vierzehn Tage Urlaub. Vierzehn Tage ohne Gäste, die mehr Kaffee wollten, denen die Butter zu hart oder die Matratze zu weich war. So lange ließen wir die Pension geschlossen. Ein letztes Atemholen vor den Pfingstferien und der nächsten Welle von Urlaubern, die dann über uns hereinbrechen würde.
Hugo war vom Einkaufen zurück und kletterte aus der Luke, die Tageszeitung und einige Illustrierte in der Hand. Natürlich hatte er sofort die Absinthflasche entdeckt.
»Du weißt ja, dass sie eine Nackttänzerin war und als Spionin verurteilt wurde? Man hat sie hingerichtet und ihren Kopf im Pariser Anatomiemuseum ausgestellt. Ich wäre vorsichtig mit dem Zeug.«
Mata Hari war in der Tat ein vielversprechender Name für einen Absinth. Ein Gläschen zu viel und man tanzte sich nur mit einem Feigenblatt bekleidet ins Unglück?
»Danke.« Ich nahm ihm die Zeitungen ab. »Den habe ich von einem Gast geschenkt bekommen. Es wäre unhöflich, ihn nicht zu probieren.«
Hugo schob die runde Brille ein wenig hoch und blinzelte in die Sonne. Seine Haut war so blass und durchscheinend, dass ein Grottenolm dagegen wahrscheinlich frisch und rosig aussah.
»Ich muss dann bald los«, sagte er.
»Hast du gehört, dass ein Schwarm von über hundert Haien Teneriffa umkreist? Gestern haben sie einer Touristin einen Zeh abgebissen. Kam eben im Radio.«
Hugo schien das wenig zu beeindrucken. »Gib’s auf, Mila. Ich werde nur zwei Wochen auf Teneriffa bleiben, keine zwei Jahre. Das schaffst du schon.«
»Wahrscheinlich werden schreckliche Dinge passieren, wenn du nicht da bist.« Ich schüttete mir etwas Mata Hari ins Glas und füllte es mit Wasser auf. »Vielleicht verkaufe ich auch alle Möbel und setze mich mit dem Erlös nach Neuseeland ab.«
Auswandern nach Neuseeland, das war ein alter Traum von mir. Doch meine Tante Flo hatte es geschafft, mich von meiner norddeutschen Heimat Ülske in die Pension ihrer Freundin Rosel nach Heidelberg zu lotsen, damit ich dort aushalf. Inzwischen lebte Rosel auf Teneriffa, hatte ihre Pension kurzerhand ihrem Neffen Hugo überschrieben, und Hugo und ich kümmerten uns um die Gäste. Mein Neuseelandtraum war in weite Ferne gerückt. Aber mit Anfang dreißig konnte man sich da noch ein bisschen Zeit lassen.
»Ich habe Perkeo wieder aufgehängt«, sagte Hugo. »Damit du dich nicht so allein fühlst.«
»Danke, Schätzchen, wirklich sehr rücksichtsvoll.«
Das Bild von Perkeo, dem Heidelberger Hofnarren, war ein Überbleibsel aus Rosels Zeit, die die Pension mit Bildern von Heidelberger Berühmtheiten ausgestattet hatte. Vor einer Weile hatten wir einige der Zimmer gestrichen und dabei gleich die teils streng dreinblickenden Herrschaften wie den Kurfürsten Karl Theodor und Liselotte von der Pfalz gegen blaue Pferde und schwebende Liebespaare von Chagall ausgetauscht. Nur auf Perkeo hatte Hugo nicht verzichten wollen. Aber mit einem zweidimensionalen Hofnarren konnte man leider nicht reden, und er würde mir morgens keinen Kaffee kochen. Ich war nicht gern allein, und auch nach über einem halben Jahr in Heidelberg kannte ich hier bislang kaum jemanden. Manchmal vermisste ich meine alte Heimat Ülske, meine Freunde, die Weite einer Landschaft und krumme Weidenbäume an Bachläufen.
»Flo hat noch angerufen«, sagte ich. »Du sollst Rosel schöne Grüße von ihr bestellen.«
»Danke, mache ich. War George Clooney wieder zum Essen da?«
»Nein, heute nicht, aber angeblich hat Audrey Hepburn ihr die Haare gemacht. Ich nehme an, das war Julia vom Friseurladen, die sich was dazuverdient.«
»Meinst du nicht, deine Tante bräuchte doch professionelle Hilfe? Vielleicht gibt es Medikamente für so etwas.«
»Warum denn? Wenn der alte Reschke vorbeikommt und vorher Gülle gefahren hat, würdest du dir auch wünschen, Clooney säße am Tisch. Der riecht bestimmt nur nach Rasierwasser und Espresso.«
Flo hatte nach dem Tod ihrer Zwillingsschwester Alma die Realität etwas aus den Augen verloren. Aber ich fand, mit über siebzig durfte man ein bisschen seltsam werden, wenn das Leben dadurch leichter wurde, und schließlich schadete sie niemandem.
Zögerlich blieb Hugo vor dem Liegestuhl stehen.
»Mila, ich muss mit dir noch über etwas reden.«
Seit Tagen schlich Hugo um mich herum, fuhr sich nervös durch die Haare, um dann wieder wortlos zu verschwinden. Als wäre er ein Huhn, das ein Ei legen wollte und nicht konnte. Mir war klar, dass Hugo nach einer Gelegenheit suchte, mir etwas mitzuteilen. Ich befürchtete, es ging darum, dass Hugo mich mochte. Ein bisschen zu sehr mochte. Oder zumindest auf andere Weise als ich ihn. Besser, das Ei wurde gar nicht gelegt. Das gab nur Komplikationen. Wir waren ein gutes Team, und so sollte es bleiben.
Er sah von oben auf mich herab, mit einem Blick, wie die Madonna auf das Kind, liebevoll, gütig – und mir irgendwie unangenehm.
»Mila«, begann Hugo, »ich … ich habe dir etwas verschwiegen.«
»Den Absinth solltest du unbedingt probieren.« So schnell war ich noch nie aus diesem Liegestuhl gekommen. »Ich gehe dir ein Glas holen.«
Aber es nutzte nichts.
»Mila, bitte! Bleib hier und hör mir zu!«
Ich lehnte mich an die Brüstung, dort, wo die Gießkanne stand.
»Mila, ich …«, begann er, »… also, ich wollte dir schon lange etwas sagen. Ich …«
Hatte ich es doch geahnt. Wenn das mal keine Liebeserklärung wurde. Was dann kam, war sozusagen Notwehr. Mein eigenwilliger Ellbogen stieß gegen das grüne Plastik. Die Gießkanne ließ sich nicht lange bitten und kippte von der Mauer.
»Oh, mein Gott!« Scheinbar entsetzt schaute ich der Kanne hinterher. Zum Glück ging unten niemand entlang. »So etwas Dummes!«
Hugo stürzte an die Mauer. Man konnte bis hier oben hören, wie die Gießkanne unten in der Gasse aufschlug und über das Kopfsteinpflaster polterte. Zwischen Hugos Brauen war eine tiefe Furche aufgetaucht.
»Verdammt, Mila! Ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst nichts auf die Brüstung stellen!« Hugos Stimme war laut geworden. Jetzt bekam er auch endlich eine etwas frischere Farbe. »Das gibt noch einmal ein Unglück! Willst du da unten jemanden erschlagen? Wenn hier irgendetwas passiert und die Polizei kommt ins Haus, können wir gleich dichtmachen!«
Da war es wieder, das übliche Thema, Hugos größte Angst: Die Polizei könnte uns den Garaus machen. In der Tat hätte sie in der Pension einiges zu bemängeln. Aber die Kanne war so gut wie leer gewesen. Das hätte eine Beule gegeben, aber keinen Toten. Wer würde da schon die Polizei rufen.
»Tut mir leid«, murmelte ich. »Ich gehe runter und hole sie.«
»Nein, lass nur.« Hugo stützte die Hände auf die schmalen Hüften. »Ich muss sowieso jetzt los.« In seiner Stimme schwang Enttäuschung. Ich wusste es und er auch: Der richtige Moment für Geständnisse war verflogen. »Was ich dir sagen wollte, kann warten, bis ich wieder von Teneriffa zurück bin. Mach’s gut. Ich melde mich.«
Das war alles. Keine Umarmung, nichts. Mit finsterem Gesicht kletterte Hugo durch die Luke zurück ins Haus.
»Es tut mir leid!«, rief ich ihm hinterher. »Grüß Rosel von mir. Und pass auf deine Zehen auf, wenn du schwimmen gehst! Und komm gesund zurück!«
Ich ließ mich wieder in dem klapprigen Holzgestell nieder. Ich hätte Hugo einen schöneren Start in seinen Urlaub gewünscht. Irgendwann würden wir um dieses Gespräch nicht mehr herumkommen. Aber dieser Tag war zu schön, um Hugo das Herz zu brechen. Vielleicht sollte ich ihn nicht so oft Schätzchen nennen. Meine Tante nannte mich Schätzchen, da war eigentlich nichts dabei, aber für Hugo war es möglicherweise doch die falsche Anrede.
Ich nippte an meinem Glas, nippte noch einmal und knabberte einen Keks, der überraschenderweise herzhaft und nicht süß schmeckte, und trank wieder vom Absinth. Bis ich spürte, wie die Sonne mich von außen und Mata Hari mich von innen wärmte.
Noch ein Blick in die Zeitung. Die Überschriften waren die typische Sammlung deprimierender Neuigkeiten: Tote bei einem Unwetter auf Korsika. Ein Chemiefabrikant in Frankfurt, der gestern in seiner Mittagspause bei einem Waldspaziergang spurlos verschwunden war. Offensichtlich war er entführt worden, man wartete auf eine Lösegeldforderung. Mich würde bestimmt nie jemand entführen. Manchmal war es von Vorteil, wenn man kein Geld hatte.
So viel blauer Himmel machte müde. Die Zeitung glitt mir aus der Hand.
Ich fühlte mich angenehm leicht. So wunderbar leicht wie eine Feder. Was war das dahinten? Eine Krähe? Nein, das musste Mata Hari sein, mit einem Blumenkranz im Haar. Sie rekelte sich nackt auf der Balkonbrüstung und plauderte mit jemandem, den ich nicht sehen konnte. Perkeo?, fragte sie. Entführt? Dann warf sie den Kopf zurück und lachte. Ein Schmetterling flatterte um sie herum, mit golden schimmernden Flügeln, groß wie ein Unterteller. Er setzte sich vor sie auf die Mauer. »Hallo? Jemand zu Hause?«, rief eine dunkle Stimme. Mata Hari beugte sich nach vorn, um den Schmetterling zu berühren. Dabei fiel ihr Kopf ab und rollte auf der Brüstung entlang. Aber zum Glück stand Tante Flo in ihrem gelben Bademantel an der Mauer und hielt den Kopf fest. Mila, schimpfte sie. Kannst du denn nicht aufpassen! Wenn der hier runterfällt, weißt du, was dann passiert? Das gibt noch einmal ein Unglück! Drohend hielt sie den Kopf über die Brüstung. Sie würde ihn fallen lassen, ich wusste es. Ich kannte meine Tante. Ich versuchte, aus dem Liegestuhl hochzukommen, ruderte verzweifelt mit den Armen. Ich musste Flo aufhalten. Etwas klirrte. »Hallo«, rief die dunkle Stimme.
Endlich schaffte ich es, die Augen zu öffnen. Das Licht hatte sich auf seltsame Weise verändert, war sanft und golden, als hätte der Schmetterling ein wenig Staub von seinen Flügeln verloren. Und kühl war es geworden. War schon Abend? Hatte ich so lange geschlafen? Mühsam stemmte ich mich aus dem Liegestuhl hoch. Der Boden unter meinen Füßen schien nachzugeben, und ich brauchte einen Moment, ehe ich sicher stand. Das Glas lag zerbrochen neben der Holzkiste, auch die Absinthflasche war heruntergefallen. Anscheinend hatte ich im Schlaf alles hinuntergestoßen.
Aus dem Haus drang ein Geräusch nach oben. Hugo war doch bestimmt längst weg? Ich wankte zur Luke und horchte. Stille. Dann knackte und knarzte es. Es war das typische Geräusch, das die alte Holztreppe von sich gab, wenn jemand auf die Stufen trat. Als ich durch die Luke hinabschaute, wurde mir schwindlig.
»Ist da jemand?«, rief ich mit mulmigem Gefühl in die Tiefe.
Die Stimme eines Mannes antwortete: »Ich bin hier unten!«
So deutlich, wie ich ihn hören konnte, musste er schon im ersten Stock sein.
»Entschuldigung, dass ich einfach so hereingekommen bin, aber als ich vor die Haustür gedrückt habe, ging sie auf. Ich brauche dringend noch ein Zimmer für heute Nacht. Sie vermieten doch, oder?«
Manchmal schnappte das Schloss nicht richtig zu. Es stand auf unserer Liste notwendiger Reparaturen, aber die war verdammt lang.
»Hallo! Wo sind Sie denn?«
»Ich komme gleich!« War das wirklich meine Stimme? Hörte sich seltsam an. »Einen Moment, bitte!«
Jemand, der ein Zimmer suchte. Weshalb sollte der sonst hier sein. Aber das Unbehagen blieb. Man ging doch nicht einfach so in ein fremdes Haus hinein. Dachluke von oben zuziehen, sich totstellen und warten, bis dieser Mann weg war, wäre auch eine Alternative. Aber ich hörte nicht auf die leise Stimme der Vorsicht.
Stattdessen stieg ich auf unsicheren Beinen durch die Luke ins Haus.
2
Im dämmrigen Flur sah ich den riesigen Schmetterling an der Wand sitzen. Langsam bewegte er die Flügel auf und ab, dann flatterte er davon und verlor etwas Goldstaub. Die Treppe kam mir seltsam schief vor. Manche Stufen schienen einen halben Meter hoch zu sein. Ich schaute von den Stufen hoch zur Lampe, dorthin, wo der Schmetterling gesessen hatte, und wieder auf die Stufen. Die Wände fingen an, sich zu bewegen, alles drehte sich. Mir wurde so schwindlig, dass ich mich am Treppengeländer festhalten musste.
»Vorsicht!« Ein hochgewachsener Mann kam die Stufen herauf. Er zog mich vom Geländer fort. »Kommen Sie lieber weg da, sonst fallen Sie noch runter. Geht es Ihnen nicht gut?«
»Ich … ich fühle mich … so … so …«
»Setzen Sie sich hierher«, sagte der Fremde, »ich hole Ihnen einen Schluck Wasser.«
Mit seiner Hilfe ließ ich mich auf dem Boden nieder. Er verschwand und kam gleich darauf mit einem Rucksack wieder, zog eine Wasserflasche heraus und reichte sie mir. In diesem Moment entdeckte ich Flo in ihrem gelben Bademantel. Sie stand hinter ihm auf der Treppe, das Gesicht seltsam bleich. Ihre Lippen formten Worte, die ich nicht hören konnte und doch verstand. Das gibt noch einmal ein Unglück, sagte sie. Das gibt noch einmal ein Unglück! Ich schrak zurück und stieß mit meinem Kopf gegen das Geländer.
»Was ist denn los?« Der Mann folgte meinem Blick und drehte sich um. »Ist da etwas?«
Flo wurde immer durchscheinender. Wie Wasserdampf, der sich langsam auflöste.
»Hey!« Der Fremde nahm meinen Kopf in seine Hände und drehte ihn so, dass ich ihn ansehen musste. Ich schaute in Augen, so graublau wie das Gefieder einer Taube. »Hallo! Ich bin hier, okay? Jetzt trinken Sie mal!«
Er hielt mir die Wasserflasche hin. Ich nahm sie und trank in hastigen Schlucken, spürte das Wasser durch meine Kehle laufen, trank und trank. Flo konnte nicht da sein. Flo war zu Hause, in Ülske. Und viel zu wirr im Kopf, um allein bis Heidelberg zu kommen. Das Wasser tat gut, es war kühl wie ein See, in den ich meinen Kopf tauchte. Mit geschlossenen Augen trank ich weiter. Ich wollte, dass Flo verschwand. Flo hier in der Pension, das war unmöglich. Ich trank, bis die Flasche leer war. Dann beugte ich mich ein wenig zur Seite, sodass ich die Stelle sehen konnte, an der Flo gestanden hatte. Sie war verschwunden. Da schwebte nur Chagalls Liebespaar vor einem gelben Himmel, aber im Bilderrahmen, so wie es sich gehörte.
»Soll ich einen Arzt holen?«, fragte der Fremde.
Ich schüttelte den Kopf. Zu viel Sonne. Das war die Erklärung. Mein Gehirn war einfach zu warm geworden.
»Es geht bestimmt gleich wieder. Ich bin oben auf der Dachterrasse eingeschlafen. In der Sonne. Das wird der Kreislauf sein.«
»Ich kann dir einen Kaffee besorgen.« Der Mann mit den taubenblauen Augen wechselte so selbstverständlich zum Du, als hätte er entdeckt, dass wir einander schon lange kannten. »Vielleicht bringt das deinen Kreislauf wieder in Schwung.«
»Gute Idee.« Ich musste meinen Kopf unter Kontrolle bekommen, und Koffein half mir immer. »Kaffee haben wir hier. Gehen wir runter in die Küche.«
Ich hielt mich am Geländer fest und zog mich hoch. Der Fremde bot mir seinen Arm an, als wäre es eine Einladung zum Tanz.
»Ich heiße übrigens Vinzent.«
Dankbar hakte ich mich unter. Als wir langsam die Treppe hinunterstiegen, glaubte ich kurz, den Schmetterling wieder zu sehen. Aber als ich noch einmal hinschaute, war es nur die Wandleuchte.
In der Küche bugsierte Vinzent mich auf einen Stuhl, ließ sich sagen, wo er was finden konnte, und kochte Kaffee. Ich starrte auf die Tischplatte. Ich hatte Angst, Flo könnte neben dem Kühlschrank auftauchen, wenn ich hochsah. Ich konnte sie spüren, so wie ich es als Kind gespürt hatte, wenn ich nachts aufwachte und sie neben meinem Bett stand, um nach mir zu sehen. Gleichzeitig wusste ich, dass das Unsinn war. Ein bisschen Sonne und ein Glas Absinth, da musste man doch nicht gleich durchdrehen. Was war nur los mit mir?
Vinzent setzte sich zu mir und löffelte reichlich Zucker in seinen Becher. »Geht es dir jetzt besser?«
»Ja, geht schon, danke«, sagte ich und unterdrückte den Drang, mit meinen Blicken die ganze Küche abzusuchen.
»Du siehst ziemlich blass aus.«
Vinzent musste ähnlich alt sein wie ich, irgendwo Anfang dreißig. Sein Kinn war ein wenig kantig, die dunklen Haare kurz und leicht gewellt. Er trug eine Jeans, eine schwarze Jacke und ein graues T-Shirt darunter. Auf der Straße wäre ich an ihm vorbeigelaufen, ohne ihn zu bemerken, so unauffällig normal sah er aus. Sein Lächeln allerdings garantierte ihm eine Hauptrolle im nächsten Rosamunde-Pilcher-Film.
Ich versuchte, meine störrischen Locken im Nacken zu verschlingen. Bestimmt sah ich aus wie eine Vogelscheuche.
»Lass doch«, sagte Vinzent. »Deine Haare sind wunderschön.«
Seine Augen schienen mich über den Rand des Kaffeebechers regelrecht zu scannen.
»Ich brauche nur etwas für eine Nacht. Ist noch ein Zimmer frei?«
»Eigentlich haben wir geschlossen.« Aber einen Mann, der mich davor bewahrt hatte, übers Treppengeländer zu fallen, konnte ich wohl kaum wegschicken. »Ach, egal, das geht schon. Die Fünf ist gemacht, da kannst du rein. Das Bad ist gleich nebenan.«
»Verrätst du mir auch deinen Namen?«
»Mila. Also eigentlich Milena. Böckle. Ich bin hier das Mädchen für alles. Ich meine, fürs Frühstückmachen, Bettenbeziehen, Aufräumen, Putzen und so«, schob ich rasch hinterher.
»Milena«, sagte er, als wäre mein Name ein Stück Schokolade, das man sich auf der Zunge zergehen lassen konnte. »Aber du schmeißt den Laden nicht allein, oder?«
»Nein, zusammen mit Hugo. Der ist sozusagen mein Chef. Er sitzt gerade im Flugzeug nach Teneriffa.«
Ich konnte nicht anders, ich drehte mich einmal kurz um. Es fühlte sich so an, als wäre Flo da. Aber natürlich stand niemand hinter mir.
»Ist etwas?«, fragte Vinzent irritiert.
»Nein, alles in Ordnung. Wirklich. Mir geht es schon viel besser. Und, was führt dich nach Heidelberg?«, lenkte ich ab. »Willst du dir das Schloss ansehen?«
Das war die typische Touristenaktion, wenn man nur einen Tag in Heidelberg war: Schlossbesuch, Spaziergang auf dem Philosophenweg und abends völlig erschöpft Pfälzer Bratwurst essen.
»Nein, ich habe hier etwas zu erledigen. Ich muss morgen früh nach Handschuhsheim. Weißt du, wie ich da am besten hinkomme?«
Handschuhsheim war ein Stadtteil Heidelbergs, der nördlich des Neckars lag. Ich kannte ihn ungefähr so gut wie Kuala Lumpur, nämlich gar nicht.
»Tut mir leid, da kann ich dir leider nicht helfen. Ich lebe noch nicht so lange in Heidelberg. Willst du dort jemanden besuchen?«
»Wie man’s nimmt.« Vinzent sah auf den Becher, den er mit beiden Händen umfasst hielt, als wollte er sich daran wärmen. Seine Stimme wurde so leise, dass ich Mühe hatte, ihn zu verstehen. »Ich habe da etwas zu klären. Und ich muss jemanden retten.«
Hatte ich das richtig verstanden? Jemanden retten? Oder war das wieder Einbildung? War das Ganze hier vielleicht Einbildung? Lag ich immer noch auf der Dachterrasse und schlief? Für einen Moment war ich versucht, die Hand auszustrecken, um Vinzent anzufassen. Zu prüfen, ob dieser Mensch da vor mir aus Fleisch und Blut war.
»Was musst du?«, fragte ich zur Sicherheit nach.
Er hob den Kopf. Erst jetzt fielen mir die dunklen Schatten unter seinen Augen auf, wie bei einem Menschen, der schon lange nicht mehr gut geschlafen hatte.
»War nur ein Scherz«, entgegnete Vinzent. »Du kennst doch das Lied? ›Muss nur noch kurz die Welt retten‹.«
»›Und vierzehntausend Mails checken‹«, vervollständigte ich den Text.
»Das eher nicht. Ich habe schon viel zu viel gecheckt. Manchmal sollte man nicht alles lesen, was einem unterkommt. Keine Mails und vor allem keine fremden Briefe.«
Abrupt stand er auf und ging zur Anrichte mit der Kaffeemaschine, sodass ich nur noch seinen Rücken sehen konnte. Einen Augenblick blieb er mit gesenktem Kopf stehen, dann nahm er die Kanne und schüttete Kaffee in seinen Becher. Als er sich umdrehte, war das Lächeln auf sein Gesicht zurückgekehrt.
»Eigentlich bin ich wegen eines Füllers hier. Ein Füller … sagen wir es mal so: der eine ganz besondere Geschichte hat.« Vinzent setzte sich wieder zu mir und beugte sich vor, als würde er mir ein Geheimnis anvertrauen. »Wusstest du, dass es Füller gibt, die so viel wert sind, dass man davon locker ein paar Jahre leben könnte? Schon einmal etwas vom ›Fulgor Nocturnus‹ gehört?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Nicht? Der ist ein paar Millionen Dollar wert. Also wirklich. Dabei wohnst du in der ehemaligen europäischen Hochburg der Füllerproduktion.«
Tat ich das? Es war das Erste, was ich davon hörte.
»Ist dein besonderer Füller auch so ein wertvoller?«
Statt darauf zu antworten, stützte Vinzent die Ellbogen auf und legte den Kopf in die Hände.
»Also, um die Wahrheit zu verraten: Ich bin nach Heidelberg gekommen, weil ich gehört habe, dass es hier eine Pension gibt, in der eine wunderschöne Prinzessin lebt, die auf der Terrasse in einem hundertjährigen Schlaf liegt. Und von nah und fern kommen alle Prinzen und würden sie gern wach küssen. Aber nur bei einem öffnet sich auf geheimnisvolle Weise die Haustür. Und mit dem sollte sie unbedingt ausgehen.«
Ein bisschen viel Flirterei dafür, dass wir uns gerade erst kannten. Und ziemlich kitschig. Aber nett und so ganz anders als Hugos finstere Miene. So verdammt nett, dass ich lachen musste und das beklemmende Gefühl, Flo könnte in der Ecke stehen, endgültig verflog.
»Eigentlich könnte ich auch noch länger bleiben. Wenn ich diese Angelegenheit morgen früh erledigt habe, bin ich frei«, sagte Vinzent. »Du könntest mir die Stadt zeigen.«
Ausgerechnet ich. Außer der Fußgängerzone kannte ich so gut wie nichts von Heidelberg. Aber als Prinzessin konnte man sich schließlich kleine Bildungslücken erlauben.
»Klar, mache ich gern.«
Wir kamen ins Plaudern. Redeten über Belangloses, über die grünen Papageien, die in den Bäumen am Heidelberger Bahnhof herumflatterten, über den Zuckerladen in der Plöck, den er auf seinem Weg entdeckt hatte, scherzten, lachten und landeten schließlich bei Neuseeland und meinem Traum, dorthin auszuwandern und ein Café mit Kirschkuchen und Apfelstreusel aufzumachen. Wie im Flug war fast eine Stunde vergangen, und ich hatte keine Sekunde mehr an Flo oder schiefe Wände im Treppenhaus gedacht. Vinzent war witzig und charmant, bekam beim Lachen Falten in den Augenwinkeln und sah mich an, als wäre ich der Schmetterling mit Goldstaub auf den Flügeln.
Irgendwann war ein Klingeln zu hören, als hätte Vinzent eins von diesen alten schwarzen Bakelit-Telefonen in seiner Hosentasche. Er zog ein Handy hervor, schaute kurz auf das Display und stand auf.
»Kleinen Moment«, sagte er und ging vor die Küchentür.
Natürlich hörte ich mit, ich konnte mir schlecht die Ohren zuhalten.
»… ich bleibe dabei … Nein, ich komme zu euch in die Mühltalstraße, wie wir es vereinbart hatten … Also gut, wenn es sein muss. Aber versprich dir nicht zu viel davon …«
»Sorry«, sagte er, als er wieder hereinkam. »War wichtig. Es könnte sein, dass gleich noch jemand kurz vorbeikommt. Wäre das okay?«
»Sicher, kein Problem. Wir sind eine Pension und kein Gefängnis.«
»Dann gehe ich jetzt mal auf mein Zimmer, wenn du allein klarkommst.«
»Mir geht es wieder gut, keine Sorge«, versicherte ich. »Du musst einmal die Treppe hoch. Die Fünf ist die vorletzte Tür auf der linken Seite.«
Als er an der Türschwelle war, drehte Vinzent sich noch einmal um.
»Also dann, bis spätestens morgen. Wenn ich zurück bin, komme ich mit meinem Schimmel vorbeigeritten.«
»Prima, dann werde ich mal so lange mein goldenes Pantöffelchen suchen.«
Er verbeugte sich, machte eine Handbewegung, als zöge er einen Federhut vom Kopf, und verschwand.
Ich spülte die Becher und wischte über den Tisch, bis der letzte Zuckerkrümel verschwunden war. Eigentlich hätte ich auch noch auf die Dachterrasse hochklettern und die Scherben wegkehren müssen. Was Sauberkeit und Ordnung anging, war Hugo ein Pedant. Aber schließlich war er nicht da, also konnte das bis morgen warten.
Auf dem Weg zu meiner Dachkammer merkte ich, dass meine Beine mir immer noch nicht ganz gehorchten. Froh, die Treppe heil geschafft zu haben, legte ich mich auf das Bett. Von hier aus konnte ich durch das Dachfenster in den Himmel sehen. Inzwischen war es dunkel geworden. Ich liebte diesen Blick, mal in die Sterne, mal in die Wolken oder einfach nur in das Schwarzgrau der Nacht.
Vinzent war wirklich nett. Das erste Mal seit langer Zeit, dass mir ein Mann gefiel. In gewisser Weise ähnelte er meinem Ex, Jens. Nicht vom Äußeren, aber von der Art her. Offen, flirtig und mit ein paar Geheimnissen im Gepäck. Bei Jens war das Geheimnis meine beste Freundin Sarah gewesen, mit der er mich betrogen hatte. Inzwischen war Sarah schwanger, und die beiden wohnten zusammen, Jens hatte es mir geschrieben. Seinen Brief hatte ich in kleine Fetzen gerissen und die Toilette hinuntergespült.
Der Dunst von Anis und Alkohol stieg mir in die Nase. Ich schnupperte an meinem T-Shirt, anscheinend hatte es einiges vom Absinth abbekommen. Also suchte ich nach einem wohlriechenden Prinzessinnen-T-Shirt und stand gerade halb nackt vor meinem Schrank, als es unten an der Haustür klingelte. Bevor ich etwas überziehen konnte, hörte ich Vinzent schon rufen: »Ich mache auf, das ist bestimmt für mich.«
Kurz darauf ächzte die Treppe. Stimmengemurmel drang zu mir, dann wurde im Stockwerk unter mir die Zimmertür zugezogen. Zwei, drei Minuten war es leise, doch dann wurde das, was eben noch Gemurmel gewesen war, lauter und lauter. Bald konnte ich einzelne Stimmen unterscheiden. Eine Männerstimme, die aufgeregte helle Stimme einer Frau.
Ich steckte den Kopf zur Zimmertür hinaus. Da ich zurzeit die Hausherrin war, sollte ich besser wissen, was da vor sich ging. Leider verstand ich immer noch nicht alles. Also schlich ich hinunter bis zur Fünf. Hinter der Tür schnaufte und stöhnte es. Was war denn jetzt los? Versöhnungssex?
»Nicht!« Die Stimme der Frau klang schrill. »Hör auf! Hör sofort auf!«
Nein, das klang nicht nach Lust, eher nach Panik.
»Schluss jetzt!«, rief die Frauenstimme.
Ich klopfte, aber das schien niemand zu hören. Drinnen ging das Geächze und Gestöhne weiter. Ein Gerumpel. Danach Stille. Hinter der Tür rührte sich nichts mehr.
»Hallo? Brauchen Sie Hilfe?«
Ich wartete nicht auf eine Antwort, sondern drückte die Klinke hinunter und öffnete die Tür einen Spalt weit. Eine Frau in einem grünen Mantel kniete neben dem Bett. Als sie bemerkte, dass die Tür aufging, drehte sie sich um. Kurze dunkle Haare umrahmten das blasse Gesicht. In ihrem Blick lag ein Entsetzen, als hätte sie in die Hölle gesehen.
»Was ist denn los?«, fragte ich. »Kann ich Ihnen …«
Erst da sah ich Vinzent. Er lag vor dem Bett, lang gestreckt wie eine hölzerne Puppe, die nach hinten gekippt war, die Arme gerade neben dem Körper. Sein Kopf war zum Bett hin gedreht, sodass ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Als ich näher kam, erhob die Frau sich und ging zur Seite.
Ich beugte mich hinab. »Vinzent!«
Doch Vinzent regte sich nicht.
»Was ist denn mit ihm?«, fragte ich die Unbekannte.
Aber die Frau wich nur stumm weiter von mir.
Vinzent sah seltsam aus. Wächsern bleich wie ein Toter. Ich streckte meine Hand aus und berührte ihn an der Schulter.
»Vinzent, sag was!«
Der Schlag traf meinen Hinterkopf mit voller Wucht. Im Fallen versuchte ich noch, mich an der Bettkante abzustützen, aber ich konnte mich nicht mehr halten und sackte über Vinzents Körper zusammen. Ich wollte den Kopf drehen, doch er war schwer wie eine Eisenkugel. Unfähig, mich zu bewegen, sah ich nur noch die Beine der Frau, die herangetreten war und direkt vor mir stand. Weinrote Schuhe mit großen silbernen Schnallen, die ihre Konturen verloren, anfingen, sich aufzulösen, und zu einem einzigen Farbklecks verschmolzen. Dann tauchte ich ein in die Dunkelheit.
3
Verzweifelt versuchte ich, mich an die Oberfläche zu kämpfen. Für einen kurzen Moment gelang es mir, die Augen zu öffnen. Über mir schimmerte etwas Helles, ein Ballon mit einem dicken dunklen Strich quer darauf. Dann versank ich wieder im Nichts. Ein paar Minuten, eine halbe Ewigkeit. So lange, bis sich die Dunkelheit zurückzog wie das Wasser, das dem Mond folgt.
Das Erste, was ich sah, waren Stäbe. Gedrechselte Stäbe aus dunklem Holz. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, dass es das Treppengeländer war, auf das ich schaute. Ich drehte den Kopf, Licht fiel seitlich von einem hellen Dreieck auf mich herab. Es war eine der Wandleuchten, daneben eine Zimmertür nach der anderen mit messingfarbenen Metallziffern darauf. Als Erstes die Nummer fünf mit geschlossener Tür. Anscheinend lag ich auf dem Flur nahe der Treppe, die hoch zu meiner Dachkammer führte. Ich richtete mich auf und musste gleich wieder die Augen schließen. Ein riesiger Ballon schien von innen gegen meine Schädeldecke zu stoßen.
Wieso lag ich auf dem Flur? Ich war doch in das Zimmer hineingegangen. Weinrote Schuhe. Eine Frau im grünen Mantel. Vinzent auf dem Boden. Waren die beiden noch da drin?
Ich lauschte, aber das Einzige, was ich hörte, war das Ticken der Uhr, die unten im Flur hing. Ich musste zurück in die Fünf, sehen, was mit Vinzent geschehen war. Als ich versuchte aufzustehen, wurde der Druck in meinem Kopf so unerträglich, dass ich wieder auf den Boden zurücksank. Eine Weile saß ich da, die Augen geschlossen. Das war alles nur ein böser Traum, mehr nicht. Gleich würde ich aufwachen.
Aber ich wachte nicht auf. Stattdessen spürte ich unter mir das harte Holz der Dielen und konnte den Duft der Lavendelsäckchen riechen, die Hugo in die Kleiderschränke gehängt hatte. Die Uhr tickte und tickte, als wollte sie sagen: Steh endlich auf! Da liegt ein Mann im Zimmer, der deine Hilfe braucht! Und gleichzeitig kroch die Angst in mir hoch. Vinzent hatte so seltsam reglos dagelegen. Was war da drinnen geschehen?
Schließlich robbte ich auf allen vieren bis vor die Tür der Fünf. Noch einmal lauschte ich, hielt den Atem an, um besser hören zu können. Hinter der Tür war es absolut still. Anscheinend war die Frau weg. Hatte mich niedergeschlagen und war geflohen. Ich griff hoch zur Klinke, zog sie hinunter und stieß die Tür auf.
»Vinzent!«, rief ich.
Ich kroch über die Schwelle, zog mich am Bettgestell nach oben, bis ich schwankend auf meinen Beinen stand. Das Zimmer war leer! Das Bett schien völlig unberührt zu sein. Kein Rucksack, keine Jacke, nichts, was Vinzent bei sich gehabt hatte, war zu sehen.
Der Raum war so, wie ich ihn heute Morgen nach dem Saubermachen verlassen hatte. Die Handtücher hingen ordentlich gefaltet am Waschbecken, der Läufer lag akkurat vor dem Bett. Der Stuhl war an den kleinen Schreibtisch gerückt. Ich wankte zum Schrank und riss die Tür auf. Klappernd stießen die leeren Kleiderbügel aneinander. Das konnte nicht sein! Ich hatte Vinzent hier gesehen. Auf dem Boden vor dem Bett. Die Frau war klein und schmal, nie im Leben hätte sie den Körper eines Mannes einfach so wegtragen können.
Sie musste ihn irgendwo versteckt haben. Ich kniete mich vor das Bett und beugte mich hinab, es brachte meinen Kopf fast zum Platzen. Außer ein paar Staubflocken konnte ich nichts entdecken. Vielleicht hatte ich mich einfach im Zimmer geirrt?
Im Schneckentempo arbeitete ich mich durch das Haus, begegnete in der Drei Perkeo, dem versoffenen Zwerg vom Heidelberger Schloss, der an der Wand hing und sich eine Prise Schnupftabak in die Nase rieb. Ich suchte jeden Raum ab, sah in jeden Schrank, unter jedes Bett, in jeden Winkel, bis ich unten in der Küche angekommen und mir sicher war: Außer mir und einem Marienkäfer, der auf der Küchenlampe krabbelte, war niemand im Haus.
Erschöpft schleppte ich mich wieder nach oben. Bei jeder Stufe pochte es in meinem lädierten Kopf. Ich zwang mich hoch bis auf die Dachterrasse. Von der Gasse schien so viel Licht herauf, dass ich trotz der Dunkelheit schemenhaft erkennen konnte, was hier herumlag. Ich suchte nach der Absinthflasche. Als ich sie hochhielt und schüttelte, war nichts zu hören. Die Flasche war leer. Bestimmt war das meiste herausgelaufen, als sie runtergefallen war. Aber wie viel hatte ich vorher davon getrunken? Etwa so viel, dass ich betrunken die Treppe hinuntergefallen war und alles sich nur in meinem Kopf abgespielt hatte? Handtellergroße Schmetterlinge mit goldenen Flügeln. Flo im Bademantel auf der Treppe. Beides konnte nicht real gewesen sein. Und Vinzent? Hatte ich mir meinen Traumprinzen nur zusammenphantasiert – eine Folge des nächtelangen Netflix-Konsums von Lovestorys?
Ich lehnte mich an die Brüstung und atmete ein paarmal tief durch, in der Hoffnung, die frische Luft würde mir helfen, all das zu verstehen. Wenn ich die Polizei rief und erzählte, dass ein attraktiver Mann, der mich morgen mit dem Schimmel abholen wollte, verschwunden war, genauso wie meine Tante, die sich aufgelöst hatte – landete ich dann in der Psychiatrie?
Hugo würde kein Wort mehr mit mir reden, wenn die Polizei ins Haus kam, nur um festzustellen, dass es nichts festzustellen gab. Außer den wahrscheinlich hundert Brandschutzbestimmungen, gegen die wir verstießen. Das Denkmalamt hatte keine Ahnung von einer Dachterrasse, und für das Finanzamt war die Pension seit Längerem geschlossen. Hugo zahlte Rosel eine Art Leibrente und meinte, das würde er nicht schaffen: Steuern zahlen, mir ein Gehalt und die monatliche Rate an Rosel. Er beruhigte sein Gewissen damit, dass Ikea und Apple schließlich auch kaum Steuern zahlten.
Wenn ich den Grund dafür lieferte, dass er aufflog, würde Hugo mich umbringen. Oder noch schlimmer: Er würde mich rauswerfen. Und sosehr ich Ülske und meine Freunde dort vermisste, zurück wollte ich nicht. In Ülske gab es nämlich nicht nur keinen Bäcker, keine Bank und keinen Arzt mehr, es gab vor allem keine Arbeit für mich. Meine Zukunftsperspektive in Ülske beschränkte sich darauf, vor dem Fernseher auf Flos Sofa zu verenden.
Ich stieg zurück ins Haus, ließ im Bad eiskaltes Wasser in meine hohlen Hände laufen und tauchte mein Gesicht hinein. Als ich in den Spiegel schaute, sah mich eine Frau mit langen wirren Haaren und einem seltsamen Flackern in den Augen an. Es war das gleiche Flackern, das ich manchmal bei Flo gesehen hatte, wenn sie besonders durch den Wind war. Meine verrückte Tante und ich, wir teilten bestimmt eine Menge Gene. Auch die, die einen Menschen aus der Wirklichkeit fallen ließen? Zum ersten Mal in meinem Leben machte mir die Frau, die ich da im Spiegel sah, Angst.
Ich musste wissen, was geschehen war und was nicht, sonst würde ich mir selbst nicht mehr über den Weg trauen. Ich brauchte Hilfe, und zwar von jemandem, der die Lage neutral einschätzen konnte und die Möglichkeit hatte, die Wahrheit herauszufinden.
Es gab vielleicht noch andere Wege, als gleich die Polizei einzuschalten. Inoffizielle. Schließlich kannte ich hier jemanden bei der Kripo, der mir einen Gefallen schuldete: Hauptkommissarin Maria Mooser. Bei meiner Ankunft in Heidelberg war ich in eine unglückliche Geschichte verwickelt worden, die damit geendet hatte, dass ich mit einer Waffe am Kopf im Wald gelandet war. Die Hälfte der Schwierigkeiten hatte mir damals Frau Mooser eingebrockt. Wir hatten noch eine Rechnung offen. Frau Mooser musste mir helfen. Inoffiziell.
Den Rest der Nacht kämpfte ich mit der Angst, einzuschlafen und im nächsten Alptraum aufzuwachen. Ich trank kannenweise Kaffee, horchte auf die Geräusche im Haus, auf das Surren des Kühlschranks, auf das Klappern des Briefkastens, als frühmorgens die Zeitung hineingesteckt wurde. Um acht Uhr rief ich bei der Kripo an.
Frau Mooser hatte damals davon gesprochen, in Rente zu gehen, ich wusste also nicht, ob sie überhaupt noch dort arbeitete. Doch der freundliche Herr Pöltz, ein Mitarbeiter von ihr, der sich noch gut an mich erinnern konnte, klärte mich auf.
»Nein, sie ist nicht berentet. Hier ist sie allerdings auch nicht. Sie hat sich für einige Monate beurlauben lassen.«
Ihre private Telefonnummer wollte er leider nicht herausgeben.
»Ich muss sie wirklich dringend sprechen«, beteuerte ich. »Sehr, sehr dringend.«
»Das mit so einer Beurlaubung sollte man besser lassen.« Herr Pöltz seufzte. »Da ist man nicht ganz raus, aber auch nicht richtig drin. Das bekommt nicht jedem.«
»Ich brauche nur einen Rat. Ich werde Frau Mooser bestimmt nicht lange belästigen.«
»Es soll heute wieder sehr schön werden«, sagte Herr Pöltz unvermittelt. »Manche Menschen, die nicht arbeiten müssen, gehen bei so einem Wetter morgens irgendwo Zeitung lesen und einen Kaffee trinken. In Heidelberg haben wir da natürlich reichlich Auswahl. Wenn man in der Weststadt wohnt, könnte man zum Beispiel ins ›Krokodil‹ gehen. Man sitzt dort ganz nett, muss ich sagen.«
»Ach, wirklich? Meinen Sie, ich sollte da mal hingehen?«
»Tun Sie das, Frau Böckle. Die heimische Gastronomie sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Zumal es dort Krokodile gibt. Ziemlich große sogar.«
Na also. Herrn Pöltz hatte ich damals schon gern gemocht. Er war einfach ein guter Mensch.
»Danke, Herr Pöltz.«
»Machen Sie’s gut, Frau Böckle«, sagte Herr Pöltz, und leise fügte er hinzu: »Gestern hat sie sieben Mal angerufen.«
Ich hatte keine Ahnung, wo das »Krokodil« war, aber das Internet wusste es und auch, dass man dort um zehn Uhr öffnete. Eine halbe Stunde vorher machte ich mich auf den Weg.
Die Stadt schien gerade erst aufzuwachen, wie eine Katze, die am Ofen geschlafen hatte und sich rekelte und streckte. Die kleinen Verkaufsstände in den Nischen der Heiliggeistkirche hatten die rot-braunen Läden noch geschlossen. Später würde es hier wieder Fähnchen, Socken und Hampelmänner zu kaufen geben, alles, wovon die Verkäufer glaubten, es würde das Herz der Touristen erfreuen. Nur noch die Brezeln, die in den roten Sandstein der Kirchenwände gemeißelt waren, erinnerten daran, dass hier früher einmal Bäcker und Händler Waren verkauft hatten, die Menschen zum Leben brauchten.
Die frühe Uhrzeit ersparte es mir, mich in der Fußgängerzone durch Touristenströme zu kämpfen. Es war gleichzeitig die »Hauptstraße« Heidelbergs und der Teil der Stadt, den ich am besten kannte. Wenn ich in der Pension nichts zu tun gehabt hatte, war ich hier langgeschlendert, hatte mich in Cafés mit regionalen Besonderheiten wie Granatsplittern und Helmut-Kohl-Torte vertraut gemacht, die Fassade bewundert, auf der ein Gnom mit der Axt Kümmel spaltet, oder den Bären, der in luftiger Höhe unermüdlich Seifenblasen in die Luft pustet.
Heute kam mir die Welt um mich herum vor lauter Müdigkeit seltsam gedämpft vor, als hätte sie sich hinter einer dicken Glaswand verschanzt. Am Bismarckplatz, von dem aus Busse und Bahnen in alle Himmelsrichtungen fuhren, hupte ein Fahrer wütend, weil ich ihm in die Spur lief. Bis ich in der Weststadt ankam, war ich dreimal beinahe überfahren worden. Wenn ich abergläubig gewesen wäre, hätte ich es als Warnung verstanden, aber selbst dafür war ich zu müde.
Schließlich stand ich vor dem Gebäude, das ein grüner Schriftzug über dem Eingang als das »Krokodil« auswies. Es lag nah einer Kirche an einer Straßenecke, gleich gegenüber einem Laden, dessen klangvoller Name »WortReich« keinen Zweifel daran ließ, dass dort Bücher verkauft wurden. Tische und Stühle standen auf dem Gehweg längs des Gebäudes. Noch saß niemand dort, und als ich in das Lokal hineinschaute, sah ich zwar einen imposanten Kachelofen, aber keine Kommissarin. Ich spähte die schmalen Straßen hinunter, die sich hier kreuzten. Weit und breit war keine Frau Mooser in Sicht. Also beschloss ich, mich in einen Hauseingang gegenüber zu setzen, von dem aus ich möglichst viele der Sitzplätze im Blick hatte.