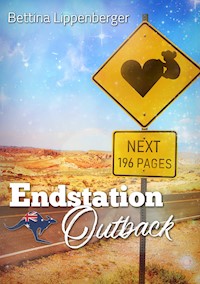
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Traumschwingen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sally kehrt ihrem bisherigen Leben den Rücken. Seit dem Tod ihrer Eltern ist sie rastlos und nirgends zuhause. Nun hofft sie, auf der Farm ihres Onkel ein geborgenes Heim zu finden. Als sie mit dem Zug in Richtung ihres neuen Lebens fährt, ahnt sie noch nicht, welch Schicksal das australische Outback für sie bereit hält…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Title Page
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Impressum
Bettina Lippenberger
Endstation
Outback
Australien-Roman
Für meine Mami,
eine unglaublich starke Frau.
Kapitel 1
Um drei Uhr nachmittags bestieg ich den Zug nach Perth. Natürlich hätte ich auch mit dem Auto oder Bus fahren können, doch diese Reise sollte mich meinem alten und zugleich neuen Zuhause auf ganz besondere Weise näherbringen. Viel zu lang war ich fern von den Menschen, die mich aufgenommen hatten, als mir nichts geblieben war. Dem Ort, an dem ich mich geborgen, ja heimisch fühlte.
Mit glänzenden Augen betrachtete ich voller Vorfreude die Natur, die draußen am Fenster vorüberzog. Wie sehr genoss ich es, den australischen Himmel in seinen schönsten Farben zu bewundern. Das Spinifexgras beim Wiegen im Wind zu beobachten, und das eine oder andere Känguru. Für meinen Geschmack wurde es leider viel zu schnell dunkel. Was hier draußen im Outback nichts Ungewöhnliches war. Ein Emu rannte aufgeschreckt neben dem Zug her, bevor ihn die Dunkelheit gänzlich verschluckte. Ich wandte mich erschöpft ab. Mir steckten noch die schlaflosen Nächte in den Knochen. Das Ausräumen der Wohnung und die Suche nach einem Nachmieter hatten sich schwieriger gestaltet, als gedacht. Wer wollte schon im Mief von Imbissen leben. Aber zwei Studenten nahmen das nicht so genau. Dem Besitzer war es recht und ich war erleichtert. Ich seufzte leise. Sydney hatte ich für lange Zeit den Rücken gekehrt. Wenn nicht sogar für immer. Meine Lider wurden schwerer. Lange konnte und wollte ich mich auch gar nicht mehr gegen den mehr als willkommenen Schlaf wehren.
Ich legte meinen Mantel über mich und schlief nach wenigen Momenten zufrieden ein.
Am nächsten Morgen, die Sonne war gerade über dem Horizont aufgetaucht, hielten wir in Broken Hill.
Nachdem ich geduscht und ein kleines Frühstück eingenommen hatte, lief ich durch den Zug. Das dauernde Sitzen hielt auch mein junger Körper nicht tagelang durch. In dem nächsten Wagon voller gemütlicher Sitzecken und Sesseln saß eine nette ältere Dame. Einige Postkarten lagen vor ihr. Ich vermutete, für die Lieben daheim. Sie schien sichtlich Probleme damit zu haben, denn sie grübelte. Der Kugelschreiber wippte währenddessen in ihrer Hand auf und ab. Vielleicht versuchte sie, nicht diesen immer wiederkehrenden Blödsinn auf die Karten zu schreiben, wovon sie wohl auch schon eine Menge bekommen hatte. Aber das kannte man ja: Essen gut, Wetter spitze, Hotel ist großartig. Manche ließen sich dann noch herab und schrieben, was man gerade so tat: Wir sind gerade am Pool oder liegen am Strand.
Aber mal ehrlich, mehr Platz gab eine Postkarte auch nicht her, außer man hatte eine Bonsaischrift. Neben ihr lag eine Zeitschrift, in der sie wohl kurz vorher noch gelesen hatte, einige kleine Zettel ragten daraus hervor. Wahrscheinlich handelte es sich um interessante Artikel oder Reisetipps hier in Down Under.
Ein Wombat zierte das Titelbild. Er stapfte tollpatschig durchs grüne Gras. Ich mochte das Tier sehr. Neben Koalas, Kängurus und Kukaburra. Weil ich kurz innegehalten hatte, lächelte mich die ältere Dame an. »Wollen sie sich nicht zu mir setzen, Kindchen?«
»Nur zu gerne.«
»Mein Name ist Margaret Walter«, stellte sie sich vor.
»Ich heiße Sally Mayfield.«
»Was verschlägt sie in diese Ödnis, meine Liebe?«, begierig wartete sie auf meine Antwort.
»Ich bin hier zu Hause.«
»Wirklich? Oh, das tut mir leid.«
»Warum? Ich bin froh, endlich wieder auf der Farm meines Onkels leben zu können.«
»Dann ist es gut. Jeder sollte seinen Platz im Leben finden. Ich dachte, weil sie so jung sind, ist es sicher nicht leicht, hier zu leben.« »Wo geht ihre Reise hin?«, fragte ich sie im Gegenzug. »Mein Ziel ist Perth. Ich hörte von den schönen Galerien und Museen dort. Schon seit meiner Jugend liebe ich die Maler des Impressionismus. Vor allem Edgar Degas und Claude Monet. Viele Orte haben mein Mann und ich gemeinsam besucht. Als er starb, habe ich mein Elternhaus verkauft. Unsere zwei Kinder sind erwachsen und so entschloss ich mich, auf eine letzte große Reise zu gehen.«
»Es wird sicher nicht ihre Letzte sein«, entgegnete ich.
»Das ist lieb von ihnen. Aber langsam macht sich das Alter doch bemerkbar.«
»Welches Alter? Sie sind doch noch nicht alt. Außerdem wüsste ich nicht, ob ich so ganz allein in der Weltgeschichte herumreisen würde, egal in welchem Alter«, gab ich offen zu.
»In der ersten Zeit ist es gewöhnungsbedürftig. Mit niemandem kann man die Eindrücke teilen.« Ihre Hand ruhte nun auf einem schwarzen Notizbuch. »In diesem Buch halte ich alles fest. Vielleicht werden meine Kinder, später darin lesen.«
Margaret verstummte. Ihr Blick wanderte weit weg, als ich mich räusperte. Mein Hals fühlte sich wie die Wüste Gobi an, total trocken. »Darf ich ihnen vielleicht etwas zu trinken holen?«
»Das ist sehr lieb Kindchen. Einen Earl Grey Tee bitte, wenn es ihnen keine Umstände macht.«
»Natürlich nicht.«
Den Tee in der einen und eine Flasche Wasser in der anderen Hand kehrte ich zurück. Wir unterhielten uns noch lange, tauschten Adressen aus und als sie mich später verließ, um sich auszuruhen, ging ich zu meinem Platz zurück.
Während unseres Gesprächs war der Zug wieder angefahren. Ratternd glitt er über die Schienen. In knapp sechs Stunden würden wir Adelaide erreichen. Die Sonne hatte an Kraft gewonnen. Gleißendes Sonnenlicht verfing sich nun in der silbernen Außenhaut der Wagons hinter uns. Nur in Kurven konnte man das Schauspiel betrachten. Wunderschön und so friedlich, wie ich fand. Die anderen Passagiere im Zug achteten komischerweise nur wenig auf die Landschaft. Ich wunderte mich, denn wie oft machte man eine solche Reise? Es konnte aber sein, dass sie auch nach längerem Hinausstarren nichts Aufregendes entdeckt hatten. Die Jüngeren ließen sich sicher vom Fernsehprogramm berieseln, denn es war ziemlich ruhig im Wagen. Keine Streitereien, kein Herumrennen in den Gängen. Gegenüber spielte ein älteres Paar Karten und diskutierte gerade über die richtige Strategie. Lust zu lesen hatte ich nicht. Aber etwas von meiner Lieblingsmusik, gepaart mit dem Blick nach draußen, machte das Reisen sehr angenehm. Mein Mobiltelefon hatte ich schon vor der Reise ausgemacht. Hier draußen war der Empfang mehr als dürftig, auf der Farm meines Onkels fast unmöglich. Außerdem war ich glücklich ein paar ungestörte Stunden, ohne den Trubel und Tratsch der Außenwelt verbringen zu können. Das Leben in der Stadt war purer Lärm. Wie oft hatte ich mir diese Ruhe herbeigesehnt.
Der Halt in Adelaide rückte langsam näher. Die Aufregung der Passagiere steigerte sich, bis sie fast zum Greifen war. Sechs Stunden Aufenthalt und tolle Ausflüge warteten auf sie. Für mich allerdings war das viel zu teuer. Mir graute davor ganz allein, hier im Zug, sechs Stunden auszuharren, während mich draußen der Sonnenschein lockte und die frische Luft. Der Gedanke, was ich die ganze Zeit tun sollte, beschäftigte mich sehr. Adelaide war wirklich schön, der Elder Park ein Traum. Ich hatte ihn schon früher besucht. Dorthin zog es mich. Der Park befand sich nicht unweit vom Bahnhof. Auf dem Fluss, der sich durch den Elder Park zog, tummelten sich Pelikane, schwarze Schwäne und Enten. Es war wirklich schön. Ich bewunderte den Pavillon mit seinen Schnörkeln und Farben. Das Gold glänzte in der Sonne, blau und grün sahen aus wie frisch aufgemalt. Eine Augenweide. Im Schatten der Rotunde unterhielten sich Menschen, auf den Stufen sitzend. Wie gut konnte ich mir vorstellen, dass manche Abendveranstaltung hier stattfand. Ein Mann packte gerade ein Saxophon aus, und spielte kurz darauf mit einer Hingabe, die seinesgleichen suchte. Jazz mochte ich schon immer und erkannte das Stück Footprints.
Dem Weg folgend, spazierte ich in den hinteren Teil, wo ich mich auf einer Bank niederließ. Einige Besucher hatten sich ein Tretboot ausgeliehen und drehten auf dem Wasser ihre Runden. Lachen drang an mein Ohr. Zwei der Boote lieferten sich ein erbittertes Rennen. Ich öffnete meinen Rucksack, zog Skizzenblock, Stifte und Wasserflasche heraus. Ein Motiv auszuwählen war leicht.
Mit leichten Strichen zeichnete ich erst die Umrisse der Szene, dann das Ufer, die herrliche Wasserfontäne im Hintergrund und noch ein paar der Wasservögel. Ein Tretboot durfte auch nicht fehlen. Die Hitze des Tages erreichte schnell ihren Höhepunkt. Mein Glück, das ein Baum nun Schatten auf die Bank und mich warf. Nachdem ich ein paar Sandwiches gegessen hatte, skizzierte ich noch eine kleine Szene, im Mittelpunkt ein Eukalyptusbaum, darunter eine Picknickgesellschaft. Ein Hund sprang um die Familie herum. Der Kleinste rannte ihm hinterher und plumpste immer wieder hin. Anstatt zu weinen, lachte er haltlos, denn der Hund kam zurück, um zu schauen, ob alles in Ordnung war. Gerade schleckte er ihm das Gesicht ab. Ich musste einfach mitlachen, wie schön war es doch, Kind zu sein. Mein Lachen wich schon bald Traurigkeit. War doch meine frühe Kindheit auch so wunderbar gewesen. Mit diesem Gefühl des Verlustes sah ich ihnen noch eine Weile zu. Dann wurde es für mich Zeit, zusammenzupacken. Den Strohhut behielt ich auf, das schützte wenigstens etwas meinen Nacken und das Gesicht. Ich tauchte mein Halstuch ins Wasser und befeuchtete damit meine Handgelenke. Ein letztes Mal ließ ich den Blick schweifen. Diese Stunden hatten mir so viel mehr gegeben, als zwei Skizzen. Die Eindrücke, die Ruhe und auch die Erinnerung. All das würde ich mit mir nehmen. Ich machte noch einen kurzen Abstecher in einen nahegelegenen Supermarkt. Mir war nach neuem Lesestoff und ein paar Keksen. Die Zeitschriften würden mich sicher bis zum nächsten Tag gut beschäftigen. Kreuzworträtsel und ein paar Rezepte, die ich aufmerksam studieren konnte.
Am Bahnhof angekommen sah ich, dass Mitreisende sich in die Wartehäuschen zurückgezogen hatten. Sie unterhielten sich angeregt über das gemeinsam Erlebte. Manche schritten auch einfach auf und ab. Ich stieg ein. Hoffentlich hatte Joe meine Nachricht erhalten. Ansonsten müsste ich mir was ausdenken. Die Farm lag ja nicht gerade zentral, sondern weit draußen.
Während ich gedankenverloren durch den Zug lief, die neugierigen Blicke der anderen ignorierend, fragte ich mich zum wiederholten Mal, ob es richtig war, was ich hier tat. Auch wenn ich selbst davon überzeugt war, nagten die Fragen der anderen doch an mir. Überstürzt, zum Erstaunen aller, hatte ich alles hinter mir gelassen. Freunde, Arbeit und die kleine Wohnung, deren Miete ich mir jeden Monat aufs Neue gerade noch so leisten konnte. Für mich war es pures Glück, dass mir zu diesem Zeitpunkt mein Onkel schrieb. Schon lange war ich unglücklich mit der Situation. Indes beschränkte sich mein Freundeskreis auf zwei ganz liebe, aber etwas durchgeknallte Mitkolleginnen. Die Arbeit war knochentrocken und an manchen Tagen träumte ich auch noch nachts von Zahlen und Bilanzen. In der Wohnung roch es immer öfter nach den fettgeschwängerten Gerüchen der Schnellimbisse unter den Fenstern. Mal dominierte das Asiatische, dann wieder kroch der Pommes- und Burger-Duft durch die Ritzen der zugigen Fenster.
Ich kehrte gedankenversunken zu meinem Platz zurück. Von irgendwo drang ein erfrischender Wind ins Abteil. Ich schloss kurz die Augen.
Bald, auf der Nullarbor Plain, die wir durchquerten, strebten die Schienen, hier mitten im Niemandsland, dem Horizont entgegen.
Die Aussicht, täglich frische Luft zu atmen, die Freiheit auf der Farm meines Onkels zu erleben, zogen mich nach dem Lesen der Zeilen des Briefes immer mehr in ihren Bann. Er hatte keine eigenen Kinder, wirtschaftete mehr schlecht als recht herum, und brauchte nun wohl meine Fähigkeiten und eine weitere helfende Hand. Ich seufzte erneut. Die Schafherden auf der Weide wuchsen, wie ich wusste, um diese Jahreszeiten enorm. Wenn nicht Räuber auf vier Tatzen etwas dagegen taten.
Zäune waren auszubessern, neue Brunnen zu graben und Windräder zur Förderung des Wassers aufzustellen.
Meine Großeltern hatte ich leider nie kennengelernt. Sie starben kurz nacheinander. Meine Mutter und ihr Bruder waren fern von der Stadt, auf jener Farm, aufgewachsen. Als ihre Eltern starben, war es Joe, der auf der Farm blieb. Meine Mutter ging nach Perth. Zweimal im Jahr kehrte sie zurück. Erst allein, dann mit meinem Vater, nach meiner Geburt dann auch mit mir. Zu dritt besuchten wir Joe regelmäßig. Vor allem in den Ferien. Die wunderbare malerische Landschaft war die pure Erholung. Herrliche Tage waren das. Ein Bild, das auf meinem Nachttisch einen festen Platz hatte, erinnerte mich daran. Wir standen vor der Scheune. Papa hinter Mama und ich, keine zwölf Jahre, kniete in kurzen Hosen und T-Shirt, neben dem Hofhund, der seine Schnauze in die Luft hob, als ob er etwas gewittert hätte.
Es war das letzte Bild, das von unserer glücklichen Familie aufgenommen wurde. Denn nur zwei Tage später kam, was keiner kommen sah. Niemand ahnte was von dem schrecklichen Verlust, der uns ereilen sollte.
Meine Mutter und Joe streiften oft durch die Wildnis. Im kindlichen Entdeckerdrang, den nicht einmal die Warnungen der Eltern schmälern konnten. Sie kannten sich besser aus, als die Erwachsenen. Wege die uns, meinem Vater und mir, verborgen blieben, kannten sie seit Kindertagen. Weshalb meine Mutter, wahrscheinlich aus reiner Sentimentalität, einige Stunden allein im Busch verbrachte. Das tat sie bei jedem unserer Aufenthalte. Sie hatte von den Einheimischen viel gelernt, hatte in Kinder- und Jugendjahren mit ihnen gespielt.
An jenem Tag wollte sie wieder los. Ein paar Stunden durch die Wildnis streifen, Tiere beobachten und einige Fotos machen. Mein Vater hätte sie sicher begleitet, war aber dabei, mit Onkel Joe den Geräteschuppen neu zu streichen. Ich selbst wollte mit dem Hund spielen und ein wenig zeichnen. Sie winkte uns noch und war dann einen Augenblick später hinter ein paar Büschen verschwunden.
Nachdem die Stunden vergingen, machte man sich zunächst keine großen Sorgen, doch je länger ihre Abwesenheit dauerte ohne ein Lebenszeichen von ihr, begannen wir uns doch Sorgen zu machen. Es wurde eine großangelegte Suche eingeleitet, die aber trotz aller Anstrengungen ergebnislos blieb. Man hatte weder viele Spuren noch Hinweise gefunden, die auf ihren Aufenthaltsort hindeuteten. Tagelang suchten wir, wochenlang hofften wir. Doch sie war und blieb verschwunden. Für mich brach die Welt zusammen. Brauchte ich doch jetzt, da ich langsam erwachsen wurde, ihre Ratschläge.
Mein Vater litt schwer darunter, als klar wurde, dass sie nie wieder zurückkehren würde. Wir verließen, kurz bevor die Sommerferien zu Ende waren, die Farm.
Zu Hause in Perth stürzte sich Papa in seine Arbeit, doch dies half ihm in seiner Trauer nicht weiter. Er fuhr einen Roadtrain. Drei und mehr Anhänger waren da ganz normal.
Die Verzweiflung allerdings nahm ihm den letzten Lebensmut. Die Zeit auf der Straße verbrachte er mit grübeln. Er ging daran kaputt. Doch ich sah das damals nicht. Ich war noch zu jung, um etwas zu begreifen. Nach außen hin versuchte er, den starken Mann zu markieren. Aber in ihm war es genauso düster und trostlos wie in mir. Ich versagte in der Schule und musste eine Klasse wiederholen. Papa sorgte für eine Nachhilfe. Er machte mit mir Ausflüge, um mich abzulenken. Doch wenn er mich ansah, sah er sie. Die Liebe seines Lebens. Ihre Liebe, die so unerschütterlich wie ein Fels und so tief wie der Marianen-Graben gewesen war. Nie hatte ich erleben müssen, dass sie sich stritten, oder einen Tag an dem sie nicht miteinander scherzten und lachten. Sie waren glücklich. Mein Vater meinte später, ihr Glück wäre erst perfekt gewesen, als ich geboren wurde. Sie nannten mich Sally Maeve, nach meiner Großmutter.
Jetzt, da meine Mutter verschollen war – wir sprachen das Wort »tot« nicht aus, denn in aller Stille hofften wir beide noch auf ein Wunder – begann er, sich zu verändern. Er zog sich immer mehr zurück, wurde einsilbiger. Seinen Schmerz ertränkte er im Alkohol. Für mich war er aber immer da. Wenn ich Fragen hatte oder Hilfe brauchte. Früh schon konnte ich mir kleine Mahlzeiten selbst zubereiten. Das machte mir nichts aus. So war es auch kein Problem, als mein Vater an einem Freitag einer Überlandfahrt nicht heimkam. Ich aß, wusch ab und machte meine Hausaufgaben. Als ich auf die Uhr sah, bekam ich ein mulmiges Gefühl. Stunden verstrichen. Mein ungutes Gefühl steigerte sich weiter, und da am späten Abend immer noch nichts von ihm zu sehen war, lief ich zu meiner Freundin. Dort blieb ich, während ihre Mutter die Polizei verständigte. Es war zu spät, um in der Firma noch jemanden zu erreichen, weshalb die Polizei auf den nächsten Morgen hoffte. Obwohl es Samstag war, nahm schon um halb acht jemand ab. So erfuhren die Polizisten und auch wir von der Route, die er genommen hatte. Der Chef hatte sich selbst schon Gedanken gemacht, jedoch kam es draußen im Outback um diese Jahreszeit auch gern mal zu Unwettern. Überflutete Straßen waren oft die Folge. Einfach durchfahren war da nicht drin. Nicht selten wurden die Straßen sogar eine Zeitlang gesperrt.
Nichts von alledem war der Grund für sein Ausbleiben. Man fand ihn sturzbetrunken in einer Kneipe an der Strecke. Der Chef war stinksauer. Zu Recht. Da mein Vater aber seit über zwanzig Jahren zuverlässig seine Waren ablieferte, blieb es bei einer Abmahnung. Von nun an sprach er trotzdem mehr und mehr dem Alkohol zu. Bei unserem nächsten Aufenthalt auf der Farm versuchte Joe, in zu überzeugen, dass er Hilfe brauche, dass er sich doch nicht einfach gehen lassen könne. Schließlich wäre er nicht allein. Dass er die Verantwortung für mich hätte, und es sicher meiner Mutter nicht gefallen würde, wenn er sich so hängen ließe und alles, was wichtig war, vernachlässigte. Doch mein Vater machte unmissverständlich klar, dass er davon nichts hören wollte. Onkel Joe war, das wusste ich bis dahin noch nicht, mein Pate.
Mein Vater nahm Urlaub und wir fuhren durchs Land. Er zeigte mir nicht nur den Uluru, sondern auch die Kata Tjutas, Kings Canyon und den Kakadu Nationalpark. Wir übernachteten im Zelt, unter freiem Himmel, in Jugendherbergen und saßen abends am Lagerfeuer.
So gingen die Jahre ins Land. Ich war mittlerweile siebzehn. Die Traurigkeit in unseren Herzen begleitete uns jeden Tag. Wir sprachen kaum noch darüber. Auch ich hatte mich verändert. In der ganzen Trauer war ich schnell erwachsen geworden. Ich lernte für die Schule, um zu vergessen. Ging kaum aus. Freunden erzählte ich nie von unserem Schicksal. Es tat einfach zu weh. Auf mitleidige Blicke konnte ich verzichten. Jedoch hatte ich eine Freundin, die von alldem wusste. Marcy. Sie lebte in einer Stadt nicht weit von der Farm. Wir telefonierten viel und wenn ich mit meinem Vater auf der Farm war, trafen wir uns häufig, um zu reden, einkaufen oder ins Kino zu gehen.
Es war kurz vor meinem Schulabschluss. Die Prüfungen hatte ich mit guten Noten bestanden. Den Ausbildungsplatz würde ich in zwei Monaten antreten, um noch etwas Zeit für mich zu haben. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Mein Vater war wieder einmal verschwunden. Mittlerweile hatte ich die persönliche Nummer seines Chefs. Ich rief an, doch er wusste nichts und war seinerseits sehr aufgebracht. Er nannte uns die Abladestellen, die mein Vater angefahren haben sollte. Wie die Polizei herausfand, war er auch überall gewesen.
Während ich mich zusammen mit der Polizei auf die Suche machte, wäre ich niemals auf die Idee gekommen ihn so vorzufinden. Auf einem Parkplatz stand sein Truck. Die Vorhänge waren zugezogen, so das von außen nichts zu sehen war. Da das Führerhaus abgeschlossen war, befragte die Polizei die Leute vor Ort. Doch gesehen hatte ihn niemand. »Er ist in der Nacht angekommen. Hat sich einen Kaffee und ein Omelett bestellt. In aller Ruhe gegessen und dabei immer ein Foto angestarrt. Ich fragte ihn was ihn so traurig machen würde. Doch eine Antwort bekam ich nicht. Als ich aus der Küche zurückkam, war er schon weg«, berichtete die Angestellte des Rastplatzes.
Die Polizisten entschlossen sich, den LKW mit Gewalt zu öffnen. Doch durch mein Wissen vom Zweitschlüssel, versteckt am Truck, war das zum Glück nicht nötig. Sie versuchten mich davon abzuhalten ins Innere zu gehen. Denn sie fanden das Führerhaus nicht leer vor. Sie rieten mir eindringlich, draußen zu warten. Doch meine Sturheit siegte, vor der Vernunft. Seinen Anblick, wie er auf der Pritsche lag, kalt, bleich und ohne jede Regung, konnte ich nun nicht mehr vergessen. Auch heute noch, Jahre später. Wie eine Verrückte hatte ich voller Schmerz an ihm gezerrt, ihn angeschrien, dass er aufwachen solle. Dass es kein Spaß sei. Bevor ich von Weinkrämpfen geschüttelt auf den Boden sank.
Was er mir hinterließ, hielt ich damals wie auch heute in meiner Hand. Starrte fassungslos auf die Worte. War das wirklich alles, was er mir noch zu sagen hatte? In meiner Trauer und aufkommender Wut zerknüllte ich es, tränkte es mit meinen Tränen. Dieses Stück Papier begleitet mich seitdem. Später glättete ich es. Legte es in mein Skizzenbuch. Marterte mich selbst damit, dass ich es immer wieder las. Meinte er wirklich, dass mir diese wenigen Zeilen genügen würden? Ich war doch gerade erst siebzehn, stand doch gerade am Anfang meines Lebens. Wer würde mir nun all meine Fragen beantworten? Mir das Leben erklären?
Der Schmerz war zerstörerisch, tausend Gedanken stürmten auf mich ein. Es war einfach zu viel. Ich fühlte mich alleingelassen und verraten. Mir wurde schwarz vor Augen und ich fiel in Ohnmacht. Erst zwei Tage später erwachte ich wieder. Im Dämmerschlaf bekam ich zwar mit, dass meine Freundin und ihre Mutter kamen und auch viele Schulkameraden, doch eigentlich wollte ich nur einen sehen. Meinen Vater. Sobald mir wieder ins Bewusstsein strömte, dass er nie wieder an meinem Bett stehen, mir nie wieder seine Hand tröstend auf die Schulter legen würde, rannen meine Tränen heiß und unaufhaltsam. Heute noch kämpfte ich mit den Tränen, wenn ich daran dachte.
Die Obduktion ergab, dass mein Vater Schlaftabletten zu sich genommen hatte. Zusammen mit Alkohol eine tödliche Mischung. Weitere Einzelheiten ersparten sie mir.
Onkel Joe, nahm sich meiner an, wie von meinem Vater gewünscht. Er sorgte für mich, achtete darauf, dass ich aß und nicht nur im Bett blieb. Meist irrte ich aber in der ersten Zeit auf der Farm umher ohne Plan und Ziel. Setzte mich unter einen Baum, verweilte dort, schaute den Kakadus zu, in Wirklichkeit sah ich gar nicht richtig hin. Sie stritten sich mit tosendem Lärm um den besten Platz, bis es dunkel wurde.





























