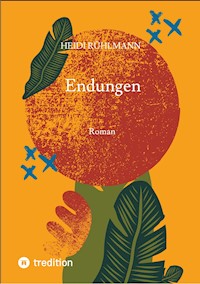
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lydia (75) lebt mit ihrem übergewichtigen Sohn Ulli in Berlin. Für Ulli scheint es nur einen Weg aus seiner Esssucht zu geben: eine Magenverkleinerung. Da die Krankenkasse die Kostenübernahme verweigert, planen sie die OP in einer berühmten Fachklinik für Adipositaschirurgie in Houston/Texas machen zu lassen. Kosten: 25000 Dollar. Woher nehmen? Lydia setzt alles auf eine Karte und schmiedet einen gefährlichen Plan. Gloria (70) hat keine Geldsorgen, dafür einen liebevollen Ehemann, drei wohlgeratene Kinder, ein schönes Haus auf dem Land und einen noch schöneren Garten. Ihr Leben scheint perfekt zu sein. Doch dann wird sie durch einen Anruf aus ihrer Komfortzone gerissen. Eberhard (75) , Glorias Ehemann, arbeitet als Berater für Bio-Bauern unermüdlich an der Rettung der Welt. Durch die Begegnung mit der Brandenburger Gutsbesitzerin, Buddhistin und Radikalökologin Bettina von Breskow gerät sein Leben aus den Fugen. Lydia taucht bei Gloria auf. Sie will Geld. Und Eberhard erhält eine Nachricht: "Du musst sofort kommen! Es ist etwas Schreckliches passiert".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Heidi Rühlmann
Endungen
Roman
Heidi Rühlmann
Endungen
Roman
© 2022 Heidi Rühlmann
Buchsatz von tredition, erstellt mit dem tredition Designer
Verlagslabel: Textmanufaktur Schreibschatten Berlin
ISBN Softcover: 978-3-347-54139-9
ISBN E-Book: 978-3-347-54140-5
ISBN Großschrift: 978-3-347-54142-9
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Kapitel 1
Lydia September
Lydia hatte die Schultern bis zu den Ohren hochgezogen und die Hände tief in die Taschen ihres abgetragenen Mantels gesteckt. Der stürmische Herbstwind fuhr ihr in die Knochen und dann begann es auch noch in Strömen zu regnen. Natürlich hatte sie nicht daran gedacht, einen Schirm mitzunehmen. Vermutlich hätte der sowieso nichts gebracht. Die erste Böe hätte ihn umgeklappt, die Streben zerknickt und anschließend hätte sie ihn wegwerfen können. Seufzend zog sie sich die fadenscheinige, graue Wollmütze tiefer in die Stirn. Seit einer Stunde stand sie sich hier die Beine in den Bauch. Wenn es nicht endlich weiterging, würde sie sich eine Erkältung holen. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte. Aber die Leute rückten nur im Schneckentempo voran.
Gestern hatte sie sich bei der „Tafel“ angemeldet. Wegen des großen Andrangs war auch im Büro der Kirchengemeinde Geduld gefragt gewesen. Eine Eigenschaft, die sie nur noch begrenzt besaß seit sie wusste, wie wenig Zeit ihr noch blieb. Aber sie hatte sich zusammengerissen und auf der von zahllosen nervösen Hintern glatt polierten Holzbank ausgeharrt, bis sie an der Reihe war. Einer korpulenten Frau mit silbergrauem Haar, das zu einem strengen Bob geföhnt war, hatte sie ihren Personalausweis sowie den Grundsicherungsnachweis vorlegen müssen und 1,50 Euro bezahlt. So viel hatte sie gerade noch zusammenkratzen können. Es war Monatsende und wäre sie nicht so pleite gewesen, wäre sie gar nicht erst hierhergekommen. Schließlich hatte sie ein blaues Ansteckkärtchen mit der Nummer 20 erhalten, welches sie als legitime Empfängerin gespendeter Lebensmittel auswies.
Wie sich dann herausstellte, kamen im laufenden Quartal Berechtigte mit blauen Nummernschildern zuletzt an die Reihe. Und am Ende dieser Reihe stand sie nun mit dem verschlissenen Einkaufstrolley, den sie von ihrer Mutter geerbt hatte, und zitterte vor Kälte.
Pünktlich um 14:00 Uhr hatte sie sich vor der Ausgabestätte eingefunden, wo bereits eine große Zahl von Bedürftigen mit grünen und gelben Kärtchen Aufstellung genommen hatte. Vor ihr warteten weitere 19 mit blauen Kärtchen und hinter ihr noch drei. Die kalte Luft löste einen Hustenanfall nach dem anderen aus.
Lydia hielt sich ein Taschentuch vor den Mund und kämpfte um jeden Atemzug. Obwohl sie sich vor Schmerzen krümmte und fürchtete, jeden Moment umzukippen, nahm niemand Notiz von ihr.
Die Leute hier haben mit sich selbst zu tun, dachte sie. Im Grunde war es ihr recht, dass sich niemand um sich scherte.
Als der Husten endlich nachließ, beugte sie sich aus der Warteschlange und taxierte die Menschen die vor ihr ausharrten: Frauen mit dunklen, bodenlangen Gewändern und Kopftüchern, umringt von Scharen quengelnder Kinder, abgerissene Kerle in vor Dreck starrender Kleidung, deren schlechter Geruch bis zu ihr herüber wehte, alte Weiblein mit abgenutzten Taschen, junge Männer mit bleichen Gesichtern und zerfetzten Hosen und bärtige Patriarchen, die mit strengen Blicken ihre weiblichen Familienmitglieder überwachten und ihnen das Tragen prall gefüllter Beutel überließen, ob sie schwanger waren oder nicht. Und dazwischen Lydia, die nie, nie, nie in diese Situation hatte kommen wollen.
Sie fror erbärmlich. Kein Wunder, bestand sie doch fast nur noch aus Haut und Knochen. Außerdem war ihr schlecht. Vielleicht hätte sie etwas essen sollen bevor sie losgegangen war. Aber wie an jedem Morgen hatte sie keinen Appetit gehabt und das Essen auf später verschoben. Wie hätte sie auch ahnen können, dass man hier so lange anstehen musste?
Ihre Füße schmerzten und sie lechzte nach einer Zigarette. Doch Rauchen war auf dem Kirchengelände verboten. Stöhnend fügte sie sich wieder in die Reihe, die ab und zu ein paar Trippelschrittchen vorrückte.
Als sie endlich eingelassen wurde, waren die Körbe und Kisten fast leer. Lydia griff nach einer Aubergine und wurde von einer Mitarbeiterin streng zurechtgewiesen.
„Selbstbedienung ist bei uns verboten!“
„Okay, Okay!“
Lydia hob beschwichtigend die Hände, legte die fleckige Aubergine zurück und blickte ungläubig auf die Gaben, die ihr über den Tisch gereicht wurden: Zwei runzelige Äpfel, zwei Clementinen, eine Orange, eine runzelige Limone, zwei überreife Bananen, eine Plastikschale mit matschigen Brombeeren, zwei Köpfe Eisbergsalat, ein Päckchen geschnittenes Roggenbrot, eine angefaulte Fenchelknolle, ein welkes Bund Schnittlauch. Das war alles.
Sie brachte es nicht fertig, sich zu bedanken, warf alles in ihren Trolley und verließ wortlos das Gemeindezentrum. Auf dem Heimweg begann eins der beiden Rädchen zu eiern und zu quietschen, wahrscheinlich würde es demnächst abfallen, aber sie achtete nicht darauf. Sie wollte nur so schnell wie möglich nach Hause und eine Zigarette rauchen.
Keuchend schleppte sie sich und den Trolley die vier Etagen zu ihrer Wohnung hinauf, wobei sie auf jedem Treppenabsatz pausieren und nach Luft schnappen musste. Wäre die Tasche voll gewesen, hätte sie in der Wohnung klingeln und Ulli über die Sprechanlage herunterbitten müssen. Da er das Treppensteigen wie jede körperliche Anstrengung mied, hätte er den Fahrstuhl nehmen können. Lydia war mindestens 30 Jahren in keinen Aufzug mehr gestiegen. Seit ihrer Haft litt sie unter Klaustrophobie.
Außerdem blieb dieser klapprige Kasten alle naselang stecken. Zur Not hätte sie den Trolley in den Fahrstuhl stellen und nach oben schicken können, aber sie traute den anderen Mietern nicht über den Weg. Sie klauten alles was nicht niet- und nagelfest war, warfen stinkende Pampers in die Biomülltonne und pinkelten in den Hauseingang. Zwei Mal hatten sie schon versucht, in ihre Wohnung einzubrechen. Die Kratzer am Schloss konnte man immer noch sehen. Sie würde es auch so schaffen. Sie hatte es immer geschafft.
Endlich war sie oben angekommen. Im engen Flur der Mansardenwohnung hängte sie die nasse Jacke auf einen Kleiderbügel, trat die durchweichten Schuhe von den Füßen und schlüpfte in ihre Pantoffeln. Dann schlurfte sie ins Bad, seifte ihre Hände mit Kernseife ein, schrubbte sie mit einer kleinen Bürste bis sich die Haut rot färbte, und spülte den Schmutz und die Qual der letzten Stunden mit bis zur Schmerzgrenze heißem Wasser ab.
Auf dem Weg zur Küche rief sie in Richtung einer geschlossenen Tür: „Ich bin wieder da“, bemüht, ihrer heiseren Stimme einen fröhlichen Klang zu verleihen. Dann lauschte sie eine Weile, aber in dem Zimmer blieb es still. Vermutlich hatte Ulli seine Kopfhörer auf den Ohren und hörte irgendetwas Lautes. Oder er schlief noch.
Sie bugsierte den Trolley in die warme Küche, ließ sich auf einen Stuhl fallen und zündete sich sofort eine Zigarette an.
Das Nikotin wanderte über die verästelten Atemwege in ihr Nervensystem und breitete sich rasch im ganzen Körper aus. Lydia lehnte sich zurück, schloss die Augen, streckte die Beine aus und entspannte sich. Während sie Rauch inhalierte und wieder ausblies, überlegte sie, was sie mit den gespendeten Lebensmitteln anfangen sollte. Am liebsten hätte sie das Zeug weggeworfen, zwang sich dann aber, wenigstens einen Blick darauf zu werfen.
Der Schnittlauch hatte den Heimweg nicht überlebt und landete im Mülleimer. Mit spitzen Fingern sortierte sie die Brombeeren und warf die angeschimmelten ebenfalls weg. Die restlichen würden, mit der gleichen Menge Zucker gekocht, ein halbes Glas Marmelade ergeben, die beiden Äpfel, zusammen mit dem letzten aus ihrem Obstkorb, ein Schälchen Apfelmus. Beides passte gut zu Pfannkuchen, die Ulli über alles liebte. Jedenfalls hatte er sie als Kind geliebt. Zucker, Mehl, eine halbe Tüte H-Milch und ein Ei hatte sie noch im Schrank.
Sie nahm einen letzten Zug, quetschte den Stummel in den Aschenbecher und unterdrückte einen Hustenanfall. Dann machte sie sich an die Arbeit.
Von der Fenchelknolle und den Eisbergsalaten schnitt sie die matschigen, braunen Stellen ab und legte das Übriggebliebene zur späteren Verwendung in den Kühlschrank. Die Zitrusfrüchte und die beiden Äpfel leisteten dem Apfel im Obstkorb Gesellschaft. Die Bananen würde sie später in Scheiben schneiden und auf den Pfannkuchen verteilen. Was sollte sie mit dem Schnittbrot machen? Die Mindesthaltbarkeit war längst abgelaufen, außerdem mochte sie kein Schnittbrot. Warum hatte sie es überhaupt angenommen? Sie riss die Packung auf und begutachtete jede einzelne Scheibe, ohne jedoch Schimmelspuren zu entdecken. Vielleicht konnte man es doch noch essen.
Nachdem sie sich eine weitere Zigarette angesteckt hatte, überschlug sie den Wert der Spenden und kam zu dem Ergebnis, dass sie bei dem Discounter, von dem sie stammten, frisch und in einwandfreiem Zustand, zusammen nicht mehr als fünf Euro gekostet hätten. Zog sie die Tafel-Gebühr von 1,50 Euro davon ab, hatte sie zwar 3,50 Euro gespart, insgesamt aber vier oder fünf Stunden kostbarer Lebenszeit verschwendet.
Wie war sie nur auf die Idee mit der Tafel gekommen? Sie musste eine andere Möglichkeit finden, um für Ulli wenigstens ab und zu etwas Gesundes kochen zu können. Der Junge musste unbedingt abnehmen.
Ich kann nicht drei Monate warten, bis die Besitzer blauer Kärtchen zuerst an die vollen Körbe gelassen werden. Ich bin schließlich keine wandelnde Bio-Mülltonne für Billig-Discounter und schon gar kein Blitzableiter für Damen mit Föhnfrisuren, die wahrscheinlich aus Langeweile ehrenamtlich bei der Tafel arbeiten, murrte sie vor sich hin und schüttelte unwillig den Kopf. Morgen würde sie wieder auf den Wochenmarkt gehen, wo die Gemüsehändler nach Verkaufsschluss ihre Reste für wenig Geld abgaben, manchmal sogar verschenkten.
Bevor sie mit den Pfannkuchen anfing, musste sie unbedingt eine Weile ausruhen. Sie leerte den Aschenbecher, lüftete kurz durch und ging leise ins Wohnzimmer. Bei Ulli war noch alles still.
Aufatmend sank sie auf die Couch, zog die flauschige Fleecedecke über sich und stopfte drei dicke Kissen hinter den Rücken. Flach auf dem Rücken liegen konnte sie wegen der Atemnot schon lange nicht mehr. Die Tafel-Aktion hatte viel Kraft gekostet. Und wozu das Ganze? Für nichts und wieder nichts. Sie nahm sich vor, die blaue Nummer 20 zurückzugeben. Vielleicht hatte jemand anderes mehr Glück damit. Langsam sank ihr Kopf zur Seite und der Körper erschlaffte. Sie war so unendlich müde.
Kapitel 2
Lydia September
„Mama!“
Nachdem Ulli seine Mutter überall gesucht hatte, fand er sie schließlich auf dem Sofa. Unter der dicken Decke war ihre schmächtige Gestalt kaum zu erkennen.
„Mamaa!!“
Lydia rührte sich nicht.
Ulli bekam es mit der Angst zu tun.
„Mamaaa!!!“
Endlich schlug sie die Augen auf und betrachtete versonnen die Gestalt, die den ganzen Türrahmen ausfüllte. Sie musste sehr tief geschlafen haben. Die Bilder eines Traums gingen ihr noch im Kopf herum. Es waren farbige Bilder, wie man sie nur selten träumt. Irgendwie hatten sie mit früher zu tun. Und mit Gloria. Lydia versuchte den Traum festzuhalten, aber er löste sich rasch auf und hinterließ ein befremdliches Gefühl in ihrem Bauch.
„Ich hab' Hunger“, jammerte der Mensch an der Tür und Lydia wurde mit einem Ruck in die Gegenwart katapultiert.
„Ulli“, wollte sie sagen, konnte jedoch wegen eines Hustenanfalls gerade noch das „U“ herausbringen.
Als sie wieder Luft bekam, zupfte sie ein Papiertaschentuch aus der Packung und spuckte hinein. Früher hätte sie ihren Auswurf genau untersucht, jetzt knüllte sie das Tuch zusammen und ließ es unauffällig zwischen den Kissen verschwinden. Sie wusste, wie es darin aussah und wollte ihren Sohn nicht weiter beunruhigen.
„Ich muss was essen!“ drängelte Ulli, der keine Anstalten machte, näher zu kommen.
„Ich kümmere mich darum, mein Schatz. Gib mir nur ein paar Minuten“, keuchte sie, zwischen jedem Wort nach Luft schnappend.
„Okay“, brummte er und verschwand aus ihrem Blickfeld. Kurz darauf hörte sie die Toilettenspülung und seine Zimmertür, die krachend ins Schloss fiel.
Nur ein paar Minuten, redete sie sich zu, dann steh' ich auf und backe Pfannkuchen. Er muss sich mit dem zufrieden geben, was da ist. In zwei Tage gibt es wieder Geld. So lange halten wir noch durch.
Lydias winzige Rente und Ullis Sozialbezüge reichten kaum für den Lebensunterhalt. Der größte Teil ging für sein Essen drauf. Sie selbst bekam fast nichts mehr hinunter und war nur noch ein Strich in der Landschaft. Sie musste sich zwingen, wenigstens eine Kleinigkeit zu essen. Einen Bissen weiches Brot mit Margarine bestrichen, ein paar Löffel Suppe, ein winziges Stück Schokolade oder ein Schälchen Haferbrei. Mehr ging nicht.
Ulli konnte Unmengen verschlingen. Döner, Pommes, Pizza, XXLBurger, Chickenwings, Megatüten Chips und Berge von Süßigkeiten. Dazu trank er literweise Cola. Wenigstens raucht er nicht. Im Gegensatz zu mir, dachte Lydia nachsichtig.
Ihr Brustkorb schmerzte. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es ihr endlich, sich aufzurichten und nach den Tabletten zu greifen. Sie steckte zwei in ihren ausgetrockneten Mund und spülte sie mit abgestandenem Leitungswasser aus einem halbleeren Glas hinunter. Sofort wurde ihr übel und sie musste sich wieder zurücklehnen.
Sie musste sich dringend um Tabletten kümmern. In absehbarer Zeit würde sie auch Sauerstoff brauchen. Den beunruhigenden Gedanken an ihren Onkologen wischte sie energisch beiseite.
Da sie Ulli kaum dazu bringen konnte, rauszugehen und ihr die Medikamente zu besorgen, würde sie ihren Hausarzt anrufen und um die Zusendung eines Rezeptes bitten. Wozu hatten Apotheken einen Lieferdienst? Wenn die Sprechstundenhilfe ihr einen Termin aufdrängen wollte, müsste sie eben eine Ausrede erfinden. Ihr würde schon etwas einfallen.
Bei der letzten Nachuntersuchung vor einem halben Jahr hatte der Arzt versucht, sie von einem neuen MRT zu überzeugen. Sie hatte abgewunken, weil sie wusste, worauf es hinauslaufen würde. Auf das MRT würde die Bronchoskopie folgen, danach, je nachdem wie weit sich der Krebs schon in den verbliebenen Lungenflügel gefressen hatte, Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungen.
Noch einmal würde sie diese Tortur nicht durchstehen. Es war zu spät. Sie wusste, wie es um sie stand. Der Tod war in ihrer Nähe und wartete geduldig auf den Moment, an dem sie bereit war. An Tagen, an denen sie es vor Schwäche kaum aus dem Bett auf die Toilette schaffte, spürte sie, wie er sich näherte. Wie gern hätte sie sich ihm dann anvertraut, um mit ihm in den weiten, zeitlosen Raum zu schweben, wo nichts mehr wehtat und nichts mehr erledigt werden musste. Sie war 75 und hatte mit ihrem Leben abgeschlossen. Manchmal fragte sie sich, wie sie überhaupt so alt hatte werden können.
Aber noch war es nicht so weit. Der Sensenmann musste warten und sie noch eine Weile kämpfen. Nicht für sich, sondern für Ulli, den einzigen Menschen den sie wirklich liebte. Und für diese überwältigende Erfahrung war sie ihm etwas schuldig.
Sie war schon 43 gewesen, als sie noch einmal schwanger geworden war und beschlossen hatte, dieses Mal nicht abzutreiben. Was hatte sie ihrem Sohn nicht alles zugemutet. Entzüge, Rückfälle, Klinikaufenthalte, neue Rückfälle, Gefängnis und Wohnungslosigkeit. Monatelang hatte er in Heimen leben müssen, weil seine Mutter zu kaputt war, um für ihn zu sorgen. Wer sein Vater war, wusste Lydia nicht genau. Irgendein Freier vom Drogenstrich, vermutete Ulli, dem es inzwischen egal war. Zumindest tat er so.
Aber dann hatte Lydia doch noch die Kurve gekriegt und ihren Sohn wieder zu sich nehmen dürfen. Das war vor 20 Jahren gewesen. Der Tod ihrer Mutter hatte den Ausschlag gegeben. Sie hatte deren Wohnung übernehmen und Ulli zum ersten Mal ein richtiges Zuhause bieten können. Damals war er 13 gewesen und hatte schon über 90 Kilogramm auf die Waage gebracht.
Seit er bei ihr lebte, war sie clean und hatte keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Nur das Rauchen konnte sie nicht lassen, obwohl sie nur noch einen Lungenlappen besaß und dieser auch nicht mehr richtig funktionierte.
Die Tabletten begannen zu wirken. Mit den Schmerzen ließ auch die Übelkeit nach. Sie stemmte sich hoch und kam auf die Beine. Auf dem Weg in die Küche hörte sie Ulli in seinem Zimmer rumoren. Sicher suchte er nach etwas Essbarem zwischen den leeren Verpackungen, die überall herumliegen, vermutete sie. Sie durfte sein Zimmer nur noch selten betreten, konnte sich aber vorstellen, wie es darin aussah.
Kapitel 3
Gloria September
Gloria richtete sich auf und blickte zufrieden über ihre Rosenbeete. Sie hatte nichts übersehen. Alle verwelkten Blüten waren abgeschnitten. Wenn sie das konsequent tat, blühten manche Sorten bis weit in den Herbst, wie sie an den vielen Farbtupfern in den Rabatten erkennen konnte. Die rosafarbene „Constanze Mozart“, deren Duft an Champagner erinnerte, „Ghislane“, die Kletterrose, die mit ihren apricotfarbenen Blüten den Durchgang zum Gemüsegarten zierte, und die karminrote „Rotilie“ hatten sich entschlossen, eine letzte Blühperiode einzulegen und noch einmal Knospen gebildet. Gloria hoffte, dass sie es bis zum ersten Frost schafften. Oder wenigstens bis zu ihrem Geburtstag im Oktober. Am unermüdlichsten war Schneewittchen“, eine reinweiße, fein duftende Sorte, die sogar im Dezember noch Blüten hervorbrachte und Gloria besonders am Herzen lag. Immer wieder hatte sie sich gefragt, wie ein so zartes Gewächs so robust sein konnte. Die meisten Rosen hatten sich jedoch schon auf rauere Tage eingestellt und Hagebutten gebildet.
Es musste eine schicksalhafte Vorherbestimmung gewesen sein, die sie ausgerechnet an einen Ort mit Namen Rosfelden geführt hatte. Obwohl der Name nichts mit Rosen zu tun hatte, sondern auf die Rösser zurückging, die hier einst gezüchtet worden waren. 45 Jahre hatte Gloria gebraucht, um den Garten, der von ihren Schwiegereltern im Stil der 60er Jahre angelegt worden war, in ein Rosenparadies zu verwandeln. Sie konnte sich noch gut an die von düsteren, immergrünen Koniferen eingefasste Rasenfläche erinnern, an Bodendecker in ovalen Beeten und an den nierenförmigen Gartenteich in der Mitte des Grundstücks, in dem Goldfische auf und ab schwammen.
Sie steckte die Nase in die letzte sattgelbe Blüte der „Bengali“ und sog das süß herbe Aroma ein. Berauschend! Auf dem frisch geschnittenen Rasen, der an die Rabatten grenzte, lagen verstreut Rosenblätter in allen Farbnuancen. Eine Weile genoss sie diesen Anblick, dann griff sie energisch zum Laubrechen, fegte alles zusammen und warf es zu den vertrockneten Stängeln des Lavendel und Frauenmantels in ihre Schubkarre.
Es war Ende September, der Altweibersommer ging zu Ende. Buntes Laub segelte von den Bäumen herunter. Der Kirschbaum war schon fast kahl. Er war immer der erste, der seine Blätter losließ, als sei er ihrer überdrüssig.
Gloria schaute prüfend zu dem alten Ahorn hinüber und stellte fest, dass er noch fast grün war. In wenigen Wochen würde er ein bezauberndes Farbspektakel bieten. Das alte Baumhaus in seiner Krone war vollständig eingewachsen. Glorias Sehschärfe war nicht mehr die beste, aber die Holzleiter, die zu ihm hinaufführte, konnte sie selbst auf die Entfernung noch deutlich erkennen. Eberhard hatte sie vor langer Zeit mit einem Spanngurt am Stamm befestigt. Der Wimpel mit dem aufgemalten Totenkopf und den gekreuzten Knochen, den der kleine Adrian beim Richtfest stolz gehisst hatte, war verschwunden und den roten Drachen, der vor Ewigkeiten in der Baumkrone hängengeblieben war, hatten die Herbststürme längst losgerissen und über den Zaun und die angrenzenden Felder geweht.
An einem stürmischen Herbsttag war auch Merle fortgegangen. Wochenlang hatte Gloria versucht, ihre Tochter davon abzubringen.
„Ausgerechnet Berlin. Warum nicht Freiburg, München oder Göttingen?“ hatte sie gefragt.
„Was hast du gegen Berlin? Du hast doch selbst dort studiert“, hatte Merle entgegnet.
„Das waren andere Zeiten“, hatte Gloria gemurmelt und sich dabei wie ihre eigene Mutter angehört. Sie hasste es, wenn sie Ähnlichkeiten mit ihrer Mutter an sich bemerkte. Tatsächlich hatten sich ihre Eltern damals genauso vehement gegen Glorias Studium in Berlin gesträubt. Und wenn sie ehrlich war, mit gutem Grund. Am Ende hatte sie Hals über Kopf aus Berlin fliehen müssen, um nicht vollständig unter die Räder zu geraten. Aber davon ahnte bisher niemand etwas. Und so sollte es auch bleiben.
Merle war nicht von ihren Plänen abgerückt. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, zog sie es durch. So war sie eben. Gloria hatte schließlich nachgegeben, zumal Eberhard, wie immer, auf Merles Seite gestanden hatte. Gloria waren schließlich die Argumente ausgegangen. Und so war ihre Tochter an einem kalten, regnerischen Oktobertag vor 29 Jahren mit einem vollgestopften Kleintransporter in ihr neues Leben aufgebrochen.
Nachdem Merle ausgezogen war, hatte Eberhard mit Adrian das Baumhaus, das vorher nur eine Plattform aus Brettern gewesen war, zu einem richtigen kleinen Holzhaus mit Spitzdach, Fenstern und Veranda ausgebaut. Damit würde der Junge leichter über Merles Auszug hinwegkommen, hatten sie gehofft, und den ganzen Herbst daran herumgebastelt, in jeder freien Minute Werkzeuge und Baumaterial nach oben gezogen, während Adrians kleine Schwester Bianca und Gloria sie mit Saft, belegten Broten und Keksen versorgt hatten.
Als das Baumhaus winterfest gewesen war, hatten sie Richtfest gefeiert, unter dem Ahorn ein Lagerfeuer angezündet und Stockbrot gebacken. Anschließend hatten Vater und Sohn im Baumhaus übernachtet. Gloria lächelte in Erinnerung an Adrians übernächtigtes, aber glückliches Gesicht am nächsten Morgen. Vor Aufregung hatte er sicher kein Auge zugemacht.
Jetzt stemmte sie die Hände in die Hüften, zog die Schultern nach hinten, drückte den Rücken durch und versuchte den Schmerz zu ignorieren, mit dem sich ihre Bandscheiben in Erinnerung brachten.
Wie lange war sie nicht mehr im hinteren Teil des Gartens gewesen? Hauptsächlich hatte sie sich um die Blumen-, Kräuter- und Gemüsebeete gekümmert. Für das Mähen, den Baum- und Heckenschnitt hatten sie eine Firma beauftragt. Der abgelegene Bereich an der hinteren Grundstücksgrenze, über den der riesige Ahorn seine Äste breitete, war von der Gartenpflege ausdrücklich ausgenommen. Im Februar schoben sich dort Schneeglöckchen durch das vermodernde Laub und bald darauf zeigten sich gelbe Winterlinge und blaue Hasenglöckchen. Auch Anemonen, Schlüsselblumen und Taubnesseln hatten dort ihren Stammplatz.
Als sie noch klein waren, hatten die Kinder oft in dieser Wildnis gespielt. Weit genug vom Haus entfernt, um ungestört zu sein, aber noch in Rufweite. Gloria hatte sich immer bemüht, ihren Kindern einen angemessenen Freiraum zuzugestehen, aber seit dem tragischen Unfall, der dem kleinen Sohn ihrer Freundin Bea zugestoßen war, hatte sie Sorge, ihnen könnte auch etwas passieren. Auch wenn sie keine direkte Schuld traf, waren Gloria und Eberhard an der Kette von Ereignissen, die einst auf Kreta in Gang gesetzt worden waren und letztlich zum Tod des Jungen geführt hatten, nicht unbeteiligt gewesen.
Sie sah wieder hinüber zu dem Ahorn und erinnerte sich an den Igel, den Adrian vor Zeiten unter den Büschen entdeckt hatte, und wie sie den Jungen nur mit Mühe davon abhalten konnte, das Tier ins Haus zu tragen. Stattdessen hatten sie ihm einen kleinen Verschlag gebaut und Apfelschalen und ein Schüsselchen Milch hineingestellt. Aber am nächsten Tag war der Igel verschwunden. Adrian war außer sich gewesen, hatte geweint und jeden Winkel des Gartens abgesucht.
„Der Igel ist abgehauen“, hatte Bianca trocken gesagt, als Adrian wieder aus dem Unterholz aufgetaucht war.
Das kleine Mädchen hatte eine Decke auf dem Rasen ausgebreitet, winzige Teller und Tassen daraufgestellt und mit ihren Puppen „Picknick“ gespielt.
„Die gehört Merle!“ hatte Adrian geschrien, als er Poppi entdeckte, und die Puppe an sich gerissen.
„Merle ist weg! Gib sie sofort her!“
Bianca war hastig aufgesprungen, wobei das Puppengeschirr klirrend durcheinander gefallen war.„Ja, die blöde Merle ist weg. Genau wie mein Igel.“
Wütend hatte sich Bianca auf ihren Bruder gestürzt, ein Bein der alten Puppe zu fassen bekommen und mit aller Kraft daran gezogen.
„Die gehört jetzt mir! Lass sie los!“
„Gehört sie nicht!“ hatte Adrian gebrüllt und mit der freien Hand nach seiner Schwester geschlagen.
Biancas Geschrei war noch lauter geworden, als sie plötzlich ein Puppenbein Bein in der Hand gehalten hatte.
Gloria, die das Geschehen vom Küchenfenster aus beobachtet hatte, in der vergeblichen Hoffnung, die Kinder würden den Konflikt alleine lösen, war über die Wiese gerannt, hatte die Streithähne getrennt, die Puppe und ihr ausgerissenes Bein an sich genommen und den Kindern ein Eis in Aussicht gestellt, wenn sie sich wieder vertrügen. An diesem Abend hatte Eberhard Bianca ins Bett gebracht und Gloria war leise an Adrians Bett getreten und hatte versucht, ihn zu trösten.
„Ich vermisse Merle auch ganz schrecklich. Bestimmt besucht sie uns bald.“
„Ich will aber keinen Besuch! Sie soll bei uns wohnen oder ganz wegbleiben“, hatte er trotzig erwidert und sich zur Wand gedreht.
Gloria hatte ihm einen Kuss auf das strubbelige Haar gehaucht.
„Lass mich in Ruhe!“ hatte er geschluchzt, sich die Decke über den Kopf gezogen und Gloria war still aus dem Zimmer gegangen.
Noch am selben Abend hatte sie das ausgerissene Bein wieder befestigt und die Puppe als Merles stumme Stellvertreterin in eine Sofaecke gesetzt. Bianca durfte sie nicht mehr anrühren und irgendwann war Poppi wie vom Erdboden verschluckt gewesen.
Gloria rätselte noch immer, wo sie geblieben war. Bianca hatte unter Tränen beteuert, es nicht zu wissen und Adrian hatte behauptet, sie sei „gestorben“. Damals war sie von seinem kindlichen Erklärungsversuch gerührt gewesen. Später hatte sie sich oft gefragt, ob der Erdboden Merles Puppe wirklich verschluckt hatte. Und ob jemand dabei nachgeholfen hatte.
Im Schatten des Ahorns lag auch der kleine Tierfriedhof. Dort war vor langer Zeit Moni, die alte Hauskatze beerdigt worden. Auch Merles Hamster und einige aus dem Nest gefallene, tote Vögelchen hatten in Gräbern aus Blättern und Blüten die letzte Ruhe gefunden. Die kleinen Kreuze aus Zweigen und Wollfäden, die die Kinder gebastelt und auf die Grabhügel gesteckt hatten, waren sicher längst vermodert.
Gloria bugsierte die Schubkarre zum Kompost, kippte sie aus und lehnte sie an das Gartenhaus. Dann wandte sie sich noch einmal um, ließ ihren Blick über das weitläufige Gartengrundstück schweifen und fand, dass sie für heute genug getan hatte. Trotzdem hatte sie noch keine Lust ins Haus zu gehen. Auch dort war alles getan. Das große Wohnzimmer mit dem offenen Kamin, den gemütlichen Sesseln und Sofas und den großen Schiebetüren aus Glas, die auf die Terrasse führten, war so sauber und aufgeräumt, dass es unbewohnt wirkte. Was es fast auch war. Ein Wunder, dass noch nicht eingebrochen wurde, dachte sie, während sie das Haus durch den Seiteneingang betrat.
Sie hatte Lust auf einen Kräutertee. Es war später Nachmittag, fast schon Abend, aber die Dämmerung hatte noch nicht eingesetzt. Kaffee hatte sie heute genug getrunken und für Wein war es noch zu früh. Sie zog die Arbeitshandschuhe aus, schlüpfte aus den Gartenschuhen, stellte sie in das Regal im Windfang und ging auf Socken in die Küche. Ein Blick auf ihr Handy, das auf der Arbeitsplatte aus poliertem Granit lag, zeigte, dass keine Nachrichten oder Anrufe eingegangen waren. Die Kinder meldeten sich nur sonntags, wenn überhaupt, und Eberhard rief nur selten von unterwegs an. Hatte er nicht gesagt, dass er heute früher von seiner Dienstreise zurückkommen würde? Aber darauf konnte man sich nicht verlassen.
Die helle Landhausküche aus nachhaltig produziertem Massivholz, eine Maßarbeit der örtlichen Schreinerwerkstatt, ausgestattet mit modernstem Komfort, war Eberhards Stolz. Gloria nutzte den Eis- Zerkleinerer, die italienische Kaffeemaschine, den Mikrowellenherd und all die glänzenden Töpfe und Pfannen nur, wenn die Familie oder Freunde zu Besuch kamen. Das war in letzter Zeit jedoch immer seltener vorgekommen. Für sich allein kochte sie keine aufwändigen Mahlzeiten und meistens viel zu viel. Die Reste landeten dann auf dem Kompost, in der Toilette oder abends aufgewärmt in Eberhards Magen. Anscheinend waren ihr die Mengen für eine fünfköpfige Familie in Fleisch und Blut übergegangen.
Heute hatte sie sich Nudeln mit einer Sauce aus den letzten Gartentomaten gekocht und etwas Schafskäse darüber gebröselt. Obwohl sie sich mehr als satt gegessen hatte, waren ein halber Topf Pasta und eine Menge Sauce übriggeblieben. Sollte Eberhard heute noch heimkommen, könnte er es sich in der Mikrowelle aufwärmen. Gestern hatte sie Pellkartoffeln mit Leinöl und Kräuterquark gehabt und bewusst fünf mittelgroße Kartoffeln abgezählt. Beim Blick in den fast leeren Kochtopf war ihr schwer ums Herz geworden und sie hatte sich vorgenommen, demnächst ein paar kleine Töpfe anzuschaffen.
Da es sich nicht lohnte, mit dem wenigen schmutzigem Geschirr die Spülmaschine in Gang zu setzen, hatte sie es von Hand abgewaschen und zum Trocknen auf die blinkende Edelstahlspüle gestellt. Sie würde es später wegräumen.
Sie setzte den Wasserkocher in Gang und schüttete ihre Spezialmischung aus getrockneten Gartenkräutern in die Teekanne. Dann ging sie ins Bad, um sich das verschwitzte Gesicht zu waschen. Ihre Füße bewegten sich lautlos über die Fliesen, die Eberhard konsequent „Feinsteinzeug“ nannte, und erneut fiel ihr auf, wie still es in diesen optimal isolierten Niedrigenergiehäusern war. Zurück in der Küche goss sie den Tee auf, stellte Kanne und Tasse auf ein Tablett und trug es auf die Terrasse hinaus. Dort ließ sie sich in einen Rattan Sessel sinken.
Nach Sonnenuntergang war es deutlich kühler geworden. Gloria legte sich eine Decke um die Schultern und goss Tee ein. Die Vögel hatten ihr Abendkonzert fast beendet. Bald würden die meisten von ihnen fort sein. Der Herbst war spürbar nah. Sie schloss die Augen. Sie war müde und der Rücken schmerzte.
Das Baumhaus fiel ihr wieder ein. Wie es wohl darin aussah? Hatten sie die Matratze je heruntergeholt? Wahrscheinlich moderte sie da oben immer noch vor sich hin. Sie würde nachsehen. Falls das Holz noch stabil war, könnten ihre Enkel im Baumhaus spielen, wenn sie im Oktober zu Besuch kamen. Luisa war vielleicht noch zu klein und hatte noch nicht genügend Körperspannung, um hinaufzuklettern, aber Leo würde es bestimmt gefallen.
Gloria trank den Tee aus, verknotete die Zipfel der Decke vor ihrer Brust, ging über das weiche, vom Abendtau angefeuchtete Gras zu dem Ahorn und sah hinauf. Das Baumhaus befand sich viel weiter oben als in ihrer Erinnerung. Der Ahorn war ihr schon riesig vorgekommen, als sie das Haus von Eberhards Eltern übernommen hatten. Mit den Jahren hatte er an Höhe und Breite mächtig zugenommen. Es sah aus, als hätte er das Baumhaus mit sich hochgehoben. Doch die Leiter stand immer noch am Boden und endete oben an der Kante des Bretterbodens, der eine kleine Veranda bildete. Prüfend rüttelte Gloria an ihr. Sie fühlte sich fest und sicher an. Dann gab sie sich einen Ruck und stieg vorsichtig hinauf.
Ein Schwarm Krähen, die sich im dichten Blattwerk zur Nachtruhe begeben hatten, warf sich in die Luft und flatterte mit lautem Krächzen davon. Vor Schreck wäre Gloria beinahe abgestürzt. Nachdem sie sich wieder gefangen hatte, kletterte sie ganz nach oben, kroch vorsichtig über den Bretterboden, zog die schmale Tür auf, die schief in den Angeln hing, und schob sich hinein.
Sie konnte sich nicht erinnern, jemals hier oben gewesen zu sein. Die kleinen Fenster aus bruchsicherem Plexiglas waren blind und verdreckt. Von der Decke hingen Spinnweben und die Matratze war zerfetzt. Irgendwelche Tiere hatten anscheinend Nistmaterial gebraucht oder es sich im Schaumstoff gemütlich gemacht. Da sie sich nicht aufzurichten konnte und mit den Spinnweben unter der Decke nicht in Berührung kommen wollte, kauerte sie sich in eine Ecke, winkelte die Beine an, schlang ihre Arme um die Knie und wunderte sich, wie Vater und Sohn hier hatten schlafen können.
Kapitel 4
Gloria September
Als sie aufwachte, war es stockdunkel. Eingewickelt in die dünne Decke lag sie in Embryonalhaltung auf der Seite. Der Arm, den sie unter den Kopf geschoben hatte, war vollkommen taub und als sie sich aufrichtete, fuhr ihr ein stechender Schmerz in den Nacken. Zuerst wusste sie nicht, wo sie sich befand, doch langsam dämmerte es ihr langsam. Sie lag im Baumhaus auf der verschimmelten Matratze und musste eingeschlafen sein.
Verwundert kämpfte sie sich in eine Vierfüßler-Position hoch und kroch auf die Veranda hinaus. Dort streckte sie ihre steifen Glieder bis sie sich wieder lebendig anfühlten. Als sie den Blick nach oben richtete, stockte ihr fast der Atem. Über der Baumkrone schimmerten unzählige Sterne und die schmale Mondsichel am Nachthimmel. Sie drehte sich auf den Rücken und bestaunte die Wunder des Weltalls über sich, als eine Stimme die Stille zerriss.
„Gloria!“
Wie albern sich dieser Name anhörte, wenn er durch die Nacht tönte. Was hatten sich ihre Eltern nur dabei gedacht, ihr wehrloses Baby so zu nennen? Anscheinend sollten „Glanz und Gloria“ - „Ruhm und Ehre“ ihre Lebensbegleiter sein. Dabei hatte Ruhm sie nie interessiert und die Ehre war ihr schon in jungen Jahren abhanden gekommen. Den Namen hatte sie jedoch behalten. Vor allem, seit sie ihn 1964 im Radio gehört hatte. Auf AFN, dem amerikanischen Armee-Sender, den damals fast alle jungen Leute hörten.
„G – L – O - R – I – A“, dabei jeden Buchstaben betonend, hatte Van Morrison, Leadsänger der Beat-Band „Them“ ihren Namen gebrüllt. Gloria hatte im Wohnzimmer ihrer abwesenden Eltern vor der Musiktruhe die Glieder verrenkt, rhythmisch den Kopf geschüttelt, bis ihr schwindelig geworden war, und sich eingebildet, mit dem Song meinte Van Morrison sie.
„Glooo – riaaa!“





























