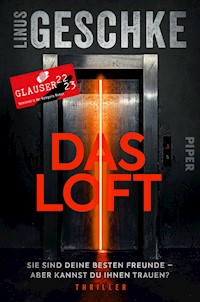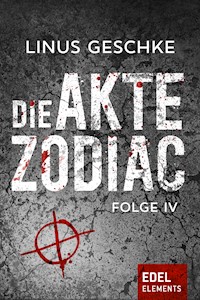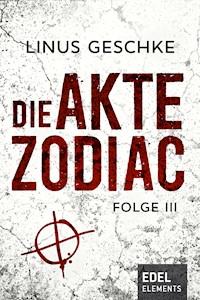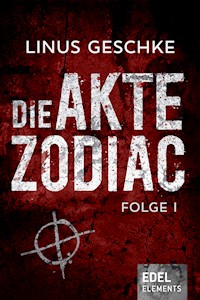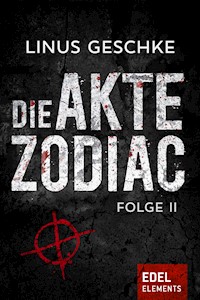9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Born-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine unheilvolle Allianz zwischen Jäger und Gejagtem Höchst alarmiert wendet sich Carla Diaz, Borns frühere Kollegin bei der Sitte, an den Ex-Polizisten. Zwei junge Frauen, Mitglieder der Sekte »Cernunnos«, der auch Carlas Tochter Malin angehört, wurden ermordet aufgefunden. Nun fürchtet Carla um Malins Leben, dringt aber nicht zu ihr durch. Auch Borns Rückholmission scheitert – an Sektenführer Lampert und an Malin selbst. Da schaltet Born seinen alten Gegenspieler Andrej Wolkow ein, der ihm noch einen Gefallen schuldet. Tatsächlich schickt der Russe einen jungen Killer, der sich als entwurzelter Russlanddeutscher bei »Cernunnos« einschleicht. Doch Wolkow treibt ein doppeltes Spiel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
In größter Verzweiflung wendet sich Carla Diaz, Borns frühere Kollegin bei der Sitte, an den Ex-Polizisten. Zwei junge Frauen, Mitglieder der sektenähnlichen Gemeinschaft Cernunnos, der auch Carlas Tochter Malin angehört, wurden ermordet aufgefunden, aufs Grausamste hingerichtet. Nun fürchtet Carla um Malins Leben, dringt aber nicht zu ihr durch. Auch Borns Mission scheitert – an Sektenführer Lampert und nicht zuletzt an Malin selbst. Da schaltet Born seinen alten Gegenspieler Andrej Wolkow ein, der ihm noch einen Gefallen schuldet. Tatsächlich schickt der Russe einen jungen Killer, Artjom, der sich als vorgeblich entwurzelter Russlanddeutscher bei Cernunnos einschleicht. Doch Wolkow treibt ein doppeltes Spiel.
Von Linus Geschke sind bei dtv außerdem erschienen: Tannenstein Finsterthal
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dortErlkönigs Töchter am düstern Ort?Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:Es scheinen die alten Weiden so grau.
Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig
BELGIENDER NORDÖSTLICHE TEIL DER ARDENNEN, AM RANDE DES NATIONALPARKS HOHES VENN
Das imposante Gebäude lag auf halber Höhe eines Bergvorsprungs, abgeschieden vom Rest der Welt. Bei trüben Lichtverhältnissen verschmolzen die schieferbedeckten Mauern mit der felsigen Tannenlandschaft, als wäre es ein natürlicher Teil der Umgebung. Als wollte es sich inmitten der Natur verstecken und als dürfte niemand finden, was nicht gefunden werden wollte, niemand sehen, was besser im Verborgenen blieb.
Einst als Wohnsitz einer wohlhabenden wallonischen Familie errichtet, diente das U-förmige und mit Erkern versehene Anwesen ab den 1950er-Jahren als luxuriöses Sanatorium für wohlhabende Menschen, die an einer Lungenkrankheit litten. Eine Geschäftsidee, die in den ersten dreißig Jahren auch aufging; damals, als die größte Zahl an Gästen aus dem nahe gelegenen Deutschland kam. Dann änderte sich das Abrechnungsverfahren der Krankenkassen, die Patientenzahlen sanken, und der Betreiber musste 1991 Insolvenz anmelden.
Ein aus Messing gefertigtes Schild mit dem Namen des Sanatoriums war alles, was aus dieser Zeit noch übrig geblieben war: Engelsgrund.
Die Bewohner der umliegenden Dörfer kannten das Anwesen, aber nur die wenigsten hatten das Innere des Gebäudes je mit eigenen Augen gesehen. Früher hatte es dafür kaum eine Gelegenheit gegeben, und heute schon gar nicht mehr. In Kilometern gemessen lag Engelsgrund nicht weit von den nächsten Ortschaften entfernt, und dennoch schien der Bau aus einer anderen Welt zu stammen. Aus einer, die lieber für sich blieb, unbemerkt von allen anderen, bis man irgendwann vergaß, dass es sie überhaupt gab.
Um nach Engelsgrund zu gelangen, musste man einer schmalen Straße folgen, die sich wie ein Gedärm den Berg hochschlängelte, und dann auf einen unscheinbaren Forstweg abbiegen, der an einem massiven Zaun endete, welcher das Grundstück weiträumig umschloss – errichtet von dem neuen Besitzer, der das Anwesen dreizehn Jahre nach der Insolvenz und zu einer Zeit gekauft hatte, als die Natur schon begann, sich die Mauern des ehemaligen Sanatoriums einzuverleiben.
Vor allem in den ersten Jahren hatte es unter den Dorfbewohnern viele Gerüchte über diesen geheimnisvollen Mann gegeben, aber nur wenige gesicherte Erkenntnisse. Sein Name war Maurice Lampert, und er war reich, das war klar. Nach dem Kauf hatte Lampert durch verschiedene Unternehmen umfangreiche Baumaßnahmen durchführen lassen, die sich über Jahre hinzogen, bevor er mit einer Gruppe Frauen und Männer, die er wie ein Fürst um sich geschart hatte, nach Engelsgrund gekommen war.
Bestes Futter für ausufernde Spekulationen. Ein Festmahl für Klatschmäuler.
In den darauffolgenden Jahren sah man die Mitglieder der Gemeinschaft ab und zu in den kleinen Lebensmittelgeschäften der Umgebung beim Einkauf oder auf ihren Arbeitsstellen außerhalb des Anwesens. Es waren freundliche Menschen, die Fremden gegenüber aber stets distanziert blieben. Sie beteiligten sich nicht am sozialen Leben, gingen nicht auf Dorffeste oder in die Kneipen und Lokale der Umgebung. Sie blieben lieber unter sich, und keiner wusste, wie viele es eigentlich waren.
Manche Einheimischen sprachen von dreißig Bewohnern, andere von siebzig. Die eine Hälfte hielt die Hinzugezogenen für eine Sekte und die andere glaubte, es seien lediglich Aussteiger, die sich auf dem Anwesen weitestgehend selbst versorgten. Alles, was man mit Sicherheit wusste, war, wie die Gruppe sich nannte.
Cernunnos.
Es war ein Name, der sonderbar klang und Neugierde weckte, und die Einheimischen brauchten nicht lange, um herauszufinden, woher er eigentlich stammte.
Cernunnos war der lateinische Name einer ursprünglich keltischen Gottheit, die manchmal auch als »der Gehörnte« bezeichnet wurde. Für die Kelten war Cernunnos der Gott der Natur, der Fruchtbarkeit und der Unterwelt, und er war der Herr der Tiere, ihr Schutzpatron. Als solcher wurde er nicht in Tempeln angebetet, sondern in der freien Natur, oftmals auf abgelegenen Waldlichtungen. Nicht wenige Religionsforscher sahen in ihm das Vorbild für die nordische Gottheit Freyr, die zur Zeit der Wikinger einen hohen Stellenwert genoss.
Auf den wenigen Abbildungen, die es von Cernunnos gab, wurde er zumeist als großer, bärtiger Mann dargestellt, der ein Hirschgeweih trug. Seine Aufgabe war es, die Natur zu schützen, ein Mittler zwischen Leben und Tod zu sein, und aus diesem Grund hatte er in den letzten Jahren vor allem unter esoterisch veranlagten Umweltschützern eine Renaissance erlebt.
Alles Quatsch und Dinge, über die die eher bodenständigen Einheimischen den Kopf schüttelten.
Die meisten Menschen hier, die nicht vom Tourismus lebten, waren einfache Arbeiter und Angestellte, oftmals auch Bauern. Gute und hart arbeitende Leute, die sich normalerweise nicht um das kümmerten, was andere machten. Dennoch tratschten sie gerne. Jeder hatte Spaß daran, ein Gerücht zu streuen, über dessen Wahrheitsgehalt man abends bei einem Bier in der Dorfkneipe trefflich streiten konnte.
Wahrscheinlich, so spekulierten sie, hatte in der Gruppe jeder mit jedem Sex, und der Anführer musste eine Art Guru sein, der die komplette Kontrolle besaß. Sicherlich trugen die Fremden auch seltsame Gewänder, wenn sie unter sich waren, tanzten Hand in Hand im Mondlicht oder frönten sonderbaren Ritualen, bei denen sie auch illegale Substanzen konsumierten. Ganz gewiss musste jedes Mitglied Lampert seinen kompletten Verdienst überlassen.
Die Einheimischen meinten all dies nicht böse. Ihre Vorstellungen von Sekten waren in erster Linie durch Bhagwan und Scientology geprägt; vielleicht noch von den medienträchtigen Geschehnissen rund um den Sektenführer Jim Jones, in dessen Siedlung Jonestown 1978 neunhundertneun Menschen ums Leben kamen.
Niemand nahm das, was er in bierlauniger Runde sagte, wirklich ernst. Es war lediglich ein unterhaltsamer Zeitvertreib, wenn man gemütlich bei einem Jupiter oder Stella Artois zusammensaß und die belgische Fußballliga wie jetzt gerade Winterpause hatte.
Nun gut, sie waren vielleicht ein wenig merkwürdig, die Mitglieder von Cernunnos, und die Abgeschiedenheit des Ortes gab ausreichend Raum für Spekulationen, aber bedrohlich? Nein, das sicher nicht. Dachten sie, während sie sich den Bierschaum von den Lippen wischten.
Ihre Einstellung änderte sich erst, als an einem kalten Wintermorgen eine nackte Frauenleiche gefunden wurde, die mit dicken Zimmermannsnägeln an einen Baum unweit des Grundstücks genagelt worden war. Ihr schmaler Körper war mit zahlreichen Schnitten übersät, die Brüste waren abgetrennt. Eine Haube aus Schnee hatte sich auf ihre dunklen Haaren gelegt, die im Licht der frühen Morgensonne wie eine Krone glänzte – so als wollte die Natur die Tote nach all den erlittenen Qualen auch noch verspotten.
Die örtliche Polizei war mit der Situation heillos überfordert, dennoch fand sie drei Dinge recht schnell heraus: Die Tote hieß Valerie Wegmann, war siebenundzwanzig Jahre alt, Mitglied bei Cernunnos und hatte in Engelsgrund gelebt.
Sie war die erste Leiche.
Der Anfang.
Mit ihr begann, was so bald nicht enden würde.
BERLINVIER TAGE SPÄTER
In der Nacht hatte es in der Hauptstadt geschneit, aber dann waren die Streufahrzeuge gekommen, der morgendliche Berufsverkehr hatte eingesetzt, und kurz danach sahen die eben noch so sauber wirkenden Straßen wie ein vollgepisstes Katzenklo aus.
Sie rochen auch so ähnlich.
Trotzdem liebte Alexander Born diese Stadt. Sie war seine Stadt, der Beginn seiner Existenz und gleichzeitig auch sein Verhängnis. Er liebte jeden schmutzigen, schäbigen Quadratmeter und lehnte Modernisierungsmaßnahmen ab. Er liebte Berlin gerade wegen, nicht trotz seiner Fehler, und diese Liebe war auch das Einzige, was in seinem Leben von Bestand war.
Der Rest?
Ein ewiges Auf und Ab, welches immer häufiger in Trostlosigkeit mündete. So wie jetzt, als er am Wohnzimmerfenster seiner Eigentumswohnung in Charlottenburg stand und überlegte, was er mit dem Rest des Tages anfangen sollte.
Er wusste es nicht.
Wenn er nicht auf die Uhr schaute, wusste er nicht einmal, wie spät es gerade war, und es spielte auch keine Rolle. Die Stunden glichen sich immer mehr an; sie gingen so ereignislos ineinander über wie die verwaschenen Farben eines Batik-T-Shirts.
Es hatte eine Zeit gegeben, in der das noch anders gewesen war. Eine Zeit, in der Born ein Polizist gewesen war, fast so etwas wie der Star der Truppe. Er hatte bei der Sitte gearbeitet, oft undercover, und war dann zur Mordkommission gewechselt. In beiden Dezernaten hatte er für viele spektakuläre Festnahmen gesorgt. Unzählige Schulterklopfer hatten ihm eine große Karriere prophezeit, und eine Berliner Zeitung hatte ihn einen Helden genannt, als er mit seinem Team siebzehn rumänische Zwangsprostituierte aus einem Zehlendorfer Hinterhaus befreit hatte.
Als der damalige Berliner Oberbürgermeister (also jener Mann, der der Polizei ansonsten nur in den Rücken fiel) ihm während eines Besuches des Polizeipräsidiums vor laufenden Kameras die Hand schütteln wollte, hätte er dem Typen am liebsten öffentlichkeitswirksam eins auf die Fresse gehauen.
Born hatte früh erkannt, dass er mit seinem Tun nur die Symptome bekämpfte, nie die Ursachen. Ihm war mit den Jahren immer klarer geworden, dass sich kein Krimineller – zumindest nicht die wirklich harten Jungs – durch die Androhung einer Haftstrafe von irgendwelchen Straftaten abhalten ließ, niemals.
Diese Sprache verstanden sie einfach nicht. Sie taten, was sie taten, weil sie waren, was sie waren.
Abschaum.
Damit solche Leute verstanden, musste man sie an den Eiern packen, ihnen wehtun und ihnen das nehmen, was sie begehrten. Also begann er, mit schöner Regelmäßigkeit jenen zu schaden, die er sowieso für den Bodensatz der Gesellschaft hielt. Er klaute Drogenhändlern das Koks, Raubtätern die Beute und Clanmitgliedern die Waffen, um das Ganze anschließend an Dimitri Saizew zu verkaufen, einen Restaurantbesitzer mit guten Kontakten zum organisierten Verbrechen. Born wurde kriminell, um Kriminellen zu schaden, und war sich des darin enthaltenen Widerspruchs durchaus bewusst.
Anschließend hatte er mit dem Geld das gemacht, was er für das Richtige hielt – meist war es leider das Falsche. Er half Menschen, von denen er glaubte, dass sie seine Hilfe brauchten, und wurde von diesen Menschen verraten. Sein Tun flog auf, eine Suspendierung und die Anklage folgten, dann drei Jahre Haft in der Justizvollzugsanstalt Tegel, wo in seinem Inneren ein dunkles Wesen geboren wurde, das ihm fortan nicht mehr von der Seite wich. Als er vor zwei Jahren wieder freikam, gab es keine Chance mehr, in den Polizeidienst zurückzukehren.
Wieder das Richtige zu tun.
Man hatte ihn vom Schiff der Guten gestoßen. Danach hatte er hilflos im Ozean getrieben und erkannt, dass die Guten nicht mehr zurückkommen würden. Als dann plötzlich eine Piratenflagge am Horizont auftauchte, hatte er sich entscheiden müssen: an Bord gehen oder absaufen.
Er hatte seine Wahl getroffen, und dennoch vermisste er das Schiff der Guten jeden Tag. Vor allem das damit verbundene Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und nicht gezwungen zu sein, ein Leben in unterschiedlichen Grautönen zu führen, wo ein Tag dem anderen glich, die Freunde immer weniger wurden und die Zukunft noch trostloser erschien als jene des Schnees, der sich vor seinen Augen langsam in Matsch verwandelte.
Borns Dilemma war: Er war ein Mann, der genau wusste, was er wollte, aber erkannt hatte, dass er es nicht mehr bekommen würde. Für ihn gab es kein Schwarz oder Weiß mehr, nur die Schattierungen dazwischen, was es so unglaublich schwer machte, jeden Tag das Richtige zu tun.
Also tat Born gar nichts mehr. Dank der Wohnung, die er von seinen Eltern geerbt hatte, und einiger Aktienpakete hatte er zumindest keine finanziellen Sorgen, und ab und zu gab es sogar in diesem Leben Momente des Glücks. Aber selbst die schönsten Momente waren letztendlich nur Momente, und naturgemäß dauerten sie nicht ewig.
Dann kam die Tristesse wieder.
Die dumpfe Orientierungslosigkeit und das Gefühl, versagt zu haben.
Mitten in diese Überlegungen hinein klingelte es. Born ignorierte das erste Läuten und das zweite; wahrscheinlich nur der Briefträger. Erst beim dritten stand er auf und drückte den Türöffner. Hörte das Summen an der Haustür und schnelle, klackernde Schritte.
Schuhe mit Absätzen, dachte er.
Eine Frau.
Wenn Born gemeint hatte, ihm gehe es dreckig, war das augenscheinlich nichts gegen Carla Diaz, die kurz darauf vor seiner Wohnungstür stand. Das Gesicht der sonst so attraktiven Halbspanierin war von kleinen Fältchen durchzogen, die bei ihrer letzten Begegnung noch nicht da gewesen waren. Die Haut sah blass und teigig aus, und dunkle Ringe breiteten sich unter ihren Augen aus. Die Gesichtszüge waren versteinert, die Lippen zusammengekniffen.
Ein Anblick, der ihm Sorgen machte.
Gemeinsam mit Carla hatte er früher bei der Sitte gearbeitet, und sie war eine der wenigen Freunde, die ihm aus dieser Zeit noch geblieben waren. Ohne sie hätte er Finsterthal nicht überlebt, so einiges andere wohl auch nicht. Carla war einer der stärksten Menschen, die er kannte, stets furchtlos und loyal, und er fragte sich, was ihr die Energie geraubt hatte, die sie sonst immer ausstrahlte.
»Kaffee?«, fragte er nur.
Sie nickte und folgte ihm ins Wohnzimmer, wo sie sich kraftlos aufs Sofa fallen ließ. Carla war nicht nur müde; sie wirkte auch nervös, beunruhigt und verstört. Schlug die Beine übereinander, überlegte es sich anders, stellte sie wieder nebeneinander.
»Was ist passiert?«, fragte Born, als er kurz darauf mit zwei dampfenden Tassen zurückkam. »Stress auf der Arbeit, oder ist …«
»Es war übel, Born«, sagte sie tonlos. Nur diese vier Worte, und das machte ihm Angst.
Aus ihrer gemeinsamen Arbeit wusste er, dass Carla eine harte Polizistin war, tough und durch nichts aus der Ruhe zu bringen. In ihrer Laufbahn war sie schon mit etlichen Grausamkeiten konfrontiert gewesen. Sie hatte wehrlose Rentner gesehen, deren Kopf mit einem Baseballschläger zertrümmert worden war, oder tote Babys, die wie Abfall weggeworfen in Mülltonnen lagen. Sie wusste, wie missbrauchte Frauen aussahen, brutal zusammengeschlagene Männer oder elendig krepierte Junkies, denen noch die Spritze im Arm steckte, während ihnen das Erbrochene aus dem Mundwinkel lief.
Nie war sie deshalb zusammengebrochen, niemals. Auch nicht, als Born in Finsterthal einen Menschen getötet hatte. Carla hatte alles weggesteckt, immer, doch jetzt benahm sie sich, als hätte sie ein Gespenst gesehen.
»Was ist passiert?«, fragte er noch einmal.
Sie beugte sich vor, bedeckte das Gesicht mit den Händen. »Es ist vier Tage her, und es war grauenhaft«, sagte sie. »Eine der schlimmsten Sachen, die ich je gesehen habe, und du weißt, ich habe einiges gesehen. Ziemlich grausame Dinge, aber das hier war anders. Es geht …« Sie brach ab, schüttelte den Kopf, und er hakte nicht nach. Ließ ihr die Zeit, die sie brauchte.
»Da war eine junge Frau Mitte zwanzig«, sagte sie, nachdem sie sich wieder gefasst hatte. »Sie war nackt. Irgendwer hat sie mitten im Wald an einen Baum genagelt, hat ihr sechs lange Nägel durch Arme und Beine getrieben. Durch das Fleisch. Bevor sie gestorben ist, haben der oder die Täter ihr noch die Brüste abgetrennt und den Körper mit Messerschnitten verunstaltet.« Ein tiefer Atemzug. »Üble Typen, Born. Das waren richtig üble Typen. Psychopathen von der schlimmsten Sorte.«
Er kramte in seinem Gedächtnis, fand aber nichts. »Und das Ganze ist vier Tage her?«
Sie nickte.
»Warum habe ich dann noch nichts in der Zeitung gelesen?«
»Es ist nicht hier passiert. Nicht in Berlin. Es war kurz hinter der belgischen Grenze. Am Rande der Ardennen.«
Er sah sie verwundert an. »Was hast du mit einem Mord in Belgien zu tun?«
»Die Tote heißt Valerie Wegmann, und sie war Mitglied in einer Sekte, die sich Cernunnos nennt. Irgendwelche Umweltaktivisten, die von einem Leben im Einklang mit der Natur träumen.«
»Carla, noch einmal: Was hast du damit zu tun?«
»Malin ist …«, erwiderte sie, bevor ihr die Stimme versagte.
»Was ist mit deiner Tochter?«
Carla griff sich an den Mund und quetschte die Unterlippe zusammen. »Malin ist dort ebenfalls Mitglied«, sagte sie dann. »Bei Cernunnos, meine ich. Was, wenn es irgendein Irrer auf die Sektenmitglieder abgesehen hat? Was, wenn sie das nächste Opfer ist?«
Born sagte nichts. Er hatte noch nie gut damit umgehen können, wenn andere Menschen ihm von ihren Sorgen erzählten. Nicht, weil es ihm an Mitgefühl mangelte, sondern weil er in solchen Momenten stets das Gefühl hatte, nicht die richtigen Worte zu finden.
Dann räusperte er sich, um das Gefühl der Beklemmung abzuschütteln. »Woher weißt du überhaupt, dass Malin in dieser Sekte ist? Ich dachte, ihr habt seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr.«
»Sie ist mein Baby, Born, und das bleibt sie auch. Trotz allem. Ich liebe sie. Und ist es nicht das Wesen der Liebe, niemals den Menschen aufzugeben, dem man sein Herz geschenkt hat? Immer nach diesem Menschen zu sehen und auf ihn aufzupassen, so schwierig es auch sein mag?«
»Wahrscheinlich«, sagte er. »Zumindest sollte es so sein.«
»Ich habe auf sie aufgepasst, wenn auch nur aus der Ferne. Nachdem Malin kurz nach ihrem achtzehnten Geburtstag ausgezogen ist, haben wir anfangs noch regelmäßig telefoniert und uns ab und zu in einem Café getroffen. Natürlich habe ich sie jedes Mal gefragt, was sie gerade macht oder wo sie jetzt wohnt, aber Malin … Sie hat mir gegenüber dichtgemacht. Wollte nichts erzählen. Sie meinte nur, dass es ihr gutgehe und ich mir keine Sorgen machen müsse. Sie hat auch gut ausgesehen und glücklich gewirkt, also dachte ich, ihre Verschlossenheit wäre nur eine Phase, das ginge vorbei. Aber es wurde immer schlimmer. Zuerst hat sie die Treffen abgesagt und dann auch nicht mehr auf meine Anrufe reagiert. Ich war so verzweifelt, dass ich angefangen habe, sie zu suchen – kurz nachdem wir in Finsterthal waren.«
»Und dann?«
»Bin ich auf eine ihrer früheren Freundinnen gestoßen, mit der Malin wohl noch eine Zeit lang Kontakt hatte. Von ihr habe ich erfahren, dass Malin sich einer Sekte angeschlossen hat und dass sie jetzt in Belgien auf einem Anwesen lebt, das sich Engelsgrund nennt.« Carla zog scharf die Luft ein. »Meine Tochter ist in einer gottverdammten Sekte, Born! Kannst du dir das vorstellen?«
Weil er wieder nicht wusste, was er sagen sollte, trank er einen Schluck Kaffee, um die Stille zu überbrücken. Mittlerweile war das Gebräu bitter geworden, es schmeckte ekelig.
»Ich bin noch am selben Tag in die Ardennen gefahren, um sie da rauszuholen. Das ist jetzt ein halbes Jahr her«, fuhr Carla fort. »Als ich dort ankam, hatte ich eigentlich mit Gegenwehr gerechnet. Du weißt schon, irgendwas in der Art, dass diese Sektenleute mich nicht zu Malin oder auf das Gelände lassen. Aber so war es nicht. Ich habe geklingelt, sie haben geöffnet, und dann konnte ich mit Malin sprechen, einfach so. Sie hat sich ein paar Minuten lang angehört, was ich zu sagen hatte, und meinte dann, dass sie dort glücklich sei und dass dies genau das Leben sei, das sie führen will.«
»Hast du ihr geglaubt?«
Carla zuckte die Schultern. »Ich kann es nicht genau sagen. Sie war mir … ich weiß auch nicht … vollkommen fremd, irgendwie nicht greifbar und gleichzeitig so beseelt, als wäre sie im Besitz einer Wahrheit, die mir verborgen ist. Hätte sie mir wie sonst immer Vorwürfe gemacht, mich angeschrien und eine schlechte Mutter genannt, okay, damit hätte ich umgehen können, aber mit so was? Keine Chance.«
»Und dann?«
»Was schon? Ich habe natürlich versucht, ihr klarzumachen, dass das Ende solcher Gruppierungen nie so friedlich verläuft wie der Anfang. Dass sie hier nur ihre Zukunft wegschmeißt, um einer Ideologie zu folgen, in der das Individuum nichts zählt, nur der Wille des Meisters – oder wie auch immer sie diesen Typen an der Spitze nennen, der sich so aufspielt, als hätte er als Einziger den Sinn des Lebens verstanden.«
»Und Malin?«
»Sie hat sämtliche Argumente weggelächelt und behauptet, dass sie und die anderen Bekloppten dort diejenigen seien, die irgendwann die Welt retten, indem sie die Menschheit ›zurück zu einem natürlichen Leben‹ führen. Sie wollte tatsächlich, dass ich selbst mit diesem Maurice Lampert spreche, weil es auch für mich nicht zu spät sei, ›die Wahrheit zu erkennen‹.«
»Und, hast du?«
Carla schüttelte den Kopf. »Dazu ist es nicht mehr gekommen. Nachdem Malin und ich eine Zeit lang gestritten haben, kam eines der anderen Sektenmitglieder angerauscht und hat mich aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Ich wollte aber nicht gehen. Der Typ hat mich am Arm gepackt, ein wenig unsanft vielleicht, und dann … na ja, dann bin ich wohl ausgerastet und habe ihm eine verpasst.«
»Du hast was?«
Sie sah ihn mit Augen an, die schwarz wie Kohlen waren. »Er hat mich festgehalten, und ich habe mit dem Ellbogen nach hinten geschlagen. Dummerweise genau da hin, wo sein Gesicht war. Das Ende vom Spiel war dann, dass ich Hausverbot bekommen habe und Malin sogar versucht hat, ein Kontaktverbot gegen mich zu erwirken. Das hat nicht geklappt, aber gegen das Hausverbot kann ich nichts machen. Ich habe ja nichts in der Hand. Gegen die Sekte wird von Amts wegen nicht ermittelt, und Malin ist volljährig. Rechtlich betrachtet, kann sie tun und lassen, was sie will.«
»Und wie passt jetzt die Tote dazu, diese …?«
»Valerie Wegmann?«
Born nickte.
»Als ich nach meinem Besuch wieder zurück in Berlin war, habe ich als Erstes einen Google Alert eingerichtet, der mich seitdem mit allen Neuigkeiten versorgt, die rund um die Sekte in den Medien auftauchen. Darüber habe ich dann vor drei Tagen von dem Mord erfahren. Natürlich bin ich noch am selben Tag erneut nach Engelsgrund gefahren, um mit Malin zu sprechen. Aber sie haben mich nicht mehr auf das Gelände gelassen und gesagt, dass Malin nicht mit mir reden will. Ich habe rumgeschrien und gewütet, aber es half nichts. Irgendwann habe ich aufgegeben und bin nach Berlin zurückgekehrt, um in Ruhe nachzudenken. Zwei Tage lang, und das Ergebnis meiner Überlegungen hat mich dann zu dir geführt.«
Born schwieg.
Sie sah ihn an.
Er schwieg weiter.
»Sag was«, forderte sie ihn auf.
Er seufzte. »Was genau erwartest du jetzt von mir?«
»Gar nichts. Ich möchte dich nur um etwas bitten.«
»Das ist das Gleiche, nur höflicher ausgedrückt.«
Zum ersten Mal lächelte Carla. »Fahr nach Belgien, Born. Hol Malin da raus und sorg dafür, dass sie nicht länger in Gefahr ist. Wenn einer das kann, dann du. Sie hat dich früher immer gemocht, weißt du noch?«
Natürlich wusste er das; mit seinem Gedächtnis war schließlich alles in Ordnung. Außerdem wusste er, dass er nicht nach Belgien fahren wollte, um sich in Dinge einzumischen, die ihn nichts angingen, es aber trotzdem tun würde. Ihm blieb gar keine Wahl.
Es gab viele Arten von Schuldscheinen, und nicht alle hatten mit Geld zu tun. Manche vergaß man, andere verdrängte man, aber irgendwann kam die Zeit, in der man sie begleichen musste.
»In Ordnung«, sagte er. »Ich schaue, was ich tun kann.«
»Ernsthaft?«
»Natürlich.«
»Wann fahren wir?«
»Von wir war nie die Rede.«
Carla kniff die Augenbrauen zusammen, und eine Zornesfalte grub sich in ihre Stirn. »Muss ich dich daran erinnern, was für ein gutes Team wir sind? An unsere Zeit bei der Sitte? An Finsterthal? Komm schon, Born – zusammen sind wir einfach effektiver.«
Er wusste, dass sie recht hatte.
Sie hatte meistens recht.
»Du bleibst hier«, sagte er dennoch. »Malin ist deine Tochter, und wenn es um die eigene Familie geht, kann man nicht mehr klar denken. In Belgien wärst du mir nur ein Klotz am Bein. Ich kann Malin da nicht rausholen, wenn ich gleichzeitig ständig Angst haben muss, dass du wieder überreagierst.«
»Fick dich, Born!«, explodierte sie. »Du klingst wie eine Ratgebertante in irgendeinem billigen Frauenmagazin, aber ich …«
Er sah sie durchdringend an, und das brachte sie zum Schweigen. »Ich fahre alleine, oder ich fahre gar nicht«, sagte er mit Nachdruck. »Und wenn du mir helfen willst, sie da rauszuholen, musst du mir jetzt alles erzählen, was du sonst noch weißt. Über den Mord, über die Sekte und vor allem natürlich über diesen Maurice Lampert.«
ARDENNEN
Der Tag, an dem Born das deutsch-belgische Grenzgebiet erreichte, war kalt und nebelverhangen. Er war noch nie in dieser Gegend gewesen, und wenn er früher das Wort Ardennen gehört hatte, hatte er es nur mit der Schlussoffensive der Deutschen Wehrmacht verbunden, damals, im letzten Winter des Krieges.
Fast siebenhundert Kilometer Fahrt lagen hinter ihm, die ihn über Hannover und das Ruhrgebiet bis nach Aachen und dann über kleinere Landstraßen nach Monschau geführt hatten. Die Eifel ging hier direkt in die Ardennen über; mehr oder weniger war es das Gleiche, selbst gemeinsam errichtete Nationalparks gab es.
Eine abgelegene Gegend, fand er. Kaum Industrie, dafür dichte Wälder und schroffe Felswände. Die Häuser in den kleinen Ortschaften waren oft alt und abgewohnt, viel Fachwerk, und aus den Schornsteinen quoll Rauch. Zusammen mit dem grauen Himmel und dem grauen Schnee am Straßenrand erzeugten sie ein Bild der Trostlosigkeit, und er fragte sich, wie die Menschen hier wohl Ablenkung fanden.
Er fand nichts, was dazu dienen konnte. Keine Kinos, keine Theater und auch keine Einkaufszentren. Die Restaurants schienen eher auf Touristen ausgerichtet zu sein, die wahrscheinlich kamen, um ein paar Tage lang die Natur zu genießen, und anschließend froh waren, wieder nach Hause und ins einundzwanzigste Jahrhundert zurückzukehren.
Hinter der belgischen Grenze steuerte Born seinen Wagen durch dunkle Tannenwälder, in denen der Schnee fast einen Meter hoch lag. Wenigstens die Straßen waren gründlich geräumt, und immer wieder kamen ihm Fahrzeuge entgegen, auf deren Dachgepäckträgern Langlaufski befestigt waren. Er musste jetzt nur noch wenige Kilometer zurücklegen, dann hatte er Malmedy erreicht, wo er sich nahe der Rue Jules Steinbach ein Hotelzimmer nahm.
Vor seiner Abfahrt hatte er den Ort als idealen Ausgangspunkt ausgemacht: Sowohl das Tierheim, in dem Valerie gearbeitet hatte, wie auch Engelsgrund lagen in unmittelbarer Nähe. Außerdem hatte er Hunger, musste etwas essen, und mit seinen zahlreichen Bistros und Restaurants bot Malmedys Zentrum jede Menge Gelegenheit dazu.
Er entschied sich für eine Pizzeria, die versteckt in einer Seitenstraße lag, und ein überbackenes Nudelgericht. Die Kellnerin brachte es nach wenigen Minuten. Es war heiß, und es war fettig; genau das, was er gebraucht hatte. Born war kein Feinschmecker – ein Essen musste satt machen, und wenn es das tat, war er schon zufrieden.
Nachdem er sich ausreichend gestärkt und einen doppelten Espresso getrunken hatte, warf er einen Blick auf die Uhr: kurz nach sieben. Draußen war es bereits dunkel und damit der richtige Zeitpunkt, um sich das Anwesen der Sekte einmal unbemerkt aus der Nähe anzusehen.
Born rief die Kellnerin, bezahlte die Rechnung und legte ein ordentliches Trinkgeld obendrauf, dann ging er zu seinem Wagen und fuhr los.
Er verließ Malmedy in nordöstlicher Richtung, bevor er sich auf die N68 begab, die er kurz hinter dem Örtchen Mont wieder verließ. Anders als die vorherigen Straßen war diese noch nicht von Schnee geräumt worden; die weiße Decke war bis auf vereinzelte Spurrillen jungfräulich.
Verkehr gab es auch keinen mehr. Kein anderes Fahrzeug folgte ihm, keines kam ihm entgegen. Wer in dieser Umgebung stecken blieb, war unweigerlich einer abgeschiedenen Landschaft ausgeliefert, die alles in Stille hüllte; selbst das Autoradio bekam die Sender nur noch rauschend rein.
Er fuhr jetzt langsamer, um die Abzweigung nach Engelsgrund nicht zu verpassen, und dennoch hätte er den schmalen Pfad in der Dunkelheit fast übersehen. Er bremste hart, der Wagen rutschte leicht, dann kam er zum Stehen. Born überlegte, wie er jetzt vorgehen sollte. Er entschloss sich, den Wagen am Wegesrand abzustellen und die restlichen Meter zu Fuß zu gehen. Laut Carlas Beschreibung würde ein Zaun ihm sowieso bald die Weiterfahrt verwehren. Außerdem sah er keinen Grund, die Bewohner von Engelsgrund schon jetzt auf sich aufmerksam zu machen.
Er schloss den Wagen ab und folgte dem Weg, der sich immer tiefer in den Wald zog. Hier war die Stille noch bedrückender, und abgesehen vom Schnee, der leise unter seinen Schuhen knirschte, war kein Laut zu hören. Noch nicht einmal das Geraschel irgendwelcher Tiere. Die Bäume schoben sich jetzt dichter an den Weg heran, bedrängten ihn regelrecht. Als Born den Blick hob, sah er, dass sich ihre Kronen scharf vor dem glanzlosen Nachthimmel abzeichneten: eine Armee aus stummen Kriegern, die die dunklen Spitzen ihrer Lanzen nach oben reckten.
Jedes Mal, wenn Schneebrocken von den Ästen fielen, zuckte Born unwillkürlich zusammen. Er war weiß Gott kein ängstlicher Mensch, aber hier hatte er das beklemmende Gefühl, dass die Umgebung lebte; dass dieser Wald den Wäldern in Horrorfilmen glich, die alles verschluckten, das es wagte, in sie vorzudringen, Mensch wie Tier. Vielleicht, um alles Fremde fernzuhalten, vielleicht auch, um zu verhindern, dass das Böse aus dem Inneren ausbrach.
Dann, endlich, konnte er den Eingang zu Engelsgrund sehen. Er bestand aus zwei steinernen und rund zweieinhalb Meter hohen Portalpfeilern, die ein schmiedeeisernes Tor von etwa drei Metern Breite säumten. Der Zaun, der sich links und rechts an die Pfeiler anschloss und sich irgendwo zwischen den Baumstämmen verlor, wirkte stabil und war oben mit Stacheldraht versehen.
Einladend sah anders aus.
Dummerweise hatte Carla Born zwar von dem Tor und dem Zaun erzählt, nicht jedoch von der Kamera, die sich in dem Moment surrend auf ihn richtete. Als er sie entdeckte, war es bereits zu spät – selbst in der Dunkelheit musste seine schwarz gekleidete Gestalt vor dem Weiß des Bodens einen nahezu perfekten Kontrast bilden.
Die Kamera – ein bewegliches Hightech-Modell unter einem kleinen Stahldach, das als Schneeschutz diente – war auf einer der beiden steinernen Säulen angebracht, die den Zugang wie Ausrufezeichen zierten. Unterhalb der Kamera sah Born eine Gegensprechanlage und ein Klingelschild, auf dem nur ein einziges Wort stand: CERNUNNOS.
Die gegenüberliegende Säule hatte keine derartigen Spielereien zu bieten. An ihr war lediglich eine rechteckige Granitplatte von vielleicht achtzig Zentimeter Breite befestigt, auf der in verschnörkelten Buchstaben der Name des Anwesens stand: ENGELSGRUND.
Wenn sie mich sowieso schon gesehen haben, dachte er, kann ich ebenso gut auch mal »Hallo« sagen.
Er drückte auf den Klingelknopf. Nichts passierte. Er drückte erneut, länger diesmal. Wieder keine Reaktion. Beim dritten Mal drang ihm dann aus der Gegensprechanlage ein lang gezogenes »Ja, bitte?« entgegen.
»Mein Name ist Alexander Born«, sagte er. »Ich bin ein Bekannter von Malin Diaz und hätte sie gerne gesprochen.«
»Einen Moment bitte«, sagte die Stimme, dann herrschte wieder Stille.
Während Born wartete, versuchte er, einen Blick auf das Anwesen zu erhaschen, das ein Stück oberhalb lag und weitgehend hinter Tannen verborgen war. Im Mondlicht sah es schiefergrau und älter aus, als es das Baujahr vermuten ließ. Ein großer, weiträumiger Komplex, imposant und wehrhaft wirkend, fast wie ein altes Herrenhaus aus viktorianischer Zeit. Vielleicht mochte der Eindruck am Tag und bei Sonnenschein ein anderer sein, aber jetzt kam es ihm nicht so vor, als wäre dies ein Ort, der der Gesundung von Menschen gedient hatte. Eher das Gegenteil.
Als er kaum noch mit einer Antwort rechnete, knisterte es erneut aus der Gegensprechanlage, gefolgt von einem: »Malin schläft schon. Kommen Sie morgen um siebzehn Uhr wieder, dann hat sie Zeit für Sie.«
»Ernsthaft?«, fragte er. »Es ist gerade mal neun.«
»Wir gehen hier früh zu Bett. Bis morgen, Herr Born.«
Der Tonfall des Mannes und das anschließende Klicken in der Gegensprechanlage ließen keinen Zweifel, dass das Gespräch beendet war. Born blieb noch ein paar Sekunden vor dem Eingang stehen, scheinbar unschlüssig, dann wandte er sich ab. Ging einige Meter in Richtung seines Fahrzeugs zurück, bis er außerhalb des Blickfelds der Kamera war, und schlug sich dann seitlich in den Wald.
Carla hatte ihm genau beschrieben, wo man Valerie Wegmanns Leiche gefunden hatte: rechts vom Eingang und in Sichtweite des Zauns. Zwei Cernunnos-Mitglieder hatten ausgesagt, dass sie den Zaun nach einem Sturm hatten reparieren wollen und dabei auf die Tote gestoßen waren.
Obwohl es Nacht war, fiel Born das Fortkommen leicht. Die Stämme der Nadelbäume waren im unteren Bereich unbewachsen, und der Mond stand wie ein silberfarbener Knopf vor einem mittlerweile wolkenfreien Himmel. Zusätzlich wurde sein Licht vom Schnee reflektiert, sodass selbst Stolperfallen wie emporragende Wurzeln oder Fuchsbauten frühzeitig zu erkennen waren.
Er musste nicht lange suchen, bis er den Tatort gefunden hatte. Noch immer flatterten die Absperrbänder der Polizei zwischen den Baumstämmen, war das Moos von der Spurensicherung und den Polizisten platt getreten.
Auch den Baum, an den man Valerie Wegmann genagelt hatte, fand er sofort. Die Spuren der Nägel darin, das Blut der Wunden. Es war nicht besonders viel, nur ein paar Tropfen, die im Mondlicht schwarz glänzten. Born stellte sich vor den Baum, um zu sehen, was der oder die Täter gesehen hatten. Um zu hören, was sie gehört hatten.
Nichts.
Erneut fiel ihm auf, wie still diese Gegend war. Dass er nicht mal die Bewegungsgeräusche eines nachtaktiven Tieres hören konnte, kam ihm seltsam vor. Vielleicht stimmte es ja, was manche Menschen behaupteten: Vielleicht nahmen der Boden und die Umgebung tatsächlich etwas von dem Bösen auf, das an manchen Orten geschehen war. Das Seufzen einer geschundenen Seele, den nie vergehenden Schmerz.
Born war kein Esoteriker, aber er hatte schon an zu vielen Tatorten das Gleiche gespürt, um dieses Gefühl als Einbildung abzutun. Als er den Baum und die ihm anhaftenden Blutspuren betrachtete, wusste er sofort, dass es schlimm gewesen war. So schlimm, wie Carla gesagt hatte.
Dann drehte er sich um und schrie.
Sein Schrei fegte zwischen den Baumstämmen hindurch und über den Schnee hinweg, getragen von der klaren, reinen Winterluft. Er musste Hunderte Meter weit reichen, und er verriet Born, was er hatte wissen wollen. Wenn man in dieser Umgebung einen Menschen folterte, lange und qualvoll, mussten seine Schreie auch in Engelsgrund zu hören sein. Es sei denn, man hatte das Opfer geknebelt, aber davon war laut Carla in dem Polizeibericht keine Rede gewesen. Die andere Möglichkeit wäre, dass Valerie betäubt gewesen war. Das sollte im Autopsiebericht stehen, an den Born noch irgendwie herankommen musste.
Wahrscheinlicher war jedoch, dass Valerie bereits tot gewesen war, als man sie an den Baum nagelte, was auch die verhältnismäßig geringen Blutspuren erklären würde. Sie wurde nicht hier getötet, sondern nur hierhergebracht und mit Absicht so drapiert, dass der Schockeffekt möglichst groß war.
Born musste den Autopsiebericht gar nicht mehr sehen. Er wusste auch so, dass er richtig lag.
Dann sah er sich genauer um. Durchkämmte die angrenzende Fläche so gründlich wie möglich, fand aber nicht, wonach er suchte. Anschließend dehnte er das Suchgebiet aus, indem er den Radius vergrößerte, wieder ohne Ergebnis. Er verharrte und dachte darüber nach, was dieser Umstand bedeutete.
Die Mitglieder von Cernunnos, die die Leiche gefunden hatten, hatten gegenüber der Polizei ausgesagt, dass sie zu dieser Stelle gekommen seien, um den Zaun zu reparieren, auf den beim letzten Sturm ein Baum gefallen war.
Blödsinn.
Born hatte weder einen abgebrochenen Baumstamm noch eine Beschädigung am Zaun oder Anzeichen von Reparaturarbeiten gefunden. Nichts, was ihre Aussage stützte. Ob das den belgischen Beamten auch aufgefallen war? Wenn ja, würde dies ihre Sichtweise ändern und aus Zeugen Tatverdächtige machen. Es musste …
Er zwang sich, jeden weiteren Gedankengang zu stoppen, indem er sich in Erinnerung rief, warum er eigentlich hier war. Nicht wegen des Mordes an Valerie Wegmann, sondern wegen Malin. Sie würde er morgen treffen, und dann würde er alles daran setzen, sie zur Rückkehr nach Berlin zu bewegen. Nur das war er Carla schuldig, nicht mehr. Malin war sein Problem, und Valerie Wegmann das der belgischen Polizei. Er würde jetzt nicht den Fehler begehen und sie zu seinem Problem machen.
Dachte er.
Niemand musste Malin erzählen, dass die Welt ein verlorener Ort war. Niemand. Sie hatte das im Verlauf ihres noch recht jungen Lebens oft genug selbst mitbekommen.
Sie war ein sensibles Kind gewesen, dicht am Wasser gebaut und sich nach einer Familie sehnend, die aus Vater und Mutter bestand – nicht nur aus einer Mutter, die kaum Zeit für sie hatte, ständig arbeiten war und sie deshalb oft zu den Großeltern abschob. Bei ihnen war Malin mit sich und ihren Gedanken allein gewesen, und schon damals hatte sie gemerkt, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Dass sie anders fühlte, als andere Menschen das taten.
Dass sie den Schmerz spürte.
Nicht nur den eigenen, jeden.
Empathie und Sensibilität wurden immer nur als etwas Gutes dargestellt, aber das stimmte nicht. Zumindest nicht bei Personen, die über beides verfügten, und Malin besaß davon im Überfluss. Ihre Gefühlswelt war ihr schon immer eine Bürde gewesen, und es hatte lange gedauert, bis sie sich die nötige Härte antrainiert hatte, um auch an verlorenen Orten zu überleben.
Schon in ihrer Kindheit hatte sie Dinge gesehen, die andere nicht sahen. Geräusche gehört, wo sonst vermeintlich Stille war. Sie erkannte Zusammenhänge, die den meisten Menschen verborgen blieben, und hatte sich mehr als einmal gewünscht, sämtlichen Ungerechtigkeiten gegenüber blind und taub zu sein. Für andere mochte das nach irgendeinem esoterischen Mist klingen, aber so war es nicht. Leider. Es war die Realität, die sie sah und hörte, und nachdem Malin das einmal erkannt hatte, veränderte diese Einsicht ihr ganzes Leben.
Wenn sie die Augen schloss und sich konzentrierte, konnte sie noch immer die Angst hören, die Panik, die Wut, den Zorn und das allgegenwärtige Chaos. Sie hörte die Schreie, immer und überall. Alles schrie, weil die Menschen stumm waren, und nichts war mehr im Gleichgewicht, nirgends.
Jeder forderte von seinem Gegenüber stets Respekt ein, aber niemand war mehr bereit, ihn selbst zu erbringen. Es sei denn, es drohten finanzielle oder rechtliche Strafen. Wer schwächer war, wurde ansonsten gnadenlos ausgebeutet, und für Tiere und die Natur galt dies in besonderem Maße. Der menschliche Verstand entwickelte sich immer weiter, aber die Seele verrohte, und wenn es niemanden gab, der die Stimme erhob und sich dagegen auflehnte, würde irgendwann alles in einer apokalyptischen Katastrophe enden.
Malin lehnte sich auf, und sie war auch bereit, die Stimme zu erheben. So laut zu sein, dass niemand sie überhören konnte.
Sie ging mit offenen Augen durch die Welt, und wohin sie auch blickte, sah sie nur Ausbeuter und Ausgebeutete, Gewinner und Verlierer. Sie sah Schweine, die unter elendsten Bedingungen gehalten wurden, damit ein Kilo Fleisch für unter sechs Euro zu haben war, und sie sah gerodete Urwälder und Lebensräume, die Platz für Monokulturen schufen, weil es eine Hand voll Mächtiger so entschieden hatte. Noch nie waren so viele Arten ausgestorben wie in den letzten fünfzig Jahren, noch nie hatte das Klima so dicht am Abgrund gestanden, und selbst miteinander gingen die Menschen nicht besser um.
Aus Malins Sicht gab es eine einfache Regel, die immer zutraf: Wer Macht hatte, nutzte sie auch aus. Alle anderen waren die Ohnmächtigen, das blöde Menschenvieh, dessen einziger Sinn darin bestand, neues Menschenvieh zu zeugen. Ansonsten hatten sie den Mund zu halten und zu gehorchen. Und wenn sich doch mal einer der Schwachen auflehnte, wenn es gar einen Aufstand gab, zeigten die Mächtigen den Schwachen schnell, wer hier das Sagen hatte.
Und warum? Weil sie die ganze Technik besaßen und beherrschten. Die Waffen und das Kriegsmaterial, die Konsumgüter, die Medien und das Internet. Die Menschen lebten in einer Welt, in der sich mittlerweile alles der Technik unterordnete. Sie diente nicht mehr den Menschen, der Mensch diente ihr, und sie entzweite alles und jeden.
Sie sorgte dafür, dass der mächtige Teil der menschlichen Spezies kurz vor dem Durchbruch stand, was die totale Überwachung anging, während ein anderer Teil nicht einmal mehr wusste, wie er an etwas so Existenzielles wie Wasser kommen sollte, um die ausgedörrten Felder zu bestellen.
Ja, die Welt war ein verlorener Ort. Zerrissen, geschändet und entzweit, und dennoch gebaren Mütter immer wieder Kinder in diese Verlorenheit hinein; nur, um dann zu beten, dass sie da heil durchkamen.
Sie war auch eines dieser Kinder gewesen. Still, sensibel und gehorsam, immer auf der Suche nach Wärme und Liebe und Nähe. Sie hatte sich nach einer Familie gesehnt, einer richtigen, und war letzten Endes doch nur darauf getrimmt worden, immer neue Puppen und später stets das neueste Smartphone haben zu wollen. Wie eine Ertrinkende hatte sie Menschlichkeit gesucht, stattdessen aber Konsumgüter bekommen, und war daran fast zerbrochen.
Aber damit war es jetzt vorbei, dachte sie. Mittlerweile brauchte sie keine Liebe mehr, die letzten Endes doch nur der Ausbeutung diente. Kein geheucheltes Verständnis, hinter dem sich lediglich ein Machtanspruch verbarg. Keine Mutter, die behauptete, alles für sie zu tun, und die sie dennoch verraten hatte, an diesem gottverdammten Tag, als es darauf angekommen war.
Malins Leben war jetzt ein anderes. Sie hatte nun Cernunnos, und mehr brauchte sie nicht. Vielleicht war es noch nicht zu spät. Vielleicht konnte sie mit ihrer Vorstellung eines natürlichen Lebens die Leben vieler anderer retten. Dafür war sie bereit, alles zu tun. Wenn man für etwas kämpfte, an das man aus tiefstem Herzen glaubte, konnte das kein Fehler sein.
Niemals.
Maurice Lampert hatte ihr den Weg gezeigt, sie sah ihn jetzt klar und deutlich vor sich. Der Mensch war nur ein Teil der Natur, nicht der Herrscher über sie. Wenn es ihr gemeinsam mit den anderen gelang, diesen Gedankengang in den Köpfen vieler zu etablieren, konnten sie es schaffen.
Ihrem Ziel und dem Weg konnte sie trauen, ihren Mitmenschen leider nicht. Das hatte sie oft genug gesehen. Vertrauen war nur die Vorstufe der Enttäuschung, ein Versprechen die Vorstufe der Lüge. Am Ende stand immer der Schmerz, und Malin wollte nicht mehr leiden, nie mehr.
Sie hatte ihre Lektion gründlich gelernt. In dieser Welt, an diesem verlorenen Ort, war es besser, die Menschen auf Distanz zu halten. Es war besser, anderen nicht zu vertrauen und ihnen nicht zu viel zu erzählen.
Es war besser, ein Leben lang auf seiner eigenen kleinen Insel zu bleiben, anstatt im Meer eines anderen unterzugehen.
»Malin?«
Sie war so in Gedanken versunken gewesen, dass sie nicht gemerkt hatte, dass Maurice Lampert in ihr Zimmer getreten war. Wie immer hatte er vorher nicht geklopft, aber das war okay, er durfte das. Überhaupt war er der einzige Mensch in ihrem Leben, der fast alles durfte.
Der Anführer von Cernunnos war nicht groß, keine imposante Erscheinung, und dennoch beherrschte er jeden Raum, sobald er ihn betrat. Seine Ausstrahlung war gewaltig, sein Blick hypnotisch, und wenn er mit leiser, aber ausdrucksstarker Stimme sprach, schwang in ihr etwas mit, das keinen Widerspruch duldete. Er war ein Mann, der in sich selbst ruhte, weil er wusste, dass das, woran er glaubte, das Richtige war.
»Vor einer Stunde war jemand hier, der dich sprechen wollte«, sagte er. »Ein Alexander Born. Ich habe ihm ausrichten lassen, dass du schon schläfst und er morgen wiederkommen soll. Bevor wir ihn hereinlassen, wollte ich zuerst mit dir reden.«
Sie nickte. »Ich weiß. Matthias hat es mir schon erzählt.«
Lampert setzte sich zu ihr und sah sie nachdenklich an.
»Du musst dir keine Sorgen machen«, sagte sie lächelnd. »Er ist ein alter Freund meiner Mutter. Ich kenne ihn, er ist okay. Früher haben die beiden zusammen bei der Polizei gearbeitet, aber dann muss irgendwas passiert sein. Er ist rausgeflogen, und das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er für ein paar Jahre in den Knast musste.«
»Was hat er getan?«
»Keine Ahnung, ich habe damals kaum noch mit meiner Mutter gesprochen. Bis gerade wusste ich nicht mal, ob die beiden überhaupt noch Kontakt haben. Ich denke, sie hat ihn gebeten, hierherzukommen und mich zu überreden, wieder nach Berlin zu gehen. Zumindest würde das zu ihr passen. Ich mochte Born, und wahrscheinlich denkt sie, sie könnte das jetzt ausnutzen.«
»Warum sprichst du so über sie? Deine Mutter ist besorgt, und das ist voll und ganz verständlich. An ihrer Stelle würde es mir nach Valeries Ermordung nicht anders gehen.«
Malin zuckte die Schultern. »Wir alle machen uns Sorgen, nicht wahr?«
Er ging nicht auf ihre Bemerkung ein und wollte stattdessen wissen, was für eine Art Mensch Born war.
»Tja, gute Frage …« Sie räusperte sich. »Wie gesagt, ich habe ihn seit sieben oder acht Jahren nicht mehr gesehen. Da war ich noch ein Kind, aber … Ja, ich mochte ihn. Er war irgendwie cool. Hat nicht viele Worte gemacht.«
»Willst du mit ihm reden?«
Erneut zuckte sie die Schultern
»Du weißt, dass du das nicht musst, Malin. Nicht, wenn du es nicht willst. Das hier ist Privatbesitz, und er hat keinerlei offizielle Befugnisse. Wir können ihm einfach sagen, dass er wieder gehen soll.«
»Nein«, sagte sie entschlossen, nachdem sie darüber nachgedacht hatte, »das können wir nicht. So wie ich ihn in Erinnerung habe, wird er keine Ruhe geben. Er wird so lange Ärger machen, bis er mit mir gesprochen hat. Du darfst ihn nicht unterschätzen, Maurice. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich damals aufgeschnappt habe, ist er ein Bluthund. Niemand, der sich einfach so abschütteln lässt, und schon gar nicht, wenn er wegen meiner Mutter persönlich involviert ist.«
Lampert stand auf und ging ein paar Schritte auf und ab. »Das klingt bedrohlich«, meinte er dann. »Ist er eine Bedrohung für uns?«
»Warum fragst du mich das? Ich habe ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, und für mich war er nie eine Bedrohung. Es ist vermutlich einfacher, wenn ich mit ihm spreche und ihm meine Gründe erkläre, anstatt sein Misstrauen zu schüren.«
»Okay, dann rede mit ihm. Wir können gerade keinen zusätzlichen Brandherd gebrauchen.«
»Was soll ich ihm sagen?«
»Die Wahrheit natürlich. Warum du hier bist, wofür wir kämpfen und wie wichtig es ist, dass immer mehr Menschen einsehen, dass der Weg, wie ihn die westliche Welt praktiziert, letzten Endes nur ins Verderben führt. Ich kenne diesen Born nicht und weiß nicht, wie er denkt, aber vielleicht kannst du ihn ja überzeugen.«
Sie lächelte. »Das glaube ich nicht, aber ich kann es gerne versuchen. Willst du auch mit ihm reden?«
Er dachte über ihre Frage nach. »Ja«, sagte er dann. »Bring ihn zu mir. Ein ehemaliger Polizist, der auf die schiefe Bahn geraten ist, sollte auch jemand sein, der Grenzen überschreitet. Angesichts der Gefahren und Aufgaben, die noch vor uns liegen, würde ich ihn gerne kennenlernen.«
Sie nickte.
Er trat auf sie zu, küsste sie auf die Wange und ging.
Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte er auch über Nacht bleiben können; so wie er es schon ein paar Mal getan hatte. Sie war nicht verliebt in ihn, aber sie hatte Bedürfnisse, und die wusste er besser zu befriedigen als die meisten anderen. Sie ließ sich rückwärts aufs Bett fallen und schloss die Augen. Dachte an Born und an die früheren Begegnungen mit ihm. Wie er ihr ein Eis gekauft hatte. Wie er sie immer geneckt hatte, wenn er ihre Mutter auf dem Weg zur Arbeit abholte. An seine Augen, die gleichzeitig hart und warm gewesen waren.
Was mochte mit ihm passiert sein? Warum hatte er seinen Weg verlassen und einen anderen eingeschlagen? Was hatte zerstört, woran er geglaubt hatte?
Es stimmte, was sie Lampert über Born erzählt hatte. Sie mochte ihn. Eine Zeit lang hatte sie sich sogar mal gewünscht, er wäre der Vater, den sie nie gehabt hatte.
Born und sie.
Zwei verlorene Menschen in einer verlorenen Welt.
Das konnte interessant werden.
BERLIN
Carla drehte langsam durch. Born war schon den zweiten Tag fort, ohne sich gemeldet zu haben. Sie hatte unzählige Male versucht, ihn anzurufen, und ihm Nachrichten im Halbstundentakt geschickt. Aber er antwortete nicht, hatte das Handy entweder ausgeschaltet oder befand sich in einem Gebiet, in dem er keinen Empfang hatte.
Warum machte er das? Konnte er sich nicht denken, dass sie die ganze Zeit nur auf ihr Telefon starrte, als könnte sie es alleine durch die Kraft der Gedanken zum Klingeln bringen? Dass sie immer und immer wieder das Display einschaltete, weil sie der Gedanke irre machte, das kleine Blinken übersehen zu haben, mit dem sich üblicherweise eine neue WhatsApp-Nachricht ankündigte? Schon wieder wollte sie zum Smartphone greifen, überlegte es sich aber anders. Ihr Verstand sagte ihr, dass es keinen Sinn hatte, es wieder und wieder zu versuchen. Wenn Born einen Fortschritt erzielte oder Neuigkeiten hatte, würde er sich schon melden, bis dahin wollte er seine Ruhe haben und empfand jede Störung nur als unnötige Ablenkung. So war er schon früher gewesen, als sie bei der Sitte zusammengearbeitet hatten, und hatte damit sämtliche Vorgesetzten in den Wahnsinn getrieben.
Ihm war das egal gewesen – wenn er ein Ziel verfolgte, blendete er den Rest der Welt einfach aus und empfand alles, was ihn von seiner Aufgabe ablenken konnte, als Ballast. Vor allem Dinge, die seiner Meinung nach so unnütz waren wie ein Mobiltelefon.
Keine Frage, er war ein Dinosaurier.
Aber einer von der wehrhaften Sorte.
Ein gottverdammter T-Rex.
Um in der Zwischenzeit nicht gänzlich untätig zu sein, fuhr Carla den Rechner hoch und versuchte, im Internet weitere Informationen über Maurice Lampert zu finden. Sie wusste bereits, dass er ein zweiundvierzigjähriger Belgier war, aus Zolder stammte und sein Geld früher mit einem Softwareunternehmen verdient hatte, das komplizierte Lösungen für noch kompliziertere Probleme anbot. Die meisten Begriffe waren ihr fremd, aber sie verstand zumindest, dass es bei dem Unternehmen in erster Linie um den Schutz sensibler Firmendaten gegangen war. Um Firewalls und Sicherungen gegen aggressive Bots beispielsweise, die ganze Netzwerke lahmlegen konnten.
Ziemlich technologieorientiert für jemanden, der jetzt die Technik verdammte und mit seiner Sekte zurück zur Natur wollte.
Anschließend klickte sie sich durch alte Presseberichte, in denen stand, dass er die Firma, die er gemeinsam mit einem Partner betrieben hatte, vor zwölf Jahren für dreiundzwanzig Millionen Euro verkauft hatte. Acht Jahre danach hatte er Cernunnos gegründet, jene Gruppierung, auf deren Führung er sich nun konzentrierte.
Seit der Zeit des Firmenverkaufs gab es auch keine Fotos und Interviews mehr mit ihm. Lampert schien sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen zu haben, und dieser Umstand gefiel Carla nicht.
Ganz und gar nicht.
Wenn seine Idee von einem Leben im Einklang mit der Natur wirklich so harmlos war, gab es nicht den geringsten Grund, sich so abzuschotten. Dann müsste Lampert doch eher versuchen, seine Idee einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, um weitere Menschen von ihr zu überzeugen. Das tat er aber nicht. Stattdessen hatte er sich hinter die gut geschützten Mauern eines ehemaligen Sanatoriums zurückgezogen, wo er mit seinen Anhängern … keine Ahnung, Gott weiß was tat.
Mit Malin.
Noch so ein Gedanke, den Carla gar nicht erst zu Ende denken wollte.
Obwohl sie mit ihrer Tochter in den letzten Jahren kaum noch Kontakt gehabt hatte, liebte sie sie abgöttisch. Immer, wenn sie die Augen schloss, tauchte Malins Gesicht in ihren Gedanken auf, und jedes Mal erinnerte sie sich an etwas anderes.
An den sanften Windhauch, der ihr durch die Haare fuhr, während sie als Kind mit anderen Kindern über den Spielplatz tobte.
An den Umriss ihres schmalen Körpers, der sich grell gegen die geballten Wolkenmassen am Horizont abzeichnete, als sie an einem verregneten Novembermorgen zur Schule ging.
An den Eyeliner, den Malin mit dreizehn in einem Drogeriemarkt geklaut hatte, weil Carla ihr noch keinen kaufen wollte, und dabei sofort erwischt worden war.
Tausend unterschiedliche Sachen, die meisten davon belanglos; mal ein schnippisches Wort, mal ein unbeschwertes Lachen, oft auch nur ihr schlafendes Gesicht, ganz friedlich.
So verdammt lange her.
Carla wusste, dass sie viel falsch gemacht hatte, und ja, an manchen Tagen war es unglaublich schwer gewesen, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Noch schwerer war es, wenn einem das eigene Kind diesen Umstand ständig zum Vorwurf machte. Auch sie hätte die Verantwortung gerne mit einem Partner geteilt, aber das hatte sich leider nicht ergeben. Deshalb war Carla gezwungen gewesen, alles in einer Person zu sein: der gute und der böse Bulle, Erzieherin und Ernährerin, Freundin und Feindin, und ständig hatte eine dunkle Wolke voller Schuldgefühle über ihr geschwebt.
Sie hatte Schuldgefühle gehabt, weil sie ihre Tochter vernachlässigte, wenn sie arbeiten ging. Weil sie sich nie wirklich Mühe gegeben hatte, einen neuen Vater zu finden. Weil sie … einfach wegen allem.
Und jetzt?
War Malin auf der Flucht vor irgendwas, wahrscheinlich vor sich selbst. Diese Flucht hatte sie mitten in die Einöde geführt, wo sie nun einem Mann folgte, von dem Carla nichts wusste, der aber ganz gewiss nichts Gutes im Schilde führte. Das Schlimmste aber war, dass Carla jetzt tatenlos hier rumsitzen musste, die Hände in den Taschen vergraben, abwartend und mit verzweifelten Gedanken im Kopf.
Das war nicht gut.
Ganz und gar nicht gut.
Sie war schon immer ein Mensch gewesen, der es gewohnt war zu handeln, sobald Probleme sich abzeichneten. Niemand, der den Kopf in den Sand steckte und darauf vertraute, dass andere Menschen das Problem schon lösten. Einfach dasitzen und abwarten lag ihr nicht, doch was sollte sie stattdessen tun?
Die einzige Alternative wäre, gemeinsam mit Born wie eine durchgedrehte Jeanne d’Arc die Mauern von Engelsgrund zu stürmen, um ihre Tochter zu retten, womit sie wahrscheinlich alles nur noch schlimmer machte.
Und so saß sie da und …
… wartete.
Sekunde um Sekunde, Minute um Minute, Stunde um Stunde.
Wenn man so verzweifelt auf etwas wartete, wurde die Zeit zur Qual. Die Zeiger der Uhr bewegten sich zäh wie Kaugummi, ein einziger Tag glich einer ganzen Ewigkeit, und seit der Nachricht über Valeries Ermordung war Carla in den finstersten Bereichen dieser Ewigkeit angekommen. Sie konnte nur hoffen, dass Born sich endlich meldete, bevor sie vollends den Verstand verlor.
Fuck.
ARDENNEN
In der Nacht hatte Born unruhig geschlafen. Sein Hotelzimmer war zwar halbwegs komfortabel eingerichtet, über die Jahre jedoch abgewohnt und renovierungsbedürftig geworden, was auch für das durchgelegene Bett galt, in dem sein Körper eine ausgeprägte Kuhle hinterlassen hatte.
Born ging ins Bad und machte sich frisch. Dann zog er die Vorhänge zur Seite und blickte aus dem Fenster. Sah, dass der Morgen sich auf jener schmalen Grenze bewegte, die die Nacht vom Tage trennte; ein diffuses Zwielicht, das nicht gerade zur Steigerung seiner Laune beitrug.
Er warf einen Blick auf die Uhr. Kurz nach sieben. Bis zu dem Treffen mit Malin dauerte es noch zehn Stunden, und die musste er irgendwie hinter sich bringen, wobei die Möglichkeiten hier in Malmedy eher begrenzt waren.
Er konnte in ein Museum gehen oder sich irgendeine Dokumentation über die Kriegsgeschehnisse der Ardennenoffensive angucken. Er konnte spazieren gehen und sich anschließend in dem kleinen Massagestudio, an dem er gestern vorbeigekommen war, durchkneten lassen. Den ganzen Tag auf dem Bett liegen und fernsehen.
Er konnte mit der Zeit aber auch etwas Sinnvolleres anfangen und dem Tierheim, in dem Valerie gearbeitet hatte, einen Besuch abstatten, um ein paar Fragen zu stellen.
Nur so, dachte er.
Aus Langeweile.
Um die Zeit totzuschlagen.
Er hatte das Gelände kaum betreten, als schon eine Mitarbeiterin des Tierheims auf ihn zukam. Born schätzte sie auf Mitte zwanzig. Sie trug einen dicken Wollpulli und eine beigefarbene Latzhose, ihre Frisur bestand aus kunstvollen Dreadlocks.
»Sie suchen einen Hund, nicht wahr?« Ihr Lächeln war offen und ehrlich. »Einen großen, mit dem man prima durch die Wälder streifen kann, stimmt’s? Wir haben hier ganz sicher genau den richtigen für Sie.«
»Ich suche keinen Hund. Ich suche …«
»Doch, das tun Sie!«
Born musste lachen. »Und wie kommen Sie darauf?«