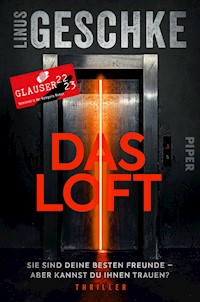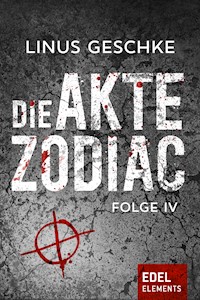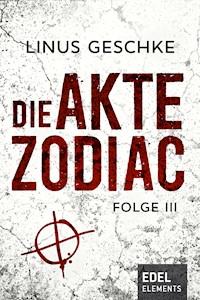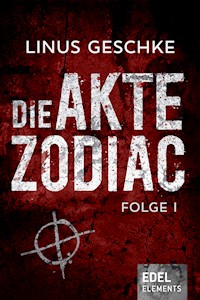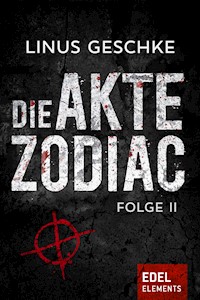9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Born-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Zeit der Rache Wenn der Wanderer kommt, sterben Menschen. Elf in Tannenstein, einem abgelegenen Ort nahe der tschechischen Grenze. Ein Tankwart im Harz, eine Immobilienmaklerin aus dem Allgäu. Der Killer kommt aus dem Nichts, tötet ohne Vorwarnung und verschwindet spurlos. Der Einzige, der sich ihm in den Weg stellt, ist Alexander Born: ein Ex-Polizist mit besten Kontakten zur Russenmafia. Einst hatte der Wanderer seine Geliebte getötet, jetzt will Born Rache – und wird Teil einer Hetzjagd, die dort endet, wo alles begann: Tannenstein. »Mehr als nur ein blutiger und sprachgewaltiger Thriller. Fast schon eine Sensation!« Verena Thies, Bayrischer Rundfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Linus Geschke
Tannenstein
Thriller
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Es sind die Tage der Dunkelheit, der fallenden Blätter und der länger werdenden Schatten. Tage, in denen das Licht verzweifelt gegen die aufkommende Finsternis kämpft, das Gute gegen das Böse.
Herbsttage.
Tannenstein, nahe der deutsch-tschechischen Grenze
Niemand kam in das Dorf, zumindest nicht zufällig. Es lag dreißig Kilometer südlich von Dresden, kurz vor der tschechischen Grenze, und es gab hier keine Touristenattraktion, keine Ausflugsorte und keine Bundesstraße, die zu bekannteren Zielen führte. Tannenstein lag am Ende eines lang gezogenen Tals, dicht umschlossen von dunklen Wäldern. Hier kam man nur hin, weil man hier wohnte oder jemanden besuchen wollte, der hier wohnte. Und wenn man kam, kam man mit dem Auto.
Der Wanderer kam zu Fuß, an einem kalten Spätherbstmorgen und zu einer Zeit, als der Nebel gerade von den ersten zarten Sonnenstrahlen vertrieben wurde. Er trug klobige Schuhe und eine dunkelblaue Jeans, dazu ein Flanellhemd mit Karomuster und einen großen Rucksack, wie ihn Backpacker benutzen. Die Einwohner Tannensteins, die gerade ihre Frühstücksbrötchen beim Bäcker holten, schauten ihn aus zusammengekniffenen Lidern misstrauisch an. Ihre Gesichter erinnerten ihn an Ratten, die man ins Freie gescheucht hatte und die jetzt schnell wieder zurück ins Dunkle wollten, wo sie sich weiterhin ein Leben in Sicherheit vorgaukeln konnten.
Niemand sprach ihn an.
Dem Wanderer war das nur recht. Er wollte nicht reden. Nicht über sich und nicht über seine Vergangenheit. Seine Erfahrungen trug er sowieso stets bei sich, gebündelt in einem zweiten, unsichtbaren Rucksack, dessen Last seine Schultern nach unten zog.
Auf dem in der Sonne liegenden Dorfplatz blieb er stehen und schaute sich um. Die kleinen Straßen, die alten Häuser, die umliegenden Wälder. Er sah unebenes Kopfsteinpflaster und über Fassaden verlaufende Elektroleitungen. Keine bunten Farben, keine Blumen vor den Fenstern, nur schmutziges Weiß und eintöniges Grau. Der Ort wirkte wie ein vom restlichen Deutschland abgekapselter Kosmos, verloren gegangen zwischen gestern und heute.
Drei Tage lang wohnte er in dem einzigen Haus des Dorfes, das Fremdenzimmer vermietete, dann hatte er etwas Besseres gefunden. Eine Blockhütte am Ortsrand, die irgendwelche Städter verkaufen wollten, nachdem sie festgestellt hatten, dass diese Gegend nichts bot, was einen mehrtägigen Aufenthalt lohnte. Sie und die Vermieterin des Fremdenzimmers waren anfangs auch die Einzigen, die seinen Namen kannten, zumindest den, der in den Papieren stand.
Der Wanderer verbrachte die Tage damit, durch dunkle Wälder zu streifen, über Hügel und Täler hinweg bis in eine Gegend, in der die Fahrzeuge schon tschechische Nummernschilder hatten. Er las viel, mindestens zwei Bücher pro Woche, und ein Kopfnicken genügte ihm zur Begrüßung, wenn er in dem kleinen Supermarkt des Ortes Lebensmittel kaufte. Ansonsten hielt der Fremde sich von allem fern. Er aß nichts in der Dorfkneipe und ging dort auch nichts trinken. Anfangs hatten die Einheimischen ihn noch interessiert beobachtet; diesen Mann, der weder alt noch jung war, dessen Schultern und Brustkorb muskulös wirkten und dessen dunkelblonde Haare bereits von den ersten grauen Strähnen durchzogen waren. Sein Gesicht war hinter einem Vollbart verborgen, und Erika Pohl, die pensionierte Dorfschullehrerin, meinte später, dass er ein wenig wie der Hauptdarsteller aus der Serie Der letzte Bulle ausgesehen habe.
Dann war der Winter gekommen, anschließend ein Frühling und ein Sommer, und die Aufmerksamkeit der Einwohner hatte nachgelassen. Er war zu einem Teil des Dorfes geworden, aber nicht der Gemeinschaft. Fast wie ein Straßenschild, das die Behörden aufgestellt hatten und das man anfangs noch beachtete, bis man sich irgendwann so an seinen Anblick gewöhnt hatte, als wäre es schon immer da gewesen.
Der Mann zahlte seine Einkäufe stets in bar, und manchmal verschwand er für mehrere Tage, was allerdings kaum jemandem auffiel. Die Dorfbewohner ließen ihn gewähren, und als ein Jahr vergangen war, betrat er zum ersten Mal die Kneipe am Markplatz, in der sich das soziale Leben abspielte.
Es war wie ein Donnerschlag.
Die Gespräche verstummten, und die Köpfe drehten sich in seine Richtung. An der Tür hatte Geschlossene Gesellschaft gestanden, es war der Stammtischabend des Kulturvereins, aber keiner machte ihn darauf aufmerksam, dass er nicht dazugehörte.
Der Wanderer nickte den elf Gästen wortlos zu, dann stellte er sich an die Theke und ließ sich ein Pils kommen. Als der Wirt das Bier vor ihm abstellte, nahm er das Glas in die Hand, trank einen großen Schluck und wischte sich den Schaum von der Oberlippe.
Die anderen Gäste beobachteten ihn fasziniert, als wären sie gerade Zeugen eines Wunders geworden, als hätten sie soeben ein Fabeltier gesehen. Sieben illusionsfreie Männer und vier desillusionierte Frauen, und jeder von ihnen hatte eine eigene Theorie, was es mit dem Fremden auf sich hatte. Einige mutmaßten, er sei ein Verbrecher. Ein Krimineller, der aus dem Gefängnis entlassen sei und hier ein neues Leben beginnen wolle. Nein, sagten sich die anderen, wahrscheinlich hat er nur eine tragische Ehe hinter sich und will jetzt, enttäuscht von der Liebe und den Menschen, sein Dasein als Einsiedler fristen. Es waren besonders die Frauen des Dorfes, die zu dieser Version neigten, wahrscheinlich auch, weil sie ihn attraktiv fanden.
Den Wanderer scherte dies nicht. Er trank sein Bier und bestellte anschließend ein zweites. Dann sah er sich um. Die Wände der Kneipe waren holzvertäfelt, die Tische in Fensternähe von der Sonne gebleicht. Plastikblumen in kleinen Vasen standen darauf, ebenso gläserne Streuer für Pfeffer und Salz.
Direkt vor ihm, über der vor der Längswand stehenden Theke, baumelten Lampen mit Keramikschirmen, die mit ländlichen Motiven bemalt waren und aus denen das Licht seitlich aus kleinen Löchern fiel. Nichts hier erinnerte an die Gegenwart, selbst die Zapfanlage war alt, und natürlich hatte man in der Kneipe keinen Handyempfang, wie der Wanderer mit einem Blick auf sein Smartphone feststellte – für die Anwesenden der erste Beweis, dass der Fremde noch mit einem anderen Leben verbunden war.
Das zweite Bier trank er dann langsamer, genussvoller, und ihm wurde bewusst, dass er diese Gegend vermissen würde. Besonders die Nachmittage, wenn die untergehende Herbstsonne das Land zum Glühen brachte. Er genoss die Abgeschiedenheit, wenn er in der Natur unterwegs war, der Waldboden unter seinen Füßen knirschte und die Eichhörnchen höher gelegene Baumbereiche aufsuchten, von wo aus sie ihn aus sicherer Entfernung beobachten konnten. Mehrmals schon hatte er Rehe und Hirsche gesehen, einmal sogar einen Wolf, und der Anblick hatte ihn erfreut. Das Raubtier war ihm ebenso stark wie scheu vorgekommen – fast erinnerte es ihn an sich selbst.
Dann zahlte er.
Er stand auf, nickte den Gästen zu und schritt langsam zur Tür. Es war jetzt kurz nach zweiundzwanzig Uhr, und wie immer steckte der Schlüssel von innen im Türschloss, obwohl der Wirt noch nicht abgeschlossen hatte.
Der Wanderer erledigte dies für ihn.
Trennte die Welt im Inneren der Kneipe mit einer knappen Umdrehung von ihrer Umwelt ab und griff in die Jackentasche. Als seine Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie eine Glock 17 umschlungen, Halbautomatik, Kaliber neun Millimeter, Magazin mit siebzehn Schüssen.
Genug.
Er hatte die Waffe zuvor mit Bedacht gewählt. Der eingebaute Kompensator machte sie bei schnellen Schussfolgen leichter kontrollierbar, was ein exakteres Trefferbild ermöglichte. Pistolen waren etwas, das ihm völlig natürlich vorkam; über die Jahre waren sie zu einem verlängerten Teil seines Arms geworden.
Dann drehte er sich um, und die Hölle öffnete ihre Pforten.
Sein erster Schuss traf mitten in die Stirn des Mannes, der der Tür am nächsten saß. Die folgenden Schüsse die beiden Männer dahinter. Knochensplitter flogen durch die Luft, Gehirnmasse trat aus, ein warmer Sprühnebel färbte das Gesicht einer etwa vierzigjährigen Frau rot.
Sie starb als Vierte.
Erst jetzt brach in dem Lokal Panik aus. Erst jetzt begriffen die anderen Gäste, was gerade geschah. Sie sprangen auf, schrien und flehten und suchten verzweifelt nach Deckung.
Es gab keine.
Nummer fünf starb, als er in Richtung der Toiletten lief. Der sechste Schuss des Wanderers ging daneben und blieb in der Holztheke stecken. Dann stürmte ein Mann Anfang fünfzig, kurz rasierte Haare, das Gesicht wie eine Bulldogge, auf ihn zu. Vielleicht sah er keinen anderen Ausweg; vielleicht dachte er, er hätte eine Chance.
Er hatte keine.
Der siebte Schuss traf ihn seitlich in den Hals, genau auf Höhe des Adamsapfels. Er stürzte zu Boden. Das Blut pumpte in Wellen aus der Wunde. Unter seinem Körper breitete sich eine rote Pfütze aus, in die seine komplette Lebensenergie floss.
Der vorletzte Mann hatte sich hinter einer Bank versteckt und wimmerte. Unter ihm: eine nach Ammoniak riechende Pfütze Urin, die schnell größer wurde. Der Wanderer ging näher, setzte ihm die Waffe an den Hinterkopf und drückte ab. Sah, wie der Schädel explodierte, dann erledigte er den letzten Mann an der Theke.
Anschließend schaute der Fremde sich um und zog Bilanz. Sieben Männer waren tot, drei Frauen waren noch übrig. Er war gnädig und tötete sie schnell. Mit peitschenden Schüssen, abgefeuert ohne Zaudern.
Dann wendete der Mann sich dem Wirt zu, der ihn mit Augen ansah, in denen nichts als Angst und Unverständnis stand. Er rührte sich nicht. Stand stumm an die Wand gedrückt, war wie paralysiert.
»Haben wir ein Problem miteinander?«, wollte der Wanderer wissen. Seine Stimme klang rau, fast schon heiser.
Benommen schüttelte der Wirt den Kopf.
»Gut«, sagte der Fremde. »Das ist gut.«
Dann drehte er sich um und ging.
Der Wanderer wusste, dass es sicher zehn, wahrscheinlich jedoch zwölf bis fünfzehn Minuten dauern würde, bis der erste Streifenwagen den Ort erreichte. Mehr als genug Zeit für das, was er noch tun musste.
Er lief lockeren Schrittes zu seiner Hütte, wo er alles, was ihm gehörte, zuvor gesammelt und mit Benzin übergossen hatte. Als er dort angekommen war, griff er nach dem Sturmfeuerzeug in seiner Hosentasche, knipste es an und warf es durch die offen stehende Tür ins Innere. Verfolgte die bogenförmige Flugbahn mit einem Lächeln im Gesicht.
Kurz darauf züngelten die Flammen wie gierige Mäuler empor. Es würde nur Minuten dauern, bis die Hütte vollständig im reinigenden Feuer aufging und dann zusammenfiel wie das letzte Monument einer untergehenden Kultur.
Einige Sekunden lang genoss der Wanderer die Hitze auf dem Gesicht, dann drehte er sich um und lief auf den nahe gelegenen Waldrand zu. Abgefallene Äste knackten unter seinen Füßen, kleine Steinchen knirschten. Er bewegte sich ebenso zügig wie vorsichtig durch die Nacht. Wurzeln und Löcher stellten Stolperfallen im Unterholz dar, und ein verstauchter Fuß war das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte.
Zwanzig Minuten später war er sich sicher, dass er die tschechische Grenze überquert hatte. Fünfzehn weitere Minuten, und er würde auch den kleinen Ort erreicht haben, in dem er vor mehr als einem Jahr einen Stellplatz gemietet hatte. Seitdem war er alle zwei Wochen hier gewesen, um das dort geparkte Fahrzeug zu bewegen, damit er sicher sein konnte, dass die Batterie geladen war und der Wagen problemlos ansprang, wenn er ihn brauchte.
Er lief immer weiter, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen. Hielt den Blick konzentriert auf den Boden gerichtet, auf die dicht stehenden Bäume vor ihm. Er dachte nicht mehr an das, was hinter ihm lag.
Warum auch?
Es war getan.
Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel Drei Jahre später, Gegenwart
Der Tag, der alles veränderte, begann mit einem Klopfen gegen die Zellentür. Alexander Born schwang die Füße von der Matratze und setzte sich auf. Sein Zuhause auf Zeit war zwei Meter sechzig lang, zwei Meter zehn breit und zwei Meter vierzig hoch. Ein Tisch, ein Stuhl und glatt verputzte Wände, aus denen die Toilette und ein Waschbecken wie Geschwüre aus Keramik ragten.
Er hatte sich seit Stunden nicht bewegt und nur den Geräuschen gelauscht, die in jedem Gefängnisbetrieb zum Alltag gehörten: das Scheppern der Stahltüren, das Rasseln der Schlüssel, das Rauschen der Toilettenspülungen. Er hatte Libanesen gehört, die sich durch die Fenstergitter unterhielten, einen voll aufgedrehten Fernseher und das Weinen des Jungen in der Zelle nebenan.
Nichts, was ihn kümmerte.
Das Schlimmste an einem Gefängnisaufenthalt waren nicht die Langeweile oder der Lärm, der einem permanent in den Ohren hallte. Was ihm wirklich zu schaffen machte, war die Abgeschiedenheit von der Außenwelt. Er war handlungsunfähig, und die Welt draußen drehte sich, während seine eigene stillstand. Innerhalb der Betonmauern diktierten gelangweilte Wärter seinen Alltag. Leute, die ihn mit tonloser Stimme ansprachen und ihm nie in die Augen sahen, als befürchteten sie, ihm nur durch einen Blickkontakt eine gewisse Menschenwürde zuzugestehen.
Die meiste Zeit passierte in diesem abgeschlossenen Kosmos gar nichts. Kurz nach seiner Inhaftierung hatten ihn drei Albaner zusammenschlagen wollen, nachdem sie erfahren hatten, dass er Polizist gewesen war. Er hatte dem ersten das Jochbein gebrochen, dem zweiten die Kniescheibe, woraufhin der dritte die Flucht ergriff, bevor er sich auch um ihn kümmern konnte. Seitdem war Ruhe. Kein Ärger mehr mit anderen Insassen, keine sexuellen Annäherungsversuche unter der Dusche.
Nur noch Warten.
Anfangs hatte Born sich noch Gedanken gemacht, auf was genau er eigentlich wartete, dann war ihm klar geworden, dass es immer nur die nächste Mahlzeit war, der nächste Gang zur Toilette oder die nächste Hofrunde, bei der er den Blick heben und zu einem der Bäume blicken konnte, die stolz hinter den Gefängnismauern aufragten. Irgendwann wusste er nicht mehr, welcher Wochentag gerade war, dann war es ihm mit den Monaten genauso ergangen.
Bis es gegen die Zellentür hämmerte.
Bis er das Klappern von Schlüsseln hörte, das Schnaufen eines Mannes.
Die Tür öffnete sich, und ein glatzköpfiger Beamter forderte ihn auf, mitzukommen. Sie folgten endlosen Gängen, deren Farbe Born an frisch Erbrochenes erinnerte, während Türen und Gitter geöffnet und nach ihnen wieder geschlossen wurden. Vor einem Raum, der normalerweise für Anwaltsgespräche bestimmt war, blieb der Justizbeamte stehen und wischte sich etwas Imaginäres von der Schulter. Es konnten weder Haare noch Schuppen sein, da er beides nicht hatte. Dann löste er seinen Schlüssel vom Gürtel, öffnete die Tür und bedeutete Born, einzutreten.
Borns Blick fiel auf eine Frau, die mit dem Rücken zum Fenster saß und ihn neugierig musterte. Sie war noch jung, Ende zwanzig vielleicht. Schulterlange blonde Haare, eine zarte Gestalt und dunkelblaue Augen. Irgendwie erinnerte sie ihn an die Lieblingspuppe eines kleinen Mädchens, mit der nie gespielt wurde, weil man Angst hatte, sie könnte dabei kaputtgehen.
Bekleidet war die Blondine mit einer dunklen Jeans und einer hellblauen Bluse. Ein sandfarbener Blazer hing hinter ihr über der Stuhllehne, und Born wusste sofort, dass sie Polizistin war. Als wenn ein Geruch von ihr ausgehen würde, den er immer noch wittern konnte.
Bis jetzt hatten seine ehemaligen Kollegen stets einen Mann geschickt – vielleicht wollten sie ja mal etwas Neues ausprobieren.
Langsam ging er auf sie zu und setzte sich auf den Stuhl gegenüber. Betrachtete sie intensiver. Sie sah gut aus, selbst im kalten Glanz des Neonlichts – ein Eindruck, der allerdings der langen Haftzeit geschuldet sein konnte, die hinter ihm lag.
Auch die Polizistin blickte ihn wortlos an, und der Raum mit den nackten Betonwänden schien die Stille noch zu vergrößern, die zwischen ihnen herrschte. Vielleicht wusste sie nicht, wie sie anfangen sollte, vielleicht war sie zu unerfahren, um mit einer solchen Situation souverän umzugehen.
Er beschloss, ihr auf die Sprünge zu helfen.
»Nachdem wir uns jetzt ausgiebig betrachtet haben: Was kann ich für Sie tun?«
»Ich bin Polizeioberkommissarin Norah Bernsen«, sagte sie mit einer Stimme, die eine Nuance dunkler klang, als er erwartet hatte. »Wir haben wieder eine Postkarte erhalten. Wie an jedem Jahrestag der Morde in Tannenstein.«
»Und?«
»Sie und Peter Koller waren damals die Leiter der Sonderkommission. Man hatte sie nach Dresden geschickt, um den Mann zu fassen, den sie den Wanderer nennen.«
»Da frage ich doch noch einmal: Und?«
Ihre Augenlider zuckten. Anstatt zu antworten, griff sie in ihre Umhängetasche und holte eine Postkarte heraus, die in einer durchsichtigen Plastikhülle steckte.
Er nahm sie entgegen und betrachtete sie. Wie in den Jahren zuvor war auf der Vorderseite ein Wanderer abgebildet – der Grund, warum die Ermittlungsbehörden den unbekannten Killer intern so genannt hatten. Auf der Rückseite stand wie immer nur ein Wort: Tannenstein. Den verschmierten Poststempel konnte er nicht entziffern.
»Wo wurde die Karte abgeschickt?«, fragte er.
»In Elbingerode. Ein kleiner Ort im Harz.«
Er gab sie ihr wieder. Die erste Karte war in Karlsruhe abgestempelt worden, die zweite in Frankfurt am Main. Diese hier war die dritte. Allesamt Orte, die mit der Tat nichts zu tun hatten und die der Täter wahrscheinlich nur zufällig ausgewählt hatte.
»Das ist alles, was Sie haben?«
Sie nickte.
»Was ist mit Lydia?«
Eine kurze Pause. Dann: »Leider kann ich Ihnen nichts Neues erzählen. Die Ermittlungen stocken. Tut mir leid.«
Anfangs war Lydia Wollstedt seine Kollegin gewesen, später seine Geliebte, bis der Wanderer ihr Leben im Berliner Tiergarten ausgelöscht hatte. In einer unheilvollen Nacht, einfach so. Sie war der Grund, warum er hier drinnen war, und ihr Tod der Grund, warum er hier rauswollte.
Neben ein paar anderen, vielleicht.
»Was ist mit Ihrem Vorgänger?«, wollte er dann wissen.
»Bitte?«
»Mit dem älteren Beamten, der die letzten Jahre hier war. Der war gut. Sie dagegen sind schlecht. Plump und wenig empathisch. Hat man Ihnen auf der Polizeischule nicht beigebracht, wie man Verhöre führt?«
Wieder das Zucken der Augenlider. »Wolfgang Liebknecht wurde vor drei Monaten pensioniert«, sagte sie dann. »Tut mir leid, wenn ich Ihren Ansprüchen nicht genüge, aber vielleicht tröstet es Sie ja, dass es mir umgekehrt genauso geht.«
Anschließend schaute sie sich um, als wenn es in dem Raum etwas Besonderes zu sehen gäbe. »Scheußlich hier – aber wenn man die Jahre gemeinsam mit den besten Kumpeln verbringt, vergeht die Zeit wahrscheinlich wie im Flug.«
Schau an, dachte er: Sie versucht, mich zu provozieren. Vielleicht war sie doch nicht so untalentiert, wie er anfangs vermutet hatte.
»Was wollen Sie?«, fragte er dann. »Ich habe mit Peter Koller die Ermittlungen geleitet und alles, was wir herausgefunden haben, steht in den Akten. Lesen Sie sie. Mich interessiert Tannenstein nicht mehr.«
»Ich dachte, Sie wären zumindest an der Festnahme von Lydias Mörder interessiert. Oder ist Ihnen Ihre ehemalige Partnerin auch egal geworden?«
Übertreib es nicht, dachte er. Fang mit mir keine Spielchen an, die du nicht beherrschst.
»Lydia ist tot, und Sie wissen rein gar nichts über sie«, erwiderte er. »Der Wanderer hat sie zu einer Zeit getötet, als ich bereits im Gefängnis saß, und hätten Sie und Ihre Kollegen Ihren Job besser gemacht, könnte sie immer noch leben.«
»Sie meinen diese Russengeschichte, von der sie kurz vor ihrem Tod gesprochen hat? Ich habe davon gehört. In meinem ersten Jahr im Kommissariat, als Sie … nun ja, schon nicht mehr da waren. Lydia und ich kannten uns nicht besonders gut, aber sie war eine Kollegin, und ihr Tod hat mich nicht ungerührt gelassen.«
Er erwiderte nichts.
»Okay«, sagte sie nach einer kurzen Pause. »Ich wollte nur, dass Sie das wissen.«
Wieder sagte er nichts. Dann: »Passen Sie auf, Frau …?«
»Bernsen ist mein Name. Norah Bernsen.«
»Gut, Frau Bernsen. Wir machen jetzt Folgendes: Ich gehe wieder in meine Zelle und sitze die letzten Wochen auf einer Arschbacke ab. Sie trollen sich in Ihr armseliges Büro und versuchen, das zu tun, wofür Sie bezahlt werden. Wenn Sie Lydia gekannt haben, sollte es Ihnen ja nicht an Motivation mangeln. Was halten Sie davon?«
Er rechnete damit, dass sie aufstehen und das Gespräch beenden würde. Sie tat es nicht. Stattdessen starrte sie auf die Tischplatte und sagte leise: »Darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen?«
Sie waren alle gleich. Alle diese Beamten, die sie bislang geschickt hatten. Immer ging es letztendlich um das Warum.
Bevor Norah Bernsen weiterreden konnte, schüttelte er den Kopf. »Sie würden es nicht verstehen.«
»Versuchen Sie’s«, forderte sie ihn auf. »Lydia hat Sie immer in den höchsten Tönen gelobt, und Sie sind nicht der erste Polizist, der kriminell geworden ist.«
»Gilt das auch für Sie?«
»Nein«, sagte sie entschlossen. »Aber auch ich habe schon Dinge getan, die sich mit den Dienstvorschriften nicht vereinbaren ließen.«
»Ach … Dann glauben Sie also, dass der Unterschied zwischen uns ein gradueller und kein kategorischer ist?«
Jetzt schwieg sie.
Natürlich konnte sie es nicht verstehen.
Wie auch?
Für seine ehemaligen Kollegen war Born nur ein krimineller Ex-Polizist, der denen das Geld abgenommen hatte, die er sowieso für den Abschaum der Gesellschaft hielt. Er hatte Dealern das Koks geraubt, Einbrechern die Beute und Zuhältern das Bargeld. Das Einzige, was er bereute und was ihn innerlich zerriss, war der Umstand, dass er Lydia nicht hatte helfen können, als sie drei Monate nach seiner Verhaftung auf den Wanderer traf. Als dieser das Leben der einzigen Frau auslöschte, die Born je geliebt hatte.
Seit er von seinem Ex-Partner die Nachricht über Lydias Tod erhalten hatte, war alles anders geworden. Früher war er ein Mann mit Zielen gewesen, mit Wertvorstellungen und Träumen. Er hatte Filme mit Sean Penn geliebt, war gerne Rad gefahren und hatte gutes Essen zu schätzen gewusst. Jetzt war sein Leben auf ein einziges Ziel reduziert, und nichts und niemand würde ihn aufhalten können, wenn es so weit war. Schon gar nicht diese unerfahrene Polizistin.
Norah Bernsen schaute ihn weiterhin fragend an, wohl immer noch auf eine Antwort hoffend. Er dagegen konzentrierte sich auf das laute Ticken der Bahnhofsuhr, die an der beigefarbenen Wand hing. Vielleicht, so dachte er, hing sie nur dort, damit ihr Geräusch den Insassen klarmachte, dass auch ihre Zeit irgendwann abgelaufen war.
Bevor das Schweigen peinlich wurde, sagte er: »Ich glaube, wir sind hier fertig.«
Norah Bernsen öffnete den Mund, als wollte sie antworten, und schloss ihn wieder. Ordnete anschließend ihre Unterlagen und packte sie in die Tasche, ohne ihn noch einmal anzusehen.
Born schaute ihr ein paar Sekunden lang zu, dann erhob er sich und signalisierte dem Vollzugsbeamten hinter der Glasscheibe, dass er zurück in die Zelle wollte.
»Herr Born?«
Ihr Ruf erreichte ihn im letzten Moment.
»Ich glaube nicht, dass Sie all dem so gleichgültig gegenüberstehen. Sie haben hier jede Menge Zeit gehabt, um über den Fall nachzudenken. Ist Ihnen denn gar keine Idee gekommen, hinter wem Ihre Kollegin her war? Haben Sie gar keinen Verdacht, wer oder was hinter den Morden in Tannenstein stecken könnte?«
Er legte den Kopf schief und sah sie an. Die blonden Haare, glänzend und weich wie Honig. Das Blau ihrer Augen, das so perfekt zu dem Oberteil passte. Die Körperhaltung, in der gleichzeitig Energie und Kraft zum Ausdruck kamen.
»Suchen Sie nach einem russischen Killer«, antwortete er. »Halb menschlich, halb göttlich und ganz und gar tödlich.«
»Was soll das denn jetzt heißen?«
»Sie sind die Polizistin. Finden Sie’s raus!«
Zwanzig Tage später schlossen sich die Türen der Haftanstalt endgültig hinter Born. Der Pförtner wünschte ihm zum Abschied alles Gute, wobei er mit einem dümmlichen Grinsen betonte, dass er aus gegebenem Anlass lieber auf die Floskel »auf Wiedersehen« verzichten würde.
Dann war Born allein.
In Freiheit.
Die ersten Minuten waren irritierend. Zu viele Geräusche, zu viele Möglichkeiten. Er brauchte einen Moment, um sich zu orientieren, und ließ den Blick über einen Himmel streifen, der tiefblau wie das Mittelmeer war. Keine Betonmauern mit NATO-Draht mehr, die den Blick auf alles verstellten, was das Leben ausmachte. Keine Zellentür, die ihn von seinem Weg abhalten konnte. Auf eine sonderbare Art begannen sich die Erinnerungen an die Haftzeit schon aufzulösen. Nicht so, als würden sie langsam verblassen, sondern so, als hätte es sie nie gegeben. Als wären die letzten Jahre nur ein Albtraum gewesen, aus dem er jetzt Stück für Stück erwachte.
Dann schulterte er seine Tasche und schlug den Weg zur Holzhauser Straße ein, von wo aus er mit der U6 bis zur Haltestelle Friedrichstraße fuhr.
Berlin Mitte.
Seine alte Heimat.
Keine hundert Meter entfernt hatte er die Grundschule besucht, als Dreizehnjähriger das erste Flaschenbier in einem Kiosk gekauft. Er war nach einem wilden Fahrradsturz in der Notaufnahme des nahe gelegenen St.-Hedwig-Krankenhauses zusammengeflickt worden, hatte auf dem Sportplatz Fußball gespielt und als Jugendlicher nachts mit Freunden im Hinterhof gekifft, während sie gemeinsam auf den Sonnenaufgang warteten.
Das hier war sein Kiez, sein Revier. Es gab keinen besseren Ort, um sein Leben wieder auf Anfang zu stellen.
Er ließ sich mit den Massen treiben und roch den Abgasgeruch vorbeifahrender Busse, den Parfümduft der gut gekleideten Frauen. Alles kam ihm neu und gleichzeitig vertraut vor. Wie ein Film, den man einst geliebt und dann jahrelang nicht mehr gesehen hatte.
Mitten auf dem Gendarmenmarkt blieb er stehen und zündete sich eine Zigarette an. Dachte nach. Die letzte Spur des Wanderers hatte es hier gegeben, in Berlin. Der Mord an Lydia lag drei Jahre zurück, und der Killer konnte mittlerweile überall sein. Born wusste, dass es schwierig sein würde, ihn jetzt noch aufzuspüren. Schwierig, aber nicht gänzlich unmöglich. Für Lydia hatte er damals viele Grenzen überschritten, und jetzt würde er noch weitergehen. Er würde den Mann jagen, der es gewagt hatte, ihm das Wertvollste zu rauben, das er je besessen hatte.
Ihn hetzen und aufspüren.
Ihn fühlen lassen, was wahres Leid bedeutete.
Norah Bernsen riss sich die Schuhe von den Füßen und schleuderte sie stöhnend in die Ecke. Dann schaltete sie die Kaffeemaschine ein und ließ sich mit Borns Personalakte, die sie unerlaubterweise aus dem Präsidium mitgenommen hatte, auf die Couch fallen. Zupfte nachdenklich an den roten Gummibändern, mit denen die Akte zusammengehalten wurde. Sie goss sich eine Tasse Kaffee ein, schlug die Akte auf und begann zu lesen.
Laut den Unterlagen war Born ein exzellenter Polizist gewesen, ein brillanter Ermittler. Jemand, der zwar unorthodox agierte, damit aber Erfolg hatte. Weiterhin entnahm sie der Akte, dass er vor Jahren einen Zuhälter erschossen hatte, als er noch bei der Sitte gewesen war. In Notwehr, sagten die einen, vorschnell, meinten die anderen. Man hatte ihn anschließend einer Reihe von psychologischen Tests unterzogen, bei denen der Psychologe zu dem Urteil gekommen war, dass sich Born »gegenüber körperlicher Gewalt in hohem Maße desensibilisiert zeigt, was vor allem dadurch zum Ausdruck kommt, dass er von Gewalt als normalem Teil des täglichen Lebens spricht. Die Tötung eines anderen Menschen löst bei ihm keine erkennbaren Gewissensbisse aus. Wenn er erneut in eine Situation geraten würde, in der er sich oder andere mit einer Tötungswaffe verteidigen müsste, würde er ohne Zögern abdrücken, ohne dass es anschließend zu psychologischen Spätfolgen des Vorfalls kommen würde.«
Vor ihr entstand das Bild eines Polizisten, der am liebsten auf eigene Faust gehandelt hatte, sowohl bei der Sitte wie auch später bei der Mordkommission. Er war ein Desperado mit Dienstmarke gewesen, und Norah konnte nicht verstehen, wie er so lange damit durchgekommen war.
Sie schaute sich sein Dienstfoto an und rief sich die Begegnung mit ihm in Erinnerung. Er war ein gutaussehender Mann Ende dreißig, knapp eins neunzig groß, mit dunklen Haaren und breiten Schultern. Er hatte kräftige Hände und eine kleine Narbe auf dem linken Jochbein, die von einer Schlägerei aus seiner Jugendzeit stammte. Insgesamt wirkte er wie jemand, der wusste, was er wollte, und der alles tat, um es zu bekommen.
Sie fragte sich, ob Born damals tatsächlich geglaubt hatte, er würde mit seinem Doppelleben durchkommen. Ob er wirklich davon ausgegangen war, über dem Gesetz zu stehen und straffrei verraten zu können, wofür er von Rechts wegen einstehen sollte. Eigentlich war er ihr bei ihrem Besuch in der JVA nicht naiv vorgekommen, aber was wusste sie schon?
Norah Bernsen stand selbst auf dem Abstellgleis, zumindest kam es ihr so vor. Tannenstein lag rund zweihundertfünfzig Kilometer von Berlin entfernt, und alles, was sie mit dem Fall verband, war Alexander Born, der damals die Sonderkommission geleitet hatte – gemeinsam mit Peter Koller, der jetzt ihr Chef bei der Mordkommission war und in dieser Funktion alles tat, um sie beruflich kleinzuhalten.
Koller hatte ihr nur aufgetragen, Born über die neue Postkarte des Wanderers zu informieren, »der Ordnung halber«, und ihr klargemacht, dass sie mit dem Fall weiter nichts zu tun haben würde, obwohl er wusste, wie unterfordert sie sich fühlte. Schon seit Kindertagen hatte Norah Polizistin werden wollen, am liebsten bei der Kriminalpolizei. Sie wollte Verbrecher verhaften, die Welt ein Stück weit besser machen. Als sie vor anderthalb Jahren endlich ihr Ziel erreicht hatte, musste sie schnell feststellen, dass die meisten Mörder gar keine Verbrecher waren – zumindest nicht solche, wie man sie aus Filmen kannte.
In der Realität wurden Tötungsdelikte meist von armen Schweinen begangen, die anschließend heulend neben der Leiche hockten und immer wieder »Ich habe es nicht gewollt …« stammelten. Häufig waren es Alkoholiker oder Drogenabhängige, oftmals auch Leidtragende zerrütteter Ehen oder eines Streits, der jedes Maß verloren hatte. Ganz andere Gestalten als der Mann, der für die Tat in Tannenstein verantwortlich war. Er hätte ebenso gut einem Hollywoodfilm entspringen können: ein ominöser Täter, ein elffacher Mord, kein erkennbares Motiv. Norah schämte sich fast dafür, aber … es faszinierte sie auch.
Sie legte Borns Personalakte auf den Tisch und konzentrierte sich auf die sonderbare Entwicklung des Falls. Soweit sie dies beurteilen konnte, hatte die Sonderkommission damals gute Arbeit geleistet. Man war sämtlichen Spuren nachgegangen und hatte nichts unversucht gelassen, auch wenn sich jeder Ansatz als Schlag ins Leere entpuppte. Motiv und Täter lagen bis heute im Dunkeln, und die einzig verbleibende Spur – welch lächerlicher Begriff für einen Haufen Nichts – bestand aus den Postkarten, die der Mörder regelmäßig schickte und auf deren Rückseite immer nur ein Wort stand: Tannenstein. Als Absender war stets die Adresse angegeben, an der die niedergebrannte Hütte gestanden hatte, sowie der Name ihres letzten Mieters – ein falscher Name, den die Polizei den Medien nie mitgeteilt hatte, was darauf schließen ließ, dass der Absender Täterwissen besaß.
Die ganze Sache war unfassbar. Sieben Männer und vier Frauen waren innerhalb weniger Minuten ausgelöscht worden. Das jüngste Opfer war siebenunddreißig Jahre alt gewesen, das älteste zweiundsechzig. Nur zwei der Getöteten waren zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten, beides Nichtigkeiten, und beide Verfahren waren gegen die Zahlung eines Bußgelds eingestellt worden.
Und der Täter? Nichts als ein Schatten. Undeutlich und verschwommen nur, nichts Greifbares. Es gab keine Fotos von ihm, keine Fingerabdrücke und keine DNA-Spuren. Selbst das Bierglas, aus dem er in der Wirtschaft getrunken hatte, hatte er nach der Tat mitgenommen, und die Ermittler gingen davon aus, dass es in dem Feuer vernichtet wurde, das der Mörder anschließend in der Hütte gelegt hatte.
Natürlich, es gab Beschreibungen von ihm, eine ganze Reihe von Phantombildern. Aber die unterschieden sich so stark voneinander, dass der Wanderer praktisch jeder Dritte sein konnte. Wahrscheinlich musste er sich nur den Vollbart abrasieren, und die Zeugen würden ihn noch nicht einmal erkennen, wenn er auf der Straße an ihnen vorbeiging. Einig waren sie sich nur, dass er zwischen fünfundvierzig und fünfzig Jahre alt war, groß gewachsen und dunkelblonde Haare hatte.
Klasse, dachte Norah, und das, nachdem er ein Jahr lang in dem Ort gelebt hatte.
Dann trank sie einen weiteren Schluck Kaffee und verzog angewidert das Gesicht. Spuckte das bitter gewordene Gesöff wieder in die Tasse und überlegte, was es wohl über ihre Stellung in der Behörde aussagte, wenn man ausgerechnet sie zur Befragung eines Mannes schickte, der die letzten drei Jahre garantiert keine neuen Informationen über den Fall erhalten hatte.
Es war zum Kotzen.
Sie wusste natürlich, dass ihr persönliches Interesse an den Vorgängen in Tannenstein ein Fehler war, spürte aber gleichzeitig, dass sie nicht dagegen ankam. Sie ahnte, dass sie keine Ruhe finden würde, solange der Fall durch ihren Hinterkopf spukte. Seit sie das erste Mal von den Morden gehört hatte, hatte es sie zu diesem abgelegenen Ort gezogen, der von dunklen Wäldern umschlossen war. Sie hatte mit eigenen Augen sehen wollen, worüber sie bislang nur gelesen hatte. Die Häuser, die Menschen, den Tatort und den Platz, an dem die niedergebrannte Hütte gestanden hatte.
Außerdem war da noch Lydia. Es stimmte, was sie Born erzählt hatte: Sie hatte ihre erfahrenere Kollegin gerne gemocht, vielleicht sogar bewundert. Als die Nachricht von Lydias Tod sie erreichte, war es wie ein Faustschlag – wie immer, wenn eine Kollegin oder ein Kollege im Dienst den Tod fand.
Norah war klar, dass die Chance, Lydias Mörder zu fassen, Jahre später nur noch minimal war, aber damit konnte sie leben. Und wenn ihr Chef sie beruflich nicht ermitteln ließ, dann würde sie es eben privat tun. Direkt morgen würde sie einen Urlaubsantrag einreichen.
Warum auch nicht?
Überstunden hatte sie weiß Gott genug.
Nischni Nowgorod, Russland
Die Zwillinge entstiegen dem See wie Überlebende einer Apokalypse. Ihre Brustwarzen waren hart, die Penisse verschrumpelt. Sie schüttelten sich kurz und ließen das eiskalte Wasser an sich abtropfen. Gut zehn Minuten hatten sie in dem halb gefrorenen Gewässer ausgeharrt. Nicht, weil sie es mussten. Weil sie es konnten. Der beste Grund von allen.
Optisch glichen die Männer sich wie ein Ei dem anderen, was nicht nur an den genetischen Gemeinsamkeiten lag, sondern auch an ihren bartlosen Gesichtern und den blonden Haaren, die sie auf die gleiche Art und Weise trugen. Ein strenger Seitenscheitel, die Nacken millimeterkurz ausrasiert. Sie waren Mitte dreißig, Veteranen des Tschetschenienkrieges, und nur wenige Menschen kannten sie gut genug, um sie anhand der Unterschiede in ihrem Wesen auseinanderzuhalten.
Es war noch keine achtundvierzig Stunden her, dass Andrej und Sergej Wolkow in Russland angekommen waren. In dieser Zeit hatten sie drei Männer getötet, zweimal gegessen und die beiden Prostituierten gefickt, die in der nahe gelegenen Datscha auf sie warteten. Die beiden Nutten waren eine zusätzliche Belohnung für die Morde gewesen, neben dem Geld, das sie später von Koslow bekommen würden.
Keiner von ihnen war je zuvor in Nischni Nowgorod gewesen, jener Millionenstadt an der Wolga, die bis 1990 Gorki hieß. Zu Zeiten der Sowjetunion galt sie als Drehscheibe des russischen Handels und als bedeutende Industriemetropole, dann kam der Zusammenbruch des Imperiums, und die Stadt veränderte ihr Gesicht. Sie wurde zu einem der wichtigsten wissenschaftlichen und kulturellen Zentren Russlands, zu einem der Hauptziele des Flusstourismus.
Und wo es Tourismus gab, gab es Geld. Wo es Geld gab, gab es Prostitution. Warum die drei Mitglieder eines verfeindeten Kartells sterben mussten, wussten die Zwillinge nicht. Sie hatten einfach Koslows Befehl ausgeführt. Waren mit Maschinenpistolen zu dem angegebenen Hotel gefahren, hatten die Zimmertür aufgebrochen, in die schreckerstarrten Gesichter der Männer geblickt und abgedrückt. Ein schneller, harter Abgang. Den Koffer mit dem Geld hatten sie auf dem Tisch stehen gelassen, weil es nicht zu Koslows Auftrag gehörte, ihn mitzunehmen.
Nachdem der Großteil des Wassers von ihren nackten Leibern getropft war, trockneten sie sich gegenseitig mit den mitgebrachten Frotteehandtüchern ab. Sie taten es fast schon zärtlich, wie Liebende. Zuerst die Brust, dann den Rücken, anschließend die Genitalien und Beine. Zuletzt zogen sie ihre Schlappen und die weichen Bademäntel an. Der eine sagte etwas, das den anderen zum Lachen brachte.
Durch die hereinbrechende Nacht liefen sie Arm in Arm zu der Datscha zurück, um sich nochmals an den beiden Nutten auszutoben. Sie blieben bis zum Morgengrauen, dann verließen sie das Blockhaus wieder.
Nur sie.
Berlin
Als Borns Eltern vor acht Jahren bei einem Flugzeugabsturz in Honduras ums Leben gekommen waren, hatten sie ihm neben unzähligen Erinnerungen auch eine Eigentumswohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg hinterlassen, nicht weit vom Olympiastadion entfernt. Drei Zimmer, Küche, Diele, Bad, dazu ein Gäste-WC und ein Balkon, vom dem aus man einen schönen Blick in den efeuumrankten Garten hatte, der hinter dem Haus lag.
Es war eine ruhige und friedliche Straße, wenig Verkehr, kaum Lärm, und dennoch konnte Born in dieser Nacht lange nicht einschlafen. Er lag stundenlang im Bett und starrte die Decke an, während er darüber nachdachte, wie alles begonnen hatte.
Der Tag, an dem Born die Polizeiausbildung abgeschlossen hatte, war ein Frühlingstag gewesen, der Berlin in ein goldenes Licht tauchte. Einer dieser Tage, an denen alles zum Leben erwachte und aufblühte, in dieser ebenso herrlichen wie dreckigen Stadt, die wie ein einziges Versprechen wirkte. Er war so jung gewesen, so unbeschwert und voller Zutrauen in seinen Beruf. Er hatte tatsächlich gehofft, sich dem Bösen ein Stück weit in den Weg zu stellen.
Aber die Anfänge kannten das Ende nicht, und das Gute konnte sich das Böse nicht vorstellen.
Niemals wäre ihm in den Sinn gekommen, dass diese Stadt ihn irgendwann zermürben, der Job ihn verschleißen würde, dass seine Wertvorstellungen vom Irrsinn, vom Leid und vom Unglück, von all dem Zynismus um ihn herum zerrieben wurden. Auf den Straßen gab es so viele Verlockungen, überall, und als dann der richtige Auslöser kam, hatte er ihnen nachgegeben.
An das erste Mal konnte er sich noch bestens erinnern. Ein libanesischer Koksdealer in Spandau, hundertfünfzig Gramm, die einfach auf dem Tisch lagen. Ein unbeobachteter Moment. Das innere Zwiegespräch, dass die Drogen in der Asservatenkammer niemandem nützten, dass sowieso immer neue produziert wurden, die immer irgendwelche Leute verkauften, solange andere sie konsumierten. Warum sollten nur Verbrecher von diesem Kreislauf profitieren? Warum nicht er, Lydia oder Menschen, die es mehr verdienten als jene, die er beraubte?
Ihm war klar gewesen, dass Geld ein wichtiger Grund für sein Handeln war, aber beileibe nicht der einzige. Gib es zu, sagte er sich, du hast auch den Kick gebraucht, wenn du Kriminelle abgezockt hast, die Gefahr und die Angst, ertappt zu werden. Regeln haben dir immer weniger bedeutet, Gesetze ebenso. Du hast dich wie Superman gefühlt, unbesiegbar, unangreifbar. Ständig hat es eine neue rote Linie gegeben, die du überschritten hast, nur um dir dann selbst zu versichern, vor der nächsten stehen zu bleiben.
Dennoch war er immer weiter und weiter gegangen.
Und wofür?
Für sie. Für sich selbst.
Er riss sich von seinen Gedanken los und schaute wieder an die Decke. Wenn vor dem Fenster ein Auto vorbeifuhr, zogen die Scheinwerfer Lichtkreise darüber. Muster bildeten sich und verschwanden wieder. So monoton, dass er irgendwann das Denken einstellte und in einen hauchdünnen Schlaf fiel. Eine Art Dämmerzustand nur, der sich anfühlte, als läge er mit den Ohren unter Wasser in der Badewanne.
Als könnte er alles vergessen.
Am nächsten Morgen hämmerte hinter seinen Schläfen ein Kopfschmerz, den er mit zwei Aspirin und einem Glas Orangensaft in den Griff bekam. Dann duschte er, zog sich eine Jeans und ein weites Polohemd an und machte sich auf den Weg in den Grunewald – ein ausgedehntes Naherholungsziel, das von unzähligen Fuß- und Radwegen durchzogen war.
Zunächst folgte er der Havel in Richtung Süden, bis er das Waldhaus Havelchaussee erreichte. Dort setzte er sich auf eine Bank und streckte die Beine aus. Trotz des immer noch warmen Herbstwetters war es im Schatten der Bäume frisch, fast schon kühl. Nur vereinzelt drangen Sonnenstrahlen durch das nach wie vor dicht stehende Blätterdach, und Lichtformationen tanzten über das Erdreich. Das Herbstlaub breitete sich in leuchtenden Farben aus, eine Sinfonie in Rot, Gelb und Gold. Er genoss einen Moment lang die Stille und schaute den vorbeiziehenden Radfahrern nach, den Läufern und frisch verliebten Pärchen.
Auch mit Lydia hatte er hier schon gesessen und einen einfachen Filterkaffee getrunken, den sie sich in einer Thermoskanne mitgebracht hatten. Den ganzen Feinschmecker-Scheiß, den Menschen, die sich Baristas nannten, in irgendeiner Gourmetbude servierten, konnten sie eh nicht ausstehen. Immer musste man dort hinter irgendeinem Idioten in der Schlange stehen, der zehn Minuten brauchte, um den perfekten Latte macchiato zu bestellen. Meist irgendein vollbärtiger Hipster, der aussah wie ein Taliban mit gezupften Augenbrauen.
»Du bist so ruhig geworden«, sagte Lydia, als sie ihren Kopf gegen seine Schulter legte. »Was geht in dir vor?«
»Hast du schon einmal daran gedacht, dein bisheriges Leben aufzugeben und am anderen Ende der Welt neu anzufangen? Alles hinter dir zu lassen und bei Null zu beginnen?«
»Klar, wer hat das nicht? Aber das ist ein Gedanke, der nur in der Theorie funktioniert. In der Praxis nimmst du dein bisheriges Leben mit. Deine Erinnerungen, deine Erfahrungen. Du kannst nicht so tun, als hätte es sie nie gegeben, weil sie aus dir gemacht haben, was du heute bist.«
»Und wenn ich nur das Gute mitnehme und das Schlechte hinter mir lasse?«
»Ach, Baby!« Jetzt lächelte sie. »Wenn wir nur einen Teil von uns ausleben – was passiert dann mit dem Rest?«
Als Born die Augen wieder aufschlug, hatte der Besucherandrang nachgelassen. Es war stiller geworden. Minutenlang hörte er nur noch das Zwitschern der Vögel und das Rauschen der Blätter. Dann stand er auf und ging los. Hundert Meter hinter dem Waldhaus und abseits des Fußwegs stand der große Monolith, zu dem er wollte. Er war von dornigen Büschen umgeben, seine Form erinnerte an einen überdimensionalen Grabstein. Kein Fußgänger war mehr zu sehen, kein Radfahrer und auch kein Läufer.
Born bückte sich und befreite eine der Längsseiten des Steines vom Laub, woraufhin ein schmaler Spalt zum Vorschein kam. Zielstrebig grub er weiter, schaufelte die Erde Hand für Hand zur Seite und sah den Spalt größer werden. Als er ihm ausreichend erschien, griff er hinein und spürte ganz am Ende die Plastiktüte. Vorsichtig zog er daran, doch immer wieder verkeilte sich ihr Inhalt in dem Felsen. Er grub so lange, bis er die Tüte in Händen hielt. Sie war mit dem Logo eines bekannten Discounters versehen und mit stabilem Klebeband luftdicht verschlossen.
Wieder schaute er sich um, um sicherzugehen, dass niemand ihn beobachtete. Die einzigen Lebewesen, die er sah, waren kleine helle Vögel, die wie hochgewirbeltes Konfetti über den Tannen aufstiegen. Dann riss er die Tüte auf. Darin lagen, eingeschlagen in Ölpapier, eine matt glänzende P220 und vier Magazine. Die halbautomatische Pistole des deutschen Herstellers SIG Sauer hatte er vor Jahren einem Zuhälter abgenommen und behalten, nachdem er festgestellt hatte, dass sie bei keiner Behörde registriert war. Angst, dass der Zuhälter den Diebstahl anzeigte, hatte Born nicht gehabt, es sei denn, der Kerl wollte den diversen Anklagepunkten unbedingt noch einen weiteren wegen unerlaubten Waffenbesitzes hinzufügen.
Nachdem er den Spalt wieder geschlossen hatte, schob er die Pistole in den Hosenbund, steckte die Magazine ein und machte sich auf den Rückweg. Keine drei Meter entfernt hielt er plötzlich inne, drehte sich um und kehrte zurück. Hob die liegen gelassene Plastiktüte auf, um sie später in einem Abfalleimer zu entsorgen. Fast hätte er dabei über sich selbst lachen müssen; über die Merkwürdigkeiten menschlicher Handlungsweisen. Er hatte kein Problem damit, eine Waffe zu holen, mit der er einen Menschen töten wollte, aber ein achtlos in der Landschaft liegen gelassenes Stück Plastik bereitete ihm Gewissensbisse.
Nachdem er die Tüte im nächsten Mülleimer entsorgt hatte, verließ er den Grunewald, überquerte die B5 und erreichte auf der anderen Straßenseite die S-Bahn-Haltestelle Pichelsberg, wo er sieben Minuten später einen Zug bestieg, der ihn nach Spandau bringen sollte. Er löste einen Fahrschein, fand einen Platz am Fenster, setzte sich und sah die altbekannte Welt an sich vorüberziehen. Frauen, die Einkaufstüten trugen, Kinder, die Fußball spielten, und Männer, die von einem langen Arbeitstag ermüdet auf dem Weg nach Hause waren.
Die ganze Zeit über spürte er die Pistole unter seinem Polohemd. Ein gutes, vertrautes Gefühl, wenn auch ein wenig irritierend. So, als begegnete man einer ehemaligen Geliebten, deren Leidenschaft einen geradewegs ins Verderben führte.
Er war soeben den ersten Schritt auf einer langen Reise gegangen, auf der es kein Zurück gab. Weitere Schritte würden folgen, und sie würden ihn immer dichter ans Ziel führen, bis er endlich dem Mann gegenüberstand, der der Fixstern seines Handelns war. Um diesen Mann nach Jahren noch zu finden, würde er Informationen brauchen, die in keiner Dienstakte standen.
Und Born wusste, woher er sie bekam.
In einem Punkt hatte Norah Bernsen recht: Einen Großteil seiner Haftzeit hatte Born damit verbracht, über die Morde in Tannenstein nachzudenken – und darüber, dass das letzte Treffen mit seiner großen Liebe im Streit geendet hatte.
Drei Tage, bevor sie im Tiergarten erschossen wurde, hatte Lydia ihn im Gefängnis besucht. Er erinnerte sich immer noch an jede Einzelheit ihrer Begegnung, als wenn es gestern gewesen wäre: ihre leuchtenden Augen, ihre vor Aufregung geröteten Wangen. Lydias Stimme hatte ebenso enthusiastisch wie beschwörend geklungen, als sie ihm ihre Theorie mitteilte, die im Wesentlichen aus einem einzigen Satz bestand: Der Täter war ein Russe.
Aus ihrer Sicht gab es jede Menge Hinweise, die dafürsprachen. Beispielsweise ein unweit der Hütte gefundenes Buch, geschrieben in Kyrillisch. Die Reste einer Wodkaflasche, die die Spurensicherung in den niedergebrannten Überresten bergen konnte. Auch die Munition, die der Täter verwendet hatte, stammte aus russischer Produktion, und die Verkäufer der Hütte hatten angegeben, der Mann habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen.
Born hörte sich ihre Argumente mit verschränkten Armen an und unterbrach Lydia nicht. Dann äußerte er seine Zweifel. Vielleicht mit Worten, die barscher klangen, als er beabsichtigt hatte. Es gab keinen Beweis dafür, dass das gefundene Buch auch wirklich vom Besitzer der Hütte stammte. Wodka war kein russisches Vorrecht, und Munition, die aus Russland stammte, konnte man im Osten Deutschlands auf nahezu allen Flohmärkten kaufen.
»Und was ist mit dem Akzent des Täters?«, wollte Lydia wissen.
Born zuckte mit den Schultern. »Die Verkäufer der Hütte glauben also, er sei osteuropäisch. Andere Dorfbewohner verorten ihn in Südeuropa. Der Wirt der Kneipe meinte, er hätte überhaupt keinen Akzent gehört. So ist das manchmal mit Zeugenaussagen: drei Personen, drei Meinungen.«
Sie schaute ihn zornig an. »Du klingst jetzt schon wie Koller, aber bei ihm habe ich noch gedacht, es läge an seiner generellen Abneigung Polizistinnen gegenüber. Von dir dagegen hätte ich mehr Unterstützung erwartet.«
»Lydia, ich …«
»Vergiss es einfach – ich mache jetzt auf eigene Faust weiter, und wenn ich das nächste Mal komme, wirst du dich entschuldigen müssen! Du wirst sehen, dass ich recht hatte. Oder glaubst du, nur du wärst in der Lage, Spuren auszuwerten und Schlüsse zu ziehen?«
»Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube nur …«
Er argumentierte noch eine Zeit lang, aber sie ließ sich nicht beirren. Ein Wort gab das andere, und als sie wütend aufstand, tat er nichts, um sie zurückzuhalten. Er war von ihrer These einfach nicht überzeugt – bis die Kugeln des Wanderers ihre Glaubwürdigkeit erhöhten.
Nach der Mitteilung über Lydias Tod war seine Welt in sich zusammengebrochen, und es hatte lange gedauert, bis er sich eine neue aufgebaut hatte. In dieser würde er keine Richter und Staatsanwälte mehr brauchen, keine gerichtsverwertbaren Beweise und keine Suche nach mildernden Umständen.
Das Urteil stand jetzt schon fest.
Nur der Täter fehlte noch.
Dimitri Saizew betrieb ein russisches Spezialitätenrestaurant im Stadtteil Köpenick, keine fünfzig Meter von der Spree entfernt. Die Vergangenheit des Neunundfünfzigjährigen war ebenso schillernd wie geheimnisvoll. Sicher war nur, dass Saizew bis 1989 für den KGB gearbeitet hatte und in den Westen kam, als die Grenzen der DDR geöffnet wurden. Seitdem hatte der Verfassungsschutz mehrmals gegen ihn ermittelt, ebenso das für Organisierte Kriminalität zuständige Dezernat der Berliner Kriminalpolizei. Er war insgesamt siebenmal festgenommen worden, wurde aber nie unter Anklage gestellt.
Born hätte Saizew nicht als Freund bezeichnet, aber als Geschäftspartner, dem er sich kameradschaftlich verbunden fühlte, obwohl ihr Verhältnis stets ambivalent geblieben war. Unter anderem war es Saizew gewesen, der Born die Waffen und Drogen abkaufte, die er Kriminellen entwendet hatte.
Jetzt saßen sie an einem der eingedeckten Tische im Pasternak, eine Stunde, bevor das Restaurant öffnete, und Born lehnte sich erschöpft zurück. Gerade hatte er dem Russen alles erzählt, was er über die Morde in Tannenstein wusste, inklusive der Schlussfolgerungen, die Lydia daraus gezogen hatte.
»Tja, mein Freund«, sagte Saizew und faltete die Hände wie zum Gebet zusammen, »das ist eine üble Geschichte. Warum, glaubst du, hat der Mann all diese Menschen getötet?«
»Ich weiß es nicht.«
»Es muss eine Ursache geben. Niemand tötet grundlos elf Menschen.«
»Manche tun es.«
Saizew lachte, wobei sich seine Augen zu schmalen Schlitzen zusammenzogen. »Wenn du einen Wahnsinnigen suchst, bist du bei mir an der falschen Adresse.«
»Der Mann lebt ein Jahr lang in dem Dorf, ohne aufzufallen. Dann geht er eines Abends in die Kneipe und bringt elf Gäste mit gezielten Schüssen um, die Hinrichtungen gleichen. Ruhig, kalt, ohne die geringsten Anzeichen von Nervosität. Anschließend vernichtet er sämtliche Spuren und verschwindet, als hätte es ihn nie gegeben. Ich denke nicht, dass das nach einem Wahnsinnigen klingt.«
»Warum gerade dieser Ort?«
Born zuckte die Schultern.
»Warum hat er ein Jahr lang gewartet, bevor er sie tötete?«
»Keine Ahnung.«
»Wie kam er dorthin?«
»Ich-weiß-es-nicht!«
»Es gibt viel, was du nicht weißt, mein Freund.«
»Für genau diese Erkenntnis habe ich dich gebraucht!«
Wieder lachte Saizew, und ein unbeteiligter Beobachter hätte ihn in diesem Moment vielleicht für einen freundlichen älteren Herrn gehalten, aber Born wusste es besser. Er hatte gesehen, was Saizew mit Menschen machte, die ihn verrieten, und er wusste …
Der Russe brachte ihn mit einem Schlag auf die Schulter in die Gegenwart zurück. »Lass uns einen Wodka trinken, Alexander. Dann reden wir weiter.«
Born deckte sein Glas mit der Hand ab. »Danke, aber für mich nicht.«
»Oh doch, du magst: kein Wodka, keine guten Gespräche!«
Widerstrebend zog Born die Hand weg, und der Restaurantbesitzer füllte die Gläser. Sie stießen an und stürzten den Inhalt in einem Zug hinunter. Dann schenkte Saizew nach und sagte: »Gehen wir mal davon aus, dass dieser Killer tatsächlich ein Russe ist. Dann musst du einen Ex-Angehörigen der Armee suchen, des KGB oder jemanden, der für die Nachfolgeorganisation SWR oder FSB gearbeitet hat. Zumindest spricht sein Vorgehen in Tannenstein für einen militärischen Hintergrund.« Er seufzte. »In Russland geht momentan vieles den Bach runter. Soldaten meutern, der Staat bezahlt die Armee schlecht und unregelmäßig. Manch einer sucht sich da neue Herren, denen er dienen kann. Die ihn zuverlässiger und besser bezahlen.«
»Worauf würdest du tippen?«
»Organisierte Kriminalität wahrscheinlich. Das Übliche: Drogen, Menschenhandel oder Waffen.«
»Also genau dein Gebiet, Dimitri.«
Der Russe lachte. »Ich bitte dich … das sind doch alles nur Gerüchte!«
Born ging nicht darauf ein. »Lass uns spekulieren. Was hältst du für wahrscheinlicher: ehemaliger KGB- oder Armee-Angehöriger?«
»Unser unbekannter Freund hat in Tannenstein nicht zum ersten Mal getötet, das ist sicher. Für einen Anfänger ist er viel zu gut und effektiv vorgegangen. Ich würde also auf Armee tippen, vielleicht sogar auf eine Spezialeinheit wie die SpezNas.«
Born fragte sich, was an elf unschuldigen Toten und der Ermordung Lydias gut sein sollte, sagte aber nichts. Stattdessen wollte er wissen, wo man ehemalige SpezNas-Angehörige in Deutschland finden konnte.
»Das willst du nicht, mein Freund.« Saizews Stimme wurde ernst. »Halte dich von denen fern, Alexander! Wenn du meinen Rat hören willst: Fang von vorne an, genieße dein Leben, und wenn du wieder arbeiten willst, kommst du zu mir. Für einen Mann mit deinen Qualitäten habe ich immer einen Job.«
»Vielleicht komme ich irgendwann darauf zurück, aber noch ist es nicht so weit. Sieh es mal so: Ich bin ein krimineller Ex-Bulle, der drei Jahre im Knast gesessen hat. Ich habe nichts zu verlieren. Alles, was mir bleibt, ist die Vergangenheit und eine Gegenwart, die ständig in Bewegung ist und auf die ich keinen Einfluss habe. Alles, was zählt, ist Folgendes: Der Wanderer hat Lydia getötet. Dafür werde ich ihn töten. Und wenn der Killer ein SpezNas sein könnte, will ich einen anderen SpezNas treffen. Also?«
Anstatt auf die Frage einzugehen, sagte Saizew: »Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Habe ich in dieser Zeit jemals Angst gehabt?«
»Meines Wissens nach nicht.«
»Aber jetzt habe ich Angst! Richtig Angst, und zwar um dich. Wenn es wirklich ein SpezNas ist, scheiße ich mir vor Angst sogar in die Hose. Ich kenne ein paar dieser Kerle, und mit keinem von denen willst du Ärger haben. Erstens sind sie bestens ausgebildet, zweitens halten sie auch nach ihrem Ausscheiden aus der Truppe zusammen, und drittens interessiert ein Toter sie nicht mehr als ein Blatt, das vom Baum fällt. Das sind keine Menschen, Alexander – das sind Tiere.«
»Übertreibst du nicht?«